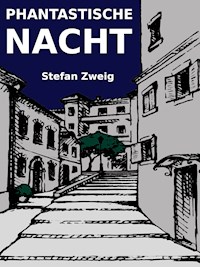
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bei Phantastische Nacht handelt es sich um ein einzigartiges Werk von Stefan Zweig. Die fiktiven Aufzeichnungen eines Reserveoberleutnant sind der zentrale Part dieses Buches. Auszug: Heute morgens überkam mich plötzlich der Gedanke, ich sollte das Erlebnis jener phantastischen Nacht für mich niederschreiben, um die ganze Begebenheit in ihrer natürlichen Reihenfolge einmal geordnet zu überblicken. Und seit dieser jähen Sekunde fühle ich einen unerklärlichen Zwang, mir im geschriebenen Wort jenes Abenteuer darzustellen, obzwar ich bezweifle, auch nur annähernd die Sonderbarkeit der Vorgänge schildern zu können. Mir fehlt jede sogenannte künstlerische Begabung, ich habe keinerlei Übung in literarischen Dingen, und abgesehen von einigen mehr scherzhaften Produkten im Theresianum habe ich mich nie im Schriftstellerischen versucht. Ich weiß zum Beispiel nicht einmal, ob es eine besonders erlernbare Technik gibt, um die Aufeinanderfolge von äußern Dingen und ihre gleichzeitige innere Spiegelung zu ordnen, frage mich auch, ob ich es vermag, dem Sinn immer das rechte Wort, dem Wort den rechten Sinn zu geben und so jene Balance zu gewinnen, die ich von je bei jedem rechten Erzähler im Lesen unbewußt spürte. Aber ich schreibe diese Zeilen ja nur für mich, und sie sind keineswegs bestimmt, etwas, was ich kaum mir selber zu erklären vermag, andern verständlich zu machen. Sie sind nur ein Versuch, mit irgendeinem Geschehnis, das mich ununterbrochen beschäftigt und in schmerzhaft quellender Gärung bewegt, in einem gewissen Sinne endlich einmal fertig zu werden, es festzulegen, vor mich hinzustellen und von allen Seiten zu umfassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Phantastische Nacht
Phantastische NachtAnmerkungen zu dieser AusgabeImpressumPhantastische Nacht
Die nachfolgenden Aufzeichnungen fanden sich als versiegeltes Paket im Schreibtisch des Barons Friedrich Michael von R..., nachdem er im Herbst 1914 als österreichischer Reserveoberleutnant bei einem Dragonerregiment in der Schlacht bei Rawaruska gefallen war. Da die Familie nach der Titelüberschrift und bloß flüchtigem Einblick in diesen Blättern nur eine literarische Arbeit ihres Verwandten vermutete, übergaben sie mir die Aufzeichnungen zur Prüfung und stellten mir ihre Veröffentlichung anheim. Ich persönlich halte diese Blätter nun durchaus nicht für eine erfundene Erzählung, sondern für ein wirkliches, in allen Einzelheiten tatsächliches Erlebnis des Gefallenen und veröffentliche unter Unterdrückung des Namens seine seelische Selbstenthüllung ohne jede Änderung und Beifügung.
Heute morgens überkam mich plötzlich der Gedanke, ich sollte das Erlebnis jener phantastischen Nacht für mich niederschreiben, um die ganze Begebenheit in ihrer natürlichen Reihenfolge einmal geordnet zu überblicken. Und seit dieser jähen Sekunde fühle ich einen unerklärlichen Zwang, mir im geschriebenen Wort jenes Abenteuer darzustellen, obzwar ich bezweifle, auch nur annähernd die Sonderbarkeit der Vorgänge schildern zu können. Mir fehlt jede sogenannte künstlerische Begabung, ich habe keinerlei Übung in literarischen Dingen, und abgesehen von einigen mehr scherzhaften Produkten im Theresianum habe ich mich nie im Schriftstellerischen versucht. Ich weiß zum Beispiel nicht einmal, ob es eine besonders erlernbare Technik gibt, um die Aufeinanderfolge von äußern Dingen und ihre gleichzeitige innere Spiegelung zu ordnen, frage mich auch, ob ich es vermag, dem Sinn immer das rechte Wort, dem Wort den rechten Sinn zu geben und so jene Balance zu gewinnen, die ich von je bei jedem rechten Erzähler im Lesen unbewußt spürte. Aber ich schreibe diese Zeilen ja nur für mich, und sie sind keineswegs bestimmt, etwas, was ich kaum mir selber zu erklären vermag, andern verständlich zu machen. Sie sind nur ein Versuch, mit irgendeinem Geschehnis, das mich ununterbrochen beschäftigt und in schmerzhaft quellender Gärung bewegt, in einem gewissen Sinne endlich einmal fertig zu werden, es festzulegen, vor mich hinzustellen und von allen Seiten zu umfassen.
Ich habe von dieser Begebenheit keinem meiner Freunde erzählt, eben aus jenem Gefühl, ich könnte ihnen das Wesentliche daran nicht verständlich machen, und dann auch aus einer gewissen Scham, von einer so zufälligen Angelegenheit dermaßen erschüttert und umgewühlt worden zu sein. Denn das Ganze ist eigentlich nur ein kleines Erlebnis. Aber wie ich dies Wort jetzt hinschreibe, beginne ich schon zu bemerken, wie schwer es für einen Ungeübten wird, beim Schreiben die Worte in ihrem rechten Gewicht zu wählen, und welche Zweideutigkeit, welche Mißverständnismöglichkeit sich an das einfachste Vokabel knüpft. Denn wenn ich mein Erlebnis ein »kleines« nenne, so meine ich dies natürlich nur im relativen Sinn, im Gegensatz zu den gewaltigen dramatischen Geschehnissen, von denen ganze Völker und Schicksale mitgerissen werden, und meine es andererseits im zeitlichen Sinne, weil der ganze Vorgang keinen größeren Raum umspannt als knappe sechs Stunden. Für mich aber war dies – im allgemeinen Sinn also kleine, unbedeutsame und unwichtige – Erlebnis so ungeheuer viel, daß ich heute – vier Monate nach jener phantastischen Nacht – noch davon glühe und alle meine geistigen Kräfte anspannen muß, um es in meiner Brust zu bewahren. Täglich, stündlich wiederhole ich mir alle seine Einzelheiten, denn es ist gewissermaßen der Drehpunkt meiner ganzen Existenz geworden, alles, was ich tue und rede, ist unbewußt von ihm bestimmt, meine Gedanken beschäftigen sich einzig damit, sein plötzliches Geschehen immer und immer wieder zu wiederholen und durch dieses Wiederholen mir als Besitz zu bestätigen. Und jetzt weiß ich auch mit einemmal, was ich vor zehn Minuten, da ich die Feder ansetzte, bewußt noch nicht ahnte: daß ich mir dies Erlebnis nur deshalb jetzt hinschreibe, um es ganz sicher und gleichsam sachlich fixiert vor mir zu haben, es noch einmal nachzugenießen im Gefühl und gleichzeitig geistig zu erfassen. Es ist ganz falsch, ganz unwahr, wenn ich vorhin sagte, ich wollte damit fertig werden, indem ich es niederschreibe, im Gegenteil, ich will das zu rasch Gelebte nur noch lebendiger haben, es neben mich warm und atmend stellen, um es immer und immer umfangen zu können. Oh, ich habe keine Angst, auch nur eine Sekunde jenes schwülen Nachmittags, jener phantastischen Nacht zu vergessen, ich brauche kein Merkzeichen, keine Meilensteine, um in der Erinnerung den Weg jener Stunden Schritt für Schritt zurückzugehen: wie ein Traumwandler finde ich jederzeit mitten im Tage, mitten in der Nacht in seine Sphäre zurück, und jede Einzelheit sehe ich darin mit jener Hellsichtigkeit, die nur das Herz kennt und nicht das weiche Gedächtnis. Ich könnte hier ebensogut auf das Papier die Umrisse jedes einzelnen Blattes in der frühlingshaft ergrünten Landschaft hinzeichnen, ich spüre jetzt im Herbst noch ganz lind das weiche staubige Qualmen der Kastanienblüten; wenn ich also noch einmal diese Stunden beschreibe, so geschieht es nicht aus Furcht, sie zu verlieren, sondern aus Freude, sie wiederzufinden. Und wenn ich jetzt in der genauen Aufeinanderfolge mir die Wandlungen jener Nacht darstelle, so werde ich um der Ordnung willen an mich halten müssen, denn immer schwillt, kaum daß ich an die Einzelheiten denke, eine Ekstase aus meinem Gefühl empor, eine Art Trunkenheit faßt mich, und ich muß die Bilder der Erinnerung stauen, daß sie nicht, ein farbiger Rausch, ineinanderstürzen. Noch immer erlebe ich mit leidenschaftlicher Feurigkeit das Erlebte, jenen Tag, jenen 7. Juni 1913, da ich mir mittags einen Fiaker nahm ...
Aber noch einmal, spüre ich, muß ich innehalten, denn schon wieder werde ich erschreckt der Zweischneidigkeit, der Vieldeutigkeit eines einzelnen Wortes gewahr. Jetzt, da ich zum ersten Male im Zusammenhange etwas erzählen soll, merke ich erst, wie schwer es ist, jenes Gleitende, das doch alles Lebendige bedeutet, in einer geballten Form zufassen. Eben habe ich »ich« hingeschrieben, habe gesagt, daß ich am 7. Juni 1913 mir mittags einen Fiaker nahm. Aber dies Wort wäre schon eine Undeutlichkeit, denn jenes »Ich« von damals, von jenem 7. Juni, bin ich längst nicht mehr, obwohl erst vier Monate seitdem vergangen sind, obwohl ich in der Wohnung dieses damaligen »Ich« wohne und an seinem Schreibtisch mit seiner Feder und seiner eigenen Hand schreibe. Von diesem damaligen Menschen bin ich, und gerade durch jenes Erlebnis ganz abgelöst, ich sehe ihn jetzt von außen, ganz fremd und kühl, und kann ihn schildern wie einen Spielgenossen, einen Kameraden, einen Freund, von dem ich vieles und Wesentliches weiß, der ich aber doch selbst durchaus nicht mehr bin. Ich könnte über ihn sprechen, ihn tadeln oder verurteilen, ohne überhaupt zu empfinden, daß er mir einst zugehört hat.
Der Mensch, der ich damals war, unterschied sich in Wenigem äußerlich und innerlich von den meisten seiner Gesellschaftsklasse, die man besonders bei uns in Wien die »gute Gesellschaft« ohne besonderen Stolz, sondern ganz als selbstverständlich zu bezeichnen pflegt. Ich ging in das sechsunddreißigste Jahr, meine Eltern waren früh gestorben und hatten mir knapp vor meiner Mündigkeit ein Vermögen hinterlassen, das sich als reichlich genug erwies, um von nun ab den Gedanken an Erwerb und Karriere gänzlich mir zu erübrigen. So wurde mir unvermutet eine Entscheidung abgenommen, die mich damals sehr beunruhigte. Ich hatte nämlich gerade meine Universitätsstudien vollendet und stand vor der Wahl meines zukünftigen Berufes, der wahrscheinlich dank unserer Familienbeziehungen und meiner schon früh vortretenden Neigung zu einer ruhig ansteigenden und kontemplativen Existenz auf den Staatsdienst gefallen wäre, als dies elterliche Vermögen an mich als einzigen Erben fiel und mir eine plötzliche arbeitslose Unabhängigkeit zusicherte, selbst im Rahmen weitgespannter und sogar luxuriöser Wünsche. Ehrgeiz hatte mich nie bedrängt, so beschloß ich, einmal dem Leben erst ein paar Jahre zuzusehen und zu warten, bis es mich schließlich verlocken würde, mir selbst einen Wirkungskreis zu finden. Es blieb aber bei diesem Zuschauen und Warten, denn da ich nichts Sonderliches begehrte, erreichte ich alles im engen Kreis meiner Wünsche; die weiche und wollüstige Stadt Wien, die wie keine andere das Spazierengehen, das nichtstuerische Betrachten, das Elegantsein zu einer geradezu künstlerischen Vollendung, zu einem Lebenszweck heranbildet, ließ mich die Absicht einer wirklichen Betätigung ganz vergessen. Ich hatte alle Befriedigung eines eleganten, adeligen, vermögenden, hübschen und dazu noch ehrgeizlosen jungen Mannes, die ungefährlichen Spannungen des Spiels, der Jagd, die regelmäßigen Auffrischungen der Reisen und Ausflüge, und bald begann ich diese beschauliche Existenz immer mehr mit wissender Sorgfalt und künstlerischer Neigung auszubauen. Ich sammelte seltene Gläser, weniger aus einer inneren Leidenschaft als aus der Freude, innerhalb einer anstrengungslosen Betätigung Geschlossenheit und Kenntnis zu erreichen, ich schmückte meine Wohnung mit einer besonderen Art italienischer Barockstiche und mit Landschaftsbildern in der Art des Canaletto, die bei Trödlern zusammenzufinden oder bei Auktionen zu erstehen voll einer jagdmäßigen und doch nicht gefährlichen Spannung war, ich trieb mancherlei mit Neigung und immer mit Geschmack, fehlte selten bei guter Musik und in den Ateliers unserer Maler. Bei Frauen mangelte es mir nicht an Erfolg, auch hier hatte ich mit dem geheimen sammlerischen Trieb, der irgendwie auf innere Unbeschäftigtkeit deutet, mir vielerlei erinnerungswerte und kostbare Stunden des Erlebens aufgehäuft, und hier allmählich vom bloßen Genießer mich zum wissenden Kenner steigernd. Im ganzen hatte ich viel erlebt, was mir angenehm den Tag füllte und meine Existenz mich als eine reiche empfinden ließ, und immer mehr begann ich diese laue, wohlige Atmosphäre einer gleichzeitig belebten und doch nie erschütterten Jugend zu lieben, fast ohne neue Wünsche schon, denn ganz geringe Dinge vermochten sich schon in der windstillen Luft meiner Tage zu einer Freude zu entfalten. Eine gutgewählte Krawatte konnte mich fast schon froh machen, ein schönes Buch, ein Automobilausflug oder eine Stunde mit einer Frau mich restlos beglücken. Ganz besonders wohl tat mir in dieser meiner Daseinsform, daß sie in keiner Weise, ganz wie ein tadellos korrekter englischer Anzug, in keiner Weise der Gesellschaft auffiel. Ich glaube, man empfand mich als eine angenehme Erscheinung, ich war beliebt und gerne gesehen, und die meisten, die mich kannten, nannten mich einen glücklichen Menschen.
Ich weiß jetzt nicht mehr zu sagen, ob jener Mensch von damals, den ich mir zu vergegenwärtigen bemühe, sich selbst so wie jene anderen als einen Glücklichen empfand; denn nun, wo ich aus jenem Erlebnis für jedes Gefühl einen viel volleren und erfüllteren Sinn fordere, scheint mir jede rückerinnernde Wertung fast unmöglich. Doch vermag ich mit Gewißheit zu sagen, daß ich mich zu jener Zeit keineswegs als unglücklich empfand, blieben doch fast nie meine Wünsche unerfüllt und meine Anforderungen an das Leben unerwidert. Aber gerade dies, daß ich mich daran gewöhnt hatte, alles Geforderte vom Schicksal zu empfangen und darüber hinaus nichts mehr ihm abzufordern, gerade dies zeitigte allmählich einen gewissen Mangel an Spannung, eine Unlebendigkeit im Leben selbst. Was sich damals unbewußt in manchen Augenblicken der Halberkenntnis in mir sehnsüchtig regte: es waren nicht eigentlich Wünsche, sondern nur der Wunsch nach Wünschen, das Verlangen, stärker, unbändiger, ehrgeiziger, unbefriedigter zu begehren, mehr zu leben und vielleicht auch zu leiden. Ich hatte aus meiner Existenz durch eine allzu vernünftige Technik alle Widerstände ausgeschaltet, und an diesem Fehlen der Widerstände erschlaffte meine Vitalität. Ich merkte, daß ich immer weniger, immer schwächer begehrte, daß eine Art Erstarrung in mein Gefühl gekommen war, daß ich – vielleicht ist es am besten so ausgedrückt – an einer seelischen Impotenz, einer Unfähigkeit zur leidenschaftlichen Besitznahme des Lebens litt. An kleinen Zeichen erkannte ich dieses Manko zuerst. Es fiel mir auf, daß ich im Theater und in der Gesellschaft bei gewissen sensationellen Veranstaltungen öfter und öfter fehlte, daß ich Bücher bestellte, die mir gerühmt worden waren und sie dann unaufgeschnitten wochenlang auf dem Schreibtisch liegen ließ, daß ich zwar mechanisch weiter meine Liebhabereien sammelte, Gläser und Antiken kaufte, ohne sie aber dann einzuordnen und mich eines seltenen und langgesuchten Stückes bei unvermutetem Erwerb sonderlich zu freuen.





























