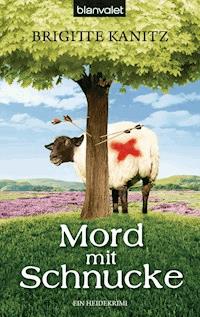6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Pizza Amore in Bella Italia. Was könnte schöner sein?
Landei Sina leidet unter einer Menschenphobie. Blöd, so als Grundschullehrerin. Zeit das zu ändern, findet Nachbarin Esther. Also schnappt sich die furchtlose Rentnerin die ängstliche Sina und reist mit ihr nach Rom. Da sind ja genug Menschen unterwegs, und die Nähe zu Seiner Heiligkeit schadet sicher auch nicht, wenn man auf eine Wunderheilung hofft. Während Esther sich in einen jungen Offizier der Schweizer Garde verknallt und sich vor lauter Liebeskummer in den Tiber stürzen will, stellt sich Sina ihren Ängsten und verliebt sich in den schönen Römer Pietro, der aber dummerweise Priester ist. Oder etwa doch nicht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Das norddeutsche Landei Sina leidet unter einer Menschenphobie. Was ziemlich ungünstig ist, so als Grundschullehrerin. Und außerdem auch zu ziemlich peinlichen Situationen führen kann. Das geht so nicht weiter, findet Nachbarin Esther. Sie schnappt sich Sina und reist mit ihr nach Rom. Da sind ja bekanntlich reichlich Menschen unterwegs. Und die Nähe zu Seiner Heiligkeit schadet sicher auch nicht, wenn man auf eine Wunderheilung hofft. In Rom angekommen gibt es zwar gewisse sprachliche Hindernisse, die Sina verwirren, aber sie stellt sich der Herausforderung. Und zum Glück hat sie auch noch Esther an ihrer Seite. Die furchtlose Rentnerin verknallt sich jedoch Hals über Kopf in einen jungen Offizier der Schweizer Garde und will sich nun vor lauter Liebeskummer in den Tiber stürzen. Sina will eigentlich nur noch zurück in ihr Heimatdorf. Wenn da bloß nicht der schöne Römer Pietro wäre, der aber dummerweise Priester ist. Oder etwa doch nicht?
Autorin
Brigitte Kanitz wuchs in Rom, Lugano und Hamburg auf. Sie arbeitete als Redakteurin für diverse Printmedien, bevor es sie zurück nach Italien zog, wo sie seit vielen Jahren als freie Autorin lebt. Für Blanvalet hat sie bereits eine ganze Reihe von romantischen Komödien geschrieben.
Weitere Informationen zur Autorin finden Sie unter
www.BrigitteKanitz.de
Von Brigitte Kanitz bereits erschienen
Immer Ärger mit Opa · Oma packt aus · Onkel Humbert guckt so komisch · Die Herzensammlerin
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Brigitte Kanitz
PIZZAAMORE
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.1. Auflage
Copyright © 2018 by Brigitte Kanitz
© 2018 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Ivana Marinović
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
JaB · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN978-3-641-22173-7V001
www.blanvalet.de
Für meine Mutter, Christa Kanitz (1928 – 2015), die in den Sechzigerjahren in Rom als große blonde und blauäugige Deutsche für so manchen Auffahrunfall sorgte, wenn sie über die Straße schritt.
ERSTERTEIL
1 Verflixt eng hier
Er kam direkt auf mich zu. Groß, durchtrainiert, weißblond, mit hellen, beinahe farblosen Augen. Ein Nordmann, ein Krieger, ein Eroberer.
Okay, in Wahrheit nur ein Sportlehrer. ABER: Er hatte ein Grübchen am Kinn, und auf dieses Grübchen musste ich jedes Mal starren, wenn ich ihn sah. So von unten herauf, weil er locker einen halben Meter größer war als ich. Na, sagen wir dreißig Zentimeter.
Ich starrte also, während er mit lässigem Gang über den Pausenhof der Grundschule von Norderbüll auf mich zusteuerte. Kein Kindergeschrei durchschnitt die weihevolle Stille. Erst in zwei Stunden sollte das Fest zum Ende der Sommerferien beginnen, und im Augenblick versammelte sich nur das Kollegium der Waldschule plus einiger freiwilliger Helfer, um mit den Vorbereitungen zu beginnen.
Neben mir stand Esther, meine zweiundsechzigjährige Nachbarin, und starrte ebenfalls. Auf den Mann und sein Grübchen.
»Großer Gott!«
Ich stieß sie mit dem Ellenbogen in die Seite – der Sportlehrer war schon fast in Hörweite. Mir war ihr Verhalten peinlich. Mein eigenes auch, aber das bemerkte er bestimmt nicht, weil er mich eher selten richtig wahrnahm. Meine Nachbarin hingegen, die mich mit ihrem silbergrauen Haar und der markanten Adlernase um mehr als einen Kopf überragte, war nicht zu übersehen.
Esther hatte von sich aus vorgeschlagen, mich zu begleiten. Sie könne sich nützlich machen, hatte sie gemeint und einen langen, orakelhaften Blick durch mein Küchenfenster zum Himmel geworfen. Dort waren schon am Vormittag fette dunkle Wolken aufgezogen, und wir beide wussten, was das bedeutete: Bei Regen fand das Schulfest in der Turnhalle statt. Viele, sehr viele Menschen würden sich auf eher beengtem Raum tummeln.
Keine ideale Situation für mich.
Allein schaffst du das nicht, Sina, hatte Esthers Blick gesagt.
Möglich.
Aber vielleicht machte sie auch alles nur noch schlimmer.
So wie jetzt. Zum ersten Mal seit Monaten begegnete ich Jan, ohne dass andere Leute um uns herum waren, und ausgerechnet bei dieser einmaligen Gelegenheit blieb Esther eisern an meiner Seite.
Ich stieß sie ein zweites Mal in die Rippen. Jede gleichaltrige Freundin hätte schon längst kapiert, dass sie sich verdrücken sollte.
Nicht so Esther.
»Du hast recht«, fügte sie zum Glück um einiges leiser hinzu. »Der ist wirklich zum Anbeißen.«
Wieder einmal bereute ich es, meine Nachbarin ins Vertrauen gezogen zu haben. Hätte ich ihr bloß nie verraten, dass ich seit meinem ersten Tag als Vertretungslehrerin an der Schule – seit genau fünf Monaten und zweieinhalb Wochen – in diesen bombastisch aussehenden Sportlehrer verliebt war. Und dass sich diese Sommerferien, in denen ich ihn höchstens mal von Weitem zu Gesicht bekam, endlos und zäh dahinzogen.
Hätte ich doch meine Klappe gehalten!
Dummerweise waren meine Freundinnen aus Kindertagen, die inzwischen wie ich Mitte dreißig waren, in aller Welt verstreut. Sie machten Karriere oder hatten irgendwen Wichtiges geheiratet. Nur ich lebte noch in Norderbüll, einem Ort dicht an der dänischen Grenze mit tausendneunhundertneunzig Einwohnern und wenig Chancen, dass es noch mal zweitausend würden.
Also blieb mir nur meine ältere Nachbarin als Freundin. Besser als nichts. Hatte ich zumindest bis gerade eben gedacht.
Während Jan näher kam, überdachte ich diese Einstellung.
Nervös zupfte ich an meinem neuen Sommerkleid herum, das ich mir extra für heute im Internet bestellt hatte und das in verschiedenen Grautönen schimmerte. Ich fand es außerordentlich elegant, zudem kaschierte es ein paar meiner Pölsterchen, die ich mir im Lauf der Jahre aus einem ganz bestimmten Grund angefuttert hatte. Ich fühlte mich todschick, hielt mich aufrecht und übte mich in einem verführerischen Lächeln.
»Vielleicht hättest du dir nicht unbedingt das Turiner Grabtuch überwerfen sollen«, murmelte Esther.
Das kokette Lächeln, das ich für Jan aufgesetzt hatte, musste bei diesem feinfühligen Kommentar irgendwie missraten sein, denn er riss erschrocken Mund und Augen auf.
Na, na. So schlimm konnte mein Ausdruck auch nicht sein! Mit einiger Mühe brachte ich meine Gesichtsmuskulatur unter Kontrolle.
Esther kicherte. »Er verliert aber eindeutig an Ausstrahlung, wenn er wie ein Koi-Karpfen guckt.«
»Wie bitte?«, fragte Jan, der nun vor uns stand.
»Äh … nichts«, erwiderte Esther und strich sich über ihren kurzen grauen Pagenkopf. »Ich sagte nur zu der lieben Sina, dass es bestimmt ein kolossal schönes Schulfest wird.«
Entweder hatte er sie nicht richtig gehört, oder er beschloss, die seltsame ältere Dame nicht so wichtig zu nehmen. Seltsam, weil sie annähernd so groß war wie er selbst – also knapp eins fünfundachtzig – und weil sie an einem warmen Spätsommertag Wollhose und Rollkragenpullover trug. Esther fror immer, auch bei vierzig Grad im Schatten. Was vermutlich daran lag, dass sie nur aus Haut und Knochen zu bestehen schien. Dabei aß sie so viel wie zwei Schleswig-Holsteiner Bauern zusammen.
Jetzt streckte sie ihre große sehnige Hand aus. »Hallo. Esther Claasen.«
»Angenehm, Jan Dierksen.«
Ich schloss kurz die Augen, damit keiner von beiden den Anflug von Bitterkeit in meinem Blick sehen konnte. Zum einen hätte meine eigene kleine, weiche Hand in seiner liegen sollen, zum anderen beneidete ich Esther und Jan brennend um ihre wunderbaren norddeutschen Nachnamen. Sie passten an diesen Ort zwischen Flensburg im Osten und der Insel Sylt im Westen. Sie passten in das flache weite und fruchtbare Land mit dem endlosen Himmel darüber.
Sina Wagner hingegen verband man eher mit schneebedeckten Alpengipfeln, mit braunen Kühen und seltsamen langen Blasinstrumenten.
Dabei war ich hier geboren! Ich war eine waschechte Nordfriesin, wenn auch erst in zweiter Generation. Mein Großvater, Hubert Wagner, war einst von München aus als Zimmermann auf die Walz gegangen, hatte sich kurz vor der dänischen Grenze rettungslos in eine blonde Bauerstochter verliebt und war geblieben. Mein Vater wurde Ragnar getauft, so nordisch wie möglich. Darauf hatte meine Großmutter bestanden, die sich ständig von der Schande reinwaschen wollte, einen Mann aus Bayern geheiratet zu haben. Also quasi einen Ausländer, der auch noch so komisch redete und dabei das »R« mit der Zunge rollte.
Ragnar Wagner. Armer Papa!
Da war ich mit Sina noch gut weggekommen, fand ich. Hätte Oma bei mir ein Wörtchen mitzureden gehabt, hätte ich vielleicht als Kunigunde oder Kriemhild durchs Leben gehen müssen.
Sina Dierksen, sagte ich im Stillen. Und das nicht zum ersten Mal in den vergangenen Monaten. Sina Dierksen klang deutlich besser als Sina Wagner. Geradezu himmlisch.
Himmlisch?
Mir fiel ein, dass es da eine gewisse Schwierigkeit geben könnte, falls Jan seine Liebe zu mir entdecken, mich am Traualtar erwarten und mir seinen Nachnamen schenken würde. Es hatte etwas mit dem lieben Gott im Himmel und seinem Stellvertreter auf Erden zu tun. Auch so ein Erbe meines Opas, und Oma hatte nichts dagegen ausrichten können.
Mit einer energischen Handbewegung wischte ich meinen eigenen störenden Einwand beiseite.
»Alles klar bei dir?« Jans Stimme ließ mich wieder die Augen öffnen, und ich hörte umgehend damit auf, wirr in der Luft herumzufuchteln.
Er hatte Esthers sehnige Hand losgelassen und sah aus seiner enormen Höhe auf mich herab.
»Alles bestens«, sagte ich schnell. Mutig fügte ich hinzu: »Schön, dich zu sehen.«
Einer von uns musste doch mal den ersten Schritt machen, überlegte ich. Ein knappes halbes Jahr der stillen Verliebtheit war genug. Ich war schließlich eine emanzipierte junge Frau. Wer sagte denn, dass ich darauf warten musste, bis Jan Dierksen vor mir auf die Knie fiel?
»Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist«, schob ich immer noch mutig, wenn auch etwas steif hinterher.
»Äh, ja«, erwiderte er. »Das ganze Kollegium ist hier verabredet.«
Er begriff nichts. Gar nichts!
Ich machte einen halben Schritt auf ihn zu. »Jan …«
Esther zog mich mit einem Ruck zurück. »Vorsicht!«, rief sie. »Da … ist ein Riesenkäfer!«
Jan hüpfte zur Seite. Besonders mutig war er ja nicht.
Ich funkelte Esther an.
»Irgendjemand muss dich ja davon abhalten, dich lächerlich zu machen«, zischte sie mir ins Ohr.
Jan hörte sie nicht, da er ziemlich hysterisch rief, wo denn der verdammte Käfer sei. Er habe eine Insektenphobie.
Interessant. Eine Phobie. Ich selbst konnte mit so etwas auch aufwarten. Da hätten wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Passten wir deshalb vielleicht besser zusammen?
Bevor ich ihn auf seine kleine Schwäche ansprechen konnte, fing sich Jan wieder und sagte mit leicht zitternder Stimme: »Fangen wir jetzt endlich mal an? Ahrends hat mich angerufen. Ich bin für den Aufbau verantwortlich.«
Piet Ahrends war der Rektor unserer Schule. Klang auch so schön norddeutsch.
»Das Fest wird sicher in die Turnhalle verlegt«, fügte er hinzu. »Von Osten zieht ein heftiger Sturm auf. In spätestens einer Stunde gießt es hier wie aus Kübeln.«
Esther warf mir einen besorgten Seitenblick zu. Ich achtete nicht weiter auf sie, zu sehr war ich noch in meine Überlegungen über Gemeinsamkeiten zwischen Jan und mir versunken.
»Sina?«, fragte er. »Hörst du mir zu? Wir sollen drinnen aufbauen.«
»Wunderbar.«
Esther seufzte. »Ungefähr achtzig kreischende Kinder und doppelt so viele sabbelnde Eltern auf ziemlich engem Raum zusammengepfercht.«
»Verdammt!«
»Wie bitte?«, fragte Jan.
Upps!
So kannte er mich nicht. So zornig und fluchend. Für ihn war ich die kleine, stets lächelnde Vertretungslehrerin für Deutsch und Kunst, ein bisschen pummelig, aber mit schönem langem Haar, irgendwo zwischen Blond und Braun, und bronzefarbenen Augen.
Okay, wahrscheinlich hatte er mich nie gründlich genug angesehen, um die ungewöhnlichen Farben an mir zu bemerken. Ich tat ja auch meistens alles, um unsichtbar zu bleiben. Schlang die Haare in einen Knoten, schminkte mich nicht, trug dunkle Klamotten. Schwarz, Dunkelblau & Co. machen bekanntlich schlank. Außerdem schlug ich sämtliche Einladungen zu Partys aus, die ich im Laufe des Frühjahrs und Sommers von Kollegen erhalten hatte, und galt in der Schule als Einzelgängerin.
Den Grund dafür kannte hier niemand.
Außer Esther, in deren länglichem Gesicht mit der leicht gebogenen Nase jetzt ein Ausdruck tiefster Besorgnis erschien.
»Was hat sie denn?«, wandte Jan sich ratlos an meine Freundin.
»Demophobie«, sagte Esther mit Grabesstimme.
Herzlichen Dank auch, dachte ich. Jetzt bin ich bei allen unten durch.
Was wahrscheinlich nicht so schlimm war, denn ich wusste schon seit einer Woche, dass mein Vertrag nicht verlängert werden würde. Die Lehrerin, für die ich eingesprungen war, kam früher als gedacht aus der Elternzeit zurück, und eine zusätzliche Stelle für mich war nicht frei.
Pech, Sina. Der Traum, eine Festanstellung in meinem Heimatort zu ergattern, war geplatzt. Was bedeutete, dass ich bald wieder würde pendeln müssen. Ins große, laute, volle Flensburg. Für meine Verhältnisse eine Art Mexiko-Stadt des Nordens.
Falls ich überhaupt so schnell etwas anderes fand. Gut möglich, dass ich eine Weile arbeitslos sein würde. Ich sah mich schon einen tristen Herbst und noch tristeren Winter lang eingesperrt in meiner Wohnung sitzen, mit der knochigen Esther als einziger Gesellschaft.
»Wie bitte?« Jans schöne hohe Stirn legte sich in Falten, als er nun wieder auf mich hinunterblickte. »Soll das bedeuten, du hast Angst vor Demos?«
»So ungefähr«, murmelte ich.
»Von so etwas habe ich ja noch nie gehört.«
»Ist ziemlich selten.« Warum tat sich nie der Boden unter einem auf, wenn das gerade dringend nötig war?
Esther wollte zu einer längeren Erklärung anheben, aber da näherten sich zum Glück ein paar andere Lehrer und Helfer, begrüßten uns, klopften einander auf die Schultern und freuten sich ganz offensichtlich auf einen verregneten Nachmittag Mitte August in einer stickigen Turnhalle.
Die Menschen waren schon seltsam, fand ich.
Mit hängenden Schultern folgte ich der Truppe. Esther hielt sich dicht neben mir, Jan war längst von ein paar jungen großen, furchtlosen Kriegerinnen … ähm, Grundschullehrerinnen umzingelt, die es mir unmöglich machten, zu meinem Objekt der Begierde vorzudringen.
Innerhalb einer Stunde wurden Sportgeräte beiseite gerückt, Tische und Bänke aufgestellt, Luftballons aufgeblasen und Girlanden verteilt, während ich mich mit Esther in ein leeres Eck in der Nähe des Büfetts verdrückte, Servietten faltete und sehnsüchtige Blicke Richtung Jan warf, der sich in der Aufmerksamkeit des weiblichen Kollegiums sonnte. Mütter und Großmütter schleppten Schüsseln mit Kartoffelsalat und Würstchen, Berge von Frikadellen und unzählige Bleche mit Butter- und Streuselkuchen sowie diverse Torten an.
Besonders der süße, buttrige Duft machte mir schwer zu schaffen.
»Untersteh dich!«, rief Esther aus, als sie mich leise hechelnd vor dem Tisch mit den süßen Verführungen erwischte.
»Ich kann nicht anders. Ich bin ein Pawlowscher Hund oder so etwas Ähnliches. Die Leute da …«, ich zeigte in die Runde, » … sind meine Glocke. Die Kuchen sind meine Belohnung.«
Inzwischen war die Turnhalle auch mit Kindern bevölkert. Normalerweise hatte ich mit den Kleinen kein Problem. Aber im Alltag sah ich ja auch nur rund zwanzig von ihnen in unserem Klassenzimmer vor mir. Die Erst- und Zweitklässler waren lieb, meistens ruhig und für mich leicht zu ertragen.
Doch heute waren sämtliche Schüler da – plus Geschwister, plus Eltern, plus Großeltern, plus vermutlich Verwandte dritten bis zehnten Grades.
So voll war es geworden, dass man sich kaum noch frei bewegen konnte. Der Lärm dröhnte in meinen Ohren, ständig wurde ich von jemandem angerempelt, mein persönlicher Schutzraum existierte nicht mehr.
Panik nahte.
Es gab nur eine Abhilfe. Ich blickte das sahnige, mit Nusskrokant ummantelte Tortenkunstwerk vor mir an. Und hechelte gleich noch etwas stärker.
»Das redest du dir bloß ein«, sagte Esther schnell. »Du kannst mit Stress auch anders fertigwerden, wenn du nur willst.«
»Ach ja, zum Beispiel?«
»Mit Meditation.«
»Schon versucht, klappt nicht.«
»Psychotherapie.«
»Damit bin ich durch. Das weißt du doch. Hat auch nicht funktioniert.«
»Alkohol.«
»Ich werde lieber dick als leberkrank.«
»Sex.«
»Oha!« Mein Blick schnellte durch die Turnhalle auf der Suche nach Jan Dierksens blondem Haarschopf. Inzwischen war er von so vielen Frauen umringt, dass ich vermutlich nur noch mit roher Gewalt zu ihm durchgekommen wäre. So etwas lag mir bloß nicht. Enger Körperkontakt mit wildfremden Menschen war für mich der reinste Horror. »Sex scheidet aus«, erklärte ich Esther leise.
»Es gibt noch andere Männer.«
»Nicht für mich.«
Was ein Irrtum war, aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen.
Die füllige ältere Dame, die am Kuchentisch bediente, schaute von einer zur anderen und fragte arglos: »Warum soll diese hübsche Deern denn nichts Süßes bekommen? Ist sie Diabetikerin?«
»Schlimmer«, erwiderte Esther.
Die Dame legte die Stirn in Falten, ganz ähnlich wie Jan vorhin. Der hatte dabei aber besser ausgesehen. Noch bevor sie nachhaken konnte, brach die Hölle los. Jemand brüllte etwas, andere schrien dazwischen. Alles rannte scheinbar ziellos hin und her. Ich spürte, wie mein Herz losraste, gleichzeitig brach mir der Schweiß aus.
»Ist Feuer ausgebrochen?«, fragte Esther die Kuchendame.
»Nein, nein. Gleich fängt die Tombola an. Die Leute freuen sich einfach nur.«
Das sollte Freude sein? Die waren doch alle hysterisch!
Ich jetzt auch.
»Sina, stopp!«, rief Esther.
Zu spät.
Mit beiden Händen schnappte ich mir die Sahne-Nuss-Torte, hielt mit einer Hand die Kuchenplatte hoch und brach mit der anderen ein großes Stück ab. Das stopfte ich mir nach und nach in den Mund, kaute kaum, schluckte und schluckte. Schon war das nächste Stück dran, und dann noch eins und noch eins. Ich verschlang die ganze Torte. Ich mampfte und würgte und schielte schon nach dem Bienenstich direkt neben mir. Der war als Nächster dran.
Ein Mann in meiner Nähe stieß ein seltsames Geräusch aus. Ich brauchte einen Moment, um zu verstehen, was es war. Gelächter.
Der Mann lachte sich schlapp über mich, die kleine unscheinbare Lehrerin, die in aller Öffentlichkeit eine hemmungslose Fressorgie veranstaltete. Wie sollte er auch ahnen, dass es gerade diese Öffentlichkeit war, die mich praktisch dazu zwang.
Essen, essen, essen.
Um nicht zu schreien. Um nicht komplett durchzudrehen.
Ich erstarrte. Die einzige Bewegung an mir war ein Sahneklecks, der langsam mein Kinn hinunterwanderte und dann zu Boden fiel.
Das Lachen setzte sich fort, von einem zum anderen, jagte durch die Turnhalle, blieb nirgends hängen, erstarb nicht, flog weiter, bis zu Jan Dierksen.
Sein Blick fand mich, und er begriff sofort, worum es ging. Nun würde er zu meiner Rettung herbeieilen, die gemeinen Leute zum Schweigen bringen, mich in seine starken Arme schließen, einfach hochheben (ich würde mich auch ganz, ganz leicht machen) und dann in Sicherheit tragen.
Bestimmt hatte er auf seinem Smartphone längst gegoogelt, was Demophobie bedeutete, und nun ahnte er, dass ich nur dann meine Panik vor Menschenansammlungen in den Griff bekam, wenn ich sehr viel auf einmal aß. Sein Verständnis für mich wäre ebenso groß wie seine Zuneigung zu mir.
Träum weiter, Sina!
Jan öffnete den Mund … und lachte. Lachte am lautesten von allen. Lachte mich aus und brach mir das Herz.
Es war Esther, die mich rettete.
Sie packte mich an der Hand und zog mich hinter sich her. Raus aus der stickigen, menschenvollen Turnhalle, quer über den Schulhof, im strömenden Regen weiter durch die Straßen. Die gemeinen Leute ließen wir hinter uns. Oder besser: die unwissenden Leute.
2 Ave Maria
»Ab unter die Dusche«, befahl Esther und knallte meine Wohnungstür hinter uns zu. »Ich mach uns in der Zeit einen Tee.«
Sie schob mich in mein winziges Bad, wo ich reglos in meinem pitschnassen neuen Kleid herumstand und mich zu Tode schämte.
Wie hatte das nur passieren können?
Wie hatte ich mich so sehr vor aller Welt lächerlich machen können?
War doch lecker, sagte ein kleiner Teufel in meinem Innern. Sahne-Nuss hatten wir lange nicht mehr.
Ich hasste dieses Geschöpf meiner Fantasie, das ich mir genauso vorstellte, wie die bösen kleinen Teufelchen früher in meinen christlichen Kinderbüchern dargestellt wurden: daumengroß, rot, mit winzigen Hörnern und listigen Äuglein. Der Typ erschien meist dann, wenn ich einen meiner Anfälle hatte und war nur schwer wieder zu vertreiben. Manchmal wünschte ich mir, zum Ausgleich würde mal ein liebes weißes Engelchen auftauchen. Aber das passierte nie.
Wahrscheinlich brauchte ich dringend einen Exorzisten, der mir das Teufelchen austrieb. Leider fand sich so einer nicht in den Gelben Seiten.
Vielleicht wurde ich ja auch langsam verrückt. Wäre kein Wunder nach so vielen Jahren mit einer Angststörung. Seit einer kleinen Ewigkeit fürchtete ich mich vor größeren Menschenansammlungen. Es hatte irgendwann in meiner Kindheit angefangen, allerdings wusste ich nicht mehr wann oder warum. Und es wurde nicht besser, nur schlimmer.
Schade, dass wir den Bienenstich verpasst haben, teilte mir mein Mini-Beelzebub mit.
»Halt die Klappe!«
Immer mit der Ruhe. Wenigstens sind wir jetzt diesen eingebildeten Muskelprotz los.
Wenn das mein Unterbewusstsein war, das mir seine Einschätzung von Jan Dierksen kundtat, war ich echt übel dran. Dann könnte mein Liebestraum so gut wie ausgeträumt sein.
Ist er schon! Ist er schon!
Ich heulte los. Die Tränen vermischten sich mit dem Regenwasser, das aus meinen Haaren tropfte. Dem fiesen kleinen Mann wurde das offenbar zu nass und er verschwand.
Wenigstens etwas.
Doch kaum war er weg, musste ich wieder an Jan denken. Wie er gelacht hatte, am lautesten von allen. Den Kopf in den Nacken geworfen, die strahlend weißen Zähne entblößt, während die muskulöse Brust unter dem hellblauen Polohemd bebte.
Meine Knie knickten unter mir ein, und ich landete unsanft auf dem kalten Fliesenboden. Monate der Hoffnung, der heimlichen Liebe, der Sehnsucht – mit einem Schlag zerstört.
Mein Traum von einer glücklichen Zukunft – hämisch weggegrinst.
Mochte ja sein, dass meine Liebe vorerst nur einseitig gewesen war, aber ich war mir sicher gewesen, den Sportlehrer im kommenden Schuljahr zu erobern. Ich musste nur zwanzig Pfund abnehmen, vielleicht ein bisschen in die Höhe wachsen und mein anderes klitzekleines Problem loswerden. Wer verliebt ist, glaubt, dass er alles schaffen kann. Und so war ich auch drauf gewesen. Optimistisch, voller Tatendrang. Bis vor einer guten halben Stunde.
Nun jedoch holte mich mein ganzes Elend ein. Ich war wieder einsam. Niemand liebte mich, niemand würde mich jemals lieben.
War natürlich Quatsch.
Ich hatte schon ein paar sehr nette Freunde gehabt, nur war leider nichts Dauerhaftes draus geworden. Meine Momente großen Appetits hatten sich als echte Beziehungskiller herausgestellt.
Hatte ich ja gerade wieder erleben dürfen.
Während ich förmlich vor Selbstmitleid zerfloss, spürte ich, wie mir kalt wurde. Besonders untenrum, wo ich durchnässt auf den Fliesen saß.
Im selben Moment hämmerte Esther gegen die Badezimmertür: »Warum höre ich die Dusche nicht laufen? Hockst du etwa auf dem Boden und holst dir eine Blasenentzündung?«
Esther, dachte ich dankbar. Esther hatte mich wenigstens gern. Sie kümmerte sich um mich.
»Ich liebe dich!«, rief ich.
»Alles klar, ich gieß mal ’n büsschen Rum in den Tee. Und nun mach zu.«
Unter leise quietschenden Geräuschen rappelte ich mich auf und stieg unter die Dusche. Den nassen Lappen, der vormals ein schickes Kleid gewesen war, stopfte ich in eine Plastiktüte. Später würde die in den Müll wandern. Nichts sollte mich an diesen schrecklichen Tag erinnern.
Als ich bald darauf fest in einen Bademantel gewickelt in meiner Küche erschien, hatte Esther sich bereits umgezogen und ihr Haar getrocknet. Sie trug wieder einen dicken Pulli und eine schwere Hose, diesmal beides in Dunkelgrün. Das Gewitter hatte einen Temperatursturz mit sich gebracht, und so wirkte ihre Kleidung durchaus angebracht.
»War kurz bei mir drüben«, erklärte sie überflüssigerweise.
Ich nickte und setzte mich an den schmalen Resopaltisch. Meine Küche war genauso minimalistisch eingerichtet wie die ganze Wohnung. Weiße Hängeschränke, weiße Küchengeräte, keinerlei Schnickschnack. Auch im Wohn- und Schlafzimmer fehlten starke Farben ebenso wie Kissen oder Reisesouvenirs. Schlicht und funktional war mir am liebsten und gab mir Sicherheit. Die Welt da draußen war schon unordentlich genug. Ich ließ mir einen großen Becher Tee einschenken, der verdächtig stark nach Rum duftete.
»Eigentlich ist mir schon von der Torte schlecht«, protestierte ich.
»Nicht reden, trinken.«
Das tat ich. Einer Frau wie Esther Claasen widersprach man nicht. Das hatte ich ziemlich schnell nach ihrem Einzug nebenan bemerkt. Ein halbes Jahr war das her. Sie hatte bei mir geklingelt und mir in ein paar wenigen Sätzen ihr Leben erzählt. Witwe nach über dreißig Jahren mehr oder weniger glücklicher sowie kinderloser Ehe mit einem Kieler Kaufmann. Schulrektorin im Vorruhestand. Außerdem stadtmüde und landlebenlustig. Aber so ganz allein irgendwo in der Walachei wollte sie auch nicht sein. Also habe sie sich für die freie Wohnung in diesem hübschen Vier-Familien-Haus am Rand von Norderbüll entschieden.
Dann sollte ich von mir erzählen, aber ich hatte abgewunken. Das hätte vermutlich die ganze Nacht gedauert, und ich war auch nicht der mitteilsame Typ. Insgesamt brauchte es jedoch nur drei Tage, bis Esther alles über mich in Erfahrung brachte. Fast alles. Grundschullehrerin, Single, überschaubarer Freundeskreis, der Großvater aus dem Süden eingewandert, die Eltern Landwirte, keine Geschwister.
Das war der einfache Teil.
Mein kleines Problem behielt ich lange für mich. Da Esther anfangs selbst keine Lust auf Ausflüge in die große Stadt hatte, fiel ihr nicht auf, dass ich am liebsten zu Hause war, wenn ich nicht in der Waldschule unterrichtete. Sie verstand jedoch nicht, warum ich partout nicht mit zum »Tanz in den Mai« wollte. Der fand jedes Jahr in einem großen Festzelt auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr statt, wo sich buchstäblich ganz Norderbüll versammelte. Allein bei der Vorstellung packte mich das blanke Grauen. Ich behauptete einfach, ich hätte furchtbare Kopfschmerzen, aber ich ahnte, Esther nahm mir das nicht ganz ab. Sie glaubte bestimmt, ich wollte nicht mit einer alten Schachtel auf dem Fest gesehen werden, und obwohl ich ihr hundertmal das Gegenteil schwor, war sie einige Wochen lang ziemlich verschnupft.
Erst als meine Eltern Anfang Juni sehr widerstrebend einen Nachmittag lang ihre fünfzig Schwarzbunten – ihre geliebten Holsteiner Rinder – verließen, um ihr einziges Kind zu besuchen, flog ich auf.
Es war ein schöner warmer Sommertag, und ich hatte den Kaffeetisch auf meinem Balkon gedeckt.
Mama ließ ihren Blick lange zwischen mir und dem selbst gebackenen Kirschkuchen hin- und herwandern. »Da fehlt ja noch gar kein Stück«, sagte sie.
»Antje«, mahnte Papa. »Lass sie in Ruhe.«
Mama entstammte einer alteingesessenen nordfriesischen Familie. Die sagten grundsätzlich geradeheraus, was sie dachten.
»Was denn, Ragnar? Man darf ja wohl mal fragen, ob das einzige Kind endlich seine Essstörung in den Griff bekommen hat.«
»Ich habe keine Essstörung«, sagte ich.
»Sie hat keine Essstörung«, sagte Papa gleichzeitig.
»Warum weiß ich davon nichts?«, erklang vom Nachbarbalkon Esthers empörte Stimme.
Ich zuckte heftig zusammen. Papa auch. Nur Mama blieb stoisch.
Esther schob ihren Kopf um den Sichtschutz herum. »Ich komme mal eben rüber.«
»Wer ist das?«, zischte Mama, während der Kopf meiner Nachbarin verschwand.
»Esther Claasen.«
»Schöner Nachname.« Auch Mama haderte mit Wagner, aber Papa hatte sich bei der Hochzeit geweigert, ihren Mädchennamen anzunehmen. Dabei hätte Ragnar Olafsen echt besser geklungen. Sina Olafsen auch.
»Hat sie etwa einen Schlüssel zu deiner Wohnung?«, erkundigte sich Mama, als zwei Minuten später Esthers energische Schritte in meinem Flur zu hören waren.
»Klar, und ich zu ihrer. Das ist ganz normal unter guten Nachbarn und Freunden.«
Meine Eltern tauschten einen Blick und schüttelten einmütig die Köpfe. Sie waren ziemlich misstrauische Leute, was auch daran liegen mochte, dass sie von den Bauern in der Umgebung ein wenig schräg angeschaut wurden, weil …
Mama schlug das Kreuzzeichen.
Eben deshalb.
Katholiken waren den Menschen auf dem flachen, durchweg protestantischen Land äußerst suspekt. Aber die Männer in meiner Familie waren nicht bereit gewesen, ihren Glauben aufzugeben. Weder Opa noch Papa. Von Onkel Thilo ganz zu schweigen. Ein kurzer kalter Schauder erfasste mich, als ich an Onkel Thilo dachte. Das passierte mir jedes Mal. Keine Ahnung, warum.
Tja, und die Frauen hatten mitzuziehen, sprich konvertieren müssen, wenn sie Hubert und später Ragnar haben wollten.
Meine Eltern verstanden sich zwar im Prinzip recht gut mit ihren Nachbarn, aber sie schlossen bei uns zu Hause trotzdem immer sämtliche Türen dreimal ab. Vielleicht fürchteten sie ja eine nordische Version des Ku-Klux-Clans. Oder etwas in der Art.
Jemandem einen Schlüssel zu geben, der nicht zur Familie gehörte, bedeutete für sie, sein Schicksal herauszufordern.
Esther hatte inzwischen meinen Balkon erreicht und beobachtete mit aufgerissenen Augen, wie Mama ihr Kreuzzeichen beendete.
Sie brauchte dafür immer sehr lange. Als würde sie auch nach vierzig Jahren noch üben.
»Sie sind katholisch, und Sina hat eine Essstörung!«, rief Esther aus.
»Habe ich nicht«, sagte ich.
»Hat sie nicht«, sagte Papa.
»Nur manchmal«, ergänzte Mama.
»Das müssen Sie mir genauer erklären.« Esther quetschte sich zwischen meine Eltern auf die schmale Holzbank, die ich vor Jahren auf dem Flohmarkt von Norderbüll erstanden hatte. Damals war ich noch mutiger und innerlich stabiler gewesen, und so ein Ausflug hatte mir Spaß gemacht.
Während Ragnar, Antje und Esther schneller Freundschaft schlossen, als Mama das Ave-Maria beten konnte, holte ich ein Gedeck für meine Nachbarin, goss Kaffee ein, schnitt den Kuchen auf und legte jedem ein großes Stück auf den Teller.
Nur mir nicht. Aus Trotz. Niemand sagte mir eine Essstörung nach!
Zwanzig Minuten später wusste Esther über meine Angst vor größeren Menschenansammlungen Bescheid.
»Und wie hast du damit dein Lehramtsstudium geschafft? Volle Hörsäle und Prüfungen müssen doch der Horror gewesen sein.«
»Anfangs bin ich noch ganz gut klargekommen«, erklärte ich. »Es wurde erst mit der Zeit schlimmer, und die Prüfungen habe ich nur mit Ach und Krach geschafft. Deshalb bekomme ich auch nur Vertretungsposten.«
»Aber mit den Kindern hast du keine Probleme.«
»Nein, zum Glück. Vielleicht weil ich als Kind selbst noch ganz in Ordnung war. Jedenfalls bis zu einem gewissen Alter.« Mehr wollte ich nicht dazu sagen, aber Esther erfuhr noch, dass ich alle möglichen Therapien begonnen und wieder abgebrochen hatte und mir bei Panikattacken nur damit zu helfen wusste, sehr schnell sehr viel Essen in mich reinzustopfen. Vorzugsweise Süßes.
Ich fürchtete, sie würde mich jetzt abstoßend finden, und merkte, wie viel mir selbst schon an ihr lag, aber sie schaute mich nur interessiert an.
Da war keine Spur von Ekel in ihrem Blick.
»Wie bist du auf die Idee mit dem Essen gekommen?«
»Das ist schon einige Jahre her«, erklärte ich mit einem Anflug von Stolz in der Stimme. Niemand hatte mich bisher für meine Strategie gelobt. »Da wollte ich eine Freundin in Kiel besuchen und bin mitten in ein Straßenfest geraten.«
Noch bei der Erinnerung daran wurde mir ganz anders. Ich hatte Schweißausbrüche bekommen, mir war schwarz vor Augen geworden und mein Herz hatte wild geschlagen.
Ich hatte schon den Mund geöffnet, um laut zu schreien, weil ich nur so den inneren Druck loswerden konnte, da steckte mir eine Frau ein Blaubeertörtchen in den Mund. Vor lauter Überraschung vergaß ich meine Panik, kaute und fühlte mich von einer Sekunde auf die andere gar nicht mehr so schlecht.
»Seitdem esse ich, wenn ich Angst bekomme.«
Um die Anerkennung in ihren Augen nicht zu verlieren, verschwieg ich, dass die Mengen an Essen sich jedoch vervielfacht hatten.
»Faszinierend«, sagte Esther. »Und wie hat diese Angst überhaupt angefangen? Ist dir mal was passiert?«
»Ich weiß es nicht«, gestand ich.
Esther blickte von Mama zu Papa und wieder zurück. Doch die hoben nur die Schultern.
Weil ich plötzlich das Gefühl hatte, meine Eltern beschützen zu müssen, sagte ich: »Und es wird schlimmer.« Esthers Anerkennung war mir auf einmal nicht mehr so wichtig. Mama und Papa sollten von ihr nicht ins Kreuzverhör genommen werden.
»Inwiefern?«
»Ein Törtchen allein reicht nicht mehr.«
Esther hob die Brauen. »Sondern?«
Mama räusperte sich. »Es muss schon ein ganzer Kuchen sein. Oder eine Torte.« Sie schaute dabei zu meiner Nachbarin hoch. Auch im Sitzen überragte Esther meine Eltern um eine gute Kopflänge. Wir waren nun mal keine große Familie.
Papa stieß eine Art Grunzen aus.
»Was denn, Ragnar?«, fragte Mama scharf. »Seit wann darf ich nicht mehr die Wahrheit sagen? Unsere Tochter hätte uns längst Enkelkinder schenken können, wenn sie nicht diese Macke hätte.« Sie sah mich an. »Und diese rostigen Augen.«
»Bronzefarben«, sagte ich.
»Bronzefarben«, sagte natürlich auch Papa. Er war immer mein Verbündeter gewesen, während Mama ihre Liebe zu mir oft nicht so direkt zeigen konnte.
Beide zuckten erschrocken zusammen, als Esther den Kopf in den Nacken warf und in wieherndes Gelächter ausbrach.
Ich kannte das schon von meiner Nachbarin, aber wer sie zum ersten Mal so erlebte, bekam es schon mal mit der Angst zu tun. Leider schlug sie dann auch noch beiden kräftig auf die Oberschenkel. Sogar Papa stieß einen Schmerzenslaut aus.
Irgendwie war die Stimmung anschließend dahin. Der Kirschkuchen wurde schweigend und ziemlich hektisch verdrückt, und selbst nachdem Esther sich zurückgezogen hatte, wollten meine Eltern bald aufbrechen.
Mama betete im Stillen immer wieder das Ave-Maria. Das konnte ich ihr ansehen, weil sie nicht ohne Lippenbewegungen dazu auskam. Vielleicht dachte sie ja, der Leibhaftige sei in meine Nachbarin gefahren.
Nicht in Esther, hätte ich gern erklärt, ließ es aber lieber bleiben. Es reichte, wenn sie glaubten, dass ich eine Essstörung hatte. Von dem kleinen roten Teufelchen, das mich dazu antrieb, mussten sie nichts wissen. Papa forderte mich auf, bald mal zu Besuch zu kommen, und ich versprach es.
Doch der Sommer verstrich, ohne dass ich aufs Land hinausfuhr. Schon seit Langem war es mir unangenehm, mein Elternhaus zu betreten. Ich wusste selbst nicht, warum.
Aber diese Abneigung wurde mit den Jahren stärker, fast im selben Tempo, wie meine Panikattacken zunahmen. Und heute in der Turnhalle – ich schüttelte mich innerlich – , heute hatten sie ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht.
Elend saß ich jetzt in meiner Küche und hielt mich an dem warmen Becher fest. Als ich den Tee ausgetrunken hatte, fühlte ich mich, als hätte ich ein Fässchen Rum intus. Mir war immer noch schrecklich übel von dem Sahne-Nuss-Exzess. Meine Erinnerungen schwammen ineinander, dafür sah ich Esthers Gesicht doppelt. Ich vertrug Alkohol nicht so gut.
»Wie geht es eigentlich deinen Eltern?«, erkundigte sie sich.
Das war jetzt echt unheimlich!
»Kannst du Gedanken lesen?«, fragte ich zurück. Ich sagte wohl eher etwas wie »Kannschtudales«, aber sie verstand mich trotzdem.
»Nö«, erwiderte sie und schaute aus dem Küchenfenster hinaus in den strömenden Regen. »Aber es war so ein schöner Sommertag, als sie hier waren.«
Das war sehr, sehr nett von ihr, fand ich. Sie hätte auch sagen können, dass meine Fressorgie vorhin in der Waldschule sie an den Besuch von Antje und Ragnar im Juni erinnert hatte.
»Ischliebedisch«, nuschelte ich.
Esther grinste amüsiert. »Das weiß ich schon. Ich dich auch.«
»Könntest du mich nicht adoptieren?«, fragte ich, schon etwas klarer im Kopf.
»Na, na, was würden deine Eltern dazu sagen?«
Sofort musste ich wieder weinen, weil ich mir vorstellte, wie traurig sie sein würden. Ragnar vielleicht einen Ticken mehr als Antje.
Esther legte mir eine sehnige Hand auf den Arm. »Mir war nicht klar, dass es so schlimm um dich steht.«
In ihrer Stimme klang ein Hauch von Mitleid mit. War normalerweise nicht ihre Art. Esther hatte eher wenig Verständnis für die Schwächen anderer. Bei mir machte sie offenbar eine Ausnahme.
Und tatsächlich hatte sie nur einmal in diesem Sommer einen Anfall der kleineren Art miterlebt. Wir waren an einem sehr heißen Tag zum Baggersee gefahren. Als wenig später mehrere Dutzend Jugendliche laut grölend den kleinen Strand besetzten, brauchte ich drei ganze Tafeln Nougatschokolade vom Kiosk, um den Stress zu bewältigen.
»Glaubst du, Jan wird sich trotzdem in mich verlieben?«, fragte ich meine ältere Freundin.
»Warum denn nicht?«, gab sie zurück, obwohl ihr Blick etwas anderes sagte. »Aber willst du wirklich einen Mann haben, der wegen einer kleinen Schwäche so gemein ist?«
Kleine Schwäche. Das hatte sie jetzt wirklich nett gesagt.
Erst einen Moment später drang die Bedeutung ihrer Worte zu mir durch.
Jan war gemein gewesen, daran gab es keinen Zweifel. Er hatte noch lauter gelacht als alle anderen. Ich sah sein rot angelaufenes Gesicht vor mir und empfand wieder diese entsetzliche Scham. Esther hatte recht. Er verdiente meine Liebe nicht.
Bis hierhin alles klar. Die Frage war bloß, wie ich meine Gefühle für ihn ausknipsen sollte. Mein Herz war schließlich kein Lichtschalter. Schon strömten mir wieder die Tränen über die Wangen.
Mann! So viel heulte ich sonst in einem ganzen Monat nicht.
3 Ein Wunder muss her
»Von wem hast du eigentlich diese ungewöhnliche Augenfarbe?«, fragte Esther. »Wenn ich mich recht erinnere, sind die deines Vaters braun und die deiner Mutter hellblau.«
Klarer Fall von Ablenkungsmanöver.
Leise schniefend ging ich darauf ein. »Und meine sind rostig.«
»Das hat bloß Antje behauptet, aber sie hat es bestimmt nicht so gemeint. Ich finde, sie sind ganz besonders schön.«
»Danke.« Ich fühlte mich sofort getröstet. »Ist vielleicht ein Wunder des Herrn.«
Esther schaute auf einmal ausgesprochen nachdenklich drein.
»Was ist?«, fragte ich.
»Nichts. Ich hätte da vielleicht eine Idee, wie dir zu helfen ist. Aber erst mal musst du ins Bett. Schlaf dich aus.«
»Es ist noch gar nicht Abend«, protestierte ich, gähnte jedoch herzhaft, während meine Wangen wieder trocken wurden. Ich kannte das bereits. Auf eine Panikattacke folgte stets eine ungeheure Müdigkeit.
Esther ignorierte meinen Einwand. »Nun geh schon. Und wenn du morgen wieder fit bist, machen wir einen kleinen Ausflug.«
»Wohin?«, fragte ich alarmiert und war schlagartig wieder nüchtern. »Komm mir jetzt bloß nicht mit Konfrontationstherapie.«
Wow! Ich hatte das Wort fehlerfrei ausgesprochen!
»Das funktioniert nicht«, setzte ich hinzu. »Ich will auf keinen Fall in die Stadt!«
Esther lächelte gutmütig. »Wer sagt denn was von Stadt? Wir besuchen deine Eltern auf ihrem Bauernhof. Es gibt eventuell eine Möglichkeit, wie wir dich kurieren können.«
Ich blieb äußerst misstrauisch, konnte jedoch meine Neugier nicht unterdrücken. »Und was soll das sein? Vielleicht Kühe streicheln? Oder etwa Bäume umarmen? Vergiss nicht, ich bin auf dem Land aufgewachsen und habe trotzdem diese … Sache.«
»Kühe streicheln! Ha! Bäume umarmen!« Esther lachte ihr Pferdelachen, bevor sie hinzufügte: »So was meine ich nicht. Mir ist nur eingefallen, dass ihr katholisch seid …«
»Ich nicht so besonders«, unterbrach ich sie. »Es gab die Erstkommunion und die Firmung in St. Marien Schmerzhafte Mutter in Flensburg, aber seitdem habe ich meine Religion kaum noch praktiziert.«
Meinen persönlichen winzigen Luzifer verschwieg ich wohlweislich.
»St. Marien Schmerzhafte Mutter? Die Ärmste!« Esther sah aus, als wüsste sie nicht, ob sie wieder lachen oder eher weinen sollte. Sie entschied sich für einen neutralen Gesichtsausdruck. »Wie auch immer. Katholiken glauben doch an Wunder, richtig?«
»Zumindest einige.«
»Gut. Ich habe neulich nämlich eine Einladung zu einer Butterfahrt bekommen.«
»Was?« Entweder hatte die viele Sahne meine Gehirnzellen verstopft, oder Esther bekam Spontan-Alzheimer.
»Guck nicht so, ich erklär’s dir ja schon. Also, diese Butterfahrt war mal was anderes als der übliche Seniorenausflug nach Helgoland. Die sollte nach Südfrankreich gehen. Nach Lourdes, wo die Madonna mal …«
»Ich weiß, dass die Muttergottes dort der jungen Bernadette erschienen ist«, unterbrach ich sie. »Dafür bin ich katholisch genug.«
»Schon gut. Also, das Angebot richtete sich vor allem an Alte und Kranke, was ich schon etwas beleidigend fand, da ich weder das eine noch das andere bin. Aber egal. Außerdem dachten die wohl, eine olle Protestantin findet auch noch Platz im Bus. Zumal die hier im Norden bestimmt lange nach genügend Katholiken suchen müssen. Auch wurscht. Mir wurde klar, dass sehr, sehr viele Menschen jedes Jahr zu solchen Orten pilgern und um ein Wunder beten.«
»Ja, und?«
»Na, als du jetzt auch mit dem Thema angefangen hast, hatte ich eine Idee. Nenn es Erleuchtung.«
»Esther! Mach dich nicht über meinen Glauben lustig!«
»Papperlapapp! Ich finde jedenfalls, so etwas ist genau das, was du jetzt brauchst.«
»Ein Wunder? Ich?«
»Ganz genau.«
»Du machst Witze.«
»Es ist mein voller Ernst.«
»Esther. Du bist ein Vernunftmensch. Pensionierte Schulrektorin. Und evangelisch.«
»Na und?«
»Du kannst so etwas nicht vorschlagen. Das passt nicht zu dir.«
Meine Freundin rieb sich über die Adlernase und blickte mich dann aus klugen Augen an. Nur ganz schwach glaubte ich, ein verschmitztes Lächeln darin zu erkennen. Mir kam der leise Verdacht, dass ich Esther nicht besonders gut kannte. Vielleicht hatte sie mit ihrem verantwortungsvollen Rektoratsposten auch jegliche Seriosität abgestreift.
»Man sollte immer offen für neue Erfahrungen sein«, sagte sie.
Ich wollte anmerken, dass ich weder bei uns im Kuhstall noch auf der Weide je eine himmlische Erscheinung gesehen hatte, ließ es aber lieber.
»Papa ist aber auch nicht strenggläubig«, erwiderte ich stattdessen. »Und ich fürchte, Mama ist in ihrem Herzen immer noch Protestantin.«
Esther runzelte die Stirn. »Sonst gibt es keine Verwandten, die dem lieben Gott ein wenig näherstehen und dir helfen könnten?«