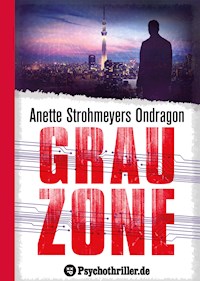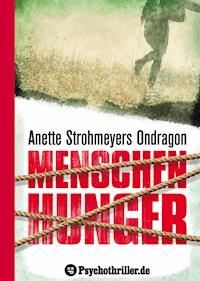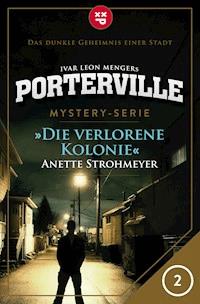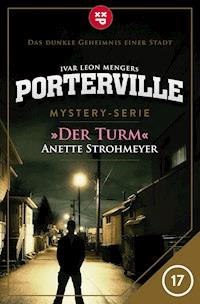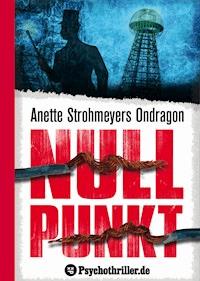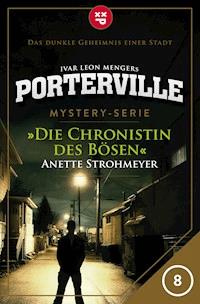
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Psychothriller GmbH E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Porterville
- Sprache: Deutsch
"Ich fühle, wie ein Lächeln meine Lippen umspielt. Ich stehe wieder näher am Fenster und blicke hinunter auf die dunklen Straßen von Porterville. Die Stadt, die ich so sehr hasse … und doch so sehr liebe. Vom ersten Augenblick an hat sie mich in ihren Bann gezogen. Der schillernde Turm aus Kristall, die Trolle aus Stein, der grüne Kobold. Ich kichere, denn heute weiß ich, was es mit all den Dingen auf sich hat." (Eleanor Dare-Sato)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PORTERVILLE
- Folge 8 -
„Die Chronistin des Bösen“
Anette Strohmeyer
- Originalausgabe -
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-942261-50-0
Lektorat: Hendrik Buchna
Cover-Gestaltung: Ivar Leon Menger
Fotografie: iStockphoto
Psychothriller GmbH
www.psychothriller.de
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung, der Vertonung als Hörbuch oder -spiel, oder der Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen, Video oder Internet, auch einzelner Text- und Bildteile, sowie der Übersetzung in andere Sprachen.
Ein Buch zu schreiben, dauert Monate. Es zu kopieren, nur Sekunden. Bleiben Sie deshalb fair und verteilen Sie Ihre persönliche Ausgabe bitte nicht im Internet. Vielen Dank und natürlich viel Spaß beim Lesen! Ivar Leon Menger
Prolog
„Ich habe Hudson überlebt, ich habe die Säuberungen unter Sato überlebt, ich habe einen Job und es gefällt mir hier. Manchmal bist du eben Polizeichef und ganz oben, manchmal bist du der letzte Privatermittler der Stadt und siehst aus wie ein übergewichtiger Penner. Und wenn Sato und die IFIS ganz ehrlich mit sich wären, müssten sie sich eingestehen, dass sie jemanden wie mich in Porterville brauchen.“
Hank Parker
Ehemaliger Polizei-Chef von Porterville
- 1 -
Porterville, 0048 – Es ist dunkel draußen, früh am Morgen, noch fast in der Nacht. Porterville schläft. Ich blicke nach oben. In meiner alten Welt würde es jetzt regnen. Aber es gibt keinen Regen mehr, schon seit fünfzehn Jahren nicht. Ich spüre Wehmut bei diesem Gedanken. Nachdenklich schaue ich aus dem Fenster unseres Penthouse im 55. Stockwerk des Sato-Towers und sehe die Reflektion meines Gesichtes … eines sehr alten Gesichtes, umrahmt von einer unnatürlich roten Flut von Haaren. Wie lange ich sie mir jetzt schon färbe? Wenn die Leute wüssten, woraus die Farbe besteht! Mir selbst wird bei dem Gedanken immer ganz anders, aber meine roten Haare sind nun mal mein Markenzeichen. Das Zeichen meines Standes.
Ich blicke erneut über die Dächer von Porterville in die dunkle Ferne. Am Horizont verschwimmen die Konturen im rötlich glimmenden Dunst, und hin und wieder blitzt es am Himmel auf wie bei einer elektrischen Entladung. Das ist der Schutzschild, der uns vor dem Draußen abschirmt. Wie ich es hasse, das allgegenwärtige Draußen! Mein Enkel Jonathan ist jetzt dort zusammen mit Emily Prey. Diese neunmalkluge Göre hat sich über die allgeltenden Verbote von Porterville hinweggesetzt und ihren Reproduktions-Partner selbst gewählt. Aber was noch schlimmer ist, sie hat Jonathan zu dieser gefährlichen Idee überredet, nach Draußen zu gehen. Sie muss viel Einfluss auf ihn gehabt haben. Einfluss, der ihr nicht zusteht … und der den wachsamen Augen und Ohren der IFIS-Überwachung entgangen ist!
Ich hole tief Luft und lasse sie langsam und kontrolliert wieder entweichen. Es ist eine Übung. Kontrolle ist hierbei der magische Punkt. Sie ist mein Lebenselixier, mein treuer Begleiter. Ich hole nochmals Luft und stoße sie wieder aus, ganz bewusst mit gespannten Lippen.
Kontrolle ist alles!
Ich brauche sie wie die Luft zum Atmen. Kontrolle über mich selbst, über andere Menschen … über ihre Gedanken. Das ist es, wofür ich lebe. Die Kontrolle hat mich hierhergeführt in diese Stadt, zu Takumi Sato. Ich spüre einen heftigen Stich in meiner Brust und lege die Hand darauf.
Takumi Sato … wie sehr er sich verändert hat. Wie sehr diese verdammte Stadt uns alle verändert hat! Ich kann den Gedanken kaum ertragen und wende mich vom Fenster ab. Doch die Erinnerung fällt über mich her wie ein lange vergessener Schmerz.
- 2 -
In der Wildnis von Amerika, 1588 – Eleanor Dare warf verzweifelt die Hände vor ihr Gesicht. Sie konnte die gereizten Blicke der anderen nicht mehr ertragen. Die kleine Virginia auf ihrem Schoß schrie und schrie vor Hunger. Sie alle litten fürchterlichen Hunger. Aber nirgendwo fanden sie genug zu essen, und das Geschrei des Kindes zerrte an ihren Nerven. Die einzige Erleichterung in all der Qual stellte das prasselnde Feuer dar, das in der Mitte des Lagers angezündet worden war. So mussten sie wenigstens nicht frieren.
Als Virginia kurz mit dem Gebrüll aussetzte, konnte Eleanor das erleichterte Aufatmen der anderen spüren, auch wenn die Männer sich Mühe gaben, es ihr nicht zu zeigen, dass sie kurz davor waren, dem Kind den Hals umzudrehen. Wie lange würde ihre Zurückhaltung wohl noch andauern? Plötzlich knackte es hinter ihnen im Dickicht des Waldes. Voller Furcht drehte Eleanor sich um und blickte in das undurchdringliche Gestrüpp. Was da ein paar Herzschläge später zwischen den Zweigen erschien, war jedoch kein Bär oder feindseliger Indianer, es war nur die Gruppe junger Burschen, die unterwegs zur Jagd gewesen war.
Ananias, Eleanors Mann, erhob sich und eilte erwartungsvoll auf sie zu. „Und? Habt ihr Erfolg gehabt?“
Die fünf jungen Männer, die alle um die fünfzehn waren, schüttelten betrübt den Kopf. „Nein, leider nichts. Das Jagdglück hat uns verlassen.“
Eleanor ließ enttäuscht das Kinn auf die Brust sinken. Dann würden sie heute Abend also wieder hungrig schlafengehen. Traurig schaute sie den schreienden Säugling auf ihren Knien an und strich ihm über das hochrote Köpfchen. Virginia war gerade mal sieben Monate alt und sie schrie nach Milch, doch die war schon vor Tagen versiegt. Wenn ihnen nicht bald ein Hirsch vor die Arkebuse lief, oder sie sonst etwas Nahrhaftes fanden, würde ihre kleine Tochter verhungern, bevor sie ihr erstes Lebensjahr vollendet hätte. Und nicht nur Virginia, sie alle wären dem Untergang geweiht.
Mit einem Seufzer, der mehr ein mattes Luftausstoßen war, setzte sich Ananias neben Eleanor auf den Baumstamm und legte einen Arm um sie. Im Gegensatz zu den anderen schien er Virginias wütendes Gebrüll nicht wahrzunehmen, abwesend starrte er in die zuckenden Flammen des Feuers. Sein Gesicht wirkte eingefallen, die Haut unter den dunklen Bartstoppeln war totenbleich und seine einstmals blaugrau glänzenden Augen stumpf wie schmutziges Eis. Er war ein großer stattlicher Mann … gewesen. Ein Mann voller Tatendrang und Entschlusskraft. Jemand, dem man sich anvertrauen konnte, jemand, der ihnen die Richtung wies. Eleanor hatte damals nicht lange gezögert, als ihr Vater ihn als möglichen Gemahl vorgeschlagen hatte. Es war zwar keine Heirat aus Liebe gewesen, aber das Beste, was sie hatte tun können, um ein gutes und sicheres Auskommen zu haben … und einen gewissen Einfluss, nach dem sie hungerte. Doch wenn sie Ananias jetzt anblickte, sah sie nur noch einen mageren Schatten. Einen dunklen Vorboten der Finsternis, die dort draußen in den Wäldern auf sie lauerte.
Um sich zu beruhigen, presste sie die Kiefer aufeinander und stieß langsam Luft durch die Nase aus. Sie musste sich damit abfinden, dass ihre Worte nur Gewicht durch den Mund ihres Ehemannes bekamen. Also bitte, flehte sie ihn im Stillen an, halt durch, Ananias, halt durch! Für mich!
Eleanor blickte in das Gesichtchen ihrer schreienden Tochter. Dann wandte sie sich von den Männern ab, öffnete die Bänder ihres Ausschnitts und legte Virginia an ihre Brust, um den anderen etwas Ruhe zu gönnen. Betrübt spürte sie das erfolglose Saugen des Kindes und hob den Blick in den Himmel, an dem die Sonne langsam hinter den Horizont sank und die Dämmerung wie ein schwarzer Schwarm Krähen herbeiflog. Leise begannen die Stimmen der Nacht zu flüstern. Beunruhigende Laute drangen aus den dunklen Tiefen des Waldes und vermischten sich mit den schmatzenden Lauten des Kindes auf ihrem Arm. Eine einzelne Träne rann über Eleanors Wange, als sie die Augen schloss und die Dunkelheit in ihr Herz sickerte. Einen Monat waren sie jetzt schon unterwegs. Vierundzwanzig tapfere Pioniere, die nach einem Ausweg suchten, darunter sie als einzige Frau. Warum sie die Kolonie Roanoke verlassen hatte?
Das wusste sie noch ganz genau und verfluchte sich im Stillen dafür. Denn sie war es gewesen, die die Idee dazu gehabt hatte.
Es war im Sommer 1587, als Eleanors Vater, der Gouverneur von Roanoke, sie und Ananias in der kleinen Kolonie in Amerika absetzte und kurz darauf wieder nach England zurücksegelte, um Nachschub zu beschaffen. Gerade mal ein halbes Jahr später suchten gleich mehrere Unglücke die kleine Kolonie heim, welche die Siedler dazu zwangen, ihre Wohnhäuser aufzugeben und bei den Indianern Unterschlupf zu suchen. Die Wilden bewohnten keine zehn Meilen von Roanoke entfernt ein Dorf namens Croatoan, mit dem die Siedler bisher regen Handel getrieben hatten. Es war der einzige Stamm im Umkreis, der ihnen freundlich gesonnen war, denn mit den anderen Stämmen hatten die Engländer bereits einige Fehden ausgefochten und sogar ein Dorf niedergebrannt. Nicht die besten Voraussetzungen für eine Bitte um Hilfe. Bevor sie die Kolonie verließen, stellten sie einen Holzpfeiler mitten in Roanoke auf und schnitzten in großen Buchstaben CROATOAN hinein, um Eleanors Vater einen Hinweis auf ihren Verbleib zu geben.
Die Wilden erwiesen sich als hilfsbereit, nachdem Eleanor sie mit dem Versprechen überredet hatte, sie würden Werkzeuge aus Eisen erhalten, wenn ihr Vater aus England zurückkehrte. Mit der Aussicht auf die wertvollen Tauschwaren teilten die Indianer bereitwillig ihre Winterreserven mit den Weißen. Doch ihre naturgegebene Großzügigkeit rächte sich, denn in Croatoan gingen die Vorräte schnell aus und der Hunger übernahm das Zepter. Schließlich fand die arg strapazierte Gastfreundschaft des Häuptlings ein Ende und er forderte die Siedler auf, das Indianerdorf zu verlassen. Er hatte von den Waldläufern der Powhatan und Delaware erfahren, dass weit im Norden eine weitere Siedlung existiere, und empfahl ihnen, dort ihr Glück zu versuchen
Wieder war es Eleanor, die mit dem Häuptling darüber verhandelte, dass sie nur eine kleine Anzahl an Männern losschicken würden und der Rest der Siedler bei den Indianern bleiben dürfe. Und als Tochter des Gouverneurs von Roanoke erklärte sie sich bereit, die Gruppe der Pioniere anzuführen. Eine kurze Geschichte über den Beginn einer langen Leidenszeit.
Eleanor spürte, dass Virginia auf ihrem Arm eingeschlafen war. Vorsichtig legte sie das Bündel mit dem Kind neben sich ab und streckte sich selbst auf ihrem Lager aus. Erleichtert schloss sie die Augen und wartete auf die sanfte Umarmung des Schlafes.
Am nächsten Morgen war nichts besser. Grau waren die Gesichter der Männer und grau die Wolken, hinter denen sich der Sonnenaufgang verbarg. Zitternd zog Eleanor sich die klamme Decke um die Schultern. Neben ihr erwachte Virginia mit einem schwachen Wimmern.
„Wir müssen weiter!“, flüsterte Ananias und erhob sich steifbeinig. Er begann, ihre Sachen in die Taschen zu stopfen. „Wir können nicht hierbleiben.“
Das war ihnen allen klar. Stumm und nachdenklich rafften sie ihr Gepäck zusammen.
„Wo ist der Stein?“, fragte Eleanor ihren Mann.
„Den haben wir an die Feuerstelle gebracht“, entgegnete er.
Eleanor hob Virginia auf den Arm und ging zu dem flachen Stein hinüber, der etwa drei Handspannen maß und eine Inschrift trug, die sie gestern mit dem Meißel eingeritzt hatten. Das wertvolle Steinmetzwerkzeug trug sie stets mit sich am Gürtel und sie wachte darüber wie über eine heilige Reliquie.
„VATER“, las sie laut die Inschrift vor, „WIR LEIDEN HUNGER, GEHEN N.“ Das N stand für Norden. Dieser Findling war schon der siebenundvierzigste seiner Art. An jedem Lagerplatz hatten sie einen zurückgelassen. Die Steine sollten ihrem Vater, wenn er nach ihnen suchte, ein Wegweiser sein. Jedoch verlor Eleanor allmählich den Glauben an ihren eigenen Plan. Was sollte noch die Mühe mit den Steinen? Bald würden sie dafür keine Kraft mehr haben.
Sie hob den Blick und sah, dass die Männer abmarschbereit waren. Mit müden Gesichtern erwarteten sie das Zeichen. Eleanor straffte ihre Haltung. Noch akzeptierte die Gruppe ihre und Ananias‘ Position als Anführer. Das war gut, das würde sie alle davor bewahren, hier in der Wildnis zu sterben. Vielleicht.
„Auf nach Norden!“, rief Ananias mit fester Stimme. Er hob den Arm in die Richtung, in der am Abend zuvor der Polarstern am Himmel gestanden hatte. „Möge der Herrgott gnädig sein und seine schützende Hand über uns halten, möge er uns den Weg zu sicheren Gestaden weisen, auf dass wir eine neue Heimat in dieser schrecklichen Einöde finden!“
„Amen!“, sagte Eleanor voller Inbrunst.
„Amen“, wiederholten die anderen und machten sich dann auf den beschwerlichen Weg durch die Wildnis. Sie versuchten, die Küste zu ihrer Rechten im Auge zu behalten, was nicht leicht war, denn immer wieder waren ihnen ausgedehnte Sumpfgebiete oder Flussläufe im Weg, die sie umständlich umgehen mussten.
Eleanor lief zusammen mit Ananias an der Spitze der Gruppe. Auch ihr machte die mühsame Wanderung allmählich schwer zu schaffen. Dumpf spürte sie den Hunger in ihrer Leibesmitte pochen und die sich langsam ausbreitende Schwäche in ihren Beinen. Aber sie durften jetzt nicht ausruhen. Wenn sie das taten und sich der Verlockung einer längeren Rast hingaben, wären sie verloren. Sie mussten weiter, immer weiter nach Norden, wo ihre Rettung auf sie wartete. Mechanisch setzte sie einen Fuß vor den anderen. Virginia war in ein endloses schwaches Jammern verfallen. Eleanor versuchte, es zu dämpfen, indem sie ihrer Tochter einen kleinen Finger in den zahnlosen Mund steckte. Gierig begann Virginia daran zu saugen. Was sollte sie ihrem Kind heute zu essen geben? Sie hatte nichts außer Wasser und Baumrinde.
Der Herrgott wird uns schon leiten, dachte sie und betete still mit jedem Schritt, den sie sich weiter voranquälte.
- 3 -
Porterville, 0048 – Der Herrgott wird uns leiten!
Was für einen Schwachsinn ich damals gedacht habe. Aber es hat funktioniert, es ist mir gelungen, die Kontrolle zu behalten.