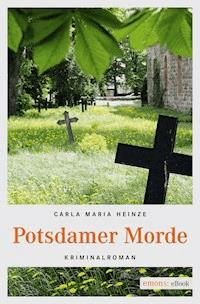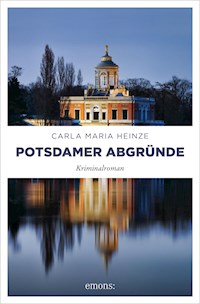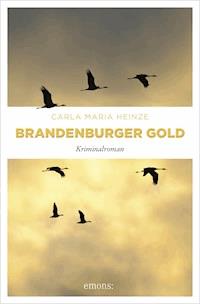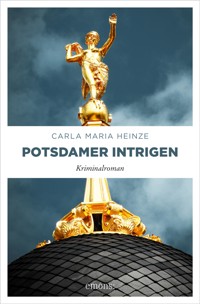
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Enne von Lilienthal
- Sprache: Deutsch
Facettenreich, authentisch und spannend bis zum Schluss! Ein Toter im Potsdamer Stadtschloss ruft Kriminalrat Maik von Lilienthal auf den Plan. Doch kaum hat er mit den Ermittlungen begonnen, wird im Park Sanssouci die nächste Leiche entdeckt. Offenbar kein Zufall, denn die beiden Opfer kannten sich. Als Lilienthals Mutter Enne, pensionierte Fallanalytikerin, von den Morden erfährt, kann sie es nicht lassen und stellt im Alleingang Nachforschungen an. Die Hinweise, auf die sie stößt, führen zurück in die letzten Jahre der DDR – und fördern tödliche Geheimnisse zutage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Carla Maria Heinze, geboren in Kleinmachnow, einem Vorort von Berlin, mag alles, was nicht in eine Schablone passt: Menschen, Meinungen und Lebensentwürfe. Ihre Kriminalromane handeln davon. Viele, oft abenteuerliche Reisen führten sie über alle Kontinente. Heute lebt sie in einem kleinen Ort zwischen Potsdam und Berlin.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Pitopia/Bernd Kröger
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-164-5
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Nessun dorma!
Ma il mio mistero è chiuso in me.
Kein Schlaf!
Aber mein Geheimnis ist in mir verschlossen.
Aus »Turandot«, Giacomo Puccini
Prolog
»Iss jetzt.« Er nahm den Löffel und schob ihn brutal an die Mundöffnung. Flüssigkeit rann herab. »Was bist du doch für ein Ferkel. Bekleckerst dich schon wieder. Pass doch auf. Bist doch kein Baby mehr. Eins sag ich dir, deine Putzfrau bin ich nicht. Hast du mich verstanden?« Er zog eine Grimasse, hob den Zeigefinger. »Dich hab ich sowieso nie gewollt. Du bist mir nur ein Klotz am Bein.« Er schaute angewidert auf die helle Flüssigkeit in der Plastikschüssel in seiner Hand. Stellte sie auf den Boden. Horchte. Und sagte auf einmal mit veränderter, heller Stimme: »Geht doch.« Dabei fuhren seine Hände durch das flauschige Haar. »Alles wird gut. Ich pass auf dich auf. Niemand tut dir mehr weh.« Er zog den Körper in seine Arme und wiegte ihn. »Schlaf, Kindchen, schlaf, im Garten steht ein Schaf«, sang er.
Die weichen Strahlen der Abendsonne erhellten für kurze Zeit die Wand mit den Märchenfiguren. Glitten weiter durch den schmalen Raum mit den abgewetzten Möbeln und dem fleckigen Teppichboden. Über den Gitterstäben des weißen Kinderbetts schwebte die kleine Figur einer Fee mit silbrigen Locken in einem blassblauen langen Kleid.
Die Konturen der Gegenstände verblassten. Die Dämmerung senkte sich herab. Durch die geschlossenen Fenster drangen die Geräusche des abendlichen Feierabendverkehrs herein. Das dumpfe Klacken zuschlagender Autotüren. Der schrille Ton einer Fahrradklingel. Eine hohe Frauenstimme rief etwas. Lachen. Ein Hund bellte. Jemand fluchte lauthals, und gleich danach war das Quietschen der Eingangstür zu hören.
Langsam verebbte die Kakofonie der Straße. Nach und nach wurde es ruhiger. In dem schmalen Raum war längst Stille eingekehrt. Eine Stille, die nicht mehr durchbrochen werden konnte.
1
Blass zeichnete sich die Sichel des abnehmenden Mondes am Himmel ab. Hinter den Wohnblöcken schob sich zaghaft die Morgendämmerung empor. Erste Vogelstimmen erklangen über den Dächern des Alten Marktes. Die Figur des Atlas auf der Dachspitze des historischen Rathauses schimmerte golden in der Dunkelheit. Dann setzten die Glocken der Nikolaikirche mit ihrem melodischen Klang ein und verkündeten die sechste Stunde.
Silvio Ragnitz kniff die Augen zusammen, gähnte, als er aus dem Fahrstuhl trat. Mit weit ausholenden Schritten lief er an den Tischen und Stühlen vorbei zu der Tür, die zu den Arbeitsräumen der Kantine im Potsdamer Landtag führte. Er strich sich über das kurz geschnittene dunkle Haar, schob den Ärmel seiner gelben Windjacke hoch und schaute auf seine Armbanduhr. Eine halbe Stunde bis Schichtbeginn.
»Dein Vorname ist Pünktlichkeit«, hatte Uli mal zu ihm gesagt. Ein bisschen spöttisch, wie Freunde halt manchmal so sind. Aber er hatte es als Lob empfunden. »Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige« war der Spruch seines Opas gewesen, und daran hielt er sich. Bis heute. Auch wenn das nicht jedem hier passte. Zeit war kostbar, sie durfte nicht verplempert werden. Und in seiner Position als Leiter der Landtagskantine war das für ihn ohne Alternative. Wenn er die Fäden nicht straff in der Hand hielt, würde sich bei den Kollegen umgehend der Schlendrian einschleichen, davon war er überzeugt. Wer sich nicht an die Regeln hielt, der hatte in seinem Team nichts verloren.
Er schloss die Tür auf und drückte den Lichtschalter. Mit einem Schlag flutete strahlende Helligkeit die vor ihm liegenden Räume. Er lief den Gang entlang, bis er zu der im hinteren Teil gelegenen Umkleide kam, streifte die Windjacke von seinen breiten Schultern, zog den grauen Baumwollpullover über den Kopf und hängte beides zusammen mit den Jeans ordentlich auf einem Bügel in seinen Spind. Griff nach dem Päckchen mit der sauber gewaschenen Arbeitskleidung, die zusammengelegt auf dem Schrankboden lag, und stieg in die weiße Baumwollhose. Darüber zog er das in gleicher Farbe gehaltene T-Shirt und die blau-weiß gestreifte Jacke.
Hier oben unter dem Dach des Landtagsgebäudes herrschte eine angenehme Temperatur. Im Gegensatz zu draußen, wo der kalte Novemberwind um die Mauern fegte. Er streckte sich, strich wieder durch das volle dunkelbraune Haar und schob die Mütze vorerst in die Jackentasche. Dann schlüpfte er in die weißen Sneaker, die am Boden vor dem Spind standen, fischte die Packung Zigaretten samt Plastikfeuerzeug aus der Windjacke und ging nach vorn zur Glastür, die auf die Dachterrasse führte.
Diese wenigen Minuten hier oben allein, das war für ihn der Beginn eines jeden neuen Arbeitstages. Die erste Zigarette mit dem Blick über die erwachende Stadt. Er schaute hinüber auf die grünlich schimmernde Kuppel der Nikolaikirche; daneben lag das Potsdam Museum und gegenüber das Barberini, Hasso Plattners Museum, erbaut im Stil des Palazzo Barberini in Rom. Mit seinen spektakulären Kunstausstellungen zog es Besucher aus ganz Europa an und genoss inzwischen auch weltweit Aufmerksamkeit in der Kunstwelt. Das erfüllte ihn mit Stolz, so als würde es ihm persönlich gehören. Als gebürtiger Potsdamer fühlte er sich sowieso ein bisschen elitär. Nie hatte er auch nur einen Augenblick daran gedacht, von hier wegzugehen. In einer anderen Stadt zu leben.
Er blies den Rauch in die kalte Morgenluft. Aber heute überkam ihn nicht die Ruhe, die sich sonst bei seinem morgendlichen Ritual einstellte. Gestern Abend hatte er Krankmeldungen von zwei seiner Mitarbeiter per SMS erhalten.
»Tagesplanung mal wieder am Arsch«, knurrte er. Drückte die halb gerauchte Zigarette aus und lief zurück zu den Arbeitsräumen. Er schloss die Tür zu seinem Büro auf. Ein kleiner quadratischer Raum, vollgepackt mit schmalem Mobiliar, auf dem sich die Unterlagen sauber stapelten. Durch die halbhohen Glasscheiben zeichneten sich im Halbdunkel auf der anderen Seite die Konturen des Kollegen »Godzilla« ab, der überdimensionalen Geschirrspülstraße aus matt schimmerndem Edelstahl.
Er ließ sich auf seinen Schreibtischstuhl fallen und griff nach dem Personalplan für den heutigen Tag. Die Personaldecke war knapp bemessen. Seine Beschwerden, die er in regelmäßigen Abständen an den Haushaltsausschuss richtete, hatten bisher kaum Gehör gefunden. Etwas irritierte ihn. Er schaute hoch. Hinter der Glasabtrennung blinkte es rot. So eine Sauerei, die Spätschicht hatte das Gerät mal wieder nicht ordnungsgemäß gewartet.
»Wenn ich den erwische«, knurrte er und stand auf.
Sein Smartphone vibrierte. Auf dem Display leuchtete der Name des Anrufers auf.
»Was gibt’s, Mario?«, meldete er sich ohne eine Begrüßung.
»Hähnchen is aus. Kannste vergessen, Silvio«, brüllte Mario durch den Lautsprecher in sein Ohr. Im Hintergrund hörte Ragnitz das Zischen der Bremsanlagen der Kühltransporter, abgehackte Sätze und Befehle in unterschiedlichen Sprachen. Die morgendliche Geräuschkulisse auf dem Großmarkt, wo Mario sich gerade aufhielt, um die letzten Einkäufe frischer Ware zu erledigen. »Keine Bioqualität, und die Preise haben sie schon wieder angehoben.«
»Haste ’ne Alternative?«
»Austern aus der Normandie und iranischen Kaviar, Cheffe«, brüllte Mario so laut, dass ihm fast das Smartphone aus der Hand fiel.
»Red keinen Scheiß. Ich hab keine Zeit für so was. Zwei Krankmeldungen, und der MP hat sich mit sechs Personen um dreizehn Uhr zu einem Imbiss angesagt. Was Regionales. Natürlich bio.«
»Bio ist die neue deutsche Vorsilbe, weißte doch«, entgegnete Mario lapidar.
»Also, was haste Reelles im Angebot?«
»Schweinemedaillons. Der Preis ist in Ordnung.«
»Qualität?«
»Hervorragend, aber bio is nich«, grölte Mario in den Hörer.
»Beeil dich, nimm die doppelte Menge. Das frieren wir ein.«
»Wer is ’n krank?«
»Marco und Bischoff.«
»Mir kommen die Tränen. Von wegen krank. Gestern war das Auswärtsspiel SV Babelsberg gegen Tasmania Berlin. Marco war deswegen in den letzten Tagen sowieso kaum noch zu gebrauchen. Hat nur noch davon geredet und trainiert wie ein Verrückter. Der is nich krank, nur alle«, erklärte sein Einkäufer. »Sport ist Mord«, setzte er nach.
Ragnitz grinste. Marios untersetzte, füllige Figur konnte er sich auch beim besten Willen nicht auf einem Sportplatz vorstellen. Eher erinnerte sein Kollege an einen Sumoringer im Anfangsstadium.
Nach weiteren Anweisungen für den Einkauf des heutigen Tagesbedarfs durch die veränderte Planung beendete er das Gespräch. Seit die Grünen in der Brandenburger Regierung mitmischten, wurde in der Landtagskantine mehr Wert auf artgerechte Haltung und Bioqualität bei den Lebensmitteln gelegt. Er war schon immer dafür gewesen. Nur wie er das mit seinem Budget hinbekommen sollte, danach fragte niemand. Genervt steckte er das Smartphone zurück in seine Hosentasche.
»Morjen, Chef«, hörte er jetzt im Sekundentakt durch die angelehnte Tür. Die Kollegen trudelten ein. Er fuhr den Computer hoch und prüfte die Vorgaben für den heutigen Tag. Öffnete den Arbeitsplan für die erste Schicht und gab die Änderungen ein. Jemand klopfte an die Scheibe. Eine attraktive Frau in den Vierzigern mit schwarzen halblangen Haaren, die Lippen im sonnengebräunten Gesicht karmesinrot geschminkt, lächelte ihm zu.
»Morjen, Rita«, grüßte er. »Urlaub schon wieder vorbei? Gut siehste aus und so braun, da kann man richtig neidisch werden.« Sie strahlte ihn an und ging weiter. Er griff nach der Einkaufsliste für die nächste Woche, vertiefte sich darin und hörte kaum die ihm vertrauten Geräusche des beginnenden Arbeitsalltags, die gedämpft durch die Glasscheiben seines Büros drangen. Da fiel ihm die rote Warnlampe ein. Er erhob sich halb von seinem Sitz, blickte hinüber und sah, dass Rita die Anlage bereits startete. Zuerst mit einem Probelauf.
»Entkalker nachfüllen«, hörte er sie rufen. Klar, das haben diese Pappnasen von der Spätschicht versäumt, dachte er. Dann erklang das Zischen und Gurgeln des Wasserziehens. Der erste Durchlauf wurde leer gestartet, um das Gerät durchzuspülen. Ragnitz konzentrierte sich wieder auf die Zahlen. Griff nach seinem alten Taschenrechner, fuhr mit dem Finger an den Zahlenkolonnen entlang und tippte dabei die Beträge ein. Dann verglich er die Angaben auf den Ausdrucken mit den Daten auf dem Bildschirm. Stutzte, blätterte zurück und fuhr erneut mit dem Finger über die äußere Spalte der letzten Seite.
»Immer das Gleiche«, brummte er. Wenn er nicht alles nachprüfte, würde ihm die Buchhaltung die Zahlen zum Monatsende um die Ohren hauen. Er griff zum nächsten Aktendeckel, öffnete ihn und blätterte bis zur letzten Seite. Mario war unübertroffen beim Einkauf. Er entdeckte sofort, wenn die angebotenen Lebensmittel nicht in Ordnung waren. Aber seine Abrechnungen musste er jedes Mal überprüfen. Nicht dass Mario betrügen wollte oder nachlässig wäre – nein, der Mann hatte ein gestörtes Verhältnis zu Zahlen.
Ragnitz fuhr zusammen, hob den Kopf.
»Nein!«, hörte er Rita abermals schreien. Dann gellend: »Hilfe!« Er sah, wie sie hinter der Waschstraße bis zur Wand zurückwich. Ihr Schreien war in ein Wimmern übergegangen. Sie starrte auf etwas, das er von seinem Platz aus nicht sehen konnte. Gegenüber steckte Jens seinen roten Haarschopf bedeckt mit einer Kochmütze durch die Tür.
»Mensch, Rita, spinnst du?«, brüllte er und knallte die Tür zu.
Ragnitz stieß den Stuhl zurück und riss die Tür auf. Rita stand haltsuchend an die Wand gepresst und hatte die Hände vors Gesicht gehoben. Er lief zu ihr, fing sie gerade noch auf, als ihr Körper langsam in sich zusammensackte. Er sah hinüber zu dem zischenden, gluckernden Edelstahlgehäuse. Durch die schwarzen Streifen der Gummilaschen am Ende des Laufbands schob sich ruckartig etwas Helles. Ragnitz ließ Rita vorsichtig zu Boden sinken. Trat näher. Grellrot schimmerten lackierte Fußnägel an kalkweißen Zehen. Ragnitz fühlte, wie sein Magen ein Eigenleben entwickelte. Die Füße schoben sich Stück für Stück ins Freie. Glänzend weißes Fleisch. Er spürte eine Hand auf seinem Arm. Fuhr herum. Ritas Finger krallten sich an ihm fest. Sie flüsterte: »Das ist mein Nagellack.«
»Anhalten! Ausschalten, verdammt noch mal!«, brüllte Ragnitz. »Halt endlich die Klappe«, fuhr er Rita barsch an und schüttelte ihre Hand ab. Das Band ruckelte weiter. Er rannte zum Notschalter und presste seinen Finger auf die Taste. Die Maschine gab einen keuchenden Laut von sich und blieb stehen. Rita, in einer Ecke hockend, wimmerte leise, die Arme vor ihrem Gesicht verschränkt.
Im grellen Licht der Deckenbeleuchtung blickte Ragnitz auf das, was dort auf dem Laufband lag. Kleine Frauenfüße. Die Fersen mit Schwielen bedeckt. Der rechte Fuß wies einen ausgeprägten Hallux valgus auf. Er beugte sich vor, versuchte, die Gallenflüssigkeit, die ihm durch die Speiseröhre nach oben stieg, zurückzudrängen. Schob die dunklen Gummilaschen zur Seite und starrte ins Innere. Seine Hand zitterte, als er sein Smartphone aus der Hosentasche zog und die 110 wählte.
2
»Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Horst Frank wird des vorsätzlichen, brutalen Mordes an seiner Ehefrau Annalena Frank für schuldig befunden.« Die Richterin, eine zierliche Frau mit kurzen dunklen Haaren, blickte auf ihre Notizen. »Zur Begründung«, fuhr sie fort. »Der Angeklagte hat seiner Ehefrau mit Vorsatz und in voller Absicht vor dem Wohnhaus aufgelauert, obwohl ihm rechtskräftig seit einem Jahr der Umgang mit Frau und Kind sowie das Betreten des Grundstücks und des Hauses untersagt worden waren. Der Angeklagte hat seine Frau mit brutaler Gewalt an den Haaren in den Garten geschleppt, ihr dabei, als sie zu fliehen versuchte, beide Arme gebrochen, sie in den Unterleib getreten, wohl wissend, dass sie im sechsten Monat schwanger war, und sie anschließend in den Gartenteich gestoßen. Obwohl sie sich weiterhin wehrte, hat er sie so lange unter Wasser gedrückt, bis sie kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Billigend hat der Beklagte dabei in Kauf genommen, dass sein fünfjähriger Sohn der Tat zusah. Und ihn, als er zu schreien begann, in den offenen Hundezwinger gesperrt, in dem sich zwei Rottweiler befanden, obwohl das Kind nur mit einem dünnen Schlafanzug bekleidet war und eine Außentemperatur von fünf Grad Celsius herrschte. Das Kind erlitt eine schwere Lungenentzündung. Ihm ist durch diese Handlung großer seelischer Schaden zugefügt worden. Der Junge befindet sich seit der Tat bis heute in psychiatrischer Behandlung, und wie der Gutachter, Herr Dr. Kohn, vorhin bestätigte, verweigert er jede Fürsorge und hat seither kein Wort gesprochen.«
Die Richterin blickte den Angeklagten jetzt direkt an. »Da der Angeklagte während der gesamten Verhandlung weder Reue für die von ihm begangene Tat gezeigt noch über seinen Verteidiger eine in diesem Sinn lautende Erklärung abgegeben hat, reicht hierfür das gesetzlich vorgeschriebene Strafmaß aus Sicht des Gerichtes nicht aus. Der Angeklagte wird daher nach Vollendung seiner lebenslänglichen Freiheitsstrafe zur anschließenden Sicherungsverwahrung in eine entsprechende Einrichtung überführt.«
Die Richterin klappte die vor ihr liegende Akte zu. Im Saal 1 des Potsdamer Landgerichtes war es still; man hätte die berühmte Stecknadel auf den Boden fallen hören können. Der Angeklagte saß breitbeinig auf seinem Stuhl neben seinem Verteidiger und blickte mit zusammengekniffenen Augen hasserfüllt zum Richtertisch.
»Die Verhandlung ist geschlossen.« Die Richterin nahm ihre Brille ab und fuhr sich kurz mit der Hand über die Lider. Dann schob sie ihren Stuhl zurück, erhob sich und verließ in Begleitung der Beisitzer den Raum durch eine schmale Tür in der rückwärtigen Wand.
Lilienthal war einer der ersten Zuhörer, die durch die Tür des Gerichtssaals ins Freie drängten. Als Mordermittler hatte er über die Jahre hinweg vieles an Grausamkeit erlebt. Aber was dieser Mann getan hatte, das ging auch ihm unter die Haut.
Draußen atmete er tief die frische Morgenluft ein und verharrte für einen Moment auf der breiten Eingangstreppe des alten Gerichtsgebäudes. Dicht an dicht zog die Blechkarawane auf der Hegelallee an ihm vorbei. Er ging nur selten zu Urteilsverkündungen. Zum Prozessauftakt hatte er als ermittelnder Polizeibeamter seine Aussage gemacht. Doch damals wie heute sah er immer noch die entsetzt aufgerissenen Augen des kleinen Jungen vor sich, der ihm verstört entgegengeblickt hatte, als er am Tatort eingetroffen war. Ein schmächtiges Kind, das kein einziges Wort herausbrachte. Nur über die Nachbarn waren sie aufgeklärt worden. Und der Junge schwieg bis heute. Wie waren Menschen nur zu so etwas fähig? Diese Frage stellte er sich in letzter Zeit häufiger. Deshalb hatte er der Urteilsverkündung beigewohnt. Das war ihm wichtig gewesen, um mit diesem Fall abzuschließen.
Schnell lief er die Stufen hinunter und durchquerte den Torbogen neben dem Gebäude, der zum rückwärtigen Parkplatz führte. Ein feiner Sprühregen hatte eingesetzt. Er schlug den Kragen seiner Lederjacke hoch, nahm sein altes Herrenrad, das er seit Jahren pflegte und das ihm immer noch gute Dienste leistete, aus dem Fahrradständer und machte sich auf den Weg zum nicht weit entfernten Potsdamer Polizeipräsidium.
Er hoffte, in der kühlen Novemberluft einen klaren Kopf zu bekommen. Sein Gefühlsleben fuhr zurzeit Achterbahn. Während der letzten Wochen hatte er versucht, Susanne, seine Lebensgefährtin und Kollegin im Potsdamer Polizeipräsidium, zurückzugewinnen, um endlich wieder ihren vertrauten liebevollen Umgang miteinander herzustellen. Vorigen Monat hatte sie ihm vorgeworfen, er respektiere sie als Frau und Kollegin nicht. Was er nicht nachvollziehen konnte. Er nahm ihre Anschuldigungen dennoch ernst und hatte sie mit kleinen Aufmerksamkeiten verwöhnt, ihr, sooft es seine Zeit erlaubte, Leckereien aus dem Feinkostladen in der Brandenburger Straße mitgebracht. Sogar die Fenster hatte er geputzt, war sich dabei allerdings nicht sicher gewesen, ob er nun den Helden oder eher den Trottel abgab. Und dann war alles auf einmal so gewesen wie früher. Diese eine Nacht lang. In der sie nicht voneinander lassen konnten.
Aber es war nicht mehr so wie früher. Gestern hatte sie ihm unmissverständlich klargemacht, dass sie nicht nur beruflich etwas ändern und Potsdam verlassen würde, sondern auch ihre Beziehung beenden wollte. Beziehung! Allein das Wort fand er unpassend. Susanne war nie eine Beziehung für ihn gewesen. Er liebte sie, so wie sie war. Manchmal stur wie ein Esel, in der nächsten Sekunde voller Leichtigkeit und Humor und mit einer explodierenden Energie, die er an ihr bewunderte. Doch sie hatte sich verändert. An allem, was er tat, herumgekrittelt. Sich auch im Präsidium kaum zurückgenommen. Als Kriminalrat und Leiter der Mordkommission 1 war er ihr Chef. Er hatte sich bemüht, geradezu bis zur Selbstverleugnung verbogen, die erstaunten Blicke der Kollegen ignoriert. Sie war ihm wichtig. Aber so konnte es nicht mehr weitergehen.
Heftig riss er den Fahrradlenker nach links, um nicht einen kleinen Hund zu überfahren, der laut bellend auf sein Rad zusprang.
Frauen, dachte er wütend, irgendwas hat bei denen in der Evolution nicht funktioniert. In seiner Wohnung im Holländischen Viertel, die sie noch nicht lange zusammen bewohnten, säuberte sie, seit das Grippevirus wieder seine Runden machte, jeden Tag alle Dinge, die sie oder er anfassten, mit Desinfektionsmitteln. Und falls er sich nicht sofort, nachdem er nach Hause gekommen war, die Hände wusch, wich sie jeder Berührung mit ihm aus. Sogar der Hund musste dran glauben. Nach jedem Gassigehen wurden ihm die Füße gewaschen. Mit Kernseife. Verdammt, dachte er und umkurvte ein älteres Ehepaar, das mitten auf dem Radweg bewundernd vor der historischen Fassade eines mit Ornamenten und Putten verzierten Gebäudes stehen geblieben war. Er hatte sich zum Affen gemacht. Je mehr er auf ihre Wünsche einging, desto höher schraubte sie ihre Forderungen.
Gestern Abend hatte er sie in das kleine französische Restaurant gleich bei ihm um die Ecke eingeladen, sich auf die Austern gefreut, die an dem Tag angeboten wurden. Nur dass Susanne Austern ablehnte. Das hatte er vergessen. Aber auch die Kalbszunge mit roter Zwiebelmarmelade und Herbstpilzen hatte sie kaum angerührt. An dem Bordeaux, den er mit dem Kellner vorher besprochen und gekostet hatte, einem samtig weichen Wein mit einer zartherben Note, hatte sie nur genippt. Wie abgrundtief blöd war er gewesen, dass er da nicht schon bemerkt hatte, wie ablehnend sie sich ihm gegenüber verhielt. Nein, er war immer noch voll naiver Hoffnung gewesen, dass nun endlich alles wieder gut und so wie früher werden würde. Und hatte sich bereits vorgestellt, wie sie sich später im Bett an ihn schmiegen würde.
Mit quietschenden Bremsen hielt er vor der Ampel, die gerade auf Rot umsprang. Er wischte sich die Regentropfen vom Gesicht und fuhr, als das Signal ihm freie Fahrt gebot, wie von Furien gejagt weiter.
Und dann der Countdown. Die Crème brûlée. Er hatte beim Ober per Handzeichen zwei Portionen für sich und Susanne bestellt. Als die Schalen serviert wurden und ihm der verführerische Duft des kandierten Zuckers in die Nase stieg, glaubte er noch, sie mache einen Scherz. Aber es war kein Witz.
»Warum hast du mich nicht gefragt?«, hatte sie wissen wollen und mit lauter werdender Stimme, was ihm peinlich war, erklärt: »Ich habe Crème brûlée noch nie gemocht, Maik. Weil ich keine Milch vertrage. Ich dachte, du wüsstest das inzwischen. Aber weißt du, Maik, gerade an solchen Kleinigkeiten stelle ich immer wieder fest, es ist dir egal.« Bei den letzten Worten war ihre Stimme gebrochen.
Er hatte aufspringen, sie in den Arm nehmen und sich entschuldigen wollen, aber sie hatte ihn angesehen, so kalt, dass er erstarrte, und gesagt: »Unsere Zeit ist vorbei, Maik.«
Einfach so. Vorbei.
»Warum?«, hatte er heiser gefragt.
»Wir passen nicht zueinander. Du kommst aus einer anderen Welt. Bevorzugst Extravaganzen, gern auch Exotisches. Ich mag es einfach, bodenständig. Du legst Wert auf besondere Qualität, trägst gern maßgeschneiderte Anzüge. Ich bin zufrieden mit Jeans und T-Shirt.«
»Aber …«, hatte er angesetzt, wollte sagen: Das mag ich doch so an dir. Du kannst anziehen, was du willst, du siehst immer wunderbar darin aus, aber da hatte sie bereits nach ihrer Umhängetasche gegriffen.
»Lass uns die restliche Zeit im Präsidium professionell miteinander umgehen, Maik. Das ist sicher auch in deinem Sinne. Du legst doch so viel Wert auf Haltung und gutes Benehmen.«
Er war sprachlos gewesen. Wenn Haltung und gutes Benehmen von ihr negativ bewertet wurden, was sollte er dann noch sagen? Auf diesem Niveau würde er nicht mit ihr reden. Später vielleicht. Denn so wollte er ihre Liebe nicht enden lassen.
»Mensch, pass doch auf!«, brüllte jemand. Lilienthal hätte den Pizzaboten, der gerade mehrere Kartons aus seinem Auto hob, beinahe touchiert. Er hob kurz entschuldigend die Hand und fuhr weiter durch die Dortustraße, am Ministerium für Wissenschaft vorbei, überquerte die Breite Straße und stoppte vor dem Polizeipräsidium in der Henning-von-Tresckow-Straße.
Am nächsten Ersten würde Susanne ihre neue Stelle in Berlin antreten. Rödelheim war dort ihr Chef. Hatte sie was mit ihm? Natürlich, warum sonst verließ sie ihn? Rödelheim, das miese Schwein, hatte sich an sie rangemacht. Der mit seinen blöden Sprüchen: »Sie sehen ja heute wieder bezaubernd aus.« Klebrig wie Pattex. Kotzen könnte er. Dass Susanne auf so etwas hereinfiel, hätte er nie gedacht. Wut stieg in ihm hoch, als er an Rödelheims sommersprossige Fratze dachte. Was fanden die Frauen nur an diesem aufdringlichen Typ? Schlecht gekleidet, mit einem Dreitagebart. Gut, der Kerl war schlank und durchtrainiert. Aber er, Lilienthal, hatte auch kein Gramm zu viel auf den Rippen.
Als er gestern um Mitternacht, nach einer weiteren Flasche Wein und drei Calvados, um die Rechnung bat, fühlte er sich wie ein Hund, den man vor die Tür gesetzt hatte. Der mitleidige Blick des Kellners hatte ihm den Rest gegeben. Als der auch noch bemerkte, die Calvados gingen aufs Haus, war er spontan aufgestanden und hatte den Mann umarmt. Was nicht nur den Kellner, sondern auch ihn überrascht hatte.
Zu Hause hatte er es gerade noch bis ins Bad geschafft und alles, inklusive der Austern, in der Toilettenschüssel versenkt. Dann schweißnass und mit zitternden Knien in den Spiegel gestarrt und erst dabei bemerkt, dass auf der gefliesten Ablage alle ihre Toilettenartikel fehlten. Auch die große Flasche »Sparkling Blush«, die er ihr erst vor Kurzem geschenkt hatte, war verschwunden, ebenso ihre elektrische Zahnbürste. Alles weg. Ihre benutzten Handtücher lagen im Wäschekorb. Er war in die Diele gegangen, hatte die Einbauschränke aufgerissen und da schon gewusst, dass die Fächer mit ihren Kleidungsstücken leer sein würden. Ihre Bücher, ihre CDs, nichts war mehr da. Noch bevor sie sich getroffen hatten, musste sie in der Wohnung gewesen sein. Sie hatte es geplant.
Er war ins Bett gekrochen, hatte die Decke über den Kopf gezogen und war sofort eingeschlafen. Im Morgengrauen war er durch etwas Kaltes, Feuchtes aufgewacht. Braune Augen hatten ihn angeblickt. Fluchend war er aufgestanden, hatte sich in Hose und Pullover gezwängt und war mit dem Hund runter auf die Straße gegangen. Den abendlichen Ausgang hatte er gestern in seinem Rausch vergessen.
Charly war ihm geblieben. Seine treue Hundeseele. Er hatte ihn schnell sein Geschäft erledigen lassen und war gleich wieder hinauf in die Wohnung gegangen. Hatte Charly seinen Napf gemacht, ihm frisches Wasser gegeben, sich selbst einen Kaffee gekocht und am Küchentisch gesessen und sein iPhone nach Nachrichten durchsucht. Nichts. Nur Enne, seine Mutter, hatte ihm geschrieben, dass sie mit Richard demnächst nach Italien fahren und sich, falls er mal Zeit hätte, über einen Rückruf freuen würde.
Nach einem Blick auf den Hund, der zusammengerollt zu seinen Füßen lag und schlief, hatte er sich kurz entschlossen unter die Dusche gestellt. Sich abwechselnd heiß und kalt das Wasser über den Rücken laufen lassen, bis er dachte, die Haut würde sich langsam von seinem Körper lösen. Danach hatte er Charly zu Frau Brenneisen rübergebracht. Seine Nachbarin liebte die kleine schwarze Fellnase und war gern bereit, ihn, wenn es nottat, zu betreuen. Eine Dauerlösung war das nicht. Susanne hatte Charly oft mit ins Büro genommen, das wollte er vermeiden. Aber darüber würde er sich später Gedanken machen.
3
»Mensch, hau ab, Hannah! Du doofe Petze.« Breitbeinig stand Jonas vor Hannah und drohte ihr mit der Faust. »Das ist Männersache. Weiber haben hier nichts zu suchen, kapierste das nicht?« Wütend fuhr der Elfjährige durch sein struppiges Blondhaar.
Hannahs Augen blitzten. Ohne Erwiderung drehte sie sich um und schlenderte betont langsam zurück zu der zerbrochenen ionischen Säule, an die sie ihre heutige Ausbeute gelegt hatte. Zwei farbige Steine. Die hatte sie unter dem Busch, der über das kleine Rinnsal weiter unten wuchs, entdeckt. Nach ein paar Schritten drehte sie sich um und streckte ihrem Bruder die Zunge raus.
»Das sag ich Mama, wirste schon sehen«, brüllte ihr Jonas hinterher.
Von wegen Petze, dachte Hannah und kickte mit ihrem Schuh einen Kieselstein vor sich her. In der Nacht hatte es gefroren, und Raureif bedeckte die Äste der hohen Bäume. Ihr war kalt. Darum war sie hergelaufen, um zu schauen, was ihre beiden Brüder in der Zwischenzeit spielten. Mitmachen ließ Jonas sie sowieso nicht. Sie wollte nur sehen, wo Benny sich diesmal versteckt hatte.
Aufmerksam schaute sie sich um. Jonas war so blöd. Allerdings auch größer und leider sehr kräftig. Da musste sie aufpassen. Erst gestern, als er sie dabei erwischt hatte, wie sie in seinem Comic las, hatte er ihr den Arm so heftig auf den Rücken gedreht, dass ihr die Tränen gekommen waren. Aber sie hatte keinen Ton von sich gegeben. Sich auf die Lippen gebissen. Das ärgerte ihn noch mehr, dass sie nie heulte, wenn er ihr wehtat. Die Heulsuse war Benny. Zwei Jahre älter als sie und darum in Jonas’ Augen eher ebenbürtig. Aber Jonas war nicht nur doof, sondern auch gemein. Vor allem, wenn er was anstellte, so wie gestern, als er heimlich den halben Schokoladenpudding, den Mama für die ganze Familie gekocht hatte, aufgegessen und danach behauptet hatte, sie habe ihn angestiftet, er habe nur probieren wollen. Mama hatte natürlich Jonas geglaubt. Zum Glück war Papa da gewesen. Der nahm sie in Schutz, wenn Jonas sich mit Mama verbündete.
»Verrat mich nicht, Hanni«, hörte sie Benny flüstern.
Sie schaute sich um. Entdeckte ihn nicht. Dann hörte sie ihn über sich keuchen und blickte nach oben. Er hielt sich an den Sprossen der Metallleiter fest, die zu dem steinernen Beckenrand hinaufführten. Das hatte Papa ihnen streng verboten. Er hatte ihnen erklärt, dass das Hochbecken mit Wasser gefüllt und beinahe vier Meter tief wäre und sie darin ertrinken würden, da es keinen Halt für sie gab. Danach war er mit ihnen die Treppen im normannischen Turm hochgeklettert. Da konnte man ganz weit schauen. Bis zum Schloss Sanssouci. Sie hielt sich immer an das, was Papa ihnen sagte, weil er nicht wie Mama einfach sagte: »Das dürft ihr nicht«, sondern weil er ihnen erklärte, warum nicht. Der Ruinenberg im Park Sanssouci mit dem Tempel, den Säulen und der Steinpyramide war ihr Spielplatz. Sie wohnten nicht weit entfernt, unten in der Jägervorstadt. Hannah blickte ängstlich hoch zu Benny.
»Komm runter, du weißt doch, dass Papa es verboten hat«, flüsterte sie. Aber Benny war schon bis zum Beckenrand gestiegen, duckte sich und schwang sich hinüber zu der Leiter, die im Inneren des Beckens angebracht war. Auf der anderen Seite hörte sie Jonas laut bis dreißig zählen.
»Ich komme!«, rief er. Gleichzeitig war ein lautes Platschen zu hören. Dann Bennys entsetzte Stimme.
»Hilfe!«, hörte sie ihn schreien.
»Jonas!«, rief Hannah. »Benny ist ins Wasser gefallen.« Über ihr schrien zwei Elstern, die in den kahlen Ästen der hohen alten Bäume saßen. Ein einzelner Sonnenstrahl zeigte sich flüchtig aus der dichten grauen Masse der Wolken. Hannah kletterte auf Bennys Fahrrad, das er unter die Leiter gestellt hatte, um an die erste Sprosse zu gelangen. Aber das Rad wackelte, als sie versuchte, sie zu ergreifen.
Über sich hörte sie Benny schreien. Seine Stimme war voller Panik. »Mama!«, schrie er. Und sie hörte, wie er um sich schlug und seine Arme dabei auf das Wasser klatschten.
»Hier«, rief Hannah Jonas zu, der angerannt kam.
»Hau ab«, brüllte er. Stieß sie vom Fahrrad und kletterte behände wie eine Katze auf den Sattel, umfasste die unterste Sprosse der Leiter, zog sich hinauf und schwang sich auf den Beckenrand. »Scheiße!«, hörte Hannah ihn fluchen. Auch er verschwand im Inneren des Beckens. Kurz darauf erschien er wieder, hinter ihm Benny, klatschnass, dem das Wasser aus allen Poren floss.
»Ich wollte mich doch nur verstecken«, heulte Benny mit vor Kälte bibbernden Lippen.
»Haste ja auch«, meinte Jonas wenig mitleidig.
»Der hat mich angefasst!«, heulte Benny.
»Der ist doch schon tot«, erwiderte Jonas altklug und half dem jüngeren Bruder die Leiter hinunter.
»Wer ist tot?«, fragte Hannah.
»So ’n alter Mann.« Jonas sprang hinter Benny auf die Erde. »Ist doch schon viel zu kalt zum Schwimmen«, fügte er hinzu. »Wahrscheinlich ist er erfroren.«
»Da ist ein Toter?«, fragte sie.
»Sag ich doch, du dumme Nuss.«
Hannah zog das rosa Smartphone aus ihrer Jacke und drückte eine Taste. »Papa!«, rief sie aufgeregt, als ihr Vater sich meldete. »Komm bitte her! Schnell. Hier ist ein toter Mann. Benny und Jonas haben den gefunden. Auf dem Ruinenberg.«
4
Als er den Gang zu seinem Büro entlangstürmte, kam Lilienthal vom anderen Ende Leo Kalumet entgegen. Er strahlte ihn mit seinem offenen, fröhlichen Lächeln an. Eine Wohltat. Kalumet war nicht nur sein Kollege, sondern durch mehrere spektakuläre Mordermittlungen, die sie gemeinsam durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen hatten, weit mehr als das. Zwischen ihnen hatte sich ein Vertrauensverhältnis gebildet, das nahtlos in eine kollegiale Freundschaft übergegangen war.
»Volles Programm heute, Maik«, rief Kalumet ihm zu. Der Kleine, wie Lilienthal ihn liebevoll nannte, reichte ihm gerade mal bis zur Schulter. »Leiche im Landtag. Manni Langer ist schon mit seiner Mannschaft vor Ort. Ich hab dir eine SMS geschrieben.«
»Und Susanne?«, wollte Lilienthal wissen, während er kehrtmachte und mit dem Kollegen Richtung Ausgang spurtete.
»Keine Ahnung«, erwiderte Kalumet und schaute Lilienthal dabei nicht an. »Hat sie dir keine Nachricht aufs Handy geschickt?«
Lilienthal fummelte sein iPhone aus der Jackentasche. Er hatte das Gerät während der Gerichtsverhandlung auf lautlos gestellt und seine Nachrichten danach noch nicht gecheckt. Zwei neue SMS zeigte es an. Eine von Susanne und eine weitere von Kalumet. Er öffnete Susannes SMS. »Komme später, habe noch etwas zu erledigen«, las er. Er steckte das Gerät zurück. Priorität hatte jetzt die Leiche im Landtag, alles andere musste warten.
Vom Polizeipräsidium bis zum Fortunaportal, dem Eingang zum Potsdamer Landtag, einem Nachbau des ehemaligen Potsdamer Stadtschlosses mit seiner barocken Fassade, waren es zu Fuß nur ein paar Minuten. Als sie eintrafen, standen im Innenhof schon die weißen Kastenwagen der Kriminaltechnik. Der Pförtner winkte sie aus seiner Pförtnerloge hinter der Eingangspforte durch, als sie ihre Ausweise in die Höhe hielten.
Sie betraten das Foyer durch die doppelte Glastür, wo sie von einer Polizistin in Uniform und mit sorgsam zum Dutt gebundenen dunklen Haaren erwartet wurden. »Klinger, vom KDD«, stellte sie sich vor. »Hier entlang bitte, Herr Kriminalrat.« Sie lief voraus, vorbei an der weißen, frei schwebenden Treppe, welche die Stockwerke miteinander verband, zu den Fahrstühlen.
Lilienthal fühlte sich immer noch nicht ganz wohl, wenn man ihn mit seinem Titel ansprach. Kriminalrat war er erst seit Kurzem, und das war dem schweren Unfall von Dr. Richard Körner geschuldet, seinem früheren Chef, der daraufhin vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden war. Woraufhin er, Lilienthal, ruckizucki dessen Posten hatte übernehmen sollen. Eher unfreiwillig hatte er der Beförderung zugestimmt, denn zeitgleich lag ihm ein Angebot der Bundespolizei vor. Ein attraktiver Karrieresprung, aber das war nun Schnee von gestern. Es war nun an ihm, Lilienthal, die Fahne in der Potsdamer Mordkommission hochzuhalten. Das gehörte sich so.
Nach seiner Ernennung hatte Kalumet gemeint: »Ab jetzt mit vollem Titel, oder genügt ein einfaches ›Sankt Lilienthal‹?« Er hatte die Hände wie zum Gebet gefaltet und rezitiert: »Oh Herr, dein ist die Macht und die Herrlichkeit, amen.«
»Mach dich vom Acker, du Pfeife«, hatte er erwidert. Aber Leo lag schon richtig, nach seiner Absage bei der Bundespolizei hatte er sich sehr selbstlos gefühlt.
Sie hatten das Dachgeschoss erreicht. Als Lilienthal mit Kalumet und Klinger aus dem Fahrstuhl trat, war der Zugang zum Kantinenbereich und zur Landtagsbibliothek bereits mit dem rot-weißen Absperrband begrenzt. Die Kollegen vom Kriminaldauerdienst hatten erste Zeugenbefragungen durchgeführt und Spuren gesichert.
Klinger führte sie an einer langen Theke vorbei in die dahinterliegenden Arbeitsräume der Landtagskantine. Sie öffnete ihnen die Tür, blieb aber draußen stehen. Als Lilienthal genervt in seiner Jackentasche fummelte, reichte sie den beiden wortlos Einmalhandschuhe und Überzieher für die Schuhe. Kalumet bedankte sich lächelnd, was der jungen Frau eine zarte Röte ins Gesicht steigen ließ.
Gleich im vorderen Bereich entdeckte Lilienthal Manni Langer, den Chef der Kriminaltechnik. Bekleidet mit dem obligatorischen weißen Schutzanzug, hockte er auf dem Boden und suchte akribisch nach Spuren. Als er Lilienthal bemerkte, hob er lässig die Hand zum Gruß und verdrehte dabei die Augen entnervt zur Decke. Da hörte Lilienthal auch schon die krächzende Stimme des Rechtsmediziners Dr. Enderlein.
»Meine Herren«, fauchte er, »wie soll ich hier arbeiten, wenn Sie wie zwei Akrobaten um mich herum Ihre Salti schlagen?«
Enderlein stand vor einer länglichen Maschine aus blitzendem Stahl, das Gesicht rot wie ein balzender Puter. Auf dem Fußboden am Ende des Laufbandes sah Lilienthal eine mausgraue Plastikwanne. Zwei Männer vom Bestattungsinstitut versuchten gerade, einen dicklichen, nackten Frauenkörper hineinzulegen. Lilienthal schätzte die Größe der Frau auf höchstens hundertfünfzig Zentimeter. Ein süßlicher Geruch, vermischt mit dem Duft von Spülmittelkonzentrat, waberte durch den Raum. Er wollte gerade näher treten, da entglitt dem einen Mann der Arm der Leiche, und sie glitschte wie ein nasser Fisch in die Wanne.
»Sind Sie völlig verrückt geworden?«, fauchte Enderlein.
Der Mann murmelte etwas, was niemand verstand, und machte einen Schritt zur Seite. Die Augen der Leiche starrten in Lilienthals Richtung. Er spürte, wie sein Magen den Aufzugmodus einschaltete, und bemühte sich, sein Innenleben unter Kontrolle zu bekommen. Kalumet neben ihm würgte unterdrückt und drängte sich vehement an den Kriminaltechnikern vorbei zum Ausgang.
»Ah, Lilienthal, auch endlich angekommen?«, tönte Enderlein und bemerkte mit Blick auf Kalumet: »Beruf verfehlt, wie?« Er beugte sich über die Leiche und befingerte vorsichtig deren Hals. »Das wird Folgen haben«, sagte er in Richtung der Bestatter. »Wie soll ich hier arbeiten, wenn unfähige Leute den Leichnam wie einen Pingpongball durch die Gegend werfen?«
Die beiden Bestatter schwiegen betreten.
Enderlein winkte Lilienthal zu sich. »Bitte hierher. Meine erste Einschätzung, um Ihren stereotypen Fragen zuvorzukommen: Das hier«, er beugte sich vor und deutete auf Vertiefungen in der Haut am Hals, an denen die noch feuchten dunklen Haare der Toten klebten, »sind noch nicht klar ausgebildete Strangulationsmale. Aber ich habe bereits das Zungenbein ertastet. Gebrochen, also todesursächlich. Dass das jedoch noch nicht alles ist, ist Ihnen nicht entgangen, nehme ich an.«
Lilienthal hatte bisher überhaupt keine Einzelheiten gesehen, nickte aber gehorsam und kam sich, wie häufig bei Enderleins Ausführungen, vor wie ein Prüfling beim Examen.
Der Rechtsmediziner deutete auf den offen stehenden Mund. »Sehen Sie?«
Lilienthal blickte auf das Gesicht der Frau, rührte sich aber nicht von der Stelle.
»Haben Sie Adleraugen, oder soll ich Ihnen die Leiche erst noch komfortabel heranrücken?«
Lilienthal beugte sich vor. Betrachtete die Mundöffnung. Schief stehende Vorderzähne schimmerten hervor.
»Die Zunge wurde verletzt«, beschied ihn Enderlein barsch.
Lilienthal beugte sich tiefer und registrierte, dass dort, wo sich in der Regel eine rosige, gut durchblutete Zunge befand, nur noch ein Fleischfetzen hing.
»Und zum Schluss …« Enderlein wies auf die linke Brust, die schlaff zur Seite hing und mehrere Stichverletzungen aufwies. »Sieben Stiche, alle mit großer Wucht ausgeführt. Ein klassischer Fall von Übertötung.«
Unterhalb des Brustansatzes ragte nur noch der Knauf des Messers aus dem Brustkorb. Die Klinge steckte tief im Fleisch.
»Ohne vorgreifen zu wollen, würde ich hier von einem gebrauchsüblichen Küchenmesser sprechen.«
Lilienthal nickte und rief einen der Kriminaltechniker heran. Er deutete auf das Messer. »Bitte überprüfen Sie, ob es sich um ein Werkzeug aus der Kantine handelt.« Dann wandte er sich wieder Enderlein zu. »Gibt es weitere Verletzungen?« Lilienthal deutete auf den Unterleib der Frau.
»Keine äußeren Verletzungen sichtbar. Aber Gewissheit gibt es erst nach der Obduktion.« Enderlein richtete sich auf und streckte sich.
Lilienthal starrte auf die Tote. Was war hier passiert? Warum diese Entwürdigung? Entblößt. Verstümmelt. Platziert in einer Maschine. In einer Umgebung, in der der Frauenkörper später von vielen Menschen gesehen werden würde. So viel Grausamkeit, dachte er. »Irgendwelche verwertbaren Spuren?«
Der Rechtsmediziner verschränkte die Arme vor der Brust. »›Schwierig‹ ist noch untertrieben.« Er wies hinüber zu der Großküche, in der sich die Mitarbeiter der Landtagskantine momentan aufhielten. Einige spähten neugierig durch die Trennglasscheiben zu ihnen herüber. »Diese Gastrogeschirrspülanlage hat Unmengen einer aseptischen Spülmittellösung über dem Leichnam ausgebracht, was an sich schon eine Herausforderung für meine Arbeit sein wird, aber zusätzlich wurde heute früh noch eine Phosphorsäurelösung zugeführt.«
»Warum?«, fragte Lilienthal irritiert.
»Warum, warum?«, ahmte Enderlein ihn empört nach. »Die Maschine und somit auch der Körper wurden entkalkt. Industrielle Entkalker enthalten Phosphorsäurelösungen. Ein ätzender Stoff, falls Ihnen die chemischen Grundkenntnisse fehlen. So viel zu verwertbaren Spuren – oder besser: So viel zu nicht mehr verwertbaren Spuren.« Er warf seine Handschuhe in einen Abfallbehälter, griff nach der Tasche, die hinter ihm stand, und nickte Lilienthal kurz zu. »Alles Weitere in meinem Bericht«, nuschelte er und strebte bereits Richtung Ausgang, als sein Handy sich meldete. Er blieb stehen, fummelte es aus seiner Jacke und las die Nachricht. Dann blickte er mürrisch zu Lilienthal. »Also zerreißen kann ich mich auch nicht.«
Lilienthal schaute ihn fragend an.
»Männliche Leiche auf dem Ruinenberg, wird mir gerade gemeldet.« Er stopfte das Gerät hastig zurück und verschwand.
Irritiert sah Lilienthal auf sein iPhone. »Toter im Wasserbecken auf dem Ruinenberg«, las er in Susannes Nachricht. »Bin mit Grewe dorthin unterwegs. Enderlein informiert. Bis später.«
Einer der Kriminaltechniker kam auf Lilienthal zu. »Das haben wir eben im Kühlraum entdeckt«, sagte er und hielt ihm die Plastiktüte eines Lebensmitteldiscounters hin. Lilienthal öffnete sie und zog einen pinkfarbenen Spitzenbüstenhalter mit passendem Slip heraus. Beides war zerrissen. Ganz zuunterst entdeckte er etwas Schwarzes. Er nahm die Kleidungsstücke heraus und hielt sie in die Höhe. Eine schwarze Spitzentunika mit aufgenähten Glitzersteinchen und eine schwarze dünne Leggings mit Spitzenbesatz. »Von der Konfektionsgröße her könnten die Kleidungsstücke vom Opfer stammen«, meinte er mit Blick auf die Leiche. Er gab dem Mann die Sachen zur weiteren Untersuchung zurück.
Kalumet trat neben ihn. »Entschuldigung«, murmelte er. Die Mitarbeiter des Bestattungsinstituts schoben gerade den Deckel über die Plastikwanne und verschlossen sie. »Muss heute früh was Falsches gegessen haben.«
Lilienthal legte ihm die Hand auf den Arm. »Ist schon gut, Leo«, sagte er.
Kalumet nickte dankbar. »Ich habe draußen im Besucherbereich mit Silvio Ragnitz, dem Kantinenchef, gesprochen. Die Tote war eine Mitarbeiterin. Betty Wehner. Sie arbeitete hier seit einigen Jahren als Patissière. War sehr beliebt, nicht nur bei den Kollegen, sondern im ganzen Haus wegen ihrer köstlichen Tartes und Kuchen. Jeden Morgen gab es Madeleines, du weißt doch, diese kleinen französischen Küchlein. Aber hier habe ich noch was.« Er hielt eine schwarze Umhängetasche aus Kunstleder hoch. »Die hat mir Ragnitz übergeben. Die lag in ihrem Spind, zusammen mit einer dunkelroten Steppjacke.«
»Das glaube ich jetzt nicht«, entgegnete Lilienthal gereizt. »Der ganze Arbeitsbereich der Kantine ist ein Tatort. Aber der Herr Kantinenchef setzt sich einfach mal darüber hinweg und nimmt wichtige Beweismittel an sich. Wie großzügig, dass er jetzt damit herausrückt.«
»Habe ich ihm auch gesagt«, erwiderte Kalumet beschwichtigend. »Er hat die Sachen sofort nach dem Fund der Leiche sichergestellt, damit nichts wegkommt, lautete seine Entschuldigung.«
Kalumet griff in die Tasche und legte den Inhalt, ein Portemonnaie, ein Schlüsseltäschchen, eine kleine Kosmetiktasche, eine Tüte mit Hustenbonbons, einen Kamm und mehrere Packungen Papiertaschentücher, neben die Discountertüte mit den Kleidungsstücken auf einen schmalen, hinter ihnen stehenden Tisch.
Lilienthal öffnete das aus weinrotem Leder gefertigte Schlüsseltäschchen und zog fünf Schlüssel heraus. Nachdenklich betrachtete er die vor ihm liegenden Gegenstände. »Wenn es sich bei den Sachen aus der Discountertüte um die Kleidungsstücke des Mordopfers handelt, dann muss sie hier auf ihren Mörder gewartet haben. Sie hat sich fein gemacht für ihn. Sie war arglos, und er hat ihr etwas bedeutet.«
Kalumet fuhr sich mit beiden Händen durch das hellblonde, wellige Haar. »Also weißt du, hier in den Arbeitsräumen ein Rendezvous … Komischer Ort für so was.« Er blickte sich um. »Ich glaube, ich werde in dieser Kantine nie wieder etwas essen können.«
»Aber, aber, Leochen, denk nur an die Wiener Schnitzel. Die sind hier doch erste Sahne, oder?« Ein breites Grinsen zog über Lilienthals Gesicht.
»Hör mir bloß uff, mein Gutester«, entgegnete Kalumet im breitesten Offenbacher Dialekt.
Lilienthal atmete innerlich auf. Dem Kleinen ging es wieder besser. Er musterte die Geschirrspülanlage, in der bis vor Kurzem noch die Leiche gelegen hatte. »Alles an diesem Tatort ist so bizarr, Leo, wie inszeniert. Als wenn jemand vom Eigentlichen ablenken möchte.«
»Und wovon?«
»Laut Enderlein hat der Mörder die Frau gewürgt, ihr siebenmal mit Wucht mit einem großen Küchenmesser in die Brust gestochen und ihre Zunge schwer verletzt«, zählte Lilienthal auf. »Was ist daran das Ungewöhnlichste?«
»Die Zunge.«
»Genau«, sagte Lilienthal. »Dem Verräter wird die Zunge entfernt.«
»Oder er wird gleich ganz zum Schweigen gebracht, Maik.«
5
Lilienthal stand vor einem sechsstöckigen Gebäude aus den siebziger Jahren und schaute auf das Klingeltableau. Zwei Reihen Klingelknöpfe, daneben Namensschilder. Einige überklebt mit Klebeband, auf dem die Namen in Druckbuchstaben, bei manchen in Schreibschrift standen. Das zweite Schild von oben wies den Namen Betty Wehner aus.
»Also, Maik. Gehen wir rein, oder gehen wir rein?«, grummelte Kalumet, der wegen der feuchtkühlen Witterung von einem Bein auf das andere trat.
Die Haustür schwang auf, und eine Duftwolke aus kaltem Tabak, vermischt mit abgestandenem Essen, umhüllte Lilienthal. Gekleidet in eine ausgebeulte Jogginghose in dunkelblauer Farbe, darüber ein giftgrüner Rollkragenpullover und eine rote Baseballkappe, aber die Füße steckten in geputzten, glänzend braunen Lederschuhen, trat ihnen ein Mann in mittleren Jahren entgegen. Farblich risikofreudig, dachte Lilienthal und bemerkte erst jetzt die Hundeleine in der Hand des Mannes.
»Aldi, bei Fuß«, befahl der Hausbewohner mit heiserer Stimme und zog, dass sich die Leine spannte.
Etwas Großes schob sich durch die Tür. Lilienthal trat einen Schritt zurück. Verblüfft blickte er auf das Tier, das eine Kreuzung aus Kalb und Bär zu sein schien. Struppiges braunes Fell bedeckte Kopf und Körper, und mit seinen Bärentatzen tapste es über den Betonboden.
»Wildtierhaltung im Mehrfamilienhaus?«, bemerkte Kalumet süffisant.
Aldi blickte Lilienthal aus Triefaugen an, ging an ihm vorbei, hob ein Bein und strullte wie ein Kamel nach einer Wüstendurchquerung direkt neben die Eingangstür in ein bepflanztes Beet. Der Dompteur hatte sich in der Zwischenzeit eine Zigarette angezündet. Misstrauisch beäugte er sie.
»Zu wem wolln Se denn?«, fragte er und spuckte einen Krümel Tabak aus. Der Hund, der sein Geschäft beendet hatte, kam schnüffelnd auf Lilienthal zu. »Der tut nix«, sagte der Joggingbehoste und aschte ab. »Komm, Aldi, mach Platz.«
Aldi warf sich auf den Weg und begann schmatzend, eine gründliche Reinigung seiner Genitalien vorzunehmen.
»Sehen Sie, der hört aufs Wort«, bemerkte sein Besitzer stolz und tätschelte den Hundekopf. »Aber zu wem wolln Se denn nu?«
»Zu Frau Wehner«, beschied ihn Lilienthal und hielt ihm seinen Dienstausweis hin.
»Pollezei?«, brummte der Mann. Er warf seine halb gerauchte Zigarette auf den Boden, trat sie aus, bückte sich, hob den Stummel auf und verstaute ihn in einer runden Metallschachtel. »Die wohnt unter mir im zweiten Stock. Komm Se wegen dem Krach von vorjestern? Na, wird aba auch Zeit. War ja kaum auszuhalten, dit Jebrülle. Aba jetze is die auf Arbeit.« Er überlegte einen Moment und fügte hinzu: »Vielleicht aba auch nich, wa.«
»Wieso?«, hakte Kalumet nach.
»Na, vielleicht isse krank.« Er kratzte sich am Kopf. »War janz schön was los bei der. Aber als ich jeklingelt hab, hat sie jesacht, bei ihr wär allet in Ordnung. Wer nich will, der hat schon, oder?« Er zuckte mit den Schultern. »Aber nüscht für unjut, Jenaues weiß man nich.« Er grinste, wandte sich um und rief: »Abmarsch, Aldi, gleich jibt’s Eintopf. Vonne Konkurrenz. Anjebot bei Tante Lidl.« Er tippte mit zwei Fingern an die Schläfe und ging gemächlich Richtung Straße, wobei er seinen Riesenköter hinter sich herzog, der alle paar Meter schnüffelnd stehen blieb.
»Krach und Gebrüll«, wiederholte Kalumet und hielt Lilienthal die Eingangstür auf.
Im zweiten Stock befanden sich drei Wohnungstüren. An der linken hing ein Kranz mit getrockneten Herbstblumen und neben dem Klingelknopf ein Schild mit der Aufschrift »B. Wehner«. Lilienthal zog das Schlüsseltäschchen aus seiner Jackentasche. Fünf Schlüssel hingen darin an einem Metallring. Drei Bartschlüssel aus einfachem Material. Der eine schien zu einem Fahrradschloss zu passen, Lilienthal besaß selbst einen ähnlichen. Dann gab es noch einen sehr kleinen Schlüssel. Lilienthal wählte den letzten, einen Flachschlüssel, der auch problemlos in den Schließzylinder passte. Er öffnete die braune Wohnungstür. Kalumet hielt ihm Einmalhandschuhe hin, die er schnell überstreifte. Er vergaß sie häufig, was der Kollege natürlich wusste.
Vor ihnen lag eine quadratische kleine Diele, von der vier Türen abgingen. Der glänzende Fußboden schien mit Laminat belegt zu sein. Lilienthal öffnete die Tür rechts neben dem Eingang. Ein schmales, weiß gekacheltes Bad mit einer Sitzbadewanne. Der Raum war sauber, alle Toilettenartikel standen ordentlich ausgerichtet auf der dazugehörenden Ablage. Die nächste Tür führte in die Küche. Weiße Einbauschränke, vor dem Fenster eine gerüschte Gardine mit roten Herzen darauf. Auf dem Fensterbrett Töpfe mit Kräutern. Auch hier herrschten Ordnung und Sauberkeit.
Kalumet inspizierte den Inhalt der Schränke, während Lilienthal die Tür gegenüber öffnete. Durch eine breite Fensterfront sah er auf einen Balkon. Abgedeckte Gartenmöbel standen in einer Ecke. Die eine Seite des Raumes wurde von einer türkisfarbenen Eckcouch eingenommen. Gegenüber befand sich eine Schrankwand in Weiß mit kombinierten Einsätzen aus Asteiche. Verschiedenfarbige Gläser standen dekorativ in einem Regal. In der Mitte dominierte ein Bildschirm, der die gesamte Breite des halbhohen Sideboards einnahm. Links ein Schrankteil mit zwei Türen. Lilienthal öffnete sie.