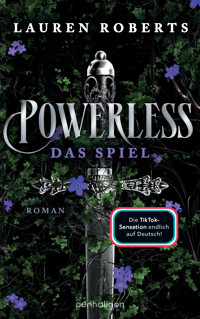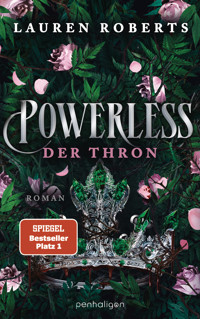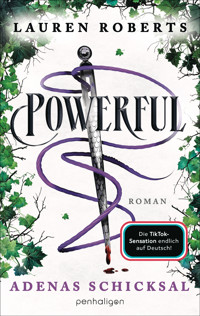13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Powerless-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ich bin keine Geliebte. Ich bin dein Untergang – Band 2 der Romantasy-Trilogie von TikTok-Star Lauren Roberts endlich auf Deutsch!
Nachdem ein Hinterhalt den Säuberungsspielen ein vorzeitiges Ende bereitet hat, versinkt das Reich Ilya im Chaos. Paedyn – nunmehr ein Symbol des Widerstands gegen die mächtigen Eliten – gelingt die Flucht in die ferne Stadt Dor. Doch jemand ist ihr auf den Fersen. Prinz Kai wurde beauftragt, Paedyn zu finden und aus dem Weg zu räumen. Aber kann er die Frau, für die sein Herz schlägt, wirklich töten? Und kann er in Dor, der Stadt der Rebellen und dem Ort, wo es keine Magie zu geben scheint, überleben?
Noch nie war der Enemies-to-Lovers-Trope mitreißender! Die große Romantasy-Saga von TikTok-Star Lauren Roberts endlich auf Deutsch!
Die Romane aus dem Powerless-Universum:
Band 1: Powerless – Das Spiel
Band 2: Powerless – Die Flucht
Band 3: Powerless – Der Thron
Novelle: Powerful – Adenas Schicksal
Novelle: Fearful – Kitts Schicksal
Enthaltene Tropes: Enemies to Lovers
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Nachdem ein Hinterhalt den Säuberungsspielen ein vorzeitiges Ende bereitet hat, versinkt das Reich Ilya im Chaos. Paedyn – nunmehr ein Symbol des Widerstands gegen die mächtigen Eliten – gelingt die Flucht in die ferne Stadt Dor. Doch jemand ist ihr auf den Fersen. Prinz Kai wurde beauftragt, Paedyn zu finden und aus dem Weg zu räumen. Aber kann er die Frau, für die sein Herz schlägt, wirklich töten? Und kann er in Dor, der Stadt der Rebellen und dem Ort, wo es keine Magie zu geben scheint, überleben?
Autorin
Lauren Roberts hat ihr ganzes Leben in Michigan, USA, verbracht. Wenn sie nicht gerade über fantastische Welten und liebenswerte Charaktere schreibt, findet man sie eingekuschelt im Bett und mit einem Fantasy-Roman in der Hand – oder auf TikTok, wo sie als @Laurens1ibrary ihre Liebe zu Büchern mit ihren fast 400.000 Follower*innen teilt. »Powerless – Das Spiel« ist Lauren Roberts Debüt und stellt den Auftakt einer mitreißenden Romantasy-Trilogie dar. Der Roman eroberte auf Anhieb die »New York Times«-Bestsellerliste und traf mitten ins Herz der Leser*innen.
Weitere Informationen unter: www.laurenrobertslibrary.com,
www.tiktok.com/@laurens1ibrary
Von Lauren Roberts bereits erschienen
Powerless – Das Spiel
Lauren Roberts
POWERLESS
DIE FLUCHT
Roman
Deutsch von Vanessa Lamatsch
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »Reckless« bei Simon & Schuster UK Ltd, London.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright der Originalausgabe © 2024 by Lauren Roberts
POWERLESS is a trademark of Lauren’s Library LLC
Published by arrangement with Simon & Schuster UK Ltd
1st Floor, 222 Gray’s Inn Road, London, WC1X 8HB
A Paramount Company
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Penhaligon
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Catherine Beck
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
nach einer Originalvorlage von Simon and Schuster UK
Umschlagillustration: Bob Lea
Karte: © Jojo Elliott
Stammbaum: © Jojo Elliott
DK · Herstellung: fe
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-31721-8V002
www.penhaligon-verlag.de
Für die mutigen Seelen, die es wagen,
zu lieben und geliebt zu werden.
Prolog
Kai
Die Flure sind um diese Uhrzeit unheimlich leer.
Wie jedes Jahr.
Ich lasse mir Zeit damit, durch die Burg zu wandern, gönne mir diese kurzen Momente des Friedens. Auch wenn gestohlenes Glück kaum mehr ist als in Schach gehaltenes inneres Chaos.
Ich entscheide mich, diesen Gedanken zu ignorieren, als ich in einen weiteren dunklen Flur abbiege; meine Schritte leise auf dem smaragdgrünen Teppich. Eine schlafende Burg ist beruhigend. Einsamkeit für die königliche Familie eine Seltenheit.
Königlich.
Fast hätte ich gelacht. Ich vergesse regelmäßig, was ich war, bevor ich geworden bin, was ich bin. Ich war Prinz, bevor ich Vollstrecker wurde. Ein Junge, bevor ich ein Monster wurde.
Aber heute bin ich niemand. Heute bin ich lediglich, wer ich hätte sein sollen.
Dämmriges Licht dringt unter den Türen zur Küche heraus. Der Anblick ermöglicht es mir, leise zu lächeln.
Jedes Jahr. Sie ist jedes Jahr hier.
Sanft schiebe ich die Türflügel auf und trete in die Lichtpfütze mehrerer flackernder Kerzen. Der Duft von süßem Teig und Zimt hängt in der Luft, erfüllt mich mit Wärme und Erinnerungen.
»Du stehst jedes Jahr früher auf.«
Ich quittiere Gails Lächeln mit einem leisen Heben meiner Mundwinkel. Auf ihrer Schürze klebt Zimt, Mehl färbt ihre Wangen. Ich hüpfe auf dieselbe Arbeitsplatte, auf der ich gesessen habe, seit ich groß genug war, den Rand zu erreichen – meine vernarbten Hände hinter mir auf den klebrigen Tresen aufgestützt.
Die Normalität der Situation tröstet mich.
Ich lächele die Frau an, die mich quasi großgezogen hat, und hebe eine Schulter zu einem lässigen Achselzucken. »Ich schlafe jedes Jahr weniger.«
Die Art, wie sie die Hände in die Hüften stemmt, verrät mir, dass sie gegen den Drang ankämpft, mich zu schelten. »Du bereitest mir Sorgen, Kai.«
»Wann habe ich das jemals nicht getan?«, frage ich locker.
»Ich meine es ernst.« Sie wedelt mit der Hand vor mir herum, die Geste schließt meinen gesamten Körper ein. »Du bist zu jung, um dich mit all dem herumzuschlagen. Es scheint erst gestern gewesen zu sein, dass du durch meine Küche gerannt bist. Du und Kitt …«
Bei der Erwähnung seines Namens verklingt ihre Stimme, sodass ich gezwungen bin, das ersterbende Gespräch wiederzubeleben. »Tatsächlich komme ich aus Vaters …« – ich verstumme lang genug, um durch die Nase zu seufzen – »… Kitts Arbeitszimmer.«
Gail nickt langsam. »Er hat diesen Raum seit der Krönung nicht verlassen, oder?«
»Nein, hat er nicht. Und ich war auch nicht lange drin.« Ich fahre mir durch mein zerzaustes Haar. »Er hat mir lediglich meine erste Mission übertragen.«
Sie schweigt einen langen Moment. »Sie ist es, oder?«
Ich nicke. »Sie ist es.«
»Und wirst du …?«
»… die Mission ausführen? Tun, wie mir befohlen wurde?«, beende ich den Satz für sie. »Natürlich. Das ist meine Pflicht.«
Ein weiterer Moment der Stille. »Und hat er daran gedacht, was für ein Tag heute ist?«
Ich hebe langsam den Kopf und lächele traurig, als ich ihren Blick einfange. »Es ist nicht seine Aufgabe, sich zu erinnern.«
»Richtig«, seufzt sie. »Nun, ich habe dieses Jahr sowieso nur eines gemacht. Habe mir schon gedacht, dass er es nicht schaffen wird, sich dir anzuschließen.«
Sie tritt zur Seite und gibt so den Blick frei auf ein klebriges süßes Brötchen neben dem Ofen. Ich rutsche von der Arbeitsplatte und gehe lächelnd zu ihr. Erst nachdem ich ihr einen Kuss auf die Wange gedrückt habe, reicht sie mir den Teller.
»Und jetzt verschwinde«, drängt sie. »Verbring ein bisschen Zeit mit ihr.«
»Danke dir, Gail«, sage ich sanft. »Für jedes Jahr.«
»Und alle, die noch kommen.« Sie zwinkert mir zu, bevor sie mich zur Tür schiebt.
Ich sehe zu ihr zurück, zu dieser Frau, die mir eine Mutter war, als die Königin es nicht sein konnte. Gail war der Inbegriff von warmen Umarmungen, wohlverdienter Schelte und heiß begehrter Anerkennung.
Ich will mir nicht ausmalen, wo die Azer-Brüder ohne sie wären.
»Kai?«
Ich halte im Türrahmen an und drehe mich zu ihr um.
»Wir haben sie alle geliebt«, sagt sie leise.
»Ich weiß.« Ich nicke. »Sie wusste es auch.«
Und dann tragen mich meine Füße in den dunklen Flur jenseits der Küche.
Das Honigbrötchen auf dem Teller duftet verlockend, nach Zimt und Zucker und einfacheren Zeiten. Doch ich zwinge mich dazu, mich auf den vertrauten Weg in den Garten zu konzentrieren – den Weg, den ich jedes Jahr von der Küche aus gehe.
Es dauert nicht lange, bis ich die breiten Doppeltüren erreiche, die mich von den Gärten dahinter trennen. Ich schenke den Imperialen keine Beachtung, die dort Wache stehen … und auch nicht denjenigen, die nutzlos neben ihnen dösen. Die wenigen, die tatsächlich wach sind, geben vor, das süße Brötchen nicht zu bemerken, das ich mit mir in die Dunkelheit trage.
Ich folge dem Steinpfad, der zwischen Reihen von farbenfrohen Blüten hindurchführt, die ich momentan kaum erkennen kann. Mit Efeu überwucherte Statuen stehen im Garten verteilt, mehrere davon mit abgesplitterten Stellen, weil sie einmal zu oft umgestürzt sind – Vorfälle, mit denen ich natürlich gar nichts zu tun hatte. In der Mitte des Ganzen plätschert der Brunnen und erinnert mich an schwüle Tage und verständliche Dummheit, die Kitt und mich dazu gebracht hat, in das Becken zu springen.
Aber ich bin hier, um etwas hinter dem Garten zu besuchen.
Ich trete auf die Rasenfläche, die für den zweiten Ball der Säuberungsspiele mit Teppichen abgedeckt war. Erlaube mir nicht, an diese Nacht zurückzudenken. Ich folge dem Mondlicht, das in fahlen Streifen ihre Umrisse erhellt.
Die Trauerweide wirkt gespenstisch verführerisch, wie sie so in der leichten Brise raschelt. Ich lasse den Blick über die hängenden Äste gleiten, über jede Wurzel, die aus der Erde ragt. Jeder Zentimeter ist schön und stark.
Ich schiebe mich durch den Vorhang aus Blättern, um unter den Baum zu treten, den ich so oft besuche, wie mein Leben es eben zulässt – aber an diesem bestimmten Tag immer mit einem Honigbrötchen in der Hand. Ich lasse die Finger über die raue Rinde des Stamms gleiten, folge den vertrauten Furchen darin.
Es dauert nicht lang, bis ich auf meinem üblichen Platz unter dem hoch aufragenden Baum sitze und einen Arm auf meine angezogenen Knie stemme. Ich positioniere den Teller auf eine besonders breite Wurzel, dann ziehe ich eine kleine Streichholzschachtel aus der Tasche.
»Dieses Jahr konnte ich keine Kerze finden, tut mir leid.« Ich entzünde das Streichholz und starre die kleine, flackernde Flamme an der Spitze an. Einen Moment lang beobachte ich, wie sie brennt; beobachte, wie das schwache Licht über den riesigen Baum huscht.
Dann senke ich den Blick und streiche mit der Hand über das weiche Gras neben mir.
»Alles Gute zum Geburtstag, A.«
Ich puste die improvisierte Kerze aus und lasse zu, dass die Dunkelheit uns verschlingt.
1
Paedyn
Mein Blut ist nur nützlich, wenn ich dafür sorgen kann, dass es in meinem Körper verbleibt.
Mein Verstand ist nur nützlich, wenn ich es schaffe, ihn nicht zu verlieren.
Mein Herz ist nur nützlich, wenn ich es davon abhalten kann zu brechen.
Nun, anscheinend bin ich dann vollkommen nutzlos geworden.
Mein Blick huscht über die Dielenbretter unter meinen Füßen, gleitet über den abgetretenen Boden. Allein der vertraute Anblick lässt Erinnerungen in mir aufsteigen. Ich kämpfe darum, die Bilder von kleinen Füßen auf großen abzuschütteln, die sich zu einer vertrauten Melodie bewegen. Ich schüttele den Kopf, um die Erinnerung zu vertreiben, obwohl ich mir nichts mehr wünsche, als in der Vergangenheit zu verweilen, da meine Gegenwart momentan nicht allzu angenehm ist.
… sechzehn, siebzehn, achtzehn …
Ich lächele, ohne den Schmerz zu beachten, der dabei durch mein Gesicht schießt.
Hab dich gefunden.
Ich bewege mich mit unsicheren, steifen Schritten. Wunde Muskeln protestieren, während ich mich dem scheinbar gewöhnlichen Dielenbrett nähere. Ich lasse mich auf die Knie sinken, beiße die Zähne gegen den Schmerz zusammen und kratze mit scharlachrot verfärbten Fingern über den Boden. Auch diese Färbung versuche ich zu ignorieren.
Der Boden scheint genauso stur zu sein wie ich, weil er sich weigert nachzugeben. Ich hätte seine Widerstandskraft bewundert, ginge es hier nicht um ein verdammtes Stück Holz.
Mir fehlt die Zeit für so was. Ich muss hier verschwinden.
Ein frustriertes Geräusch entkommt meiner Kehle, dann blinzele ich auf die Diele hinunter und stoße hervor: »Ich hätte schwören können, dass du das Geheimfach bist. Bist du nicht das neunzehnte Brett von der Tür?«
Ich starre das Holz böse an, bevor ich ein hysterisches Lachen ausstoße, zur Decke starre und verzweifelt den Kopf schüttele. »Seuchen, jetzt rede ich schon mit dem Boden«, murmele ich. Ein weiterer Beweis, dass ich langsam den Verstand verliere.
Allerdings ist es ja nicht so, als hätte ich jemand anderen, mit dem ich reden könnte.
Vier Tage sind vergangen, seit ich wieder in das Heim meiner Kindheit gestolpert bin, gequält und halb tot. Und doch haben sich weder mein Geist noch mein Körper wirklich erholt.
Ich mag dem Tod durch das Schwert des Königs entkommen sein, aber es ist ihm trotzdem gelungen, am Tag der letzten Herausforderung einen Teil von mir umzubringen. Seine Worte haben mich tiefer getroffen, als es seiner Klinge jemals möglich gewesen wäre. Sie haben mich mit der scharfen Wahrheit verletzt, als er mit mir gespielt hat; mir mit einem Lächeln auf den Lippen vom Tod meines Vaters erzählt hat.
»Willst du nicht wissen, wer deinen Vater wirklich getötet hat?«
Mir läuft ein kalter Schauder über den Rücken, während die kalte Stimme des Königs in meinem Kopf widerhallt.
»Lass uns einfach sagen, dass deine erste Begegnung mit dem Prinzen nicht stattgefunden hat, als du Kai in dieser Gasse gerettet hast.«
Wäre Verrat eine Waffe, hat er mich an diesem Tag damit angegriffen. Er hat eine stumpfe Klinge in mein gebrochenes Herz gestoßen. Zitternd stoße ich die Luft aus, verdränge die Gedanken an den Jungen mit den grauen Augen, so stechend wie das Schwert, das er vor so vielen Jahren meinem Vater in die Brust gerammt hat.
Ich kämpfe mich auf die Beine, verlagere mein Gewicht und lausche auf ein verräterisches Knirschen, während ich den silbernen Ring am Daumen drehe. Mein gesamter Körper schmerzt. Selbst meine Knochen fühlen sich zerbrechlich an. Ich habe die Wunden, die ich in der letzten Herausforderung und meinem Kampf gegen den König davongetragen habe, notdürftig versorgt, mit zitternden Fingern und geschüttelt von lautlosem Schluchzen, das mir den Blick vernebelt hat, sodass die Nähte grob sind.
Nachdem ich von der Schüssel-Arena in Richtung Beuteallee gehumpelt bin, bin ich in das weiße Häuschen gestolpert, das ich einst mein Zuhause und der Widerstand sein Hauptquartier genannt hat. Aber ich habe nur Leere gefunden. Es warteten keine vertrauten Gesichter in dem geheimen Raum unter meinen Füßen, sodass ich mit nichts zurückblieb als Schmerz und Verwirrung.
Ich war allein – bin allein damit geblieben, das Chaos aufzuräumen, das mein Körper, mein Hirn, mein blutendes Herz ist.
Holz knirscht. Ich grinse.
Wieder sinke ich auf die Knie. Ich hebe die Diele an und enthülle damit ein schattenverhülltes Fach, schüttele den Kopf und murmele: »Es ist das neunzehnte Brett vom Fenster aus, nicht von der Tür, Pae …«
Ich greife in die Dunkelheit. Meine Finger schließen sich um das unvertraute Heft eines Dolchs. Mein Herz schmerzt mehr als mein Körper, weil ich mich so sehr danach sehne, den verzierten Stahlgriff des Messers meines Vaters unter der Handfläche zu spüren.
Aber ich habe meinen Blutdurst über meine Vernunft gestellt, als ich meinen geliebten Dolch auf die Kehle des Königs geschleudert habe. Und ich bereue nur, dass er die Klinge gefunden hat; mir versprochen hat, sie mir nur zurückzugeben, indem er sie mir in den Rücken rammt.
Leere blaue Augen blinzeln in der Reflexion auf der glänzenden Klinge, die ich ins Licht ziehe; überraschen mich genug, um mich aus meinen hasserfüllten Gedanken zu reißen. Meine Haut ist von Wunden und Schnitten überzogen. Als das Spiegelbild mir den tiefen Schnitt über meinen Hals nach unten zeigt, schlucke ich schwer. Mit zitternden Fingern betaste ich die Wunde. Dann lasse ich den Dolch kopfschüttelnd in meinen Stiefel gleiten, um damit auch mein Spiegelbild zu tilgen.
In dem Fach entdecke ich auch noch einen Bogen und einen gefüllten Köcher. Ein trauriges Lächeln verzieht meine Lippen, als ich mich daran erinnere, wie Vater mir das Schießen beigebracht hat, mit dem Baum hinter dem Haus als einzige Zielscheibe.
Ich hänge mir Bogen und Köcher auf den Rücken und sortiere die anderen Waffen, die sich unter den Dielen verbergen. Nachdem ich noch ein paar scharfe Wurfmesser in meinen Rucksack geworfen habe – wo sie sich zu den Essensrationen und den Feldflaschen gesellen, die ich hastig darin verstaut habe –, stemme ich mich wieder auf die Beine.
Noch nie habe ich mich so zerbrechlich, so lädiert gefühlt. Der Gedanke lässt Wut in mir aufflackern, sorgt dafür, dass ich das Messer aus dem Stiefel ziehe und gegen den Drang kämpfen muss, damit auf den Boden einzustechen. Brennender Schmerz schießt durch meinen Arm, weil sich die Wunde über meinem Herzen bei der Bewegung spannt.
Eine Erinnerung. Ein Symbol dessen, was ich bin. Oder vielmehr dessen, was ich nicht bin.
G für Gewöhnliche.
Mit zusammengebissenen Zähnen werfe ich das Messer, sodass es sich tief in die Wand gräbt. Die halb vernarbte Wunde brennt, verkündet spöttisch, dass sie für immer Teil meines Körpers sein wird.
»Dann werde ich mein Mal über deinem Herzen hinterlassen, falls du je vergessen solltest, wer es gebrochen hat.«
Ich stapfe zu der Klinge, bereit, sie aus der Wand zu reißen, als ein Knirschen unter meinen Füßen meine Aufmerksamkeit erregt. Obwohl ich weiß, dass knarrende Dielen in Häusern in den Slums nichts Besonderes sind, beuge ich mich vor, um nachzusehen.
Wenn jedes knirschende Dielenbrett ein Geheimversteck wäre, wäre der Boden davon durchzogen …
Das Brett hebt sich, und meine Augenbrauen folgen, weil ich sie entsetzt nach oben ziehe. Als ich die Hand in die Dunkelheit des Fachs schiebe, von dessen Existenz ich nichts wusste, schnaube ich humorlos.
Wie dumm von mir zu glauben, Vater hätte nur den Widerstand vor mir verheimlicht.
Meine Finger berühren abgegriffenes Leder, dann ziehe ich ein großes Buch aus dem Fach, vollgestopft mit zusätzlichen Papieren, die herauszufallen drohen. Ich blättere durch die Seiten und erkenne sofort die unleserliche Schrift eines Heilers.
Vaters Tagebuch.
Ich stopfe es in meine Tasche, weil ich weiß, dass mir momentan die Zeit und die Sicherheit fehlen, seine Worte zu studieren. Ich habe mich schon zu lange hier aufgehalten, habe zu viele Tage verwundet und schwach hier verbracht, ständig in Sorge, ich könnte entdeckt werden.
Die Senderin, die beobachtet hat, wie ich den König ermordet habe, hat die Bilder wahrscheinlich im ganzen Königreich gezeigt. Ich muss aus Ilya verschwinden und habe den Vorsprung, den er mir so großmütig eingeräumt hat, bereits verschwendet.
Ich gehe zur Tür, bereit, durch den Spalt zu gleiten und auf die Straße zu treten, wo ich im Chaos von Beute verschwinden kann. Von dort aus kann ich versuchen, durch die Sengende Wüste die Stadt Dor zu erreichen, wo es keine Eliten gibt und sie nur Gewöhnliche kennen.
Ich strecke die Hand nach der Türklinke aus, um auf die ruhige Gasse davor zu treten …
Und erstarre.
Ruhe.
Es ist fast Mittag, was bedeutet, dass die Beuteallee und die umliegenden Straßen gefüllt sein sollten mit Händlern und kreischenden Kindern. Der Slum sollte brummen vor Geschäftigkeit.
Irgendetwas stimmt nicht …
Die Tür bebt, weil etwas – jemand – von außen dagegenrammt. Ich springe zurück, sehe mich verzweifelt um. Ich erwäge, über die Geheimtreppe in den Raum zu fliehen, in dem die Sitzungen des Widerstands abgehalten wurden. Aber bei dem Gedanken, dort unten in die Enge getrieben zu werden, wird mir schlecht. Meine Augen saugen sich am Kamin fest, und trotz der Situation seufze ich genervt.
Wieso lande ich ständig in Kaminen?
Noch bevor ich die Hälfte des rußgeschwärzten Schornsteins erklommen habe, meine Füße an die gegenüberliegende Wand gepresst, Ziegel in meinem Rücken, fliegt die Tür mit einem Knall auf.
Ein Bulle.
Nur eine Elite mit außergewöhnlicher Stärke wäre fähig, eine verschlossene und verriegelte Tür so schnell aufzubrechen. Das Geräusch schwerer Schritte verrät mir, dass gerade fünf Imperiale mein Heim betreten haben.
»Steht nicht einfach nur rum. Durchsucht das Haus und überzeugt mich von eurer Nützlichkeit.«
Beim Klang dieser kühlen Stimme zucke ich zusammen – dieser Stimme, die in meiner Nähe schon zärtlich und befehlend klang. Ich versteife mich, rutsche ein Stück an der dreckigen Wand nach unten.
Er ist hier.
Als Nächstes erklingt die raue Stimme eines Imperialen. »Ihr habt den Vollstrecker gehört. Kommt in die Gänge.«
Der Vollstrecker.
Ich beiße mir auf die Zunge, auch wenn ich nicht weiß, ob ich damit ein bitteres Lachen oder einen Schrei zurückhalten will. Mein Blut kocht bei dem Titel, weil er mich an alles erinnert, was er getan hat. An jede Grausamkeit erinnert, die er im Schatten des Königs verübt hat. Zuerst für seinen Vater und jetzt für seinen Bruder – dank der Tatsache, dass ich ihn von seinem Vater befreit habe.
Nur dass er mir nicht dankt. Nein, stattdessen ist er gekommen, um mich zu töten.
»Vielleicht finde ich meinen Mut, wenn ich dich nicht mehr sehe. Also werde ich dir einen Vorsprung einräumen.«
Dieser Vorsprung hat mir nicht geholfen.
Ich kann nicht riskieren, dass meine Bewegungen im Kamin gehört werden, also warte ich. Ich lausche auf die schweren Schritte, die auf der Suche nach mir durchs Haus poltern. Meine Beine beginnen zu zittern, weil es so anstrengend ist, meine Position zu halten. All meine Wunden protestieren schmerzhaft.
»Kontrolliert die Regale im Arbeitszimmer. Dort sollte es einen Geheimgang geben«, befiehlt der Vollstrecker. Er klingt gelangweilt.
Wieder einmal zucke ich zusammen. Ein Mitglied des Widerstands muss dieses kleine Detail unter Folter preisgegeben haben. Mein Puls beschleunigt sich beim Gedanken an den Kampf, der nach der letzten Herausforderung in der Schüssel ausgebrochen ist, in der blutigen Schlacht zwischen Gewöhnlichen, Fatalen und Imperialen.
Eine blutige Schlacht, von der ich immer noch nicht weiß, wie sie ausgegangen ist.
Die Schritte der Imperialen entfernen sich, und die Geräusche ihrer Suche werden leiser, während sie über die Treppe in den Raum unter dem Haus vordringen.
Stille.
Und doch weiß ich, dass er sich immer noch im Zimmer aufhält. Nur wenige Schritte trennen uns. Ich kann seine Gegenwart förmlich fühlen, so wie ich seine Körperwärme auf der Haut gespürt habe, die Hitze seines grauen Blicks.
Eine Diele knirscht. Er ist nahe. Ich zittere vor Wut. Rachedurst lässt mein Blut kochen und erfüllt mich mit dem verzweifelten Wunsch, sein Blut zu vergießen. Nur gut, dass ich sein Gesicht nicht sehen kann – denn wenn ich in diesem Moment seine dämlichen Grübchen erblicken würde, könnte ich mich wahrscheinlich nicht davon abhalten, sie ihm aus dem Gesicht zu kratzen.
Stattdessen atme ich so ruhig wie möglich, weil ich weiß, dass bei einem Kampf meine Wut allein nicht ausreichen würde, um ihn zu besiegen. Und ich habe vor zu siegen, wenn ich mich dem Vollstrecker endlich stelle.
»Ich vermute, du hast dir mein Gesicht vorgestellt, als du diesen Dolch geschleudert hast.« Er spricht leise, nachdenklich, klingt fast wie der Junge, den ich kannte. Erinnerungen steigen in mir auf, sorgen dafür, dass mein Herz rast. »Nicht wahr, Paedyn?« Und da ist es. Die Härte ist zurück in der Stimme des Vollstreckers, vertreibt Kai und lässt einen Befehlshaber zurück.
Mein Herz schlägt wie wild gegen meine Rippen.
Er kann nicht wissen, dass ich hier bin. Wie sollte er …
Das Geräusch von Metall, das aus Stein gezogen wird, verrät mir, dass er mein Messer aus der Wand gerissen hat. Ich höre ein vertrautes Klatschen und sehe förmlich vor mir, wie er die Klinge gedankenverloren in der Hand herumwirbeln lässt.
»Sag mir, Schatz, denkst du oft an mich?«
Seine Stimme ist ein Murmeln, als schwebten seine Lippen direkt neben meinem Ohr. Ich zittere, weil ich genau weiß, wie sich das anfühlt.
Wenn er weiß, dass ich hier bin, wieso hat er nicht …
»Suche ich dich in deinen Träumen heim, martere ich deine Gedanken, wie du es bei mir tust?«
Mein Atem stockt.
Also weiß er nicht, dass ich hier bin. Zumindest nicht sicher.
Das hat mir dieses Eingeständnis verraten.
Als Gewöhnliche, die dazu ausgebildet wurde, sich als Seherin auszugeben, hat mein Vater mir beigebracht, Menschen zu lesen – innerhalb von Sekunden Informationen aus Beobachtungen zu ziehen.
Und ich hatte viel mehr Zeit als nur Sekunden, um Kai Azer zu studieren.
Ich habe hinter seine vielen Masken und Fassaden geschaut, habe Blicke auf den Jungen darunter erhascht, habe ihn kennengelernt. Er ist mir ans Herz gewachsen. Und da wir inzwischen durch Verrat getrennt sind, weiß ich, dass er niemals zugegeben hätte, von mir zu träumen, wenn er wüsste, dass ich jedes Wort hören kann.
Ich höre einen Anflug von Humor in seiner Stimme, als er seufzend sagt: »Wo bist du, kleine Seherin?«
Der Spitzname ist lächerlich, weil er und der Rest des Königreichs inzwischen wissen, dass ich alles andere bin. Alles andere als eine Elite.
Nur eine Gewöhnliche.
Ruß brennt in meiner Nase. Ich muss die Hand vors Gesicht schlagen, um ein Niesen zu unterdrücken, was mich an die vielen Nächte erinnert, die ich damit verbracht habe, die Läden an der Beuteallee auszuräumen und durch die Kamine zu verschwinden.
Erstickende Enge. Ich sitze in der Falle.
Mein Blick huscht über die schattigen Ziegelwände um mich herum. Dieser Schornstein ist so eng, so stickig. Wie leicht wäre es, in Panik zu verfallen.
Beruhig dich.
Meine Klaustrophobie wählt den schlechtesten Moment, um aufzusteigen und mich an meine Hilflosigkeit zu erinnern.
Atme.
Das tue ich. Ich atme tief durch. Die Hand vor meinem Gesicht riecht leicht nach Metall – ein scharfer Geruch, der in meiner Nase brennt.
Blut.
Zitternd hebe ich die Hand. Und auch wenn ich das Rot an meinen Fingern nicht sehen kann, fühle ich doch, wie es meine Haut verunziert. Es klebt immer noch Blut unter meinen eingerissenen Fingernägeln. Und ich weiß nicht, ob es mein eigenes ist oder das des Königs oder …
Ich schnappe nach Luft, bemüht, mich zusammenzureißen. Der Vollstrecker hält sich ganz in meiner Nähe auf. Holzdielen stöhnen unter seinen Schritten.
Erwischt zu werden, weil ich angefangen habe zu schluchzen, wäre genauso peinlich, wie mich durch ein Niesen zu verraten.
Ich weigere mich, sowohl das eine als auch das andere zu tun.
Irgendwann stürmen die Imperialen zurück in den Raum unter mir. »Kein Hinweis auf sie, Eure Hoheit.«
Es folgt ein langer Moment der Stille, bevor Seine Hoheit seufzt. »Wie ich mir schon gedacht habe. Ihr seid alle nutzlos.« Seine nächsten Worte sind schärfer als die Klinge, die er so beiläufig in der Hand herumwirbeln lässt. »Verschwindet hier.«
Die Imperialen zögern keine Sekunde. Sie eilen zur Tür, entfernen sich schnellstmöglich von ihm. Ich kann es ihnen nicht übel nehmen.
Aber er ist immer noch da. Schweigen breitet sich aus. Ich muss mir schon wieder die Hand vor die Nase schlagen, und der Geruch von Blut, kombiniert mit der Enge des Kamins, vernebelt mir die Sinne.
Erinnerungen steigen in mir auf – mein Körper, überzogen von Blut. Meine Schreie, als ich versucht habe, es abzuwischen, nur um damit meine gesamte Haut kränklich rot zu färben. Der Anblick von so viel Blut, der Geruch, sorgt dafür, dass mir schlecht wird; lässt mich an meinen Vater denken, der in meinen Armen verblutet; lässt mich daran denken, wie Adena dasselbe getan hat.
Adena.
Tränen brennen in meinen Augen. Ich muss gegen Bilder ihres leblosen Körpers auf dem Sand der Grube anblinzeln. Erneut steigt mir der metallische Geruch von Blut in die Nase, und ich kann es nicht ertragen. Kann es nicht ertragen, das Blut zu sehen, es zu spüren …
Atme.
Ein schweres Seufzen reißt mich aus meinen Gedanken. Es klingt so erschöpft, wie ich mich fühle. »Es ist gut, dass du nicht hier bist«, sagt er sanft. Ich hätte nie geglaubt, dass ich diesen Tonfall noch einmal in seiner Stimme hören würde. »Weil ich meinen Mut immer noch nicht gefunden habe.«
Und dann geht mein Haus in Flammen auf.
2
Kai
Flammen lecken an meinen Stiefeln, während ich gemächlich zur Tür schlendere.
Hitzewellen branden gegen meinen Rücken; Rauch kriecht in meine Kleidung. Ich trete in den wolkenverhangenen Nachmittag, der jetzt dank der Rauchschwaden, die zum Himmel aufsteigen, noch grauer wirkt.
Als ich den Schock in den Gesichtern der Imperialen bemerke, zucken meine Mundwinkel. Sie bemühen sich, ihre hängenden Kiefer unter Kontrolle zu bekommen, als Feuer das Haus hinter mir verschlingt. Ihre Blicke huschen an mir nach oben bis zu meinem Kragen, dann verlagern die Männer nervös ihr Gewicht.
Als ich lässig auf sie zugehe, erstarren sie.
Sie glauben, ich wäre wahnsinnig geworden.
Als ein Fenster hinter mir zerbirst und scharfe Scherben auf die Straße fliegen, zerreißt ein Klirren die Luft. Die Imperialen zucken zusammen, schlagen die Hände vor die Gesichter. Der Anblick erheitert mich.
Vielleicht haben sie recht. Vielleicht bin ich wahnsinnig geworden.
Wahnsinnig vor Sorge, vor Wut. Aufgrund von Verrat.
Die Anspannung, die meinen Körper ständig erfüllt, meine Schultern versteift und meinen Kiefer verspannt, scheint die einzige Konstante in meinem Leben zu sein. Meine Finger trommeln auf den Dolch an meiner Hüfte. Ich bin in Versuchung, meinen Frust an einem der vielen nutzlosen Imperialen auszulassen.
Ich lasse die Fingerspitze über die aufwendigen Verzierungen am Heft der Klinge gleiten, das Muster vertraut. Wie könnte ich den Dolch vergessen, der so oft gegen meine Kehle gepresst wurde?
Wie könnte ich den Dolch vergessen, den ich aus der aufgeschlitzten Kehle meines Vaters gezogen habe?
Es ist fünf Tage her, dass ich das Heft genau dieser Waffe im Hals des Königs entdeckt habe. Ich hatte fünf Tage Zeit, um zu trauern … und doch habe ich keine einzige Träne vergossen. Fünf Tage, um mich zu wappnen, aber kein Plan wird mich jemals wirklich von ihr befreien. Fünf Tage, in denen wir einfach Kitt und Kai waren – Brüder –, bevor wir zu König und Vollstrecker geworden sind.
Aber jetzt ist die Schonzeit für sie abgelaufen.
Allerdings hat sie ihren Vorsprung offenbar klug genutzt – hat meine Schwäche, meine Feigheit, meine Gefühle für sie ausgenutzt – und ist geflohen. Ich wirbele zu den Flammen herum, beobachte, wie das farbenfrohe Chaos ihr Heim verschlingt, in einer Mischung aus Rot, Orange, dichtem schwarzem Rauch und …
Silber.
Ich blinzele, spähe mit zusammengekniffenen Augen durch den Rauch zum einstürzenden Dach auf. Aber da ist nichts. Kein Hinweis auf den Schimmer, den ich gerade bemerkt hatte. Ich fahre mir durchs Haar, dann reibe ich mir die müden Augen.
Ja, ich bin wirklich dem Wahnsinn verfallen.
»Sir!«
Ich senke die Hände, richte langsam den Blick auf den Imperialen, der mutig genug war, in meine Richtung zu rufen. Er räuspert sich, offenbar bereits von Reue über seine Entscheidung gepackt. »Ich, ähm, ich glaube, ich habe etwas gesehen, Eure Hoheit.«
Er deutet auf das brennende Dach. Der Rauch wabert, und ich erkenne eine Gestalt, die durch die Flammen stolpert. Eine Gestalt mit silbernem Haar.
Also ist sie hier.
Ich scheine nicht entscheiden zu können, ob ich erleichtert bin oder nicht.
»Bringt sie zu mir.«
Mein Befehl hallt durch die Luft, die Imperialen zögern keine Sekunde. Und offensichtlich gilt dasselbe für sie. Ich erhasche nur einen flüchtigen Blick auf ihre Gestalt, als sie vom Rand des brechenden Dachs auf das Nebengebäude springt und sofort weiterläuft, sobald sie Halt gefunden hat.
Imperiale eilen unter ihr die Straße entlang, Bullen und Schilde. Vollkommen nutzlos, während sie von Dach zu Dach springt. Ich fahre mir erneut durchs Haar, bevor ich mir das Gesicht reibe. Die Inkompetenz der Wachmänner überrascht mich nicht im Geringsten.
Ich lasse das Messer, das ich aus der Wand gerissen habe, in meiner Hand herumwirbeln, bevor ich die Straße entlangrenne, um zu den Imperialen aufzuschließen. Ich spüre ihre jeweilige Macht unter meiner Haut kribbeln, fühle ihr Flehen, freigegeben zu werden. Aber ihre Fähigkeiten nützen mir nichts, außer ich kann die Flüchtige auf den Boden zwingen. Ich bereue, keinen Tele mitgebracht zu haben, der sie mit nur einem Gedanken hätte vor mir in der Gasse absetzen können.
Sie kann nur auf den Dächern bleiben, solange sie fähig ist, von einem zum anderen zu springen. Und deswegen schleudere ich das Messer mit einer schnellen Bewegung in ihre Richtung.
Ich beobachte, wie die Klinge ihr Ziel findet, im Sprung ihren Oberschenkel aufreißt. Ihr Schmerzensschrei lässt mich zusammenzucken – eine Reaktion, die mir fremd ist … und unglaublich frustrierend.
Sie knallt hart auf das Flachdach, rollt sich ab in dem matten Versuch, die Kraft des Aufpralls zu mildern. Ich beobachte, wie sie sich wieder auf die Füße kämpft. Blut rinnt über ihr Bein. Aus der Ferne kann ich ihr Gesicht nur vage erkennen, sodass ich fast vorgeben kann, sie wäre eine beliebige Gestalt, als sie zum Rand des Dachs humpelt.
Sie ist keine Närrin. Sie weiß, dass sie den Sprung nicht bewältigen kann.
Mein Blick schießt zu den Imperialen, die mit offenem Mund zu ihr aufstarren. »Muss ich wirklich alles für euch erledigen?«, frage ich kalt. »Geht und holt sie.«
Aber dann huscht mein Blick zurück zu dem Dach. Das leer ist.
Dumm von mir zu glauben, sie würde es mir einfach machen.
»Findet sie«, blaffe ich, die Hand erneut in meinem Haar vergraben. Die Imperialen teilen sich auf, rennen in verschiedenen Richtungen über die Straßen davon, die ich genau für diesen Fall habe sperren lassen. Diebe besitzen die alarmierende Fähigkeit, mit der Menge zu verschmelzen, im Chaos unterzutauchen. Und genau das hätte sie getan, hätte ich Beute nicht für den heutigen Tag räumen lassen.
Ich stapfe die Straße entlang, spähe in jede Seitengasse. Gedämpfte Schreie sind zu hören, die von den heruntergekommenen Häusern und Läden widerhallen. Schweigend führe ich meine Suche fort, dann stocken meine Schritte, als ich eine zusammengesackte Gestalt am Ende einer Sackgasse entdecke.
Ich sinke neben dem Imperialen in die Hocke, lasse den Blick über seine einst weiße Uniform gleiten, die jetzt von Blut durchtränkt ist. In der Mitte des scharlachroten Flecks, mitten in seiner Brust, steckt ein Messer. Von dort aus fließt Rot über die gestärkten Falten seiner Uniform.
Sie ist ein wildes kleines Ding.
Ich presse die Finger an seinen Hals, suche nach einem Puls, von dem ich weiß, dass ich ihn nicht finden werde. Seufzend lasse ich den Kopf in die Hände sinken. Mein gesamter Körper sackt vor Erschöpfung in sich zusammen, niedergedrückt von meinen Sorgen.
Ich habe einmal jemanden beerdigt, der versucht hat, sie umzubringen.
Einfach weil ich wusste, dass sie sich das gewünscht hätte. Während der ersten Herausforderung habe ich Sadies Leiche durch den dunklen Wispernden Wald getragen, habe Paedyn diesen Ring am Finger drehend zurückgelassen, weil ich wusste, dass sie litt. Wäre es mir überlassen gewesen, hätte ich niemals jemandem eine Bestattung zukommen lassen, der versucht hatte, sie zu töten. Aber ich habe nicht an mich gedacht, als ich es getan habe.
Der Tod ist mir vertraut, sowohl als Freund als auch als Feind. Er begegnet mir in meinem Leben viel zu oft. Aber für sie ist der Tod verheerend – egal, wer das Opfer ist.
Ich stelle mir vor, wie sie in diesem Moment diesen Ring am Finger dreht, an der Innenseite ihrer Wange kaut, während sie sich zwingt, zu fliehen und den Mann zurückzulassen, den sie gerade getötet hat – statt ihm ein Grab zu schaufeln, wie sie es sich wahrscheinlich verzweifelt wünscht.
»Sie hätte dich beerdigt, wenn sie nicht so dringend vor mir fliehen müsste, weißt du?«, murmele ich der Leiche vor mir zu, womit ich endgültig beweise, dass ich dem Wahnsinn verfallen bin. Ich ziehe die weiße Maske des Imperialen von seinem Gesicht, sodass ich für einen Moment die glasigen braunen Augen sehen kann, bevor ich seine Lider schließe. »Also ist das Mindeste, was ich tun kann, dich für sie zu begraben«
Bisher habe ich keinen Gedanken daran verschwendet, was mit den Leichen meiner Soldaten geschieht. Und doch werfe ich mir jetzt diesen Mann über die Schulter, weil eine junge Frau, die mich verabscheut, Tod verbreitet. Ich stöhne unter dem Gewicht des Imperialen und frage mich, warum ich mir diese Mühe überhaupt mache.
Was hat sie mit mir angestellt?
Der schlaffe Körper über meiner Schulter schwankt bei jedem meiner Schritte.
Werde ich als Nächstes ihr Grab ausheben müssen?
3
Paedyn
Es entsetzt mich, dass er das Pochen meines Herzens nicht hören kann; den brennenden Blick nicht spürt, den ich über ihn gleiten lasse.
Ich verlagere das Gewicht, rutsche auf dem Bauch über das raue Dach, um über die Kante zu spähen. Schmerzen schießen durch mein Bein, lenken meine Aufmerksamkeit auf die ungeschickt verbundene Schnittwunde an meinem Oberschenkel. Ich beiße mir auf die Zunge, um einen Schrei genauso zurückzuhalten wie eine Reihe farbenfroher Flüche. Der Stoff, den ich eilig um die Wunde gewickelt habe, zeigt bereits ein scheußliches Scharlachrot und zwingt mich, meine Aufmerksamkeit wieder auf die Gestalt in der Gasse zu richten, weil ich den Anblick kaum ertragen kann.
Aber seinen Anblick kann ich auch nicht ertragen.
Ich weiß bereits, was er sagen würde, wenn ich ihm das in sein grinsendes Gesicht sagen würde – »Du bist eine schrecklich schlechte Lügnerin, Gray.«
Bei dem Gedanken verdrehe ich die Augen, bevor ich ihn erneut ansehe; seine unordentlichen schwarzen Locken mustere, die ihm wirr in die Stirn fallen. Er kauert neben der Wache, die ich mit einem Messer in der Brust beschenkt habe. Seine Miene ist grimmig, als seine grauen Augen über das Gesicht des Mannes gleiten. Dann lässt er das Gesicht in die Hände sinken und wirkt dabei gleichzeitig frustriert und erschöpft.
Der Anblick des Vollstreckers erfüllt mich mit Zorn, aber ich zwinge mich dazu, nur ihn anzusehen statt das Blut, das die weiße Uniform des Imperialen färbt.
Ich schlucke schwer, weil mir bei dem Gedanken plötzlich schlecht wird. Tränen brannten in meinen Augen, als ich das Messer freigegeben habe, sodass ich nur mit verschwommenem Blick wahrgenommen habe, wie er zu Boden fiel.
Es tut mir leid. Es tut mir so unglaublich leid.
Ich weiß nicht, ob er meine flehende Entschuldigung gehört hat, ich weiß nicht, ob er die Trauer in meinem Blick erkannt hat, bevor ich mich auf das Dach eines Ladens gezogen habe, als Schritte von den Wänden der Gasse widerhallten.
Ich blinzele gegen die Erinnerung an, gegen die Tränen und konzentriere mich stattdessen auf den Vollstrecker nur wenige Schritte von mir entfernt.
Ich könnte ihn töten. Hier und jetzt.
Plötzlich halte ich ein weiteres Wurfmesser in den blutbesudelten Fingern meiner zitternden Hand.
Versprichst du mir, lange genug am Leben zu bleiben, um mir ein Messer in den Rücken zu rammen?
Die Worte, die er nach diesem ersten Ball gesprochen hat, hallen in meinem Kopf wider.
Ich könnte dieses Versprechen einlösen.
So wie er dort sitzt, wäre es in der Tat sein Rücken, in den sich mein Messer bohren würde. Ich spüre, wie Schweiß meine Handfläche benetzt, aber ich packe das Heft des Dolchs fester.
Tu es.
Plötzlich habe ich einen Kloß in der Kehle, gegen den ich verzweifelt anschlucke. Der junge Mann dort unten hat meinen Vater getötet, hat im Namen des Königs Dutzende Gewöhnliche umgebracht. Und ich bin sein nächstes Ziel.
Und ich verabscheue mein Zögern.
Tu. Es.
Ich hebe den Arm. Meine Finger zittern immer noch. Die Bewegung sorgt dafür, dass die Narbe auf meiner Brust brennt, weil die Haut um diese stetige Erinnerung dort gedehnt wird.
G für Gewöhnliche.
Plötzlich verlagert er sein Gewicht, hebt die Maske des Imperialen und schließt die leeren Augen des Mannes, mit einer Sanftheit, die nichts mit dem Vollstrecker zu tun hat – eine Sanftheit, von der ich mir wünschte, ich hätte sie nicht bezeugt.
»Sie hätte dich beerdigt, wenn sie nicht so dringend vor mir fliehen müsste, weißt du?«
Mein Atem stockt, und mein Herz rast.
Er hat recht. Wenn es mir möglich gewesen wäre, hätte ich diesen Mann zum nächsten freien Stück Erde geschleppt und ein Grab für ihn geschaufelt. Als könnte ich so das Unrecht wiedergutmachen, das ich ihm angetan habe. Als könnte ich so wiedergutmachen, dass ich weder meine beste Freundin noch meinen Vater beerdigt habe.
Die Parallelen ihrer Tode waren ekelerregend – beide sind in meinen Armen verblutet, bevor ich weggelaufen bin.
»Also ist das Mindeste, was ich tun kann, dich für sie zu begraben.«
Dieser leise Satz bohrt sich in mein Herz wie eine Klinge, sorgt dafür, dass ich fast das Messer in meiner Hand fallen lasse. Entgeistert sehe ich zu, wie er sich den Mann über die Schulter wirft und schwankend aufsteht.
Kai.
Das ist die Person, die ich gerade vor mir sehe. In diesem Moment ist er nicht der Vollstrecker und trägt auch keine der anderen Masken, die er so mühelos anlegt – ich sehe nur ihn.
Ich verabscheue es.
Ich verabscheue, dass ich tatsächlich noch mal einen Blick auf diesen jungen Mann werfe. Weil es so viel leichter fällt, ihn zu hassen, wenn es gar nicht er ist, den ich hasse, sondern der Vollstrecker, zu dem er gemacht wurde.
Ich beobachte, wie er mit dem Mann über der Schulter, den ich getötet habe, die Gasse verlässt. Kai tut niemals etwas ohne Grund, was mich verwirrt über seine Freundlichkeit zurücklässt.
Und als er um die Ecke verschwindet, frage ich mich plötzlich, warum ich ihm Gnade erwiesen habe.
Die Sterne flirten gern, zwinkern aus der Dunkelheit nach unten.
Aber sie sind mir gute Gesellschaft, als sie mich mit ihren unzähligen Konstellationen umgeben. Ich liege seit Stunden auf diesem Ladendach, beobachte, wie der Tag in die Dämmerung übergeht und die Dämmerung zu Dunkelheit verblasst.
Die Sonne berührte schon fast den Horizont, als die Rufe der Imperialen nicht mehr durch die Gassen hallen. Irgendwann verklang auch das Kratzen ihrer Stiefel auf den abgetretenen Pflastersteinen, während ich zum Himmel aufgestarrt und ihn angefleht habe, sich zu verdunkeln.
Als das letzte purpurfarbene Glühen in den Wolken verlischt und nur eine schwarze Decke zurücklässt, die ganz Ilya einhüllt, stehe ich endlich auf und strecke mich. Mein ganzer Körper schmerzt – eine Empfindung, mit der ich inzwischen sehr vertraut bin –, aber die frische Wunde, die ich heute davongetragen habe, brennt besonders heiß. Meine Bewegung sorgt dafür, dass erneut Blut über meinen Schenkel rinnt; eine rote Spur über mein Bein zieht. Ich kann das klebrige Gefühl kaum ertragen – weil es mich an das Blut erinnert, das ich mir niemals von den Händen waschen kann.
Es dauert beschämend lange, von dem Dach zu klettern, doch sobald meine Füße die Straße berühren, gleite ich in die Schatten. Ich humpele durch ruhige Gassen, weiche den Obdachlosen aus, die sich in ihren vertrauten Ecken zusammengekauert haben.
Immer noch treiben sich überall Imperiale herum. Sie tigern leise durch die Gassen, drehen die Köpfe, halten in der Dunkelheit nach mir Ausschau. Das macht mein Fortkommen gleichzeitig schwierig und unglaublich irritierend. Im sterbenden Licht weiche ich ihnen aus. Ich gebe mein Bestes, keine Blutspur zu hinterlassen, als ich von einer Straße zur nächsten husche.
Ich biege in eine dunkle Straße mit unebenem Pflaster ab …
Eine harte Hand landet auf meiner Schulter, packt sie mit grobem Griff. Ich senke den Kopf, erkenne aus dem Augenwinkel gewienerte schwarze Stiefel, bevor mir der Geruch von Stärke in die Nase steigt. Ich zögere keinen Moment, bevor ich meinen Fuß hinter den Knöchel des Mannes hake und zerre, sodass er überrascht zu Boden fällt. Ich werfe mich auf ihn, ziehe den Dolch aus meinem Stiefel und ramme meinem Gegner das Heft mit aller Kraft gegen die Schläfe, was seinen überraschten Schrei im Keim erstickt.
Der dünne Imperiale, der jetzt als bewusstloser Haufen auf den schattenverhangenen Pflastersteinen liegt, ist kaum mehr als ein Junge. Mein Herz schlägt wie wild, zwingt mich, einmal tief durchzuatmen, bevor ich ihn tiefer in die Gasse zerre, um ihn in der Dunkelheit zu verstecken.
Den Rand der Sengenden Wüste zu erreichen, ist eine langsame und unendlich frustrierende Reise. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich einmal erleichtert sein würde, die weite Sandfläche vor mir zu sehen. Aber nachdem ich stundenlang durch die Schatten geschlichen und nur knapp meiner Verhaftung entkommen bin, löst der Anblick ein Lächeln aus, auch wenn dabei Schmerz durch mein Gesicht schießt.
An den Rändern der Senge sind nur sehr wenige Imperiale stationiert, da die Bürger von Dor und Tando zu klug sind, um Ilya zu besuchen und zu riskieren, für Gewöhnliche gehalten zu werden. Ilya liebt seine Isolation, die garantiert, dass die Elite-Gesellschaft weiterhin floriert, ohne vom Blut von Leuten ohne Fähigkeiten verpestet zu werden.
Der Gedanke macht mich wütend. Die Wahrheit darin sorgt dafür, dass mir schlecht wird.
Und angetrieben von dieser Wut, beginne ich, über den Sand zu stapfen. Er bewegt sich unter meinen Stiefeln, findet langsam seinen Weg in den Schaft und macht die Reise damit noch ein ganzes Stück unangenehmer.
Stunden vergehen, in denen ich einen Fuß vor den anderen setze. Ich beschäftige mich, indem ich mir das müde Hirn zermartere, in dem Versuch, die Karten aufzurufen, die mein Vater in meiner Kindheit vor mir ausgebreitet hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit die Wüste sich erstreckt – was mich zu einer Närrin macht, weil ich mir einbilde, ich könnte das hier trotz meiner Verletzungen überleben.
Als hätte ich eine andere Chance.
Ich seufze, akzeptiere die Tatsache, dass der Tod mich in die Enge getrieben hat, sodass ich mich ihm offen stellen muss. Meine Erinnerungen an die Landkarten sind vage, aber wenn ich auf meinem bisher eingeschlagenen Weg bleibe, werde ich Dor wohl in ungefähr fünf Tagen erreichen. Allerdings nur, wenn es mir gelingt, fast unablässig in Bewegung zu bleiben – was auch dafür sorgen könnte, dass ich zusammenbreche und damit dem Tod doch erlaube, mich für sich zu beanspruchen.
Nun, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.
Die Nacht wird immer kälter. Je tiefer ich in die Wüste eindringe, desto mehr sinken die Temperaturen. Meine dreckige Weste mit den vielen Taschen ist viel nützlicher zum Verstauen von Diebesbeute als zum Wärmen – und genau dafür hat Adena sie angefertigt. Ich lasse den Daumen über den rauen olivfarbenen Stoff gleiten; erinnere mich an die weichen braunen Hände, die das Kleidungsstück genäht haben.
»Versprichst du mir, dass du sie für mich tragen wirst?«
Das Bild von Adena, die in meinen Armen stirbt und dabei ihre letzte Bitte flüstert, steigt vor meinem geistigen Auge auf und bringt meine Füße dazu, sich schneller zu bewegen. Selbst wenn ich die Zeit hätte, weiß ich, dass ich auf dieser Reise nicht viel schlafen kann – oder jemals wieder.
Denn in den erschöpften Momenten, bevor der Schlaf mich in seine Arme schließt, sehe ich Adena immer wieder sterben. Als wäre das Herabsinken meiner Lider eine Einladung, diesen Horror erneut zu durchleben. Der stumpfe Ast in ihrer Brust, ihre gefesselten Hände, die gebrochenen Finger, ihr Körper überzogen von Blut …
Mein eigenes beginnt zu kochen, als ich mich an Blairs selbstgefälliges Grinsen erinnere, während sie den Ast mit nur einem Gedanken in Adenas Rücken geschickt hat.
Ich werde sie umbringen.
Ich weiß noch nicht wie oder wo oder wann, denn nicht nur Adena hatte die Regel, Versprechen nur zu geben, wenn sie fest vorhatte, sie zu halten.
Ich grabe in meinem Rucksack herum und ziehe eine abgetragene Jacke heraus, die meinem Vater gehört hat. Sie ist mir viel zu groß … und doch hat mir nichts jemals besser gepasst. Ich vergrabe die Hände in den Taschen, dann stapfe ich zitternd weiter durch den Sand.
Die Stunden vergehen und stehlen die Dunkelheit, zaubern Streifen von Orange an den Himmel und bringen das Versprechen auf glühende Hitze. Ich lege nur kurze Pausen ein, gerade lang genug, um meinen wunden Beinen Rast zu gönnen, während ich etwas esse und warmes Wasser trinke. Immer wieder inspiziere ich meine Wunden, achte besonders auf den frischen Schnitt an meinem Oberschenkel.
Ein Geschenk von ihm.
Diesen blutigen Schnitt habe ich ihm zu verdanken, dessen bin ich mir sicher. Allein die Treffsicherheit des Wurfs verrät mir, dass er das Messer geschleudert haben muss, gepaart mit dem Befehl, mich von den Dächern zu holen. Ich hätte nichts anderes erwartet von dem kühl kalkulierenden Vollstrecker, der so verzweifelt darauf aus ist, mich zu erwischen.
Ein guter Grund, schneller zu gehen.
Ich zwinge meine Beine, schneller zu werden, und versuche, ihn aus meinen Gedanken zu vertreiben.
Er ist mir auf den Fersen.
Meine Lippen zucken bei dem Gedanken, verziehen die Narbe auf meinem Kiefer.
Und ich werde nicht noch mal zögern.
4
Kai
»Du siehst schrecklich aus.«
Kitts Augen huschen über den roten Fleck auf meinem Hemd, eine Hinterlassenschaft des Imperialen, von dem er nicht wissen muss, dass ich ihn begraben habe. Für sie.
Im besten Falle eine Handlung am Rand des Hochverrats.
Im schlechten Falle jämmerlich.
Irgendwann fängt der König meinen Blick ein. Erheiterung funkelt in seinem Blick. Vertrautheit zaubert unwillkürlich ein Lächeln auf meine Lippen, einfach weil ich fühle, dass wir Brüder sind. Brüder, die keine Titel vor ihren Namen tragen. Brüder, die, für diesen kurzen, seligen Moment, all ihre von Blut gebundenen Treuepflichten ignorieren.
Es ist das erste Mal seit Tagen, dass er erlaubt, dass ich ihn ansehe. Wirklich ansehe.
Kitt hat Tränen gegen Erschöpfung getauscht, lächelnde Augen gegen einen heimgesuchten Blick, kombiniert mit leicht eingesunkenen Wangen und einem Bartschatten. Mein Blick bleibt an demselben schmutzigen Hemd hängen, das ich schon seit drei Tagen sehe – halb geöffnet; die Ärmel mit Tinte befleckt.
»Nun, du siehst nicht viel besser aus«, sage ich, immer noch mit diesem überraschenden Lächeln auf den Lippen.
Mit einem Blinzeln senkt Kitt den Blick auf seine schwarzfleckigen Hände und die verschmierten Papiere auf dem Schreibtisch, als sähe er all das zum ersten Mal. Dann seufzt er und rafft die Papiere, die ihn so fesseln, zu einem unordentlichen Stapel zusammen. »Ich komme schon klar. Bin nur ein bisschen müde.«
»Du bist dir bewusst, dass es für dieses Problem eine einfache Lösung gibt, richtig?« Ich klinge irritierend vorsichtig, während ich versuche, auf der feinen Linie zwischen lockerem Umgangston und Ermahnung zu tanzen.
Kitt ist anders. Wir sind anders. Ich weiß nicht mehr, wo mein Bruder endet und der König beginnt.
Als er nicht antwortet, füge ich leicht besorgt hinzu: »Du solltest versuchen, dich auszuruhen. Etwas Schlaf zu finden.« Ich nicke in Richtung des abgenutzten Ledersessels, den er geerbt hat. »Ich habe dich seit Tagen immer nur in diesem Stuhl gesehen.«
»Schlaf ist etwas für die Toten.« Das Geräusch, das Kitt nach diesem Satz ausstößt, lässt sich nur als gewürgtes Schnauben beschreiben. »Tut mir leid«, lacht er dann und schüttelt scheinbar amüsiert den Kopf. »Zu früh?«
Ich zwinge mich zu einem weiteren Lächeln, obwohl ich das Gefühl habe, einem Fremden gegenüberzustehen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Worte auch in einem anderen Leben über Kitts Lippen gedrungen wären, aber ohne diesen bitteren Unterton und die leicht irre Färbung seines Grinsens. Die Trauer hat ihn in einen Mann verwandelt, vor dem ich auf der Hut bin.
»Schön«, seufze ich, »Schlaf ist etwas für die Toten. Auch wenn es nicht aussieht, als würdest du wirklich leben.« Ich sehe ihm in die Augen, flehe ihn mit meinem Blick auf eine Weise an, die ich mit Worten nie wagen würde. »Du hast das Arbeitszimmer seit deiner Krönung nicht verlassen. Wir könnten einen Spaziergang durch die Gärten machen, die Königin besuchen.« Bei dem Gedanken daran, was die Trauer ihr angetan hat, schlucke ich schwer. »Die Ärzte sagen, es geht ihr schlechter. Sie hat ihr Bett nicht verlassen, und sie fürchten … sie fürchten, ihr bleibt nicht mehr viel Zeit.«
Er erstarrt, kommentiert meinen Vorschlag mit Schweigen. Sein Zögern sollte mich nicht überraschen. Kitt hat keine Bindung zu meiner Mutter. Weil sie genau das ist – meine Mutter. Nicht seine.
Ich räuspere mich und wende mich verlockenderen Unternehmungen zu. »Wir könnten Gail in der Küche besuchen. Sie wird nicht aufhören, nach dir zu fragen, bis du eines ihrer süßen Brötchen gegessen hast …«
»Ich bin hier sehr glücklich, vielen Dank auch.«
Ich blinzele. Eine königliche Entlassung, wenn ich je eine gehört habe.
Ich nicke, trete langsam einen Schritt zurück Richtung Tür. »Nun, wenn es sonst nichts gibt …«
Eure Majestät.
Ich schlucke die Worte herunter, bevor ich sie ans Ende des Satzes heften kann. Meine Hand greift nach der Türklinke, bereit zur Flucht …
»Ist das ihr Blut?«
Meine Schritte stocken, dann drehe ich mich zu ihm um.
Seine grünen Augen sind auf die Flecken auf meinem Hemd gerichtet. Ich schweige einen langen Moment; erlaube mir, ihn einfach zu mustern, während ich zu entziffern versuche, was ich da in seinen Augen sehe.
Endlich stelle ich die Frage, der ich bisher selbst bestmöglich ausgewichen bin. »Wärst du enttäuschter, wenn es ihr Blut ist oder wenn es von jemand anderem stammt?«
Er schluckt schwer. Atmet tief durch. Lächelt auf eine Weise, die alles andere als glücklich wirkt. »Ich weiß es nicht.« Wieder ein langer Moment der Stille. »Du?«
»Ich weiß es nicht.«
Jämmerlich.
»Also?« Kitt sieht mich bei der Frage nicht an. »Ist es ihres?«
Ich seufze, erschöpft allein von der Erinnerung an den heutigen Vormittag. »Nein.«
Erleichterung? Enttäuschung? Es scheint, als könnte ich den Unterschied zwischen diesen zwei Empfindungen nicht mehr erkennen, als ich das schlichte Wort ausspreche.
»Ich verstehe«, murmelt Kitt. »Aber sie war da, nehme ich an?«
»War sie. Ich habe sie aus dem Haus gezwungen.« Kitt hebt eine Augenbraue, bevor ich meine Erklärung beenden kann. »Haben es bis auf die Grundmauern niedergebrannt.«
»Ich verstehe.«
Wir beobachten uns wachsam. Sie ist ein Thema, an dem wir besser nicht rühren, und doch ist sie nie weiter als einen Gedanken entfernt. Sie foltert uns beide.
»Das Blut?« Kitt nickt auffordernd.
»Gehört einem Imperialen, den sie angegriffen hat. Sie hat ihn am Rand der Slums erstochen.«
Wieder erklingt dieses leblose Lachen. »Sie hat die hässliche Angewohnheit, auf Leute einzustechen, nicht wahr? Und sie umzubringen natürlich.«
Ich räuspere mich, weil ich sorgfältig darauf achten muss, diese unsichtbare Linie nicht zu übertreten, von der ich einfach nicht mehr weiß, wo sie sich befindet. »Nun ja, dasselbe gilt für mich. Und sie ist nicht unverletzt entkommen. Dafür habe ich gesorgt.«
»Also …«, sagt Kitt gedehnt, in einem Ton, der mir nur zu vertraut ist. Ich erkenne Vater in seinem Blick, höre ihn in Kitts Worten. »Was willst du mir damit mitteilen, Vollstrecker?«
Ich zucke leicht zusammen. »Ich glaube, sie ist unterwegs durch die Sengende Wüste, um entweder Dor oder Tando zu erreichen. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob sie es schaffen wird. Andererseits hat sie auch die hässliche Angewohnheit, zu überleben.« Mein Ton ist ausdruckslos, weil ich den Vollstrecker spiele, den er sich wünscht. »Ich werde ein paar Männer und Wüstenpferde ausrüsten lassen und ihr dann in die Senge folgen. Wir werden aufbrechen, so schnell es geht.« Ich halte kurz inne. »Eure Majestät.«
Verdammt. Das konnte ich nicht zurückhalten, oder?
Kitt mustert mich, offenbar wenig beeindruckt von dem Titel. Er wirkt eher neugierig. »Und dann wirst du sie zu mir bringen.«
Ich nicke.
»Wirst du das?«
Ich starre ihn an, halte meine Atmung so ruhig wie möglich. »Hast du Grund zu der Annahme, das zu hinterfragen?«
Kitt zuckt mit einer Schulter, bevor er sich nach hinten lehnt und die tintenbefleckten Arme vor dem zerknitterten Hemd verschränkt. »Es ist nur, nun, ich kenne deine … Vorgeschichte.«
Ich versteife mich. Wir beäugen uns, tauschen uns schweigend über die eine Sache aus, die wir niemals laut auszusprechen gewagt haben. Kitts Kommentar war subtil, aber sein Mangel an Vertrauen in meinen Gehorsam eben nicht.
Meine Antwort fällt kühl aus. »Das ist etwas anderes. Und das weißt du auch.«
»Wirklich?« Kitt klingt beunruhigend unschuldig. »Mit diesen Kindern hat dich nichts verbunden, und doch hast du ihnen trotz ihrer Verbrechen ihre Strafe erspart.«
»Kitt …«, setze ich an, doch er schneidet mir das Wort ab.
»Hör mal, ich will damit nicht sagen, dass es falsch war, diese Kinder zu verschonen.« Er lacht humorlos. »Ich bin kein Monster. Die Gewöhnlichen zusammen mit ihren Familien zu verbannen, statt sie sofort hinzurichten, war eine Gnade, egal, wie gering. Aber …« – sein Blick verfinstert sich – »du hast dich mehrfach Vaters Befehlen widersetzt. Wieder und wieder.«
Ich seufze genervt. Mit der Erwähnung von Vater habe ich diese Diskussion verloren, bevor sie wirklich angefangen hat. Nichts, was ich sage, kann in Kitts Augen eine Handlung gegen die Wünsche des ehemaligen Königs rechtfertigen.
»Ich habe Befehle immer befolgt.« Ich seufze erneut. »Und ich werde es immer tun. Das war die eine Ausnahme.«
»War?«, wiederholt Kitt, sein Blick forschend, seine Miene skeptisch. »Was? Hast du nicht vor, diese Ausnahme weiterhin zu machen, weil ich jetzt König bin? Weil ich es weiß?«
Es fällt mir schwer, ihn nicht mit offenem Mund anzustarren. »Du willst also, dass ich Kinder hinrichte?« Ich atme schwer, und mein Herz hämmert gegen wunde Rippen. »Bitte, sprecht nur ein Wort, und es wird erledigt, mein König.«
Mist.
Ich beiße mir heftig genug auf die Zunge, dass ich nur noch den Schmerz wahrnehme und nicht die Wut, die in mir aufsteigt. Auf keinen Fall will ich Kitt nur als König sehen; ihn behandeln, wie ich den Herrscher vor ihm behandelt habe.
Kitt ist leicht zu lieben – bis er beginnt, dem Vater zu gleichen, der kaum Zuneigung für mich gehegt hat.
»Kai.« Der harsche Blick des Königs wird weicher, gleichzeitig mit seiner Stimme. »Ich weiß, dass das kein leicht zu befolgender Befehl ist. Ich vermute, ich bin einfach … paranoid. Ich habe in der Vergangenheit bezeugt, wie du gegen Befehle verstoßen hast.« Angesichts des Blicks, den ich ihm zuwerfe, fügt er hastig hinzu: »Aus guten Gründen. Weshalb ich mir Sorgen mache, wenn ich dich bitte, sie zu mir zurückzubringen.« Sein Blick sucht meinen, und ich erkenne eine Regung in seinen Augen, die ich kaum benennen kann. »Und gäbe es bessere ›gute Gründe‹, dich Befehlen zu widersetzen, als deine Gefühle für sie?«
Wir starren uns unverwandt an, während unausgesprochene Worte uns die Kehlen zuschnüren. Ich will widersprechen; flehe meinen Mund an, sich zu öffnen und eine überzeugende Folge von Worten auszuspucken, um diesen Vorwurf zu entkräften. Aber er hat recht … und das wissen wir beide. Meine Gefühle sind in erster Linie für ihre Freiheit verantwortlich.
Der Gedanke erschüttert mich und sorgt dafür, dass ich den voreiligen Schluss ziehe, dass Kitt es weiß – dass Kitt weiß, dass ich sie bereits einmal habe laufen lassen – und mir das verübelt. Aber nichts in seiner ruhigen Miene lässt das vermuten, und ich begrabe den Gedanken, bevor er mich ins Grab bringen kann.
»Das kann auch für dich nicht einfach sein«, meine ich vorsichtig und teste damit die aufgewühlte See von Kitts Gefühlen für dieselbe junge Frau.
Fast hätte er gelacht. »Oh, also wollen wir jetzt wirklich darüber reden?«
Wir sind um dieses gefährliche Thema schon herumgetänzelt, bevor sie beschlossen hat, die Sehnen im Hals unseres Vaters mit genau dem Dolch zu durchtrennen, den ich im Moment an der Hüfte trage. Sie war ein Risiko, das wir nicht angesprochen haben – als hätten wir sie so davon abhalten können, einen Keil zwischen uns zu treiben.
Sie ins Herz zu schließen, war fatal.
»Welche Gefühle ich auch immer für sie gehegt haben mag, sie sind an dem Tag gestorben, als sie Vater umgebracht hat«, erklärt Kitt schlicht.
Lüge.
Ich habe mir selbst dasselbe eingeredet, habe genau das zur absoluten Wahrheit erklärt.
»Ich kenne das Gefühl.« Ich nicke.
Lüge.
Wir beäugen einander, beide damit zufrieden, in unserer geteilten Selbsttäuschung zu versinken. Wir sagen nichts mehr, sparen uns die Mühe, die Tatsache anzusprechen, dass wir uns gegenseitig und gleichzeitig uns selbst anlügen.
»Ich werde sie zu dir zurückbringen, Kitt«, sage ich ruhig. Aufrichtig. »Bevor ich dein Vollstrecker wurde, war ich dein Bruder. Meine Loyalität gehört dir und niemandem sonst.« Ich schweige einen langen Moment, um die Worte sacken zu lassen. »Sie hat auch meinen Vater umgebracht, weißt du?«
Wieder breitet sich Schweigen zwischen uns aus.
»Lebend«, sagt Kitt schließlich. »Bring sie mir lebend.«
Sein Ton deutet an, dass das nicht unbedingt eine Gnade ist.
Ich ziehe den breiten Ring vom Finger, den ich an dem Tag erhalten habe, als ich Ilyas Vollstrecker wurde, und lege ihn vor Kitt auf den Schreibtisch. »Gib ihn mir zurück, wenn ich erneut dein Vertrauen erworben habe.«
5
Paedyn
Sand knirscht in meinem Mund, kratzt über mein Zahnfleisch.
Ich fahre mir mit der Zunge über die trockenen Zähne, fühle dort denselben Schmutzschleier, den ich schon seit drei Tagen spüre. Ausspucken kommt nicht mehr infrage, da ich jeden Tropfen Feuchtigkeit zum Überleben brauche.
Meine Kehle schmerzt. Meine Füße. Meine Beine. Mein Kopf. Mein alles.
Der Sand bewegt sich unter meinen Füßen, während ich weiterschlurfe. Mein schmerzender Nacken protestiert, als ich meinen vernebelten Kopf in Richtung der untergehenden Sonne hebe. Sie sinkt auf den Horizont zu, droht damit, hinter den Sanddünen zu verschwinden und ihre Strahlen vom Himmel zu reißen.
Meine Handfläche findet meine Stirn, klebrig und verbrannt von Tagen in der Wüste. Ein Schauder erschüttert meinen schmerzenden Körper. Seufzend überzeuge ich mich davon, dass mich die schnell abkühlende Wüste zittern lässt und nicht etwa Fieber meine Haut mit Schweiß benetzt.
Ich bin tagelang gewandert – und auch die meisten Nächte.
Die Wüste ist ein erbarmungsloses Biest. Jede Nacht habe ich den Sand angefleht, mir ein paar Stunden der Ruhe zu schenken. Trotz meiner Verzweiflung hat die Wüste sich bisher geweigert, mir mehr als ein oder zwei Stunden Schlaf am Stück zu gönnen. Ob nun Sand in meinen Augen oder Skorpione vor meinen Füßen, mir gelingt nicht mehr als ein unruhiges Nickerchen.
»Ich bin die Einzige, die dir Gesellschaft leistet, also könntest du mir wenigstens eine Nacht ungestörten Schlaf gönnen«, flüstere ich mit aufgesprungenen Lippen, meine Stimme kaum mehr als ein Krächzen. Ich lasse den Blick über die weitläufige Wüste gleiten; sehe nichts als Sand und höre keine Antwort als den flüsternden Wind. Ich schnaube, breche kleine Stücke hartes Brot ab, um sie mir in den ebenso trockenen Mund zu schieben.