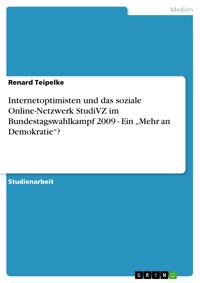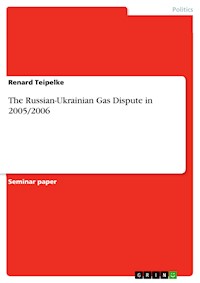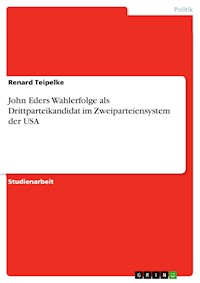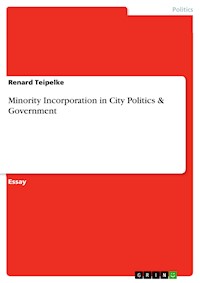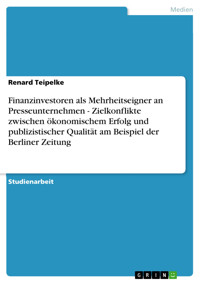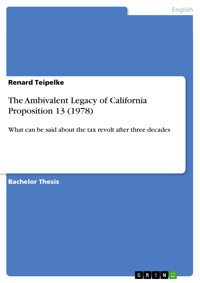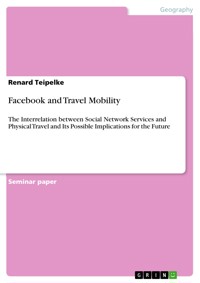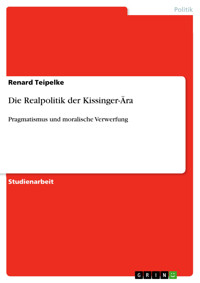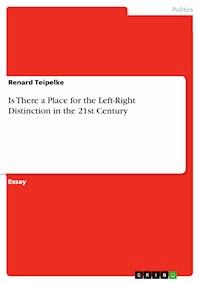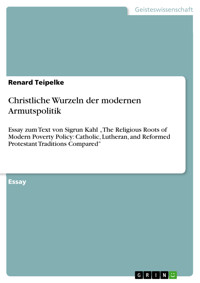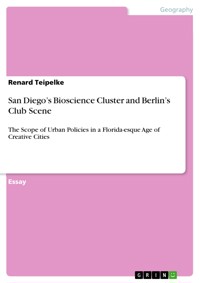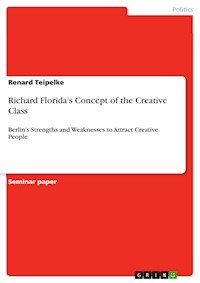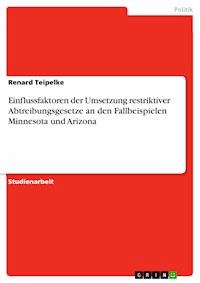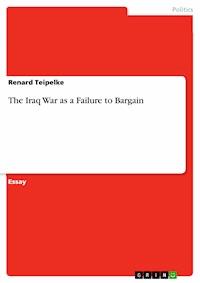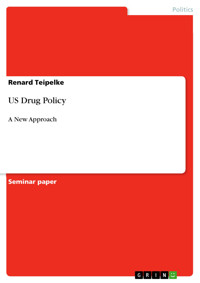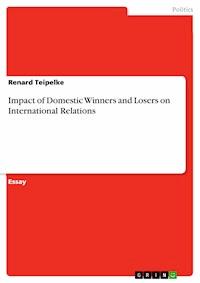Priming in Fernsehdebatten am Beispiel des zweiten TV-Duells des Bundestagswahlkampfes 2002 zwischen Schröder und Stoiber E-Book
Renard Teipelke
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Medien und Politik, Pol. Kommunikation, Note: 1,3, Freie Universität Berlin (Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft), Veranstaltung: Agenda Setting & Priming, Sprache: Deutsch, Abstract: Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das erste Mal über das Agenda Setting-Modell gesprochen. „What to think about?“ war die Kernfrage des Modells. Es wurde angenommen, dass durch eine Prioritätensetzung von Seiten der Medien bestimmte Themen bevorzugt behandelt werden, wodurch ihnen eine höhere Wichtigkeit zugeschrieben wird, die auch entsprechend von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Nach weiterführenden Studien zum Agenda Setting reifte die Vorstellung eines first level agenda setting und eines second level agenda setting heran. Während das Erstere eine genauere Bezeichnung für das Agenda Setting-Modell sein sollte, diente der zweite Begriff zur exakteren Beschreibung der durch das Agenda Setting ausgelösten Prozesse. Die Fragestellung war hier: „How to think about?“. Es geht dabei um die Massenmedien, welche durch eine bestimmte Selektion und Hervorhebung die Aufmerksamkeit der Rezipienten auf ausgewählte Themen lenken können. Die Idee des Priming und Framing war geboren. Zur Untersuchung dieser Aspekte führten Maurer und Reinemann an der Universität Mainz im Jahr 2002 eine Studie durch, welche 2003 mit den Titel „Schröder gegen Stoiber“ veröffentlicht wurde. Dabei wurde die Wahrnehmung und Wirkung des zweiten TV-Duells in einer quasi-experimentellen Untersuchung überprüft und zudem eine Inhaltsanalyse des Duells als auch der Vor- und Nachberichterstattung durchgeführt. Für die folgende Analyse waren die Befragungen direkt vor und direkt nach dem TV-Duell von Bedeutung. Beim zweiten Fragebogen war es also den Teilnehmern nicht möglich, sich durch interpersonale Kommunikation mit anderen Studienteilnehmern auszutauschen. Eine Interpretation der nachfolgenden Ergebnisse im Sinne einer Priming-Wirkung durch das Duell – ohne externe Einflüsse – ist somit möglich. In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, inwiefern sich die Wichtigkeit der unabhängigen Variablen Parteiidentifikation, Sachkompetenzen-Index und Persönlichkeitseigenschaften-Index auf die Meinung (abhängige Variable) über Schröder beziehungsweise Stoiber durch das TV-Duell, dem Stimulus, veränderten. [...]
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
A. Priming in Fernsehdebatten am Beispiel des zweiten TV-Duells des Bundestagswahlkampfes 2002 zwischen Schröder und Stoiber
1. Einleitung: Agenda Setting und Priming
2. Vorstellung der Studie
3. Kandidaten-Priming und das Ann-Arbor-Modell
4. Fernsehdebatten und die TV-Duelle 2002
5. Wahlkampfjahr 2002: Im Vorfeld der TV-Duelle
6. Methodik der Analyse
7. Ergebnisse der Analyse
8. Schlussfolgerung und Diskussion
B. Anhang
1. Fragebogen 1
2. Fragebogen 2
3. Syntax
4. Wahlabsicht vor und nach dem Duell (in Prozent)
5. Korrelationen zwischen den Items der Persönlichkeitseigenschaften und Meinung für Schröder und Stoiber vor und nach dem Duell
6. Korrelationen zwischen den Items der Sachkompetenzen und Meinung für Schröder und Stoiber vor und nach dem Duell
7. Ausführliche Regressionsanalyse für Schröder vor dem Duell
8. Ausführliche Regressionsanalyse für Schröder nach dem Duell
9. Ausführliche Regressionsanalyse für Stoiber vor dem Duell
10. Ausführliche Regressionsanalyse für Stoiber nach dem Duell
C.. Bibliografie
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Visualisierung der Priming-Analyse
Abbildung 2: Ebenen des Kandidaten-Priming
Abbildung 3: Entwicklung der Wahlabsicht 2002 (in Prozent)
Abbildung 4: Parteiidentifikation (in Prozent)
Abbildung 5: Meinung über Schröder vor und nach dem Duell (in Prozent)
Abbildung 6: Meinung über Stoiber vor und nach dem Duell (in Prozent)
Abbildung 7: Einschätzung der Sachkompetenz Schröders vor und nach dem Duell (in Prozent)
Abbildung 8: Einschätzung der Sachkompetenz Stoibers vor und nach dem Duell (in Prozent)
Abbildung 9: Einschätzung der Persönlichkeitseigenschaften Schröders vor und nach dem Duell (in Prozent)
Abbildung 10: Einschätzung der Persönlichkeitseigenschaften Stoibers vor und nach dem Duell (in Prozent)
Abbildung 11: Modelle der multiplen, linearen Regression für Schröder und Stoiber vor und nach dem Duell
A. Priming in Fernsehdebatten am Beispiel des zweiten TV-Duells des Bundestagswahlkampfes 2002 zwischen Schröder und Stoiber
1. Einleitung: Agenda Setting und Priming
Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das erste Mal über das Agenda Setting-Modell gesprochen. „What to think about?“ war die Kernfrage des Modells und bezog sich dabei auf die Hypothese, dass die Medien durch die Rahmung von Geschehnissen die Tagesordnung, im speziellen die politische Medienagenda, bestimmen konnten. Es wurde angenommen, dass durch eine Prioritätensetzung von Seiten der Medien bestimmte Themen bevorzugt behandelt werden, wodurch ihnen eine höhere Wichtigkeit zugeschrieben wird, die auch entsprechend von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird[1]. Nach weiterführenden Studien zum Agenda Setting reifte die Vorstellung eines first level agenda setting und eines second level agenda setting heran. Während das Erstere eine genauere Bezeichnung für das Agenda Setting-Modell sein sollte, diente der zweite Begriff zur exakteren Beschreibung der durch das Agenda Setting ausgelösten Prozesse. Die Fragestellung war hier: „How to think about?“. Es geht dabei um die Massenmedien, welche durch eine bestimmte Selektion und Hervorhebung die Aufmerksamkeit der Rezipienten auf ausgewählte Themen lenken können[2]. Die Idee des Priming und Framing war geboren. Framing, als Meinungs-Transfer, umzeichnet dabei das Hervorrufen bestimmter Bewertungs- und Interpretationsprozesse bei den Rezipienten durch die Salienz des Themas, also seiner Hervorhebung[3]. Priming, als Attribute-Transfer, diente besonders der Beschreibungen der Konsequenzen des Agenda Setting. Schenk umschreibt Priming wie folgt:
„Fasst man das menschliche Gedächtnis als ein assoziatives Netzwerk auf, in welchem Ideen, Konzepte etc. als Knoten des Netzwerkes gespeichert und mit anderen solchen Ideen über semantische Pfade verknüpft sind, dann kann Priming als Aktivierung solcher Knoten durch externe Stimuli verstanden werden. Ein auf diese Weise aktivierter Knoten dient als eine Art Filter, interpretativer Rahmen oder als Prämisse für die weitere Informationsverarbeitung und Urteilsbildung. Wird ein solcher Knoten aktiviert, erhöht sich dadurch die Wahrscheinlichkeit, daß bestimmte, mit ihm verbundene, Gedanken und Vorstellungen bewusst werden. Substantielle Medienberichterstattung über einen Gegenstand hebt diesen Gegenstand aus den Medieninhalten insgesamt hervor und erleichtert es dem einzelnen, sich Gedanken darüber zu machen. Gleichzeitig wird dadurch sowohl die Breite als auch die Tiefe von entsprechenden Assoziationen beeinflusst. Wie Iyengar zeigt, können solche herausgehobenen Themen die Gedanken und Vorstellungen der Rezipienten derart fokussieren, dass sie zu Kriterien für die Urteilbildung werden.“ [4]
Noch enger gefasst, kann man Medien-Priming als Sonderform des eben gegebenen psychologischen Konzepts des Priming verstehen. Hierbei bezeichnet Peter Medien-Priming als den Prozess, in welchem
„(1) massenmedial vermittelte Informationen (als >>Primes<<) im Gedächtnis des Rezipienten verfügbare Wissenseinheiten (2) temporär leichter zugänglich machen. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, (3) dass die nunmehr leichter zugänglichen Wissenseinheiten auch bei der Rezeption, Interpretation oder Beurteilung nachfolgend angetroffener Umweltinformation (dem >>Zielstimulus<<) eher aktiviert und benutzt werden als weniger leicht zugängliche Wissenseinheiten (…).“ [5]
Hierbei handelt es sich allerdings nicht um einen reflexhaften oder deterministischen Ablauf: Die Aktivierung und Benutzung der entsprechenden Wissenseinheiten ist umso wahrscheinlicher, je kürzer der Medien-Prime zeitlich zurückliegt beziehungsweise je öfter er auftritt[6]. Hwang erkennt drei Kriterien für das Wirken eines Primes: Verfügbarkeit und Anwendbarkeit (availibility & applicability), Zugänglichkeit (accessibility) und Verwendbarkeit (usability)[7].