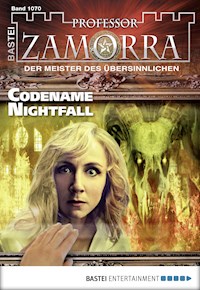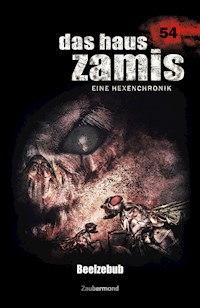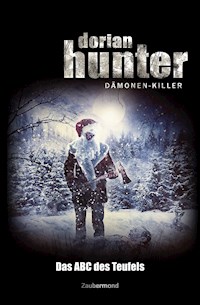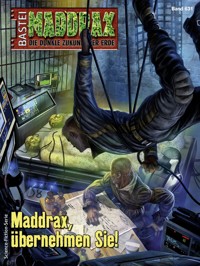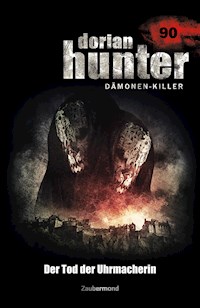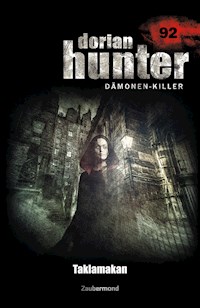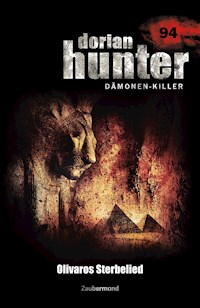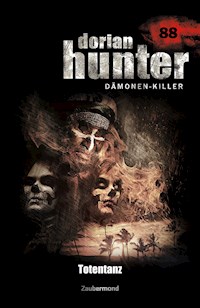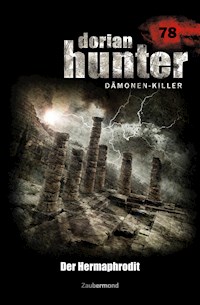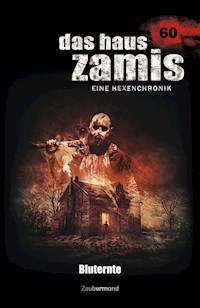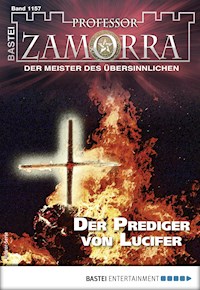
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Lucifer, Texas, ist ein winziges Kaff und auf nahezu keiner Landkarte zu finden. Hier regieren die Tradition, das Wetter und der gefeierte Prediger Carl Shingleton, den die Einheimischen wie einen Papst verehren - und wie einen Dämon fürchten.
Professor Zamorra war dienstlich in Texas und ist auf der Rückreise, als er nahe Lucifer einen Unfall erleidet. Schwer verletzt und kurzzeitig seiner Erinnerungen beraubt, kommt er in den kleinen Bauernort. Die gottesfürchtigen Luciferaner kümmern sich um ihn. Doch schon bald muss Reverend Shingleton erkennen, dass er in Zamorra einen Feind hat. Denn der alte Prediger ist tatsächlich mit satanischen Mächten im Bunde, und Lucifer, Texas ist nur der Anfang seiner Ambitionen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Der Prediger von Lucifer
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Noska Photo / shutterstock
Datenkonvertierung eBook: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-7107-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Der Prediger von Lucifer
von Simon Borner
Lucifer, Texas, ist ein winziges Kaff und auf nahezu keiner Landkarte zu finden. Hier regieren die Tradition, das Wetter und der gefeierte Prediger Carl Shingleton, den die Einheimischen wie einen Papst verehren – und wie einen Dämon fürchten.
Professor Zamorra ist dienstlich in Texas und bereits auf der Rückreise, als er nahe Lucifer einen Unfall erleidet. Verletzt und kurzzeitig seiner Erinnerungen beraubt, findet er sich plötzlich als Gefangener einer teuflischen Gemeinde wieder …
»Ich werde den Verdacht nicht los, dass Gott doch am Montag – dem achten Tag – weitermachen wird und dabei etwas Besseres vorhat als den Menschen. Wir nennen das Evolution.«
Erhard Blanck
Kapitel 1 Näher, mein Gott, zu dir
Die Ebene schien endlos. Überall Sand und Dürre, überall staubtrockenes Nichts. Einzelne Grasbüschel, halb verwelkt und gelb vor Elend, trotzten den Gewalten einer gnadenlosen Natur, und die ebenso kargen wie hohen Berge taten wenig, ihnen dringend nötigen Schatten zu spenden. Hier draußen, fernab von aller menschlichen Zivilisation, gab es keinen Schatten. Genauso wenig, wie es noch Hoffnung gab.
Und doch gab es Menschen: Ein kleines Dorf, wenig mehr als ein paar Bauernhöfe, eine bucklige Teerstraße und eine Kirche, trotzte der Szenerie seit Jahrzehnten. Es rang dem Boden Getreide ab, bewässerte und pflegte eine Handvoll Äcker, ernährte sich und sein Vieh. Die Erträge waren gering, doch sie reichten für die kleine Bevölkerung. Für die zwei Handvoll Menschen, die ohnehin nicht nur von Wasser, Brot und Fleisch allein lebten. Sondern vor allem vom Herrn.
Entsprechend groß war ihr Gotteshaus. Die HSCC – Holy Spirit Congregation Church – war wie ein Elfenbeinturm in der wüstentrockenen Eintönigkeit, ein strahlend weißes, makellos leuchtendes Fanal mitten im Niemandsland. Mit ihren hohen Wänden, den weiten Fenstern und dem Tag und Nacht von verborgenen Strahlern angeleuchteten Turm war die HSCC kilometerweit zu sehen. Ein Fanal des Lichts, selbst in finsterster Nacht. Ein Palast aus Glas und Stein, finanziert von zwei Handvoll Menschen, die sich kaum Hütten leisten konnten. Von Menschen, denen der Glaube das Wichtigste war. Viel wichtiger als das eigene Leben … oder das ihrer Familien.
Es mag unglaublich klingen, dass gottesfürchtige Christen in einem Ort lebten, der Lucifer hieß. Doch eins muss gleich zu Beginn offenbart sein: Es waren unglaubliche Menschen.
Unglaublich grausame Menschen …
Willkommen in Lucifer.
***
Die Welt war fünf Quadratmeter groß und stank zum Himmel. Kahle Mauern, schmutziger Fußboden, ein vergittertes Fenster – kaum größer als ein Schuhkarton. Die schwere Tür bestand aus Stahl, und das mehrfach verstärkte Wellblechdach, auf das tagtäglich die texanische Sonne brannte, ließ die Luft im Inneren der kleinen Baracke Temperaturen erreichen, wie sie sonst im Krater von aktiven Vulkanen herrschen mochten. Die Scheiße im Eimer, der in der Ecke der Zelle stand, gärte schon fast. Fliegen schwirrten um sie. Es waren die einzigen Lebewesen in dieser Welt, abgesehen von Aaron.
In einem früheren Leben war er Aaron Beeman gewesen, Besitzer eines kleinen Gemischtwarenladens. Ganz Lucifer hatte ihn gekannt und gemocht. Alle hatten bei ihm eingekauft, alle hatten ihre Waren zu ihm gebracht und in seinem Laden den anderen Bürgern angeboten. Beeman’s Store war immerhin die einzige Anlaufstelle des Ortes, abgesehen von der Kirche und der Praxis des alten Arztes. Der einzige Laden in einem Umkreis von Hunderten von Meilen.
Doch jenes frühere Leben existierte nicht länger, nicht für Aaron. Es endete in der Nacht, als sie ihn holen kamen. Wie lange war das nun schon her? Er wusste es nicht. Zeit verlor ihren Wert, wenn sie nicht länger verging, sondern stillstand. Wenn Warten nur noch ein Synonym für Sterben war.
Seitdem machte Aarons Familie ohne ihn weiter, seine Frau Kate und die drei Söhne. Längst schon hatten sie ihn verstoßen, sich von ihm losgesagt und distanziert. Dennoch machte der Ort bislang einen weiten Bogen um Beeman’s Store, so hieß es. Aaron hoffte, dass sich das bald änderte – andernfalls würden Kate und die Kinder verarmen. Aber er ahnte, dass es sich bald ändern würde. Alles, was noch nötig war, damit Lucifer einen Schlussstrich unter die Sache zog, würde bald geschehen. Vielleicht sogar schon heute.
Denn heute war der Tag, an dem auch sein zweites Leben endete.
Aaron trat ans Fenster. Die Hitzezelle stand außerhalb der Ortsgrenzen, mitten auf freier Fläche. In der Ferne konnte er die Pritchard-Farm sehen, dunkles Holz und weite Zäune. Dahinter kamen die Berge. Die Luft flimmerte über der Ebene, also würde es wieder ein heißer Tag werden.
Seine Hände schmerzten wie verrückt. Aaron hob sie ins Licht und betrachtete die blutig-verkrusteten Wunden an den Fingerkuppen. Seufzend sah er zu der Stelle an der Wand. Die ganze Nacht hatte er versucht, sich mit bloßen Händen einen Weg aus der Zelle zu graben. Einmal mehr. Natürlich hatte es auch diesmal nichts gebracht, doch in der Nacht kam immer die Panik zu ihm zurück, und Panik ließ einen Mann mit dem Wahnsinn liebäugeln.
Sie werden mich töten, dachte Aaron Beeman einmal mehr.
Die Erkenntnis traf ihn nicht hart, nicht bei Tag. Jene Zeiten waren vorüber. In einer Welt, die aus stinkend kargen fünf Quadratmetern bestand, war selbst der Tod eine willkommene Erlösung geworden. Eine Hoffnung.
Näher, mein Gott, zu dir.
Zwei Stunden später kamen sie.
***
Beeman zuckte zusammen, als die schwere Tür aufglitt. Zwei Männer erschienen im Türrahmen, und er erkannte sie sofort. Bill Collins und Ted Sanders trugen dunkle Roben, zweifelsohne aus dem Fundus der HSCC und ernste Mienen zur Schau. Nichts an ihren Gesichtern ließ erkennen, dass sie den Angeklagten kannten. Mehr noch: dass sie erst vor wenigen Wochen mit ihm gezecht und gefeiert hatten. Andere Leben.
»Aaron Beeman?«, fragte Sanders. Sein Tonfall war ernst wie der eines Richters. Er verzog das Gesicht, denn der Gestank im Inneren der Hitzekammer schien ihn anzuekeln. Doch er fuhr tapfer in seinem Text fort. »Es ist Zeit.«
Beeman, der kauernd am Boden saß, stand auf. Er hatte gewusst, dass dieser Moment kommen würde. Vom ersten Tag an hatte er es gewusst. Dennoch schlug sein Herz plötzlich wie wild, und sein Mund wurde trocken. »Zeit wofür?«
»Du weißt, wofür«, schnaubte Collins. Der Zimmermann mit dem grauen Vollbart spuckte auf den Boden. »Stell dich nicht dümmer als du bist, Aaron. Dafür ist es zu spät.«
»Es ist für alles zu spät oder, Bill?«, entgegnete Beeman. Panik schwang in seinem Tonfall mit. Seine Fingerkuppen kribbelten, und seine Knie wurden weich. Schnell wechselte er das Thema. »Wie geht’s euch? Was machen Anne und die Kinder, Ted? Hat der Kleine noch immer Keuchhusten?«
Sanders schwieg. Doch seine Fassade der Gleichgültigkeit bekam Risse, und er sah beschämt zur Seite.
»Was macht ihr hier?«, setzte Beeman sofort nach. Flehentlich wandte er sich an die beiden Männer. Vor Stunden hätte er es selbst noch unmöglich gefunden, nun aber geschah es: Er feilschte um sein Leben! »Seht euch doch mal an. Ihr kennt mich! Verflucht, wir sind zusammen aufgewachsen!«
»Mit Flüchen kommst du nicht weiter«, tadelte Collins. Er trug ein Seil, das er nun präsentierte wie ein stummes Versprechen.
Doch Beeman ignorierte ihn. »Ich fluche, wann ich will, Bill. Das ist momentan echt das Letzte meiner Probleme.« Wieder sah er zu Sanders, dem weicheren Ziel. »Was macht ihr hier? Ich bin es, Ted. Ich. Kein Krimineller. Kein Ketzer oder Kinderschänder – ich!«
Collins trat vor. »Das reicht, Aaron.« Er hob das Seil und streckte die andere Hand nach Beeman aus. »Lass uns anfangen.«
Beeman wich zurück. »Womit anfangen, Bill?«, fragte er, obwohl er es wusste, und seine Stimme überschlug sich vor Furcht. Auch das überraschte ihn. Er hatte sich doch längst damit abgefunden. Warum jetzt die Panik?
Collins hatte genug. Grob packte er Beemans Handgelenke und band sie mit dem rauen Seil.
»Lass das«, rief Beeman. Er wich zurück und wollte gleichzeitig nach dem alten Freund schlagen.
Sanders kam ihm zuvor. Hart schlug der Zimmermann zu, direkt auf Beemans Schläfe.
Im ersten Moment sah der Gefangene Sterne. Die ganze Kammer schien sich vor seinen Augen zu drehen. Blinzelnd kehrte er in die Wirklichkeit zurück. »Ihr Monster«, keuchte er. »Ihr Sünder.«
»Der einzige Sünder hier bist du, Aaron«, brummte Collins. Er hatte sein Opfer inzwischen fachgerecht verschnürt und hielt das freie Ende des Seils in der Hand wie eine Hundeleine. »Und was jetzt kommt, hast du dir selbst zuzuschreiben. Du hast falsch gehandelt, niemand sonst.«
»Falsch?« Beeman schluckte schwer. Tränen stiegen ihm in die Augen. »Was ist falsch daran, den Teufel beim Namen zu nennen? Was ist falsch daran, den Mund aufzumachen, wenn der Leibhaftige sein Antlitz zeigt, und ›nein!‹ zu brüllen?«
»Du hast den Reverend einen Teufel genannt«, sagte Sanders. Tadelnd schüttelte er den Kopf.
»Mehr noch«, betonte Collins. »Du hast ihn sogar töten wollen. Mit der Schrotflinte bist du mitten in den Sonntagsgottesdienst gestürmt. Hast du wirklich geglaubt, wir ließen dich schießen? Auf Reverend Shingleton?«
»Er ist der Leibhaftige!«, schrie Beeman. Da waren die Worte. Er sagte sie tatsächlich noch im Angesicht des Todes. Sie waren die einzige Wahrheit, die er noch kannte. »Der Satan wohnt unter uns, und ihr Narren seht es nicht!«
Wieder schlug Sanders zu.
Beeman ging zu Boden. Er spuckte Blut und hustete, dann drehte er den Kopf zu seinen Peinigern. »Ich vergebe euch«, flüsterte er. »Nicht ihm, nicht dem Teufel drüben in der Kirche. Aber euch. Ihr seid nicht mehr als seine Werkzeuge. Er spielt mit euch – mit diesem ganzen elenden Ort!«
»Genug geschwafelt.« Collins trat vor, packte Beeman an den Schultern und zog ihn auf die Beine. »Los.« Dann gab er ihm einen Schubs.
Beeman taumelte in Richtung der offenen Stahltür. Jenseits der Schwelle lag die Freiheit … und dahinter der sichere Tod.
Tränen rannen ihm über die Wangen, als er ins Freie und in den Wüstenmorgen trat. Frische Luft drang in seine Lunge, und für einen kurzen Moment musste er die Augen schließen, weil die Sonne ihn blendete. Er war seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr im Freien gewesen.
Dann erstarrte er.
Vor dem Jeep, der an der staubigen Straße in den Ort wartete, stand kein Geringerer als der Reverend.
Der ehrenwerte Carl Roderick Shingleton trug einen makellos sitzenden schwarzen Anzug. Die teuren Halbschuhe waren staubfrei, der Priesterkragen saß. Mit seinen ein Meter neunzig war der Prediger eine eindrucksvolle Erscheinung. Die Glatze und der lange, graumelierte Bart unterstrichen dies sogar noch. Niemand wusste, wie alt Shingleton wirklich war. Die Falten in seinem Gesicht und das graue Haar ließen ihn großväterlich wirken, aber die stahlblauen, funkelnden Augen und die Energie, die diesem Mann innewohnte, zeichneten ein ganz anderes Bild.
»Aaron«, grüßte der Reverend. »Guten Morgen, mein Sohn.«
Beeman wich instinktiv zurück. Er wollte fliehen, zur Not auch mitten in die Wüste. Alles war besser als die Gegenwart dieses Teufels mit den blauen Augen. Doch die zwei Handlanger des Reverends hielten ihn fest. Es gab keine Rettung mehr.
Shingleton trat zu ihm. »Es ist gut, Aaron«, sagte der Reverend ruhig. »Es geht alles seinen Weg. Du musst nichts mehr tun.« Dann lächelte er. »Lass uns beten.«
»Nein«, keuchte Beeman. Panik durchflutete seinen geschundenen Körper. »Nein!«
Collins trat ihm von hinten in die Kniekehlen. Sofort ging Beeman zu Boden. Hart schlugen seine Knie auf dem knochentrockenen Erdboden auf.
»So ist es richtig«, lobte der Reverend. Shingleton streckte die Hand aus und legte sie auf Beemans schweißnassen Kopf.
Sofort wich Beeman ihm aus. Er wehrte sich nach Kräften, wild wie ein Hengst. Doch Sanders und Collins waren bereit. Sie hielten ihn fest, und Shingleton konnte endlich die Hand auflegen.
Der Prediger von Lucifer, Texas, schloss die Augen. Seine Gesichtszüge entspannten sich, und sein Tonfall wurde ruhig und gelassen. »Herr, unser Hirte«, begann er. »Schau in Liebe auf die Seele deines Jüngers Aaron. Segne sie heute und an jedem Tag mit deiner schrankenlosen Gnade. Es ist nicht der Geist, der sich an dir versündigt, sondern der fehlerhafte Körper. Erlaube deinem Jünger, sich an diesem neuen Tag ein für alle Mal von seinem sündhaften Leib loszusagen und einzugehen in deine göttliche Herrlichkeit.«
»Amen«, sagten die beiden Handlanger.
Beeman weinte inzwischen unbeherrscht. Es geschah wirklich! Tagelang hatte er gewusst, dass es so geschehen würde. Nun aber kam ihm die Situation absolut willkürlich vor. Grauenvoll und endgültig.
»Der Herr ist mein Hirte«, brach es aus ihm hervor, während Tränen seine Sicht raubten, und jeder Knochen in seinem Körper schmerzte. »Mir wird nichts mangeln.«
Es war das Gebet eines hilflosen Kindes. Eines Menschen, dem nichts mehr blieb – nur der Glaube. Der wahre Glaube, nicht der Perversion eines Carl Shingleton.
Doch eben dieser Shingleton lächelte triumphierend. »So ist es recht«, sagte er. »Guter Junge, Aaron.«
Dann packten sie ihn, zerrten ihn auf die Beine und zum Jeep. Die letzte Reise des Aaron Beeman begann.
***
Gabrielle »Gabby« Pritchard liebte den sonntäglichen Gottesdienst. Die Vierzehnjährige hatte bereits ihr ganzes Leben in Lucifer verbracht, fernab von der restlichen Welt mit ihren sündhaften Verlockungen und Makeln. Die feierlichen Sonntagsmessen waren für sie die Krönung all dessen, was ihr Zuhause besonders machte. Hier war sie geboren, hier kannte sie ihren Platz. Der Globus mochte ein wilder, gefährlicher Ort sein – voller von Menschenhand erschaffener Katastrophen und Risiken. Doch in Lucifer, jener kleinen Gemeinde weit draußen in der Wüste, war die Welt in Ordnung. Und sie würde es bleiben. Dafür sorgten die Bürgerinnen und Bürger schon selbst, geführt und geleitet vom ehrwürdigen Reverend. Auch Gabby trug ihren Teil zum Gelingen des Ortes bei, seit sie ein kleines Kind war. Jeder tat das. Denn nur wer mithalf, war ein wahres Kind Gottes.
Nur manchmal – nachts, wenn sie nicht schlafen konnte – fragte sich Gabby, ob da nicht noch mehr war. Da draußen, jenseits der Ebene.
Und sie fragte sich, warum sie den Reverend einfach nicht leiden konnte. Es beschämte sie zutiefst, dass sie so empfand. Immerhin war er ein Mann Gottes und über jeden Zweifel erhaben. Doch sie konnte es nicht abstellen. Carl Shingleton machte ihr Angst. Und sie ahnte, dass sie mit der Angst nicht alleine war. Es gab nur niemand zu.
Stattdessen versammelte sich ganz Lucifer artig in der großen weißen Kirche im Ortskern, wann immer die Glocken läuteten. Es gab jeden Tag einen Gottesdienst, und jeden Tag kam die Gemeinde zusammen, doch sonntags waren die Messen besonders festlich. Den Rest der Woche kamen die Männer schmutzig von den Feldern und aus den Werkstätten, heute trug jeder seinen besten Zwirn zur Schau.
Als Gabby mit dem Knecht Eric vor der HSCC vorfuhr, stand Sally Reid bereits an der Treppe, die zum Kircheneingang führte. Sallys Eltern unterhielten sich mit der Küsterin und begrüßten Freunde. Gabby, deren eigene Eltern heute nicht von der Farm weggekonnt hatten, winkte Sally zu, dann stieg sie aus dem Wagen. Gemeinsam mit Eric betrat sie die große Kirche.
Das Innere der HSCC stand dem beeindruckenden Äußeren in nichts nach. Die makellos weißen Wände, die hohen und hellen Fenster, die Heiligenbilder und das gigantische Kreuz aus Edelholz unterhalb der Decke – Gabby fühlte sich immer großartig, wenn sie ihre Kirche betrat. Der Chor stand bereits rechts vom Altar, und der Organist griff beherzt in die Tasten. Sanfte, sakrale Klänge erfüllten den angenehm kühlen Raum.
Nervös sah Gabby sich um. Ihre Eltern fehlten zum ersten Mal, und sie hoffte, dass es niemandem auffiel. Ma und Pa konnten einfach nicht anders. Das Vieh kalbte, und mindestens zwei Leute wurden auf der Farm gebraucht. Andernfalls liefen sie Gefahr, ihre beste Kuh zu verlieren. Das Risiko durften sie nicht eingehen, es hätte sie zu viel gekostet.
Als die Sitzbänke gefüllt waren, verstummte die Musik. Ein Scheinwerfer ging an, obwohl es taghell war, und beleuchtete den Altarraum. Hinter dem Altar war der rote Vorhang, und dahinter wartete er.
Reverend Carl Shingleton trat durch den Vorhang. Sofort applaudierte die Gemeinde. Gabby hörte alte Damen seufzen und junge Männer jubeln. Shingleton blieb stehen und nahm den Jubel schweigend entgegen. Er deutete eine leichte Verbeugung an, sonst verzog er aber keine Miene. Erst als der Applaus langsam verstummte, öffnete er den Mund, und verborgene Lautsprecher trugen seine Stimme durch den ganzen Saal.
»Danke. Ich danke euch, Schwestern und Brüder. Danke.«
Abermals setzte der Chor an. Zwei, drei Takte lobpreisender Musik folgten den Worten des Reverend.
Shingleton fuhr fort. »Der Herr sei mit euch, liebe Freunde. Er segne euch an diesem, an seinem Tag – und an allen Tagen.«
»Amen«, echote die versammelte Dorfgemeinschaft.
Der Reverend ging zum Altar und breitete die Arme aus. Der Gottesdienst begann. Gabby sang mit und betete mit, wie jeden Tag. Dabei ließ sie den Blick durch den Raum schweifen und sah all die vertrauten Gesichter. Selbst die Beemans waren gekommen, Kate mit den drei Jungs. Das freute Gabby, denn seit der Sache mit Mr Beeman hatte sie die anderen nicht mehr gesehen. Heute saßen die Beemans sogar in der ersten Reihe! Auch das war neu.
Es war nach dem Evangelium, als der Gottesdienst plötzlich eine ungewohnte Richtung einschlug. Der Chor stimmte gerade das übliche Halleluja an, als der Reverend abwinkte und ihn verstummen ließ.
»Brüder und Schwestern im Herrn«, sagte er in sein dezent am Kopf angebrachtes Funkmikrofon. »Dies ist ein besonderer Tag, der Tag unseres Erlösers. Und besondere Tage verdienen besondere Taten.« Er drehte sich um und sah zum roten Vorhang. »Jetzt, Mr Collins.«
Sofort wurde der Vorhang aufgezogen. Und die Gemeinde keuchte auf.
Gabby hob die Hand zum Mund, um den Schrei zu unterdrücken, der in ihr aufstieg. Großer Gott, war das etwa Mr Beeman?