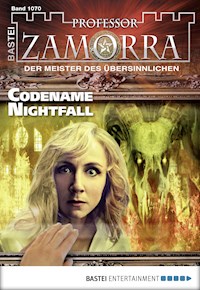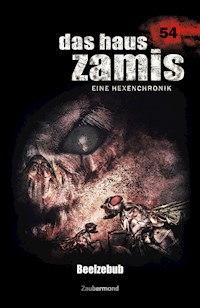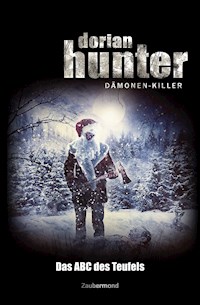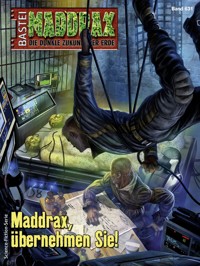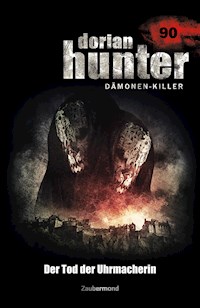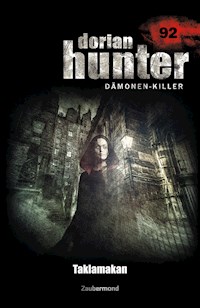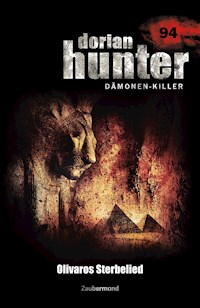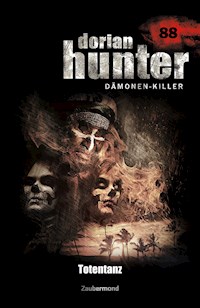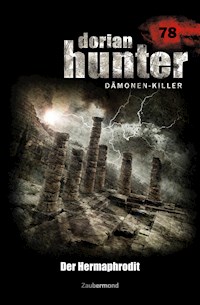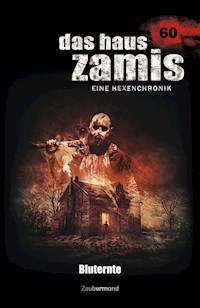1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Der Knochenpalast stand an der Klippe. Mächtig und gewaltig ragten seine verderbten Türme dem orangenen Himmel entgegen. Beißender Rauch zog an seinen Mauern vorüber, und hinter ihm loderte und wogte das endlos scheinende Höllenmeer. Ein Ozean aus Lava.
Nicole Duval kauerte in einer Bodensenke nahe dem breiten Tor des Palastes und wappnete sich. Sie wusste, was sie zu tun hatte. Doch sie gab sich keinen Illusionen hin: Es würde ihr sicherer Untergang sein.
Denn niemand schlich sich ungestraft in den Palast, um Stygia zu töten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Personenliste
Die vergessene Kolonie
Kapitel 1 Nach dem Ende
Kapitel 2 Verloren zwischen Höllenfeuern
Kapitel 3 Gefangen im Nirgendwo
Kapitel 4 Dunkle Vorboten
Kapitel 5 Im Zeichen der Furcht
Kapitel 6 Das Nadelöhr
Kapitel 7 Der Sturm vor der Ruhe
Kapitel 8 Tötet Stygia!
Leserseite
Vorschau
Impressum
Die Hauptpersonen des Romans sind
Professor Zamorra: Der Meister des Übersinnlichen
Nicole Duval: Zamorras Partnerin und Kampfgefährtin
Ellen Driver: Leiterin des Ministeriums für Transdimensionale Sicherheit
Sophia Page: Teenagerin, die ein Opfer der Dämonen wurde
Stygia: stellvertretende Fürstin der Finsternis
Sam McTaggart: Ex-Soldat und Dämonenjäger
Finn Cranston: Vampir aus Washington D.C.
Die vergessene Kolonie
von Simon Borner
Sondrak-Kolonie, Maine. Anno Domini 1593
Da sind Monster im Wald!
Ja, ich kann sie nicht anders nennen. Sie sind keine Männer, nicht einmal Menschen. Und wenngleich sie von kleinem Wuchs sind, ist die Gefahr, die in ihnen schlummert, alles andere als klein.
Dreizehn Teufel standen heute vor mir. Sie traten aus den Schatten. Ich sah Höllenfeuer in ihren Augen, sah ihre gewaltigen Zähne, und wenngleich sie mich noch nicht berührt hatten, glaubte ich bereits zu spüren, wie sie ihre entsetzlichen Klauen in meinen wehrlosen jungen Leib schlugen.
Sie sind die wahren Herren dieser neuen Welt!
Wenn wir denn einen Tyrannen erdulden müssen, so möge er ein dieser Aufgabe entsprechender Gentleman sein. Eine Axt soll uns den Kopf abschlagen, nicht das Hackebeil eines tumben Schlachters.
Lord Byron
Kapitel 1Nach dem Ende
Tal der Loire, Frankreich
Der Mond war voll und rund. Fahles Licht ergoss sich über das stille Tal der Loire, und die Sterne am nächtlichen Firmament funkelten so hell, als wollten sie einander übertrumpfen.
Francine Delons Lächeln war ebenfalls hell ... und ganz schön lasziv.
Die Sechzehnjährige aus dem kleinen Dorf Saint-Cyriac unterhalb von Château Montagne liebte die Nacht. Vor allem dann, wenn sie ihr Gelegenheit gab, sich mit ihrem Freund in die Wälder nahe des Flusses zu schleichen, ohne dass die Erwachsenen es merkten.
»Nicht so schnell«, rief Gaston. Er hatte Mühe, mit Francine Schritt zu halten, die barfüßig über die Uferwiesen lief. Oder tat er etwa nur so? »Ich bin ein alter Mann, ma chère. Vergiss das nicht. Ich komme bei solch einem Tempo nicht mehr mit.«
»Du bist knapp achtzehn«, widersprach sie neckend und drehte sich zu ihm um. »Das ist nicht alt.«
Gaston lachte nun ebenfalls. Sein sommersprossiges Gesicht strahlte nahezu im Mondschein, und sein wunderschönes Haar wirkte noch dunkler als am Tag. »Das sieht dein Vater aber anders. Für den bin ich viel zu alt.«
Das stimmte leider. Francines alter Herr – der Handwerker Jean-Pierre Delon – war ausgesprochen engstirnig, wenn es um den Umgang seines ach so wohlerzogenen Töchterchens ging. Jean-Pierre hielt den zugereisten Gaston für einen triebgesteuerten Tunichtgut. Und sein einziges Kind war selbstredend ein wahrer Engel.
Die Wahrheit sah in beiden Fällen natürlich ganz anders aus, aber kein Argument der Welt konnte den engstirnigen Jean-Pierre davon überzeugen.
In Wahrheit treffen Gaston und ich uns in der Mitte, dachte Francine bei der Erinnerung. Er ist weit weniger wüst als Papa denkt ... aber ich bin weit weniger artig.
Sie lächelte, als sie die Hand zum Saum ihres T-Shirts führte. Langsam hob sie ihn an und zog sich das dünne Kleidungsstück mit dem Superheldenaufdruck ruckartig über den Kopf. Blasses Mondlicht fiel nun auf ihre blanken Schultern. Sanfter Wind strich über ihre Haut.
»Dann beweise uns doch das Gegenteil«, lockte sie ihren Freund, der sie aus weit geöffneten Augen anglotzte. »Zeig uns, wie jung und stark du in Wirklichkeit bist ... und fang mich endlich!«
Dann lief sie weiter und ließ das Avengers-Shirt achtlos fallen. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie Gaston es auffing und ihr grinsend folgte. Die Jagd, die Francine begonnen hatte, setzte sich fort.
Die Sechzehnjährige folgte dem Lauf des Flusses, der im Mondschein funkelte wie ein verzaubertes Band. Rechts und links von ihm wurden die Uferwiesen nun spärlicher. Erstes Buschwerk säumte das leise säuselnde Wasserband, und wenige Dutzend Meter weiter begann der Wald. Auf ihn hielt Francine zu, während sie sich nach dem Shirt nun auch ihres BHs entledigte.
»Wo willst du hin, ma chère?«, stöhnte ihr ungeduldiger Verfolger. »Was machst du mit mir?«
Francine sah über die nackte Schulter zu ihm, ohne stehen zu bleiben. »Find's doch heraus«, lockte sie ihn und ließ den BH fallen. »Wenn du kannst.«
Dann lief sie in den Wald und die dunklen Schatten.
Sofort wurde es kälter ...
Oder bildete sie sich das nur ein? Ihr war, als sei die Temperatur hier zwischen den hohen Bäumen deutlich niedriger als draußen auf den Wiesen. Und warum kribbelten plötzlich ihre Fingerkuppen so arg? Das taten sie sonst doch nur, wenn sie sich in Gefahr wähnte.
Doch der Loire-Ausläufer, dessen Band sie folgte, plätscherte friedlich neben ihr her. Überhaupt wirkte die Szenerie unfassbar idyllisch. Die hohen Bäume ringsum waren wie eine schützende Wand, die Francine vor neugierigen Blicken verbarg, und der Wald ein Labyrinth für Liebende, in dem man sich verstecken konnte ... und in dem allerhand geheime Dinge möglich wurden, wenn man es zuließ.
Genau das hatte Francine vor. Diese Nacht würde der Wald nie vergessen.
»Aber ich vertraue auf deine Diskretion, klar?«, warnte sie eine nahe Eiche. Dann kicherte sie über die eigene Albernheit.
Einen Herzschlag später packte eine Hand nach ihrer Schulter.
»Hab ich dich«, sagte Gaston keuchend. Sein Atem ging schwer, doch sein Blick funkelte heller als das Mondlicht auf dem Wasser. »Und jetzt wollen wir mal sehen, wer hier alt ist.«
Francine kicherte noch, als er sie mit sanfter Bestimmtheit zu Boden zog, auf das weiche Moos am Ufer des flüsternden Flusses.
Die Hände waren überall.
Gaston Marceau hatte Mühe, sich zu bremsen. Francines Berührungen brachten ihn fast um den Verstand. Seit einer herrlichen Ewigkeit tollten sie nun schon auf dem Waldboden umher, streichelten einander, neckten sich, und nur die stille Nacht leistete ihnen Gesellschaft. Doch so sehr Gaston ihr Liebesspiel auch genoss, so sicher war er sich in einer Sache: Wenn sie nicht bald in den Turbo schalteten, passierte ihm ein peinliches Missgeschick. Wegen ihrer Hände.
»Du«, schnaufte er und suchte im Dunkel ihr Gesicht. Das Sprechen fiel ihm schwer, weil ihm das Denken schwer fiel. »Du musst aufpassen ... Ich ...«
»Ich muss aufpassen?«, betonte die Handwerkerstochter amüsiert. »Na, das wüsste ich aber, Monsieur Marceau. Meiner Ansicht nach musst du vielmehr ...«
Sie kam nicht dazu, den Satz zu beenden. Irgendetwas irritierte sie plötzlich.
»Was hast du?«, wunderte er sich, als sie von ihm abließ.
Francines Blick ging zur Seite, in Richtung Fluss. »Nanu?«
»Francine?«
Sie richtete sich auf, schob ihn von sich.
»Francine?«, wiederholte Gaston. »Was ist denn?«
Das nackte Mädchen kauerte nun auf den Knien. Suchend ging ihr Blick zu den Schatten am Flussufer. »Hörst du das denn nicht? Da ruft doch jemand!«
Wie bitte?
Gaston runzelte die Stirn. Die einzigen Geräusche, die er vernahm, waren das Plätschern des Wassers und das Rauschen seines eigenen, noch immer aufgepeitschten Blutes in seinen Ohren.
Francine sah ihn tadelnd an. »Ist das von dir? Planst du hier etwa einen Streich? Ich schwöre dir, Monsieur: Wenn einer deiner blöden Kumpels hier in den Büschen hockt, um mich zu erschrecken, dann hast du mich heute Nacht zum letzten Mal angefasst!«
Gaston schüttelte den Kopf. »So'n Quatsch. Hier ist niemand außer uns. Und ich höre auch kein Rufen, absolut nichts.«
Francine schnaubte ungläubig. Dann kroch sie näher auf den Fluss zu. »Gleich hier vorn, da muss es herkommen. Habt ihr hier ein Walkie Talkie vergraben, oder wie geht das? Irgendeinen kleinen Lautsprecher im Ufergras oder ...«
Sie verstummte so plötzlich, als hätte sie der Blitz getroffen. Von einem Moment zum anderen versteifte sich ihr Körper, just als sie über den Rand des Ufers und ins glitzernde Wasser des Loire-Ausläufers blickte.
Und mit einem Mal ging alles ganz schnell.
Gaston Marceau traute seinen Augen nicht, als das Grauen begann. Und erst als es vorüber war, begriff er, dass die panischen Schreie, die er dabei vernahm, von ihm selbst stammten ...
Little Bear Island, Maine
Es war die Wut, die ihn trug.
Der Kampf gegen die Übermacht der Dämonen ging schon so lange, dass Professor Zamorra inzwischen jede schmerzende Faser seines Körpers einzeln spürte. Merlins Stern, sein magisches Schutzamulett, zog seine Energie aus Zamorras Kraftreserven – und von denen war nur noch erschreckend wenig übrig. Jede neue Konfrontation mit den Ausgeburten der Hölle – jenen unheimlichen Wesen mit den Lavakörpern und den brennenden Augen, die unerbittlich auf ihn einstürmten und ihn töten wollten – schwächte ihn und forderte ihn aufs Neue.
Doch die Wut war stärker als das bleierne Gefühl in seinen Gliedern. Stärker als die Anstrengung, stärker als die Erschöpfung.
Sie hatten ihm Nicole genommen. Seine Partnerin und Vertraute.
Dafür würden sie bezahlen!
Zamorra neigte nicht zu Jähzorn, auch Rachsucht war ihm fremd. Doch in diesen dramatischen Minuten im Inneren des alten Leuchtturms drangen Urinstinkte in ihm hoch, die er sich unter normalen Umständen nie zugetraut hätte. Er sah rot, und im Schein dieser Farbe hatten sich schon ganz andere Männer verloren. Manche sogar für immer.
Ellen Driver schlug sich noch immer wacker. Die Leiterin des Ministeriums für Transdimensionale Sicherheit begleitete Zamorra auf diesem Abenteuer und hatte bereits mehrere Magazine ihrer mattschwarzen Glock auf die niederen Dämonen auf den unteren Treppenstufen abgefeuert. Wieder und wieder drückte sie ab, und ihre Schüsse rissen klaffende Wunden in die Leiber der blasphemischen Kreaturen.
Stygias Kreaturen.
»Wir haben es beinahe geschafft«, rief Driver gerade.
Ihre Glock hatte einen weiteren Dämon aus dem Gleichgewicht gebracht. Der Aufprall der Kugel aus nächster Nähe riss den kindsgroßen Teufel, dessen Haut aus brüchigem Stein zu bestehen schien, von den Füßen. Ehe der Dämon begriff, wie ihm geschah, taumelte er auch schon seitlich von der schmalen Treppe, die im Inneren des Leuchtturms nach unten führte.
Nun war ein neues Stück des mühsam erkämpften Weges frei. Frei für die Flucht der beiden letzten verbliebenen Menschen.
»Mir nach«, sagte Zamorra zwischen zusammengebissenen Zähnen und trat voraus, während unter ihm schon neue Ungeheuer nachrücken wollten.
Die Blitze des Amuletts erwischten die Wesen sofort. Merlins Stern sonderte sie nahezu blind ab, und sie zuckten gleißend in alle Richtungen. Trafen sie einen Gegner des Dämonenjägers, hüllten sie ihn in einen Kokon aus weißer Magie ein. Binnen weniger Sekundenbruchteile vernichteten sie den Widersacher so – spurlos und für immer.
Zamorra ging weiter. Die Macht des Amuletts war wie ein Malstrom in seinen Eingeweiden, der alles verschluckte, was in seine Nähe kam. Wie ein Energievampir, der ihn von innen heraus aussaugen wollte. Ein einziger Mentalbefehl genügte eigentlich, das gierige Monstrum in seine Schranken zu verweisen. Doch Zamorra durfte das Amulett noch nicht bremsen, denn das Erdgeschoss und der Ausgang des Turmes waren nicht mehr fern. Falls Driver und er es bis dorthin schafften, hatten sie vielleicht eine Chance. Und das ging nur mit Merlins Stern.
»Da ist die Tür, Professor«, rief die Regierungsangestellte. »Sehen Sie sie? Sie steht noch immer offen. Es sind nur noch ein paar Meter!«
Zamorra sah sie nicht. Schweiß troff in seine Augen und erschwerte ihm die Sicht, die von der immensen Anstrengung ohnehin arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Immer wieder tanzten gelbe Punkte vor ihm, und die Welt jenseits der magischen Schutzblase schien im Gewitter der grellweißen Blitze regelrecht zu schmelzen, wenn er sich zu stark auf sie konzentrierte. Auch sein Gehörgang hatte Federn gelassen, denn in seinen Ohren rauschte das Blut zum donnernden Takt seines wild schlagenden Herzens. Zamorra wusste, dass all diese Sinnesstörungen auf seine geleerten Kraftreserven zurückgingen und er sich, sollte ihm die Gelegenheit gegönnt sein, schnell wieder erholen würde. Doch er wusste auch, dass diese Erholung noch ein reiner Konjunktiv war – ein »würde«, kein »wird«. Erst mussten Driver und er es bis ins Freie schaffen. Danach konnten sie weitersehen, vielleicht.
Nur noch ein paar Meter, sagte er sich. Nur noch ein paar.
Es wurde sein Mantra für den gesamten Rest des Weges. Zamorra klammerte sich an Drivers Worte wie ein Ertrinkender an ein Rettungsseil. Sie trugen ihn voraus, als die niederen Dämonen der dunklen Fürstin einen letzten großen Angriff versuchten.
Gleich ein halbes Dutzend von ihnen stürmte knurrend auf den Meister des Übersinnlichen zu. Driver, die hinter Zamorra stand und im Kielwasser des Amulettträgers ein wenig Deckung fand und trotzdem schon aus zahlreichen kleinen Wunden blutete, schoss zielsicher und riss gleich zwei der grauenvollen Wesen von den Füßen. Merlins Stern erledigte den Rest.
Dann waren sie draußen. Zamorra wusste kaum, wie ihm geschah, als er durch die offene Eingangstür des alten Leuchtturms schwankte. Die Nacht draußen auf Little Bear Island begrüßte ihn wie einen alten Freund, doch er erkannte sie kaum wieder. Atemlos und schnaufend taumelte er voraus, getragen von Beinen, die rein reflexhaft weitergingen. Und von seiner Wut.
Bis zum Waldrand waren es einige Dutzend Schritte. Erst als sie dort ankamen, blieben Driver und Zamorra stehen und drehten sich um.
Der Leuchtturm an der Klippe wirkte fast idyllisch. Die Sterne des nächtlichen Firmaments funkelten über ihm, und an der steilen Klippe, die direkt hinter ihm begann, brach sich das sanft wogende Wasser des atlantischen Ozeans. Von den niederen Dämonen fehlte jede Spur.
»Ha...« Zamorra keuchte und wischte sich mit dem Handrücken über die schweißfeuchte Stirn. Das Amulett an seiner Brust kühlte langsam ab, die schützende Energieblase war fort. »Haben wir sie alle erledigt?«
»Vielleicht«, sagte Driver. Die Frau aus Washington D.C. stützte sich an einem Baumstamm ab, als fürchte sie, sonst einfach ins Gras zu sinken. Blut tränkte ihr Shirt, und eine schmale Wunde verunzierte ihre linke Wange. »Aber so war es früher schon mal, als ich hier war. Ich floh bis zum Wald, und von einem Moment auf den anderen waren die Monster fort. Sie kommen einem nicht nach. Vermutlich sind sie auch nicht mehr da drin, Professor. Wenn wir jetzt in den Turm zurückkehren würden, wären keine mehr da.«
Zamorra seufzte und setzte sich auf einen umgestürzten Stamm. »Ehrlich gesagt, kann ich mir Schöneres vorstellen, als den Turm erneut zu betreten«, gestand er. Dankbar spürte er, wie sich sein Körper allmählich erholte. Es würde dauern, bis er zu alter Kraft zurückgekehrt war, doch es würde gelingen. »Aber früher oder später müssen wir das vielleicht, Ellen. Um sie zu finden.«
Driver nickte stumm. Ihre Miene verfinsterte sich bei der Erinnerung an die vergangenen Minuten – und an die Falle, in die ihre beiden Begleiterinnen hineingeraten waren.
Im zweiten Obergeschoss des Leuchtturms von Little Bear Island gab es ein kleines, scheinbar leeres Zimmer. An seiner Wand hatte bis vor wenigen Minuten eine krude und Jahrhunderte alte Zeichnung geprangt, die Stygia zeigte – die einstige Fürstin der Finsternis. Als die Monster kamen und Zamorras kleines Team angriffen, war die Zeichnung plötzlich in einem krank machenden, unangenehm grünen Licht erstrahlt – und dieses Licht hatte Stygias Arme und Oberkörper »geboren«! Die dunkle Fürstin hatte aus der zweifellos schwarzmagisch aufgeladenen Zeichnung heraus in die Wirklichkeit eingegriffen und nach Nicole Duval und dem Teenager Sophia Page gegriffen. Ehe Zamorra und Driver reagieren konnten, hatte die Teufelin aus der Leuchtturmmauer die beiden überrumpelten Frauen zu sich ins Licht gezerrt und war mit ihnen verschwunden. Nun prangte nicht einmal mehr die Zeichnung an der Wand. Auch sie war einfach verschwunden.
Genau wie damals die Sondrak-Kolonie, dachte der Professor.
Driver schien ähnliche Überlegungen anzustellen. »Glauben Sie, Nicole und Sophia sind jetzt an dem Ort, wo auch die Siedler damals endeten?«
»Möglich«, antwortete er. »Aber da können wir nur spekulieren. Niemand weiß, was aus der britischen Kolonie wurde, als sie am Halloween-Abend des Jahres 1593 von hier verschwand. Wir wissen nur, dass damals eine Horde von Lavadämonen über sie hergefallen ist. Und dass heute kein einziges Gebäude aus jenen Tagen mehr steht, nicht einmal die Grundmauern. Keines ... nur der Leuchtturm.«
»Wir wissen auch, dass das Meer in jener Nacht ›brannte‹«, sagte Driver. »Erinnern Sie sich? So ähnlich stand es im Tagebuch der Siedlerstochter, das Sie in Harkers Mills gefunden haben. Das Mädchen schrieb von seltsamen Lichtern über dem Ozean, von einem brennenden Himmel ... Ich vermute, sie hat damit ausdrücken wollen, was auch wir vorhin gesehen haben: die Klippe über dem Vulkanmeer. Die Schwefeldämpfe. Das lodernde Feuer.«
Zamorra erinnerte sich an die Vision. Sophia Page und ihre jungen Freunde hatten sie ebenfalls beschrieben, weil sie sie bis in ihre Träume verfolgt hatte.
Bist du jetzt dort, Nici?, fragte er sich. Hat Stygia dich und Sophia dorthin entführt? Und wo ist dort überhaupt? Er zermarterte sich das Hirn, ohne nennenswert weiter zu kommen. Es sah aus wie ein Winkel der Hölle von einst. Aber ist das überhaupt möglich?