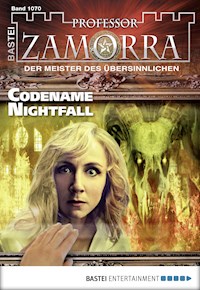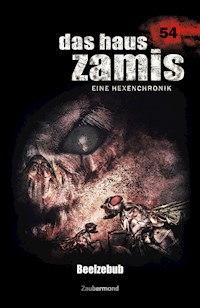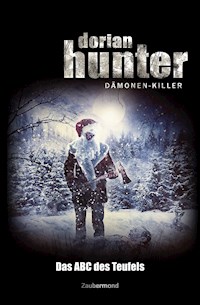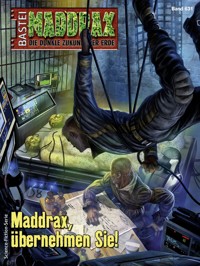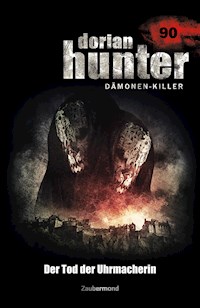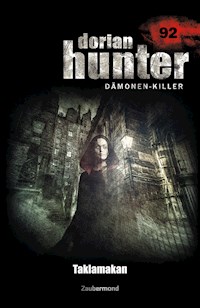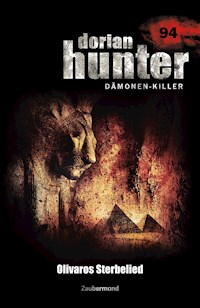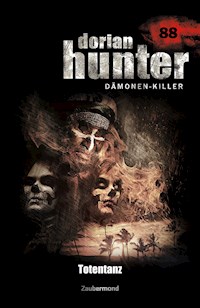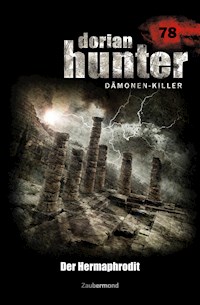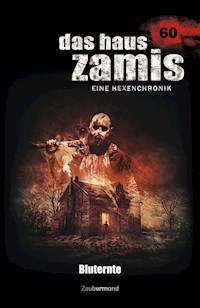1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Sie war allein in einer Geisterstadt, und sie hatte Angst!
"Mr Marks?", wiederholte sie. "Sind Sie das da draußen?"
Langsam ging sie näher, zurück in Richtung Treppenhaus. Dabei hielt sie die Flasche hoch erhoben, um jeden Augenblick damit zuschlagen zu können.
Raschelte da nicht etwas? Atmete da jemand?
Endlich kam sie zur offenen Tür der Kellerbar. Irrte sie sich, oder fiel da draußen ein Schatten auf den Gang? Der Schatten eines auf sie lauernden Menschen?
"Mr Marks?", fragte Ashley Bridges ein letztes Mal.
Dann sprang sie über die Schwelle.
Und schrie!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die Götter der Polarnacht
Leserseite
Vorschau
Impressum
Die Götter der Polarnacht
von Simon Borner
Sie hatte Angst, verflucht! Sie war allein in einer Geisterstadt, und sie hatte Angst!
»Mr Marks?«, wiederholte sie. »Sind Sie das da draußen?«
Langsam ging sie näher, zurück in Richtung Treppenhaus. Dabei hielt sie die Flasche hoch erhoben, um jeden Augenblick damit zuschlagen zu können.
Sie spitzte die Ohren. Raschelte da nicht etwas?
Atmete da jemand?
Endlich kam sie zur offenen Tür der Kellerbar. Irrte sie sich, oder fiel da draußen ein Schatten auf den Gang? Der Schatten eines auf sie lauernden Menschen?
»Mr Marks?«, fragte Ashley Bridges ein letztes Mal.
Dann sprang sie über die Schwelle.
Und schrie.
»Ich weiß nicht, was zur Hölle das da drin ist. Aber es ist wild und verdammt wütend!«
Das Ding aus einer anderen Welt, 1982
Kapitel 1Das Ding
1982
Shelly Dickens war auf einem fremden Planeten. Zumindest fühlte es sich so an.
Sprachlos und fasziniert ließ sie den Strahl ihrer Taschenlampe über die hohen Eiswände gleiten, die sie in nahezu allen Richtungen umgaben. Wo das Licht die Jahrtausende alte Eisschicht berührte, funkelte das Eis: eine ganz eigene Mischung aus Blau und Silber, Weiß und Gold. Auch das Eis schien aus einer fremden Welt zu stammen. So etwas Wunderschönes konnte die olle alte Erde doch nie und nimmer zustande bringen, oder?
»Krcht Erde an Shelly. Erde an Shelly. Meldest du dich vielleicht mal, oder was ist jetzt? Ich dachte, wir wollten loslegen. Krcht«
Shelly schmunzelte. Die Worte, die aus ihrem Walkie Talkie gedrungen waren, hatten so perfekt gepasst, als läse Thomas ihre Gedanken.
»Hey, Erde«, erwiderte sie und hob die Sprechmuschel dicht ans Gesicht. Atemwölkchen tanzten vor ihrem Mund, bei jeder neuen Silbe. »Es ist absolut atemberaubend hier drin. Unbeschreiblich schön.«
»Krcht Das mag ja sein, aber was ist mit den Eisbären? Du wolltest nachsehen, ob da Eisbären sind, Shel! Krcht«
Sie schüttelte den Kopf, auch wenn ihr Partner es nicht sehen konnte. »Hier sind keine Eisbären, Tommy. Hier ist überhaupt gar nichts, was uns gefährlich werden könnte. Nur Ruhe und Frieden.«
Dickens & Bell, so hieß ihre Produktionsfirma. Sie war klein und bestand nur aus zwei Festangestellten, die auch die beiden Bosse waren. Doch das junge Paar aus New York wollte es gar nicht anders haben. Shelly liebte die Freiheit, die sie und Tommy bei der Arbeit genossen. Sie waren niemandem Rechenschaft schuldig und konnten reisen, wohin sie wollten. Das Ziel musste nur interessant genug für eine Reportage sein, die man den »üblichen Verdächtigen« anbieten konnte. Die üblichen Verdächtigen waren Printmagazine wie der altehrwürdige National Geographic, aber auch Radio- und TV-Sender wie NPR oder die großen Networks. Seit ihrer Kindheit träumte die Achtundzwanzigjährige nun schon davon, einmal ihre eigene Natursendung im nationalen Fernsehen präsentieren zu dürfen. Und wer weiß? Vielleicht erfüllte sich ihr Traum ja doch noch eines Tages. An Tommy und ihr sollte es jedenfalls nicht scheitern.
»Krcht In Ordnung, dann komm ich jetzt ebenfalls rein. Ich bring die Kamera mit, okay? Krcht«
»Negativ, Tommy«, verneinte Shelly, einem spontanen Impuls folgend. »Ich komme wieder raus zu dir. Du, das hier müssen wir völlig neu aufziehen. Unser Drehplan war gut, das ist es nicht. Aber die Bilder hier ... Denen werden wir mit den alten Ideen echt kein bisschen gerecht. Warte kurz, ja? Dann überlegen wir uns neue.«
Er antwortete nicht. Wie immer, wenn sie ihn überrumpelte. Shelly seufzte leise – Ach, Tommy! –, dann löste sie sich wieder von der fremden Welt im Inneren der Gletscherhöhle und machte sich auf den Rückweg.
Seit drei Tagen waren sie und ihr Partner nun schon auf Spitzbergen. Die Reise zu den Gletschern im Sassen-Bünsow-Land-Nationalpark war Shellys Idee gewesen. Vor Jahren hatte sie eine Reportage darüber im Radio gehört und war sofort fasziniert gewesen. Und nun, da die Rezession ihrer kleinen Firma gehörig zusetzte, hatte sie die Idee wieder aus der Versenkung gekramt und Tommy überredet, mit ihr gen Norden zu fliegen.
Der erste Teil ihres Trips hatte sie vom Big Apple aus nach Oslo geführt. Dort hatten sie eine Jetlag-Nacht in einem schlechten Hotel verbracht und am nächsten Morgen Flieger Nummer 2 bestiegen, der sie nach Tromsö im Norden des Landes transportiert hatte. Ein weiterer Umstieg und ein paar kurze Flugstunden später waren sie in Longyearbyen gelandet, der so ziemlich einzig nennenswerten Siedlung im gesamten Archipel Spitzbergen. Das Duo hatte keinen örtlichen Guide, der sie durch die unbewohnten Weiten der Region führte. Zwar hatte es in Longyearbyen – einer Mehrere-Hundert-Seelen-Enklave in einer Bucht, zu der der hiesige Winzflughafen gehörte – Dutzende von Fremdenführern gegeben, die sich auf ankommende Touristen stürzten wie Geier auf frisches Aas. Aber sowohl Shelly Dickens als auch Thomas Bell fanden Reportagen nur dann wirklich gut, wenn die Reporter völlig unvoreingenommen und frisch auf einen Ort und eine Situation reagierten. »Wir sind die Augen und Ohren unseres Publikums«, sagte Tommy stets. »Die Leser, Hörer und Zuschauer wissen wenig über die Gegenden, in die wir vordringen. Also dürfen auch wir im Vorfeld nur wenig darüber wissen. Alles andere würde sich nicht authentisch anfühlen.« Auch dafür liebte Shelly ihn. Er war so herrlich pragmatisch.
Und er war ... fort?
»Tommy?«, rief die Achtundzwanzigjährige. Sie hatte den Ausgang der Gletscherhöhle erreicht und sah sich fragend um. »Bist du hier irgendwo?«
So weit das Auge reichte, sah sie nur Schnee und Eis. Die Ebene hier am Meer war felsig und karg. Letzteres war wenig überraschend, schließlich wuchs auf ganz Spitzbergen – Svalbard, für Einheimische – kaum mal ein Grashalm. Der Permafrost im Boden machte nicht nur Ackerbau, sondern auch simple Vorgärten nahezu unmöglich, vom zumeist rauen Wetter ganz zu schweigen. Es gab nur wenige Monate pro Jahr, in denen die Gegend grün wurde.
»Tommy!«, rief Shelly abermals. »Das ist nicht lustig, du Spinner. Wir müssen arbeiten, schon vergessen?«
Verwundert kratzte sie sich am Hinterkopf. Spielte er etwa Verstecken mit ihr? Da lag seine Ausrüstung, an derselben Stelle wie vorhin. Die zwei Schneemobile standen ebenfalls friedlich nebeneinander, die Taschen und Kisten mit dem Equipment – zwei Kameras, ein Mikrofonarm und die wohl klobigsten Akkus der Welt auch. Shelly sah das Gewehr an einer der Kisten lehnen, ebenso den Rucksack mit ihrem Zweipersonenzelt. Nur ihren Partner sah sie nirgends.
Ach, Tommy ..., seufzte sie innerlich. Einmal mehr. Dann griff sie zum Funkgerät.
»Erde an Tommy Bell. Verflixt, was treibst du? Ich bin hier, du Trottel, wo bist du?«
Sie hatte die Worte kaum ausgesprochen, da hörte sie den Schrei. Laut und gellend drang er an ihr Ohr, voller Leid und Schmerz.
Shelly wirbelte herum. Der Schrei war aus östlicher Richtung gekommen, irgendwo aus dem Gewirr aus eisbedeckten Felsen und tiefen Schluchten, vor dem sie stand. Nur sah sie seine Quelle nicht.
Tommy?, dachte sie besorgt.
»Warst du das?«, rief sie ins Funkgerät. Gleichzeitig lief sie los, dem Osten entgegen. »Scheiße, warst du das? Tommy? Red mit mir!«
Eisbären. Das musste es sein. In der kurzen Spanne zwischen ihrem Funkgespräch und ihrem Auftauchen aus der Höhle musste Bell von einem Eisbär überrascht worden sein. Die gewaltigen Raubtiere waren die Herren von Spitzbergen, das wusste hier oben jedes Kind. Ihretwegen verließ niemand das Haus ohne Gewehr; alles andere käme einem Spiel mit dem Tod gleich und war unfassbar riskant. Eisbären konnten jederzeit und überall auftauchen. Sie kannten keine Gnade.
Nach einigen schnellen Schritten durch den Schnee sah Shelly ihre Furcht bestätigt: Da waren Blutspuren am Boden! Sie führten weg von den Schneemobilen und hin zu den Felsen im Osten, wo weitere Gletscher- und wohl auch andere Höhlen warten mussten. Die Geschichte erzählte sich von selbst.
Obwohl ...
Eisbären erledigen ihre Opfer direkt, dachte Shelly. Trotz aller Furcht war noch ein rationaler Teil ihres Verstandes aktiv. Dieser Teil übernahm nun. Sie schleppen sie nicht Dutzende von Metern weit in ein Höhlenversteck. Warum sollten sie das tun? Es gibt hier draußen nichts, was ihnen gefährlich werden oder ihnen die Beute rauben kann.
Der Schrei wiederholte sich, schrill und unfassbar leidend. Er war kurz und endete in einem herzerweichenden Gurgeln. Shelly hätte die Stimme unter Tausenden wiedererkannt. Das war Tommy, natürlich. Wer sonst, hier draußen im Nichts?
»Hörst du mich?«, fragte sie in ihr Walkie Talkie. Die Hand, die es hielt, zitterte. Genau wie ihre Stimme. »Hörst du, Tommy? Ich komme. Ich habe das Gewehr, und ich komme zu dir. H... halte durch, okay?«
Er würde nicht durchhalten. Kaum jemand überlebte eine solche Attacke. Erst recht nicht ohne Waffe.
Verflucht, warum hast du dein Gewehr abgestellt?, dachte sie.
Dann gab sie sich selbst die Antwort. Weil ich dir gesagt habe, hier seien keine Eisbären ...
Tränen stiegen ihr in die Augen und drohten, ihr die Sicht zu vernebeln. Sie blinzelte schnell und versuchte, auch das weiche Gefühl in den Eingeweiden und Knien zu ignorieren. Sie musste jetzt stark sein, zum Teufel! Sie beide mussten das!
Shelly steckte das Walkie Talkie weg und nahm stattdessen das Gewehr von der Schulter. Mit geübten Handgriffen prüfte sie seinen Zustand. Es war geladen, selbstverständlich. Und es war bereit.
Sie setzte einen Schuss ab, kerzengerade in den Himmel. In den meisten Fällen hier auf Svalbard genügte das schon. Die Tiere erschraken dann vor dem lauten Knall und trollten sich dorthin, wo sie hergekommen waren. Aber in den meisten Fällen schossen die Menschen, bevor die Eisbären sich ein Opfer gepackt hatten. Nutzte so ein Warnschuss überhaupt noch, wenn das Tier schon im Blutrausch war?
Ich weiß es nicht, erkannte die Achtundzwanzigjährige. Ich weiß absolut gar nichts mehr. Ich ... ich will ihn nur nicht verlieren, verdammt!
Eis knirschte unter den Spikes an ihren Stiefelsohlen. Schneefall setzte wieder ein, erst leicht und dann immer stärker.
Sie war nun an den Felsen. Lud das Gewehr nach. Hielt es im Anschlag.
»Wo bist du?«, wisperte sie, dünne Atemwölkchen im dicken Schneefall. »Bitte, Tommy. Bitte sei hier.«
Dann sah sie ihn.
Thomas Bell lag rücklings am Boden, keine fünf Schritte von ihr entfernt und vor einem dunklen Höhleneingang im Fels. Das rechte Bein war seltsam angewinkelt, und seine Winterjacke wies einen breiten Riss auf, an dem seltsam schwarzer Schleim zu kleben schien. Eine Art dickliches Öl, das in der kalten Luft dampfte wie Säure. Oder waren das Schatten, die sich bewegten? Das Gesicht war blass wie der Schnee, bis auf das viele Blut. Und er atmete!
»Tommy!«, schrie Shelly.
Sie rannte los, vergaß den letzten Rest rationalen Denkens. Ihr Herz pochte wie wild. Im Nu war sie bei ihrem Partner, ging neben ihm auf die Knie und betastete ihn mit zitternden, vorsichtigen Händen.
»OhgroßerGottTommyneinneinbittenein«, drang es über ihre bebenden Lippen. Es gab keine Worte mehr, keine Pausen. Alles war eins in ihrer Angst, eins in ihrem grenzenlosen Entsetzen. »Daswirdwiederichbinhierdaskriegenwirschonhin.«
Er öffnete die Augen, schwer und langsam. Sah sie an. Es lag Erkenntnis in seinem trüb werdenden Blick – und unendlich viel Sorge.
»K... kein«, krächzte er, und die Worte schienen das Letzte zu sein, was er überhaupt noch zustande brachte. »Kein Eis...bär, Shel...«
Was? Shelly stutzte. »Was redest du denn da? Natürlich war das ein Eisbär. Was sonst sollte hier draußen lauern?«
»K... kein«, beharrte er und versuchte sich an einem Kopfschütteln, das jämmerlich versagte. Blut schoss ihm plötzlich aus dem Mund, und er hustete schwer. »Kein Eisb... Eisbär. S... sondern ...«
Dann wurden seine Augen groß. Im ersten Moment dachte Shelly, das sei nun der Tod. Doch dann begriff sie, dass er nicht ins Leere starrte – sondern auf etwas, das hinter ihr herankommen musste.
»Lauf!«, schrie Thomas Bell gellend.
Einen Sekundenbruchteil später wurde Shelly Dickens hinterrücks gepackt und meterhoch in die Luft geschleudert wie von der Faust eines erbarmungslosen Riesen.
Gegenwart
Pyramiden. Was für ein bescheuerter Name für eine Ortschaft!
Dylan Marks stand im Eingang des Svalbard Hotels und sah auf die rechteckigen Bauten hinab, auf den Platz mit dem schneebedeckten Lenin-Denkmal und auf die Berghänge, in denen noch immer die alten Minen vergangener Tage deutlich zu erkennen waren – mitsamt den Loren, Stiegen und Werkstätten.
Marks war nun seit zwei Tagen in seinem neuen Zuhause, und allmählich zweifelte der Neunzehnjährige aus Minnesota an seinem Verstand. Was in aller Welt war nur in ihn gefahren, als er sich entschloss, in dieses gottverdammte Nichts zu fliegen?
Der Job hatte verlockend geklungen, so viel stand fest. Und wahnsinnig lukrativ! In einer Studentenzeitung seines Colleges hatte Marks die Ausschreibung zuerst gesehen. Eine internationale Kette, die sich auf Backpacker-Hostels und zugehörigen Erlebnisurlaub für junge Leute spezialisiert hatte, war Eigentümer eines seit Jahren aufgegebenen Hotels in einer nicht minder aufgegebenen Bergbausiedlung der Russen geworden, mitten auf Spitzbergen. Um den Laden wieder flott zu machen, brauchte die Kette nun Freiwillige, die für mehrere Wochen nach Pyramiden – so der bescheuerte Name der Siedlung – kamen und nachschauten, was genau alles renoviert und optimiert werden musste. Die auf Probe wieder im ehemaligen Svalbard Hotel wohnten, gewissermaßen. Damit es eines nicht allzu fernen Tages wieder ein aktives Svalbard Hotel geben konnte.
Die neuen Eigentümer des von allen guten Geistern verlassenen Gemäuers ließen sich den Spaß etwas kosten. Auch das stand außer Frage. Marks, der stets knapp bei Kasse war und von Abenteuerlust durchdrungen, hatte zunächst an einen Druckfehler geglaubt, als er die Summe in der Anzeige sah. Doch die nette Dame am anderen Ende der Hotline hatte ihm die Zweifel schnell genommen.
»Nein, das ist schon sehr richtig«, hatte sie gesagt – in diesem warmen, herzlichen Ton. »Wir suchen Menschen, die sich mit uns ins Abenteuer stürzen, Mister Marks. Die für uns wochenlang alles stehen und liegen lassen und im absoluten Nichts leben, kurz vor dem Nordpol. Die gleichzeitig Hausmeister sind und Testgäste. Und natürlich wochenlang allein in Pyramiden.«
»Quasi wie Jack Torrance?«, hatte er gescherzt und sich im Geiste ausgemalt, was er mit dem ganzen Geld anfangen würde. Nie zuvor hatte man ihm für einen Ferienjob ein solches Vermögen in Aussicht gestellt. »Allein im schneebedeckten Hotel?«
Der Verweis war auf unfruchtbaren Boden gefallen. »Wie wer?«
»Jack Torrance«, hatte Marks verblüfft wiederholt. Wie konnte jemand den nicht kennen? »Stephen King? Shining? Klingelt da wirklich nichts bei Ihnen?«
»Bedaure«, hatte die nette Dame geantwortet, und es hatte tatsächlich wie Bedauern geklungen. »Ich komme nur selten zum Lesen. Und ... Nun ja. Ich bevorzuge Liebesromane, ehrlich gesagt.« Dann war sie schnell zurück zum Thema gekommen. »Aber in Pyramiden werden Sie viel Zeit zum Lesen haben, Mister Marks. Falls Sie das gerne tun. Da oben am Billefjord erwartet sie ja nichts und niemand. Nur die Reste der russischen Siedlung, die Ende der 1990er Jahre aufgegeben wurde. Die Bausubstanz der Häuser soll noch immer sehr gut sein, sagt man mir, und das gilt selbstverständlich auch für das alte Hotel. Es gibt sogar ein Schwimmbad in Pyramiden, wussten Sie das? Und einen Kindergarten, ein eigenes Hospital sowie einen großen Saal, in dem Filme gezeigt und Theaterstücke gespielt wurden. Onkel Ivan hatte seinerzeit an alles gedacht. Heute liegt all das natürlich brach.«
In der Tat, dachte Marks nun.