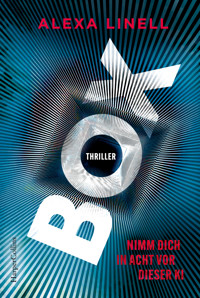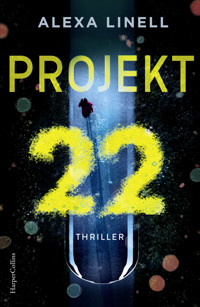
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wie fühlt es sich an, ein Experiment zu sein? Alice hofft auf ein normales Leben: Liebe, Freunde, Arbeit. Doch ihre Eltern wollen sie für immer in die Anstalt stecken. Eine berüchtigte Psychiatrie, versteckt unter der Zentrale eines Pharmakonzerns. In letzter Sekunde flieht Alice aus der elterlichen Villa im bayerischen Grünwald, trampt Richtung Norden und taucht in Hamburg unter. Aber die Hetzjagd auf sie hat längst begonnen. Angeführt von Viktor, dem brutalen Söldner, der für die Anstalt die Drecksarbeit erledigt. Denn Alice ist mehr als eine normale junge Frau ... Ein atemloser Thriller über die Grenzen der Wissenschaft und die Frage der eigenen Identität
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Copyright © 2023 by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von Büro Süd GmbH Coverabbildung von PIER, Choksawatdikorn/SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783749905409www.harpercollins.de
Prolog
Die schwarze Limousine beschleunigte.
»Was machen die denn?« Rönne gab ebenfalls Gas, verringerte zügig den Abstand.
Sein Kollege Kalle schaltete zum Haltesignal die Sirene an, die einen kurzen Heuler von sich gab.
Daraufhin hielt die Limousine endlich am Rand der Landstraße.
Rönne parkte den Streifenwagen mit laufendem Motor ein Stück dahinter. »Hoffentlich keine Wilderer.«
»In so ’nem Schlitten?«, fragte Kalle.
»Unauffällig.«
»Auch wieder wahr.«
Die Hände an den Waffen näherten sie sich vorsichtig der Limousine.
Das Fenster an der Fahrerseite glitt herunter.
»Was ist denn das Problem?«, fragte der drahtige Mann hinterm Steuer und verzog den Mund zu einem freudlosen Lächeln.
»Warum haben Sie nicht gleich angehalten?«, fragte Rönne.
»’tschuldigung, ich wollte Ihnen Platz machen. Habe nicht gecheckt, dass Sie meinen, dass ich anhalten soll.«
Rönne wechselte einen Blick mit Kalle, der zweifelnd das Gesicht verzog.
»Führerschein und Fahrzeugschein bitte.«
Nach kurzem Zögern reichte ihm der Fahrer beides. Er hatte schmutzige Finger, und Rönne roch abgestandenen Schweiß.
»Ihr rechtes Bremslicht ist defekt.«
»Oh, haben wir nicht bemerkt. Das wechseln wir aus, sobald wir wieder in der Firma sind, und fahren bei der nächsten Polizeistation vor, um es abnehmen zu lassen. Wir haben es nämlich eilig, wissen Sie.«
Der Beifahrer rieb seine Handflächen an den Oberschenkeln. Auch seine Hände starrten vor Dreck. Irgendwas stimmte hier nicht.
»Wohin wollen Sie?«
»Wir sind geschäftlich unterwegs.«
Rönne kontrollierte den Halter im Fahrzeugschein. »Für einen Buchholzer Spielhallenbetreiber? In dieser Gegend?« Er deutete mit dem Kinn in Richtung Gruber Forst.
Der Fahrer zuckte mit den Schultern.
»Steigen Sie bitte aus.«
»Warum?«
Rönne wechselte wieder einen Blick mit Kalle.
»Meinetwegen, verdammt noch mal«, fluchte der Fahrer. Er brachte neben seinem eigenen Geruch den Hauch eines weiteren, süßlich-stechenden mit.
Während er in einen Alkoholtester pustete, ließ Kalle auch den Beifahrer aussteigen und ging hinter ihm herum ums Auto. Die rechte Hand ruhte auf seiner Dienstwaffe, während er mit der linken ein paar Fliegen verscheuchte, von denen sich einige auf dem Kofferraumdeckel niederließen und zu den Rändern krabbelten.
Beide Männer hatten einen Bartschatten ums Kinn, aber der Fahrer war nüchtern.
Ein paar Kühe standen am Zaun und sahen ihnen wiederkäuend zu.
»Machen Sie bitte den Kofferraum auf«, sagte Kalle.
»Warum? Das ist doch Schikane«, sagte der Fahrer.
»Machen Sie schon! Haben Sie etwa im Naturschutzgebiet einen kapitalen Hirsch erwischt? Oder einen Wolf erschossen?«, fragte Rönne. Vor zwei Tagen hatten sie gleich drei Wilderer festgesetzt.
»Öffnen«, befahl Kalle ruhig.
Der Fahrer stakste zum Kofferraum. Der Beifahrer sah sich nervös um.
Die Fernbedienung piepste, der Kofferraum glitt auf, und die Fliegen hatten freie Bahn.
»Scheiße!«, flüsterte Rönne.
Acht Tage zuvor
Flügel müsste man haben. Und einen Panzer. Alice legte ihren Zeigefinger an die kühle Scheibe und schnitt dem Marienkäfer den Weg ab. Er stoppte. Hier nützen dir deine Flügel nichts. Sie schaute an Finger und Käfer vorbei aus dem Fenster des Autos.
Sie waren da. Vor dem großen Tor.
»Haben Sie einen Termin?«, fragte der Wachmann.
Vater bejahte und nannte Arzt und Uhrzeit.
»Ihren Ausweis, bitte.«
»Guter Mann, wir kommen seit zwanzig Jahren regelmäßig hierher«, beschwerte sich ihr Vater. »Zu oft für meinen Geschmack. Sie kennen uns. Von Hauensteins.«
Der Wachmann zeigte sich unbeeindruckt. »Ich habe meine Anweisungen.«
»Herrgott!« Vater zog sein Portemonnaie aus dem Jackett und reichte seinen Ausweis hinüber.
»Denk an die Demonstrationen, die es hier schon gegeben hat, Schatz«, sagte Mutter. »Die strengen Auflagen dienen unserem Schutz. Und dem Schutz der Patienten.« Sie hörte sich an wie die Sprecherin eines Werbeclips für GP-Tech, das diese Klinik hier in München als Außenstelle betrieb.
Sie durften passieren.
Alice bekam eine Gänsehaut. Jetzt geht es mir wie dir. Sie beobachtete den Marienkäfer, der immer noch einen Weg ins Freie suchte.
Vater lenkte den satt schnurrenden SUV auf die von Bäumen gesäumte Zufahrt, an deren Ende der schneeweiße Flügelbau mit den Sprossenfenstern inmitten eines blühenden Parks lag.
Sie hielten im Schatten eines Baumes, und ihre Eltern stiegen aus.
Alice hielt dem Marienkäfer den Finger hin, bis er draufkrabbelte.
Mutter klopfte gegen die Scheibe und winkte ungeduldig.
Alice konzentrierte sich auf den Marienkäfer und balancierte ihn auf dem Zeigefinger aus dem Auto. Er krabbelte bis zur Fingerspitze, fühlte die leichte Spätsommerbrise, die durch die Blätter ringsum strich, öffnete seinen gepunkteten Panzer und flog davon.
Viel Glück. Sie sah ihm nach. Wenigstens einer von uns ist frei.
»Alice!«, befahl Vater.
Sie ließ die Schultern hängen und trottete hinter ihren Eltern her zum Haupteingang der Klinik.
»Ach, der Rotschopf ist da«, murmelte die Oberschwester, als sie an Alice vorbeiging. Dann begrüßte sie lächelnd Vater und Mutter, trat hinter den Tresen und griff zum Telefonhörer. »Die von Hauensteins sind da.«
Alice strich sich die Haare hinter die Ohren und schaute zu Boden.
Ein großer, in weiß gekleideter Pfleger kam, um sie abzuholen.
»Der Termin mit Gerrard Knox findet morgen wie geplant um elf Uhr statt«, sagte die Oberschwester zu ihren Eltern.
Vater nickte gönnerhaft. Mutter lächelte unsicher und folgte Alice noch ein Stück in Richtung Fahrstuhl.
»Was für ein Termin?« Alice war nun auf der Hut. Fast immer musste sie nach solchen Besprechungen länger hierbleiben oder sogar in den Hauptsitz nach Buchholz, von Eingeweihten nur »die Anstalt« genannt. Sie war zu einem Routinetermin hier. Worüber wollten ihre Eltern mit Herrn Knox sprechen? Es war Jahre her, dass sie dem Arzt aus Versehen einen Finger gebrochen und dafür wochenlang in der Anstalt gebüßt hatte. Auch geritzt hatte sie sich lange nicht mehr. Alles nur, um nicht nach Buchholz zu den anderen zu müssen. Um Viktor nicht wieder zu begegnen.
»Es geht darum, wie deine Behandlung in Zukunft aussehen wird, Alice. Du bist längst volljährig. Wir können nicht ewig auf dich aufpassen. Bis morgen, Kind.«
Mutter lächelte zerstreut, scheuchte sie mit einer Hand in Richtung Fahrstuhl, ohne sie zu berühren, und eilte dann zurück zu Vater.
Er nickte Alice zum Abschied zu, die sich für das wappnete, was sie erwartete.
Neben dem Fahrstuhl hing ein Bild der Anstalt. Ein in der Sonne glitzernder Glaskasten und darunter stand in silberner Schrift: Institute for Genetic and Pharmacological Technology. Die zwei großen Tore und den doppelten Zaun mit dem NATO-Draht hatten sie nicht mit aufs Bild genommen.
Sie fuhr unter Bewachung des Pflegers nach unten und stieg in einem nach Desinfektionsmitteln riechenden, hell erleuchteten Gang aus.
Mutter sagte immer, ohne diese Klinik gäbe es sie nicht. Aber die Art, wie sie das sagte, hatte sich über die Jahre verändert. Früher hatte es sich froh und hoffnungsvoll angehört. In letzter Zeit klang sie eher resigniert und traurig. Besser wäre es gewesen, sie hätte sich eine Fortpflanzungsklinik gesucht, die nicht gleichzeitig eine psychiatrische Abteilung unterhielt, selbst wenn das zur Betreuung der oft verzweifelten Paare mit Kinderwunsch sinnvoll war.
Wie in Buchholz lag die Psychiatrie auch hier in München im Untergeschoss. Vielleicht hatte sich einer der bösen Geister nachts durch die Wände nach oben in Mutters luxuriöses Zimmer und in die unschuldige, werdende Seele ihrer Tochter geschlichen.
Der Mann neben ihr sagte nichts. Er begleitete sie durch die mit PVC ausgelegten Gänge und passte auf, dass sie nicht stehen blieb, mit niemandem sprach und nirgendwo unerlaubt abbog. Auf dem ganzen Weg spürte sie die Kameralinsen auf sich gerichtet, als wären es die kleinen, blanken Augen unzähliger Krähen. Der Mann führte sie in ein Behandlungszimmer und schloss die Tür von außen ab.
Sie setzte sich auf die Liege und sah zu dem kleinen, hoch angebrachten Fenster, das mit einer Folie verklebt war. Immerhin gab es ein Fenster.
Ob es dem Marienkäfer wohl gut ging? Hoffentlich hatte er einen schönen und sicheren Platz gefunden.
Der Raum war eng, aber hell erleuchtet. Sie versuchte, das Summen der Kamera links oben zu ignorieren, atmete konzentriert.
Was genau ihre Eltern morgen wohl mit Herrn Knox besprechen wollten? Sie hatte vor zwei Monaten ihr Abitur mit sehr guten Noten bestanden und wollte studieren. Psychologie vielleicht, oder Germanistik. Vater meinte, das könne sie mit ihrer Krankheit nicht, aber er irrte sich. Alle irrten sich. So krank war sie gar nicht. Sie wollte etwas lernen und ein eigenes Leben beginnen. Außerdem wären ihre Eltern bestimmt froh, sie aus dem Haus zu haben. Diese Fahrten zur Klinik waren ihnen längst lästig geworden, und sie mussten ständig auf Alice Rücksicht nehmen.
Die Zeit verging, und die Luft in dem kleinen Zimmer wurde stickig.
Was, wenn die Frau mit den dicken, fleischigen Lippen und den quietschenden Turnschuhen aus der Anstalt hierher versetzt worden war? Wenn sie jetzt in dieses Zimmer käme und sie anbrüllen würde? Sie war grob, laut und hatte Spaß daran, ihre Patientinnen am Bett zu fixieren. Wollte Alice ihre Tabletten nicht nehmen, fesselte dieses Miststück sie auch mal mit Kabelbindern an einen Stuhl, griff ihr in die Haare und riss ihren Kopf zurück, bis sie den Mund aufmachte.
Das Türschloss klickte, und Alice schreckte hoch.
Der Pfleger von vorhin kam herein, setzte sich auf einen Hocker, nahm ihren zerstochenen Arm, suchte kurz nach einer geeigneten Stelle und nahm ihr Blut ab. Er tat einfach seine Arbeit, deswegen pikste es nur einmal kurz. In der verfluchten Anstalt dagegen nutzten manche der Pfleger jede Gelegenheit, um den Patienten wehzutun.
Er stellte die immer gleichen Fragen und notierte ihre Antworten. Sie musste sich bis auf die Unterwäsche ausziehen, was ihr extrem peinlich war. Er schoss Fotos von allen Seiten.
Dann folgte das Wiegen. Zu dünn.
Nachdem sie sich wieder angezogen hatte, brachte er sie zum MRT. Als könnte diese lärmende Röhre die lockeren Schrauben in ihrem Kopf finden.
Wieder wartete sie in einem kleinen, engen Raum darauf, abgeholt zu werden. Hier gab es nur schummriges Licht und wahrscheinlich keine Kamera. Ihr gegenüber standen mehrere abgeschlossene Schränke, und ganz links stapelten sich Kisten. Ihr Blick blieb an ihnen hängen. Die Dunkelheit in den Zwischenräumen der Kartons bewegte sich, langsam, wie zähflüssige Lava, und kroch auf sie zu. Sie schloss die Augen und atmete tief durch. Als sie die Augen wieder öffnete, waren die Schatten an ihren Platz zurückgekehrt.
Diesmal musste der andere Arm dran glauben. Für das Kontrastmittel.
Warum machten sie das mehrmals im Jahr? Was sollte sich verändert haben? Und wie lange sollte der ganze Mist noch dauern? Diese tollen, neuen Pillen hatten sie nicht geheilt. Warum also noch testen? Sie verstand den Sinn des Ganzen nicht, aber sie hatte aufgehört nachzufragen. Vor Jahren war sie dafür immer wieder wochenlang in der Anstalt in Buchholz gelandet. Manchmal tagelang in dem Erziehungszimmer ohne Fenster, schallisoliert, nur mit einem Klo, einem Waschbecken und einer Matratze. Das Licht wurde von außen gesteuert. Morgens weckte es grell und zur Nacht wurde es nur einmal kurz abgedimmt, bevor es fast ausging. Fast, weil die Kameras etwas Licht brauchten.
Sie lag ganz still in dem ohrenbetäubend lauten Gerät und träumte sich mit Limo und Sandwiches auf eine rot karierte Picknickdecke neben ihre beste Freundin. Weil sie keine Freundin hatte, stellte sie sich die mit den Sommersprossen aus ihren Pferdebüchern vor. Neben ihnen grasten ihre treuen Ponys.
Nach der Prozedur durfte sie nicht ins Wartezimmer, weil dort eine Leidensgenossin saß, die sie hier schon öfter gesehen hatte. Im Gegensatz zu den meisten anderen durften sie bei ihren Eltern leben und wurden nicht in der Anstalt verwahrt.
Zu gerne hätte sie sich mit der jungen Frau unterhalten. Freundschaft mit ihr geschlossen. Aber das war nicht erlaubt. Taten sie es doch und wurden erwischt, folgte prompt die Bestrafung. Das Erziehungszimmer zum Beispiel. Oder eine Fixierung am Bett über Nacht. Kein Umdrehen. Allem und jedem ausgeliefert. Feuer. Viktor.
Sie atmete gegen die aufkommende Übelkeit an und sah auf ihre Uhr. Erst zehn Minuten vorbei.
Der Raum, in dem sie bis zu ihrem Gespräch warten musste, war so klein, dass sie das Summen der Kamera hörte.
Dreißig Minuten.
Oder summte es bloß in ihrem Kopf? Das sagten sie ihr ständig. Dass es hier nur in einigen Räumen Kameras zur Sicherheit gab, aber nicht in den Patientenzimmern und nicht in ihrem Zimmer zu Hause. Es sei eine der typischen Wahnvorstellungen bei paranoider Schizophrenie. Doch das stimmte nicht. Sie hatte die Kameras gefunden. Ihre Eltern glaubten ihr nicht, überprüften es nicht einmal. Und weil Diskutieren, Weinen und Brüllen nicht halfen, sondern nur noch Schlimmeres heraufbeschworen, kniff oder kratzte sie sich. Manchmal schnitt sie sich an Papier. Um zu fühlen, dass sie nicht fantasierte. Wenn der Schmerz da war, war sie es auch.
Fünfunddreißig Minuten.
Vielleicht wussten sie es doch. Schließlich war es ihr Haus. Steckten sie so tief drin? Oder waren sie ebenfalls Opfer der Lügen, die ihnen erzählt wurden? Vielleicht sollte sie doch versuchen, eine der Kameras auszubauen. Egal, wie viel Ärger das für sie bedeutete. Dann hätte sie endlich einen Beweis, dann mussten sie ihr glauben.
Erst nach einer Stunde wurde sie abgeholt.
Man stellte ihr endlos viele Fragen. Manche davon erschienen ihr sinnlos. Was spielte es für eine Rolle, wie viel sie trank und ob ihr in letzter Zeit mehr Haare ausgefallen waren oder die Haut öfter juckte? Sie bekam seit Jahren das gleiche Medikament.
Manche ihrer Antworten musste sie sehr genau abwägen, um nicht wieder im Erziehungszimmer zu landen. Und manchmal log sie einfach: Meine Angst vor der Dunkelheit ist nicht mehr so schlimm. Ich schlafe besser. Ansonsten ist alles wie immer.
Sie hatte gelernt, sich durch die Verhöre zu schlängeln.
Als sie endlich fertig waren, zog sich ein dumpfer Schmerz von den Schulterblättern über den Nacken bis hinter die Augäpfel.
Man brachte sie auf ein kleines Zimmer, dessen hoch angebrachte Fenster blind und von außen vergittert waren. Vorhänge gab es keine. Mit ihnen könnte man sich erhängen. Auch in der offenen Abteilung war man vorsichtig.
Es gab ein Bett mit einem hochklappbaren Tischchen, einen Nachttisch und einen kleinen Einbauschrank. In dem winzigen Bad war alles fest montiert und bestand aus Materialien, die sich leicht abwischen ließen. Es roch nach Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
Das an die Tür gereichte Abendessen roch dafür nach nichts. Eine Scheibe blasses Formfleisch auf gräulichem Brot. Ein angetrocknetes Stück Gurke und ein eiskaltes Stück Tomate, gegen das ihre Zähne rebellierten.
Nach dem Abendbrot öffnete sie den Einbauschrank. Einer der Pfleger hatte – wie üblich – ihre Tasche ausgepackt, kontrolliert und ihre wenigen Habseligkeiten eingeräumt.
Sie zog den verwaschenen Pyjama an, den ihre Mutter seit Jahren aussortieren wollte. Abgetragen und geflickt. Voller kleiner, bunter Luftballons. Als könnten sie jederzeit davonfliegen. Ihr kleiner Bruder hatte damals einen Schlafbeutel mit demselben Muster gehabt. Er war Erlösung, Traum, Erfüllung und Hoffnung gewesen. Sie war nach vielen Fehlversuchen, Tränen und Mühen aufgrund künstlicher Befruchtung geboren worden. Er aber war ganz unverhofft und natürlich acht Jahre später entstanden, ein kleines Wunder, an das ihre Eltern längst nicht mehr geglaubt hatten.
Oft hatte er fröhlich das Händchen nach ihr ausgestreckt und vorsichtig nach einer Strähne ihres Haares gegriffen.
Als sie ihn damals fand, sein kleines Gesicht grau, die Augen trüb und erloschen. Sein schlaffer Körper lag wie der einer Puppe im Bett. Mutter brach bei dem Anblick zusammen. Die Notärzte. Die Anklage im Blick ihres Vaters. Sie hätte sofort mit ihrem Bruder getauscht. Aber der Teufel macht keine fairen Geschäfte.
Mit dem Ärmel wischte sie die Tränen fort.
Sie putzte sich die Zähne und legte sich ins Bett. Die Tür ließ sich von innen nicht abschließen. Wie ihre Zimmertür zu Hause hatte sie keinen Schlüssel, es gab keinen Fernseher, kein Radio. Immerhin konnte sie das Licht löschen, wann sie wollte. Also tat sie genau das und träumte sich zum Einschlafen wieder auf die Wiese zu ihrer besten Freundin, der Picknickdecke und den Ponys.
Es gibt Limo, Sandwiches, Salat und Obst. Die Ponys stibitzen die Äpfel. Es ist warm, und die Luft riecht nach frischem Gras. Sanft hangabwärts liegt ein See, und an dessen Ufer taucht eine Trauerweide ihre Astspitzen ins Wasser.
Es quietscht leise. Sie sieht sich nach einem Fahrrad um. Stattdessen kommt eine gedrungene Person mit strähnigen Haaren, fleischigen Lippen und weißer Krankenhauskluft über die Wiese auf sie zugestampft. Ihre weißen Turnschuhe sind ausgelatscht und quietschten bei jedem Schritt.
Nein, bitte nicht!
Alice schreckte hoch. Ein Krankenhausbett. Fenster. Die Klinik in München. Gott sei Dank. Dass ständig etwas Licht in ihr Zimmer fiel, hatte wenigstens den Vorteil, dass sie nicht im Dunkeln aus ihren Albträumen erwachte.
Draußen im Flur verloren sich quietschende Schritte. War diese schreckliche Frau vielleicht doch hierher versetzt worden?
Sie konnte weder abschließen noch etwas vor die Tür schieben, aber sie konnte alle Schlupflöcher verstopfen. Also schlich sie ins Badezimmer, rollte Klopapier ab und stopfte es in den Türschlitz am Boden.
Dann nahm sie ihren Zahnputzbecher aus Plastik, stellte ihn umgedreht auf den Boden an die vordere Türkante und legte zwei Zehn-Cent-Münzen so nah wie möglich an den Becherrand. Ein Glasbecher wäre besser gewesen, weil er Krach beim Umfallen gemacht hätte. Leider war Glas wegen der Scherben tabu. Sie hatten zwar alles durch die Kameras im Blick. Trotzdem hoffte Alice, dass ihnen das nichts nützen würde. Öffneten sie die Tür, sollten die Münzen zu Boden fallen.
Sie schlüpfte wieder ins Bett.
Hätte sie bloß ein paar von ihren Büchern mitnehmen dürfen. Zu Hause standen sie schon in Zweierreihen. Wenn sie sich in eine schöne Geschichte einlesen konnte, träumte sie meist davon. Wenigstens ein schöner Traum.
Zuerst wachte sie stündlich auf. Dann jede halbe Stunde. Um fünf Uhr morgens nahm sie Becher, Münzen und Klopapier weg und wartete auf das Wecken um sechs.
Lautes Klopfen ließ sie hochfahren.
»Frühstück in fünfzehn Minuten«, rief eine giftige Frauenstimme.
Wo? Was? Ach so. Alice ließ sich wieder aufs Kissen fallen, seufzte und rollte sich schwerfällig aus dem Bett. Vor zehn Minuten hatte sie zuletzt auf die Uhr gesehen.
Im Halbschlaf zwang sie sich zur Eile. Die Zähne putzte sie unter der Dusche.
Das Frühstück war fast wie das Abendessen. Statt Gurke und Tomate gab es eine noch überwiegend grüne Banane und statt der Wurst Käse. Jedenfalls sah es so aus. Sie würgte das Brot hinunter und spülte mit lauwarmem Tee nach.
Danach ging es wieder in einen Behandlungsraum. Eine Kappe mit Kabeln wurde ihr über den Kopf gestülpt und weitere Elektroden ins Gesicht geklebt. Sie musste sich Bilder auf einem Monitor ansehen, Fragen beantworten und ein paar Geschicklichkeitsübungen absolvieren.
Hinterher war ihr Nacken steinhart vom Starren. Und da war auch wieder der dumpfe Schmerz hinter ihren Augäpfeln. Sie schloss die Augen, drückte sachte mit den Fingern gegen die Lider. Das half ein wenig.
In einer halben Stunde hatten ihre Eltern den Termin mit Herrn Knox.
Alice trottete neben dem Pfleger her, der gestern schon auf sie aufgepasst hatte, und starrte dabei zu Boden.
Hoffentlich durfte sie irgendwo studieren oder eine Ausbildung machen. In letzter Zeit hatte sie sich so viel Mühe gegeben, nicht aufzufallen, alles richtig und es jedem recht zu machen. Sie wollte ein ganz normales Leben führen. Freunde finden, einen Hund aus dem Tierheim adoptieren, sich verlieben, Geld verdienen.
Hauptsache, weit weg von der Anstalt. Und weit weg von …
Alice sah ein Paar schwarze Schnürstiefel, die an ihr vorübermarschierten.
Viktor!
Abrupt blieb sie stehen und sah sich hektisch um. Der Pfleger griff fest ihren Arm und führte sie wortlos weiter.
Alice entdeckte Herrn Knox, der hinter ihr durch eine Tür ging. Er trug feine dunkelbraune Lederschuhe zu einem braunen Nadelstreifenanzug.
Viktor war nirgendwo zu sehen.
»Ich muss mal«, sagte sie, als sie an der Damentoilette vorbeikamen.
»Beeil dich.« Der Pfleger bezog vor der Tür Stellung.
In einer der Kabinen setzte sie sich auf den Klodeckel, legte den Kopf in die Hände und wartete, bis der Schwindel vorüber war.
Dann atmete sie durch, stand auf und drehte den Entriegelungsknopf.
Die Tür schlug ihr entgegen, sie fiel auf die Klobrille zurück. Viktor packte sie mit einer Hand an der Kehle, die andere griff ihren Oberarm. Für einen Schrei bekam sie nicht genug Luft. Er zog sie aus der Kabine und drückte sie gegen die gekachelte Wand gleich daneben. Verzweifelt versuchte sie, ihn wegzudrücken, strampelte mit den Beinen, obwohl sie spürte, dass ihn genau das erregte.
»Da sind wir also wieder«, flüsterte er ihr ins Ohr, schob seine Hand in ihre Hose und versenkte mit einem bösen Grinsen seine Finger in ihr.
Sie schlug um sich. Er verstärkte den Griff um ihren Hals. Ihr wurde wieder schwindelig.
Plötzlich ließ er ihren Hals los, zog die Hand aus ihrer Hose, drückte sie aber weiter mit seinem Körper gegen die Wand. Sein Atem roch scharf nach Chili und Zwiebeln. In sein Gesicht hatten sich Falten eingegraben, und graue Strähnen mischten sich in sein schwarzes Haar. Dabei konnte er kaum älter als achtzehn Jahre sein.
»Ich habe es nicht eilig. Wir sehen uns ja bald öfter«, flüsterte er, durchbohrte sie mit einem langen Blick aus seinen stahlgrauen Augen und trat zurück.
Sie stolperte zur Tür und schlüpfte hinaus. Der Pfleger wich ihrem Blick aus, sagte nichts. Dabei wusste er genau, was passiert war. Trotzdem würde er nicht nachsehen, denn er hatte mindestens genauso viel Angst vor Viktor wie sie. Alle hatten Angst vor ihm. Außer Herr Knox und Herr Sendhausen.
Wieder in ihrem Zimmer, setzte sie sich zitternd aufs Bett und hoffte, dass ihre Eltern sie abholten, bevor Viktor ihr einen weiteren Besuch abstattete.
Hier war sie Viktor nie zuvor begegnet. Hatte er nur Herrn Knox begleitet? Oder hatte er einen eigenen Auftrag? Und warum sollten sie sich bald öfter sehen? Sie wollte ihn nie wiedersehen!
Vor ein paar Jahren hatte er schon einmal einen unbeobachteten Moment genutzt, um über sie herzufallen. Damals war er noch ein Teenager gewesen. Er war älter geworden. Und bestimmt schlimmer.
Sollte sie es jemandem erzählen? Würden sie ihr diesmal glauben? Sicher nicht. Jedes Mal, wenn sie von einem Übergriff erzählte, taten sie es als Übertreibung, Wahnvorstellung oder Aufsässigkeit ab. Auch ihre Eltern. Die Ärzte und Pfleger redeten es ihnen ein. Gezeigt wurden nur die schönen, hellen Zimmer, nicht die dunklen Löcher, in die man sie steckte. Selten trug sie Verletzungen davon und wenn, fanden sie immer eine unverfängliche Erklärung dafür. Und wer viel redete, wurde genauso oft und hart bestraft. Also hielt sie den Mund.
Die Türklinke bewegte sich, und ihr brach sofort der Schweiß aus.
Der große Pfleger winkte sie heraus. Erleichtert griff sie nach ihrer Reisetasche und folgte ihm. Ständig sah sie sich um, hatte das Gefühl, von allen angestarrt zu werden, und atmete auf, als sie ihre Eltern sah, die sich gerade von Gerrard Knox verabschiedeten.
»Überlegen Sie es sich«, sagte er zu ihnen und lächelte gewinnend.
»Das werden wir«, sagte Vater. Mutter nickte und zeigte ihr Gesellschaftslächeln.
Herr Knox ging lässig an Alice vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen.
Sie widerstand dem Drang, Mutters Arm zu greifen und sie zum Ausgang zu zerren, denn seit sie kein Kind mehr war, lehnte Mutter ungebetenen Körperkontakt ab.
Zum Glück hatte es Vater eilig, und keine fünf Minuten später saßen sie im Auto. Doch die Stille im Wagen wog schwer.
»Worum ging es in dem Gespräch?«, fragte Alice, obwohl sie Angst vor der Antwort hatte.
Mutter wollte sich zu ihr umdrehen, aber Vater sagte: »Wir reden später darüber.«
Mutter sah ihn kurz an und setzte sich wieder gerade hin. »Ja, erst müssen wir noch etwas miteinander besprechen, dein Vater und ich.«
»Ich will nicht wieder dorthin. Es geht mir gut.«
»Es ist nur zu deinem Besten, mein Kind«, erwiderte Mutter resigniert.
»Wenn diese blöden Pillen so toll wären, müsste ich da längst nicht mehr hin«, murmelte Alice.
»Wärst du nicht in diesem Programm, säßest du längst in einer geschlossenen Abteilung, junge Dame. Also sei etwas dankbarer«, sagte Vater.
Sollte sie ihnen von Viktor erzählen? Beim letzten Mal hatte Vater Beweise für ihre Behauptungen gefordert, und als sie ihm keine liefern konnte, war er wütend geworden: »Ich will nichts mehr davon hören. Niemand glaubt dir diese wahnwitzigen Geschichten.«
Sie hatte die ganze Zeit geweint. Mutter hätte sie fast in den Arm genommen, legte ihr aber nur die Hand auf die Schulter und sagte: »Das passiert doch alles nur in deinem Kopf, Schätzchen.«
Auch diesmal hatte sie keine Beweise.
ERSTER TAG
1.
Alice saß mit zwei dicken Kissen im Rücken in der weißen Villa ihrer Eltern auf dem Bett.
»Der Tee ist fertig, Liebling«, sagte Mutter im Erdgeschoss. Wahrscheinlich war sie auf dem Weg ins Wohnzimmer.
»Sehr gut«, sagte Vater.
Die Hintertreppe, an der ihr Zimmer im ersten Stock lag, wirkte wie ein Verstärker. Hoffentlich vergaßen ihre Eltern die Flügeltüren zum Flur zu schließen, dann konnte sie mithören, was die beiden zu besprechen hatten.
Unten klirrte feines Porzellan.
Alice’ Füße wurden kalt, aber sie schlüpfte nicht unter die Decke.
»Die neue Therapie, von der Herr Knox sprach, wird ihr guttun«, sagte Vater.
Noch mehr Pillen? Andere Pillen? Hauptsache, sie musste nicht in die Anstalt.
»Und das Programm im Anschluss«, sprach er weiter, »mit dem Alice auf ein Studium oder eine Ausbildung vorbereitet werden soll, erscheint mir sehr ausgereift. Sie kann in einer Wohngruppe leben und endlich ihre sozialen Kompetenzen ausbauen. Alle Teilnehmer werden ärztlich überwacht und an ein selbstständiges Leben herangeführt. Ich halte das für die beste Alternative, die wir im Moment haben.«
»Wahrscheinlich hast du recht«, sagte Mutter. »Die Zimmer sahen sehr schön aus auf den Bildern, und das Gebäude steht direkt neben dem Institut, sodass es keine langen Wege gibt. Außerdem haben sie das Kursprogramm extra auf die besonderen Bedürfnisse ihrer Schützlinge abgestimmt.«
»Siehst du.«
Wohngruppe? In der Anstalt? Das war eine Lüge. Es gab nur wenige kleine Zimmer für die Ruhigen und dafür umso mehr Einzelzellen für die anderen, in deren Wänden sich die Angst und der Schmerz der Insassen festsetzte.
Nachts löste sich diese dunkle Energie aus den Betonporen, kroch einem flüsternd in die Ohren und legte sich auf Mund und Nase.
Das hatte Viktor also gemeint, als er davon sprach, dass sie sich wiedersehen würden.
Sie zog ein Stück Unterlippe von innen zwischen die Zähne und kaute darauf herum.
Keine Klinik, keine Anstalt, keine Therapien mehr! Nie mehr! Dann beweg dich! Sie schlüpfte in ihre weißen Ballerinas, lief ums Bett und blieb unentschlossen stehen. Sie roch das Waschmittel und die verschwitzte Wolle ihres Pullovers.
Ihre Eltern verließen sich auf die Ärzte der Anstalt, aber denen traute sie schon lange nicht mehr. Wenn die Medikamente, die sie nehmen musste, so neu und toll waren, warum war sie dann nicht gesund und munter und reiste durch die Welt? Sie hatte oft über Flucht nachgedacht. Doch wohin? Sie kannte nur ihre Eltern, die kleine Privatklinik in München und die Anstalt. Nie durfte sie allein hinaus, besaß trotz des Luxus, in dem sie lebte, nur ein paar Münzen, und sie konnte nicht Auto fahren.
Sie brauchte einen Plan. Aber ihr Hirn war vor lauter Panik wie gelähmt.
»Wenn es nicht klappt, hat sie hier ihr Zimmer, in das sie zurückkehren kann«, sagte Mutter gerade.
Bullshit!
Bei jedem Aufenthalt in der Anstalt fürchtete sie, für immer bleiben zu müssen. So wie die vielen anderen, deren Zustand sich dort verschlechterte, bis sie gar nicht mehr gesehen wurden. Also, was jetzt? Abhauen. Egal wohin. Erst mal weg. So weit wie möglich.
Sie sah auf ihre Uhr, und ihr stiegen die Tränen in die Augen. Das kleine runde Ziffernblatt war schwarz mit goldenen Punkten statt Ziffern. Darüber wölbte sich randlos das Glas. Nach dem Tod ihres kleinen Bruders war es der einzige Kauf gewesen, bei dem sie und Mutter noch einmal zueinandergefunden hatten. Sie wischte sich die Tränen mit dem Ärmel ihres Pullovers von den Wangen und überlegte, wie sie aus dem Haus und vom Grundstück kommen könnte. Rund um die Uhr stand ein Wagen der Anstalt auf der anderen Straßenseite in der Nähe des Tores. Normalerweise nur mit einer Person besetzt. Ab und zu checkten sie die Kameras in ihrem Zimmer, die es angeblich nicht gab.
Ständig im Haus wollten ihre Eltern niemanden von GP-Tech haben. Damit verschafften sie ihr unabsichtlich mehr Bewegungsfreiheit und Zeit. So konnte Alice leichter entkommen. Und dann? Auf der einen Seite die Sackgasse, auf der anderen der Mann im Auto. Lief sie quer über das Grundstück, würde er sie sehen. Ihre Eltern genauso. Sie musste an ihm vorbei. Ungesehen.
Unmöglich. Es gab nur wenig Deckung, und mit dem Auto würde er sie schnell eingeholt haben.
Sie musste ihn aus dem Wagen locken. Die Karre lahmlegen. Dabei würde er nicht einfach zusehen. Also musste sie auch ihn ausschalten. Hätte sie eine dieser widerlichen Betäubungsspritzen aus der Anstalt, wäre sie um Hilfe rufend auf ihn zugestürzt und hätte sie ihm in den Arm gerammt. Aber das Zeug bekam sie nur, wenn sie ausflippte.
Ein Schlag gegen den Kopf?
Dazu brauchte sie eine Waffe. Außerdem ein Messer zum Zerstechen der Autoreifen.
Sie sah auf ihre schwitzigen, kalten Handflächen und überlegte, wo sie nach einer Waffe suchen könnte. Schusswaffen gab es in diesem Haus nicht. Jedenfalls hatte sie nie eine gesehen.
Keller und Dachboden waren zu weit weg.
Vorsichtig schlüpfte sie hinaus in den Flur. Er schien sich mit jedem Schritt, den sie zur Eingangshalle tat, länger zu strecken, als wolle er sie nicht dort ankommen lassen.
Türen reihten sich aneinander, und Schatten folgten ihr, mal wie gehorsame Hunde, mal sprangen sie davon, wenn sie sich nach ihnen umsah.
Rechts und links die Zimmer der Angestellten, die heute ihren freien Tag hatten. Zum Glück! Sie war früher schon verpfiffen worden und dafür im Erziehungszimmer der Anstalt gelandet.
Weiter vorne lag das Schlafzimmer von Mutter und Vater.
Davor gab es eines, das nicht verschlossen war. Alice griff nach der stumpfen Klinke, und die Tür schwang auf.
Der Luftzug scheuchte den Staub etlicher Jahre auf, schickte ihn in trägen Wirbeln über die Lichtfächer, die sich durch die halb offenen Jalousien der großen Sprossenfenster stahlen.
Alice stand auf der Schwelle und sah in den Flur.
Beobachtete sie jemand?
Niemand da.
Also trat sie ein und schloss leise die Tür hinter sich.
Es war das Zimmer ihres kleinen Bruders.
Auf den ersten Blick wirkte es wie ein großer Abstellraum.
Links stapelten sich ordentlich Möbel, Kartons und jede Menge Spielzeug, geschützt durch Plastikplanen. Sie erkannte das Kinderbett ihres Bruders, seine Schränke und den riesigen Teddy im Bett. Auch das rote, nie benutzte Elektroauto stand hier. Das konnte sie schlecht werfen.
Rechts vorne waren die Möbel des Kindermädchens gestapelt. Unter einer Plane.
In der Ecke hinten rechts lagerten ihre eigenen Kindermöbel unordentlich übereinander und ohne Abdeckung. Ein trauriger Haufen angeschwemmtes Treibholz. Alice sah wieder in das fröhliche Gesicht des Teddys. Es erinnerte sie an das Lächeln ihres zehn Monate alten Bruders.
Vater gab ihr die Schuld an seinem frühen Tod, obwohl sie ihn nur in diesem Bettchen gefunden hatte.
Sie rieb sich mit beiden Händen das Gesicht und atmete tief durch.
Sollte sie ein Tischbein abbrechen? Nein, das würde zu viel Lärm machen.
Das Krockettset!
Sie ging ans Kinderbett, hob vorsichtig die Plane an und entdeckte darunter das Set. Vorsichtig zog sie einen Schläger heraus und wog ihn in der Hand.
Sachte schwang sie ihn vor und zurück. Nicht schlecht.
Was war das für ein Geräusch? Kriechend, schleifend. Sie schaute auf den unteren Türschlitz, hielt die Luft an. Horchte. Nichts. Oder doch? Nein. Mit zittrigen Fingern öffnete sie die Tür einen Spalt und lugte hindurch.
Der Flur war zu beiden Seiten verwaist.
Sie schlüpfte hinaus, schlich zur Haupttreppe, drückte sich an die Wand und beobachtete die Eingangshalle. Kaute innen an der Unterlippe. Dort, wo sie noch nicht aufgebissen war.
Dann gab sie sich einen Ruck und stieg die Stufen hinab, als wandere sie über ein schlafendes Ungeheuer.
Die Kristalle des Kronleuchters bewegten das Licht.
Die Halle lag still, nur ihre Sohlen quietschten leise auf den weißen Marmorfliesen. Alice schlüpfte in die Küche und lehnte die Tür nur an.
Mit weichen Knien stützte sie den Rücken gegen die einzige freie Wand. Die Kälte der Kacheln und ihr vom Schweiß feuchter Pulli ließen sie frösteln. Sie bemühte sich, möglichst lautlos wieder zu Atem zu kommen.
Unbehaglich sah sie sich in der sterilen Küche um, deren Edelstahlflächen glänzten. Sie öffnete die Schublade mit den Messern. Manche waren mit einem Klingenschutz versehen und zusätzlich in Stoff eingeschlagen. Eines davon hatte Vater Mutter geschenkt, obwohl sie nie selbst kochte. Es hatte einen schön gemaserten Griff und vor allem eine zweischneidige, leicht nach oben geschwungene Spitze. Die Klinge war schmal und nicht zu lang. Zur Probe hielt sie den Stoff zwischen einer Hand und den Zähnen stramm. Er ließ sich mühelos zerteilen. Alice setzte das kühle Metall an ihren Arm, überlegte es sich dann aber anders. Sie schob den Schutz aus Plastik über die Klinge, steckte sich das Messer durch den Gürtel in die Gesäßtasche und zog ihren gelben Pullover über den Griff.
Weiter hinten führte eine schwere Metalltür in den weitläufigen Garten. Der Schlüssel steckte von innen im Schloss. Konnte sie diese Tür öffnen, ohne den Alarm auszulösen? Von der Treppe aus hatte sie das grüne Lämpchen gesehen. Die Alarmanlage war nicht scharf gestellt. Jedoch erinnerte sie sich dunkel daran, dass irgendwann von extra gesicherten Türen die Rede gewesen war. Leider war sie schon lange nicht mehr durch die Küche in den Garten gegangen. Sollte sie doch das Hauptportal nehmen? Nein. Aus dem richtigen Winkel konnte man es von der Straße aus sehen. Also schlich sie quer durch die Küche und wagte es. Der Schlüssel ließ sich leicht drehen und der solide Riegel nahezu lautlos zurückschieben. Die Tür schwang auf, die Nachmittagssonne schien ihr wärmend ins Gesicht und brachte den parkähnlichen Garten zum Leuchten.
Zuerst stand sie verdutzt in der Öffnung und starrte hinaus. Kein Alarm. Nur Vogelgezwitscher und ihr klopfendes Herz. War es wirklich so einfach?
Zögerlich trat sie über die Schwelle, schloss leise die Tür und hastete über die Schieferplatten, die kleinen Inseln gleich in verschlungenen Wegen durch den Garten führten. Erst hinter der nächsten Thuja duckte sie sich und schnappte nach Luft. Du musst ruhig atmen, gleichmäßig, sonst kommst du nicht weit!
Als sie zurückblickte, kamen ihr die Tränen.
Trotz allem, was geschehen war, liebte sie ihre Eltern. Denn früher hatten sie auch schöne Zeiten miteinander erlebt. Außerdem gab es sonst niemanden, der auf sie achtgab. Und dies war ihr Zuhause. Aber es blieb ihr keine andere Wahl.
Geduckt schlich sie von Baum zu Baum, vorbei an duftenden Rosen und Gladiolen, bis sie die Gruppe großer, alter Rhododendren hinter dem Nebengebäude mit den Garagen erreichte. Dahinter versteckte sie sich. Hielt jemand auf der anderen Seite Wache? Mied er den Kiesweg wegen des Knirschens und schlich deshalb über den Rasen oder durch die Beete?
Sie schloss kurz die Augen und lauschte.
Nichts.
Vorsichtig lugte sie um die Ecke, jederzeit auf dem Sprung. Vor den Garagen war niemand.
Mit eingezogenem Kopf huschte sie weiter, bis sie endlich bei der Buchsbaumhecke ankam, die das Grundstück begrenzte. Der strenge Geruch der Büsche ließ sie flacher atmen. Wie eine grüne Mauer türmten sich die Blätter vor ihr auf.
Eine Lücke, bitte, bitte eine Lücke!
Weit weg vom Haupteingang hatte sie Glück. Dort kümmerte eines der Bäumchen vor sich hin. Die unteren Äste waren licht und teilweise abgestorben, nur darüber war das Grün noch satt.
Sie zwängte sich durch die enge Öffnung, zog sich einen brennenden Kratzer am Arm zu und landete auf dem Seitenstreifen.
Zu beiden Seiten der Allee standen hohe Bäume, nur wenige der zurückgesetzten Häuser konnte man durch die dichten Hecken und Vorgärten sehen.
Links, ein Stück die gebogene Straße hinunter, stand die silberne Limousine, und halb auf der Motorhaube saß ein schlanker Mann. Er las Tageszeitung, die Füße lässig über Kreuz. Also musste sie ihn nicht aus dem Auto locken.
Sie warf einen Blick auf den Krocketschläger, den sie mit beiden Händen fest vor dem Körper hielt.
Auffälliger ging es kaum. Deshalb fasste sie den Schläger nur mit der rechten Hand und ließ das schwere Ende nach unten baumeln. Sie überquerte das Kopfsteinpflaster und schlenderte auf der anderen Seite Richtung Tor, als sei es völlig normal, einen Krocketschläger schwenkend die Straßen entlangzuspazieren.
Sie näherte sich dem Mann schräg von hinten. Obwohl der Sand unter ihren Füßen bei jedem Schritt laut knirschte, rührte er sich nicht.
Jetzt war sie hinter ihm.
Zwei weitere Schritte um die Motorhaube herum und sie stand neben ihm.
Er ließ die Zeitung sinken und drehte ihr den Kopf zu. Kopfhörer steckten in seinen Ohren. Das Kabel verschwand in der Innentasche seiner Jacke.
Ungläubig starrte er sie an, ließ die Zeitung fallen, wollte sich vom Auto abstoßen. Doch sie hatte den Schläger schon in weitem Bogen geschwungen und traf seinen Kopf mit einem dumpfen Geräusch. Sein Körper klatschte auf die Motorhaube, glitt an ihr herunter und blieb neben dem Auto liegen. Kleine Blutspritzer glänzten auf dem silbernen Metall. Sie hatte es tatsächlich getan! Stand er wieder auf? Sein Brustkorb hob und senkte sich, aber sonst zeigte er keine Regung.
War die Luft rein? Alice schaute sich in alle Richtungen um. Ja, sie war rein.
Also ging sie um das Auto herum, zog das Messer aus dem Gürtel, hielt es mit beiden Händen und stach die Klinge in die Seite des ersten Reifens. Zuerst erschrak sie vor dem lauten Zischen. Beim zweiten Mal war sie stolz darauf, dass ihr Plan aufging.
Als es erledigt war, warf sie Krocketschläger und Messer in die Hecke des Nachbargrundstücks und lief Richtung Hauptstraße, ohne sich noch einmal umzusehen.
2.
Hoffentlich hatte niemand gesehen, in welche Richtung sie gelaufen war.
Hatte sie sein Blut abbekommen? Nein. Gott sei Dank.
Dennoch hatte sie das Gefühl, dass Spione der Anstalt hinter den Fenstern standen und ihre Handys zückten, um die Polizei zu rufen.
Ich weiß nicht, wohin!
Sie zwang sich, an der nächsten Bushaltestelle stehen zu bleiben und die ausgehängten Abfahrtszeiten zu studieren. Dann schloss sie sich einer kleinen Gruppe Fußgänger an und ließ sich mit ihnen treiben. Menschen hasteten an ihr vorbei, schlenderten Hand in Hand vorüber, unterhielten sich miteinander oder telefonierten. Das Gefühl, beobachtet zu werden, verflog. Sie kannte niemanden, und niemand kannte sie. Erleichtert und gleichzeitig traurig trottete sie weiter und sah sich um.
Ein Paar zog sich an einem Automaten ein S-Bahn-Ticket. Unvermittelt blieb sie stehen.
Sie hatte kein Geld, kein Auto, keine Fahrkarte und keine Ahnung, wohin sie gehen sollte. Hier endete ihr Plan.
Wie konnte sie möglichst schnell möglichst weit wegkommen?
Sie beobachtete den Straßenverkehr, stellte sich in die Nähe einer leeren Parkbucht an den Seitenstreifen und hielt den rechten Daumen raus.
Niemand hielt an.
Sie versuchte, die Fahrer zu erkennen. Sahen sie freundlich aus? Suchten sie nach ihr? Oh, es war dumm, sich hier für alle Welt sichtbar an den Straßenrand zu stellen. Gerade wollte sie sich umdrehen und weggehen, als ein froschgrüner Kleinwagen neben ihr hielt. An dessen Rückspiegel hing eine Sammlung bunter, glitzernder Ketten, und aus dem heruntergelassenen Beifahrerfenster blickte sie eine junge Frau mit kurzer pechschwarzer Strubbelfrisur und knallroten Haarsträhnen an.
»Hallo, wohin willst du?«
»Nach Norden«, antwortete Alice spontan.
»Bis Kassel kann ich dich mitnehmen. Wenn du noch weiter in den Norden«, die letzten Worte markierte sie mit in die Luft gezeichneten Anführungsstrichen, »willst, musst du dir was Neues suchen.«
»Das reicht mir«, stammelte Alice, öffnete die Beifahrertür und setzte sich in ein mittelschweres Chaos aus angebrochenen Tüten mit Lakritz und Salzcrackern zwischen den beiden Sitzen, leeren Plastikflaschen im Fußraum, einer Plastiksonnenblume in der rechte Ecke der Windschutzscheibe sowie Gepäcktaschen auf den Rücksitzen. Die zerfledderte Deutschlandkarte nahm sie vom Sitz und legte sie auf ihren Schoß. Künstlicher Vanilleduft kribbelte ihr in der Nase, als sie die Tür schloss.
»Ich heiße Sabine. Mensch, das ist toll, dass ich diese öde Fahrt nicht ganz alleine machen muss. Eigentlich nehm ich ja keine Anhalter mit, aber du bist ja auch keiner von diesen abgeranzten Typen in Tarnklamotten. Und wie selten ist es geworden, dass Frauen per Anhalter fahren. Ich weiß, dass es gefährlich ist, trotzdem hab ich das früher genauso gemacht, und mir is’ nix passiert. Wenn man halt keine Kohle für ’n Bahnticket und kein Auto hat, kann man entweder zu Hause bei den nervigen Alten versauern, oder man wird kreativ. Ich bin dermaßen froh, dass ich mir endlich ein Auto leisten kann. Ist zwar ’ne alte Karre, fährt aber ganz ordentlich. Und wenn die mal kaputt ist, dann …« Sabine fädelte sich wieder in den Verkehr ein, ohne sich in ihrem Gerede zu unterbrechen.
Alice sah während der Fahrt meistens aus dem Fenster und schwieg. Zwischendurch nickte sie der quasselnden Sabine zu, wenn es ihr irgendwie angebracht schien. Ansonsten hielt sie sich an den Straßenkarten auf ihrem Schoß fest.
Nur einmal warf Sabine ihr einen verstohlenen Blick zu. Vielleicht weil sie ohne Jacke und Tasche unterwegs war. Oder lag es daran, dass sie jedes Mal zusammenzuckte und den Kopf wegdrehte, wenn ein Fußgänger sie an einer roten Ampel durch das Fenster ansah?
Sabines Zweifel waren nur von kurzer Dauer, denn kaum zwei Straßen weiter plapperte sie wieder ohne Pause.
3.
Als sich Alice spätnachts an einer Autobahnraststätte nahe Kassel hinter einer schiefen Kinderrutsche versteckte, kannte sie Sabines halbe Lebensgeschichte. Sabine sah sich verwirrt um, wartete einige Minuten bei ihrem Auto und starrte in die Dunkelheit. Dann zuckte sie mit den Schultern, stieg ein und fuhr davon. Spätestens morgen würde sie ihre stille Begleiterin vergessen haben. Hoffentlich.
Die Rücklichter des kleinen grünen Autos reihten sich in den spärlichen Autobahnverkehr ein und verschwanden in der Ferne.
Der Wind frischte auf. Hinter ihr rasselten die Kettenschaukeln, als warteten sie nur darauf, sie zu fesseln und in die düstere Welt der sich an den Spielplatz drängenden Bäume zu verschleppen.
Auf der Autobahn dröhnte ein Lastzug vorbei.
Die Dunkelheit wurde schwerer.
Bloß nicht umdrehen, nicht hinter sich gucken.
Mit schweißnassem Rücken huschte sie zur Raststätte und drückte sich an die Wand neben den Personaleingang.
Zum ersten Mal betrachtete sie bewusst den Parkplatz und bereute, dass sie sich an diesem Ort von Sabine getrennt hatte, denn da standen nur zwei Kleinwagen und eine große Zugmaschine mit Auflieger.
Die Kälte des roten Klinkers kroch ihr in die Knochen. Zitternd schlang sie die Arme um sich. Sie musste ins Warme. Also drückte sie sich durch die Eingangstür und schlüpfte in eine von drei Nischen, deren Sitzbänke mit dunkelgrünem Kunststoff bezogen waren. Die helle Tischplatte aus Holz fühlte sich quietschsauber an. Alice machte sich so klein wie möglich und beobachtete die wenigen anderen Gäste und den Kellner.
Der war in ein Gespräch mit einem leicht untersetzten Mann in den Vierzigern mit dichtem grau melierten Haar vertieft. Sein schwarzer Vollbart, das karierte Hemd und die Bluejeans erinnerten sie an die Rancharbeiter aus ihren Romanen.
Sonst saßen nur noch zwei andere Gäste jeder für sich an einem der frei stehenden Tische an den Fenstern, der eine mit dem Rücken zu ihr, der andere im Profil. Die Rückansicht des einen disqualifizierte ihn schon als potenzielle Mitfahrgelegenheit. Schulterlanges fettiges Haar fiel ihm bis auf die Schultern seiner speckigen Jacke.
Der andere Mann hatte sehr kurze blonde Haare, trug eine Cargohose mit Tarnmuster, derbe schwarze Stiefel und ein T-Shirt mit dem Konterfei eines ernst dreinschauenden Mannes, dessen schwarze Locken unter einer leicht schräg sitzenden Mütze hervorlugten.
Was hatte Sabine über Typen in Tarnklamotten gesagt? Abgeranzt sah er nicht aus, dafür so durchtrainiert, dass er ihr mit zwei Fingern das Genick brechen könnte.
Also wandte sie sich wieder dem Mann zu, der mit dem Kellner sprach. Er wirkte müde, aber gut gelaunt. Vielleicht war er auf dem Heimweg. Als er ein Foto aus der Brieftasche zog, glänzte ein schmaler goldener Ring an seiner rechten Hand auf. Die beiden Männer lachten.
Alice beobachtete ihn noch ein paar Minuten, bevor sie sich genauso leise hinausstahl, wie sie den Raum betreten hatte, und den Geruch von kaltem Frittierfett und Kaffee gegen den nach Autoabgasen und Benzin eintauschte.
Trotz der Kälte lehnte sie sich an die Außenmauer und kaute an ihrer wunden Lippe. Es tat weh, doch sie konnte nicht aufhören, mit den Zähnen an einem losen Häutchen zu ziehen.
»Soll ich?«, fragte sie flüsternd den stummen Asphalt zu ihren Füßen.
Einen Moment später kam der Rancher mit dem Bart aus der Gaststätte, zog den Reißverschluss seines navyfarbenen Parkers zu, fischte eine Packung Zigaretten aus der Tasche und zündete sich eine an. Als die Flamme des Feuerzeugs aufleuchtete, trafen sich für einen Sekundenbruchteil ihre Blicke. Sie erschrak, war sich aber im nächsten Moment nicht mehr sicher, ob sie es sich doch nur eingebildet hatte, denn der Mann tat einen tiefen Zug, steckte das Feuerzeug weg, blies den Rauch zur Nase wieder aus und ging, ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen, in einigem Abstand an ihr vorbei zu seinem Truck.
Sollte sie es wagen? Sie musste.
Die Verzweiflung trieb sie von der Wand weg und hinter ihm her.
Bei der Zugmaschine angekommen, blieb er stehen und trat die Zigarette aus. Sie hielt Abstand. Er warf einen Blick an seinem Lkw vorbei auf die Autobahn, als wolle er die Verkehrslage abschätzen.
Sie nahm all ihren Mut zusammen: »Fahren Sie nach Norden?«
Er drehte sich langsam zu ihr um und maß sie demonstrativ.
Sie kam sich nackt vor, spürte ihr Gesicht heiß werden und wollte sich schon umdrehen und davonrennen, als er den Blick wieder abwandte, um sich eine weitere Zigarette anzuzünden. Die rochen gar nicht so schlecht. Aromatisch.
Abermals ließ er das Ende mit einem kräftigen Zug aufglühen, sodass Alice über die anderen Geräusche hinweg hörte, wie der Tabak knisternd verbrannte.
Während er den Rauch ausatmete, fragte er: »Was macht ein Mädel wie du nachts ohne Jacke, Tasche und Begleitung auf ’ner Autobahnraststätte?«
Er versuchte, ihren Blick mit seinem festzuhalten, aber sie fixierte statt seiner Augen einen Punkt hinter ihm und zuckte mit den Schultern.
Verdammt, ihr fiel keine gute Ausrede ein.
Mit zwei Schritten stand er plötzlich vor ihr. Vor Schreck erstarrte sie und schloss die Augen.
Es durchzuckte sie die Erinnerung an einen grauen, endlos scheinenden Raum in der Anstalt, gleichzeitig hell und dunkel, matt und spiegelnd, muffig und kalt, die Krankenschwester mit den fleischigen Lippen und den Quietscheschuhen so dicht vor ihr, dass sich fast ihre Nasen berührten, eine kalte Betonwand an ihrem Rücken. Die Schwester brüllte, die Hand schon erhoben …
Entsetzt öffnete Alice die Augen und sah einen ruhigen, forschenden Blick. Er war nah, aber nicht zu nah. Die eine Hand steckte in der Jackentasche, die andere hielt die Zigarette, deren Qualm ihr trocken und heiß in die Nase stieg.
»Was willst du im Norden?« Er hob die linke Augenbraue und neigte leicht den Kopf.
Sollte sie sagen, dass sie von zu Hause ausgerissen war, weil ihre Eltern sie an die Hölle auf Erden und deren gierige Wächter ausliefern wollten?
»Zu meinen Eltern. Nach Hamburg.«
Der Rancher grunzte ungläubig und schüttelte den Kopf.
»Schwachsinn! Ich wette, deine Eltern wohnen genau in der entgegengesetzten Richtung.«
Anstatt zu heulen, wurde sie bockig. »Erstens bin ich volljährig, kann also gehen, wohin ich will. Und ja, ich bin abgehauen, aber von meinem – jetzt – Ex-Freund und nicht von meinen Eltern. Warum, geht Sie einen Sch…, äh, nichts an. Ich hatte jedenfalls keine Zeit, irgendetwas mitzunehmen. Und nun bleiben mir nur noch meine Eltern. Und nein, ich werde sie nicht anrufen, damit sie mich abholen. Ich will ihre Vorträge lieber später als früher hören.«
Wenn das mal keine plausible Erklärung war!
»Aha.«
Für einen Moment sagte und tat keiner von ihnen etwas, bis er einen letzten Zug nahm, die Zigarette austrat, sich umdrehte und zu seinem Truck ging. Er öffnete die Tür und setzte sich hinters Steuer.
Scheiße!
Sie wünschte ihm gerade ein Bombenkommando an den Hals, als er doch die Beifahrertür öffnete und ihr zurief: »Sieh zu, ich will hier nicht übernachten.«
Zuerst zögerte sie, stieg dann aber erleichtert ein. Sie murmelte einen Dank, schnallte sich an und wich seinem kritischen Blick aus.
»Wer weiß, von wem du dich sonst hier aufgabeln lässt.«
Während sie konzentriert aus dem Fenster starrte, hörte sie den Motor röhrend anspringen. Das Gefährt wälzte sich langsam vom Parkplatz, nahm Fahrt auf und rollte auf die dunkle, kaum befahrene Autobahn.
4.
Viktor passte sie in der Küche ihrer Eltern ab und hielt ihr das Messer an die Kehle, mit dem sie die Reifen zerstochen hatte.
»Wir haben alle Zeit der Welt«, sagte er.
Sie erwachte ruckartig.
Wo bin ich?
Ein tiefes Brummen, vorbeigleitende Lichter, eine dunkle, enge Kabine. Dann erkannte sie den Mann neben sich.
Flach atmend starrte sie das Fenster an und versuchte, sowohl ihren Herzschlag zu beruhigen als auch die Bilder ihres Albtraums zu vergessen. Sie rieb sich das Gesicht mit beiden Händen, um den Rest der Erinnerung fortzuwischen. Dabei half der Duft nach Minze, der den Geruch nach Zigaretten fast ganz überdeckte.
Der Rancher goss sich dampfenden Pfefferminztee in seinen Thermobecher.
»Geht’s?«
»Nur ein Traum.«