
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die romantische Komödie von Erfolgsautorin Kasie West Im Chemieunterricht kritzelt Lily eine Zeile aus ihrem Lieblingslied auf den Tisch – und erlebt eine Überraschung: Am nächsten Tag hat jemand geantwortet, der den Song auch kennt! Schnell entwickelt sich zwischen ihr und dem namenlosen Schreiber eine Brieffreundschaft. Sie tauschen Musiktipps und lustige Geschichten aus, aber auch geheime Wünsche und Sorgen. Mit jedem Zettel verliert Lily ihr Herz ein bisschen mehr an den Unbekannten. Doch als sie herausfindet, wer ihr da schreibt, wird alles plötzlich ziemlich turbulent. Luftig-leicht, bezaubernd vergnüglich und rundum schön – eine Liebesgeschichte zum Schwärmen und Schwelgen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kasie West: PS: Ich mag dich
Aus dem Englischen von Ann Lecker
Im Chemie-Unterricht kritzelt Lily eine Zeile aus ihrem Lieblingslied auf den Tisch – und erlebt eine Überraschung: Am nächsten Tag hat jemand geantwortet, der den Song auch kennt! Schnell entwickelt sich zwischen ihr und dem namenlosen Schreiber eine Brieffreundschaft. Sie tauschen Musiktipps und lustige Geschichten aus, aber auch geheime Wünsche und Sorgen. Mit jedem Zettel verliert Lily ihr Herz ein bisschen mehr an den Unbekannten. Doch als sie herausfindet, wer ihr da schreibt, wird alles plötzlich ziemlich turbulent.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Danksagung
Viten
Für Jared – Noch einmal und für immer
Ein Blitzschlag. Ein Haiangriff. Ein Lottogewinn.
Nein. Ich strich alle Wörter wieder durch. Zu klischeehaft.
Ich tippte mir mit dem Stift an die Lippen.
Selten. Was war selten? Selten blöd, dachte ich und kicherte. Das würde sich in einem Song richtig gut machen.
Ich kritzelte noch ein paarmal über die Wörter, bis sie völlig unkenntlich waren, dann schrieb ich ein einzelnes Wort auf. Liebe. Also die kam in meiner Welt definitiv selten vor. Zumindest die romantische Sorte.
Lauren Jeffries, meine Tischnachbarin, räusperte sich. Erst in dem Moment fiel mir auf, wie leise es im Klassenzimmer geworden war – und dass ich mich mal wieder in meine eigene Welt zurückgezogen und alles ausgeblendet hatte. In den letzten Jahren hatte ich gelernt, unauffällig zu bleiben, und wusste mittlerweile mit gelegentlicher, unerwünschter Aufmerksamkeit umzugehen. Dezent schob ich die Chemiesachen über mein Notizbuch, das mit allem Möglichen, nur nicht mit Chemienotizen gefüllt war, und hob langsam den Kopf.
Mr Ortegas Blick lag auf mir.
»Willkommen im Unterricht, Lily.«
Alle lachten.
»Du warst bestimmt gerade dabei, die Antwort aufzuschreiben«, sagte er.
»Auf jeden Fall.« Am wichtigsten war, dass man sich so verhielt, als würde es einen völlig kaltlassen, als hätte man keine Gefühle.
Wie erhofft beließ es Mr Ortega dabei und begann zu erklären, was wir in Vorbereitung für das Laborexperiment nächste Woche lesen mussten. Da er mich so leicht hatte davonkommen lassen, glaubte ich, am Ende des Unterrichts unbemerkt aus dem Zimmer schlüpfen zu können, doch nachdem es geläutet hatte, rief er mich zu sich.
»Lily? Kann ich dich kurz sprechen?«
Ich versuchte umsonst, mir eine gute Ausrede einfallen zu lassen, warum ich dringend losmusste.
»Da dein Interesse in den vergangenen fünfundfünfzig Minuten mit Sicherheit nicht mir gegolten hat, schuldest du mir jetzt zumindest eine Minute.«
Der letzte Schüler verließ den Raum und ich machte ein paar Schritte nach vorne. »Es tut mir leid, Mr Ortega«, sagte ich. »Chemie und ich liegen nicht auf derselben Wellenlänge.«
Er seufzte. »Es ist eine Frage von Geben und Nehmen und viel gegeben hast du bisher nicht.«
»Ich weiß. Ich werde mich mehr anstrengen.«
»Und ob du das wirst. Wenn ich dein Notizbuch noch einmal in meinem Unterricht sehe, beschlagnahme ich es.«
Ich unterdrückte ein Stöhnen. Wie sollte ich ohne Ablenkung täglich fünfundfünfzig Minuten Folter überleben? »Aber ich muss mir doch Notizen machen. Chemienotizen.« Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal auch nur eine einzige Notiz für Chemie gemacht hatte, geschweige denn mehrere.
»Du kannst ein loses Blatt Papier nehmen und das legst du mir am Ende jeder Stunde vor.«
Ich drückte mein geliebtes grün-violettes Notizbuch an mich. Darin tummelten sich Hunderte Song- und Textideen, halb fertige Strophen, Kritzeleien und Skizzen. Es war mein Rettungsring. »Das ist eine herzlose und ungewöhnliche Strafe.«
Er lachte kurz auf. »Es ist meine Aufgabe, dir dabei zu helfen, meinen Kurs zu bestehen. Du lässt mir keine andere Wahl.«
Ich hätte ihm eine lange Liste von Wahlmöglichkeiten aufzählen können.
»Damit haben wir wohl eine Abmachung.«
Abmachung war nicht unbedingt das Wort, das ich benutzt hätte. Es setzte ja voraus, dass wir beide ein Mitspracherecht hatten. Besser gepasst hätte Verbot, Urteil … Erlass.
»Wolltest du noch etwas sagen?«, fragte Mr Ortega.
»Wie? Oh, nein, alles klar. Bis morgen.«
»Ohne Notizbuch«, rief er mir nach.
Ich wartete, bis sich die Tür hinter mir geschlossen hatte, bevor ich mein Notizbuch wieder hervorholte und das Wort Erlass in die Ecke einer Seite kritzelte. Es war ein gutes Wort. Nicht oft genug benutzt. Während ich schrieb, prallte ich mit der Schulter gegen jemanden und legte mich fast hin.
»Pass doch auf, Magnet«, maulte ein Typ aus der Zwölften, den ich nicht mal kannte.
Zwei Jahre waren vergangen und es gab immer noch Leute, die diesen Spitznamen benutzten. Ich reagierte nicht, aber während er weiterlief, stellte ich mir vor, dass ich ihm meinen Stift wie einen Pfeil in den Rücken schoss.
»Du siehst aus, als wolltest du jemanden umbringen«, sagte meine beste Freundin Isabel Gonzales, die plötzlich neben mir auftauchte.
»Warum erinnern sich Leute immer noch an diesen bescheuerten Spitznamen, den Cade erfunden hat?«, murrte ich. Eine Strähne meiner dunkelblonden Locken entkam den Haargummifesseln und fiel mir in die Augen. Ich steckte sie mir hinters Ohr. »Er reimt sich nicht mal mit meinem Namen.«
»Ein Spitzname muss sich nicht reimen.«
»Weiß ich. Ich hab auch nicht Cades Fähigkeiten infrage gestellt, sich Spitznamen einfallen zu lassen. Ich hab gemeint, dass sich eigentlich keiner an den Namen erinnern dürfte. Jedenfalls nicht nach über zwei Jahren – und wo das Ganze nicht mal besonders eingängig ist.«
»Tut mir leid«, sagte Isabel und hakte sich bei mir unter.
»Du musst dich nicht für ihn entschuldigen. Ihr seid nicht mehr zusammen. Egal, ich möchte nicht, dass du Mitleid mit mir hast.«
»Na ja, hab ich aber. Der Name ist bescheuert und kindisch. Ich glaube, die Leute benutzen ihn mittlerweile aus Gewohnheit und nicht, weil sie wirklich darüber nachdenken, was sie da sagen.«
Ich war mir nicht sicher, ob ich das genauso sah, mochte aber nicht weiter auf dem Thema herumreiten. »Mr Ortega hat mein Notizbuch aus seinem Unterricht verbannt.«
Isabel lachte. »Oh-oh. Wie wirst du ohne diesen wichtigen Körperteil überleben?«
»Keine Ahnung. Und dann noch ausgerechnet in Chemie. Wie kann man nur von irgendjemandem erwarten, dass er in diesem Fach zuhört?«
»Ich mag Chemie.«
»Lass es mich umformulieren: Wie kann man von einem normalen Menschen erwarten, dass er in dem Fach zuhört?«
»Betrachtest du dich etwa als normal?«
Ich neigte den Kopf und gestand ihr diesen Sieg zu.
Als wir bei der Weggabelung hinter dem B-Gebäude ankamen, blieben wir stehen. Die rötliche Felslandschaft, die den Gehweg säumte, sah heute besonders staubig aus. Ich hob den Fuß und kickte mit meinem roten Sneaker ein paar Steine beiseite.
Die Landschaft war gut zur Wasserspeicherung, aber aus der Nähe fand ich Arizonas Natur nicht sonderlich inspirierend. Ich musste sie von Weitem betrachten, damit mir Songzeilen einfielen, die es wert waren, in mein Notizbuch zu wandern. Der Gedanke ließ mich aufblicken. Nur inspirierten mich die beigefarbenen Gebäude und Schülerscharen auch nicht mehr als das Felsgestein.
»Also, was hältst du von Pseudomexikanisch zum Mittagessen?«, fragte ich Isabel, als Lauren, Sasha und ihre Freunde an uns vorbeiliefen.
Isabel biss sich auf die Lippe und schaute plötzlich besorgt. »Gabriel möchte sich heute außerhalb des Campus mit mir treffen, es ist unser Zweimonatiges. Ist das okay? Ich kann auch absagen …«
»Klar, euer Zweimonatiges. Das ist heute? Ich habe dein Geschenk zu Hause vergessen.«
Isabel verdrehte die Augen. »Was hast du für mich besorgt? Ein von dir verfasstes Buch, warum man Jungs nie trauen sollte?«
Ich legte mir theatralisch die Hand auf die Brust und schnappte nach Luft. »So was würde ich doch nie tun. Der Titel lautet übrigens Wie man ein egoistisches Schwein erkennt. Na ja, vergiss es.«
Sie lachte.
»Aber bei einem Freund wie Gabriel würde ich dir so ein Buch nie schenken«, fügte ich hinzu und stupste Isabel an. »Ich mag Gabriel wirklich. Das weißt du, oder?« Gabriel war süß und echt lieb zu Isabel. Es war ihr vorheriger Freund – Cade Jennings, der King bescheuerter Spitznamen –, der mich zu solchen erfundenen Büchern inspirierte.
Ich bemerkte, dass Isabel mich immer noch besorgt betrachtete. »Natürlich kannst du mit Gabriel Mittag essen gehen«, versicherte ich ihr. »Mach dir wegen mir keine Sorgen. Viel Spaß.«
»Du könntest mitkommen, wenn …«
Ich war versucht sie den Satz beenden zu lassen. Und ihre Einladung aus Jux anzunehmen. Aber ich erlöste sie von ihrem Leid. »Nein. Ich will bei diesem Essen auf keinen Fall dabei sein. Also bitte. Ich muss ein Buch schreiben … Zweimonatige Jubiläen sind der Beginn immerwährender Liebe. Kapitel eins: Nach sechzig Tagen weißt du, ob er es ernst meint, wenn er dich der stumpfsinnigen Plackerei der Highschool entreißt und zum Mittagessen bei Taco Bell entführt.«
»Wir gehen nicht zu Taco Bell.«
»Oh-oh. Schon nach einem einzigen Kapitel sieht es nicht mehr ganz so rosig für euch aus.«
Isabels dunkle Augen funkelten. »Mach dich ruhig lustig über mich, ich finde es romantisch.«
Ich packte ihre Hand und drückte sie. »Ich weiß. Es ist total süß.«
»Und du kommst alleine klar?« Sie zeigte auf die andere Seite des Schulhofs. »Vielleicht könntest du mit Lauren und Sasha abhängen?«
Ich zuckte mit den Schultern. Von dieser Idee war ich alles andere als begeistert. Ich saß in Chemie neben Lauren und manchmal wechselten wir auch ein paar Worte. Zum Beispiel wenn sie mich fragte, was wir als Hausaufgabe aufhatten oder ob ich meinen Rucksack von ihrem Ordner nehmen könnte. Und mit Sasha hatte ich noch weniger zu besprechen.
Ich betrachtete mein Outfit. Heute trug ich ein zu großes Männerhemd, das ich in einem Secondhandladen gefunden hatte. Die Ärmel hatte ich abgeschnitten, damit es mehr wie ein Kimono aussah, und der braune Retro-Gürtel um meine Taille vervollständigte den Look. An den Füßen hatte ich abgewetzte rote High-Top-Sneaker. Meine Aufmachung war schräg, nicht cool, und ich würde nur herausstechen in einer Clique wie der von Lauren, in der alle perfekt gestylt waren mit ihren Tanktops und eng sitzenden Jeans.
Ich hielt mein Notizbuch hoch und nickte Isabel zu. »Ist schon in Ordnung. So habe ich Zeit, an einem neuen Song zu arbeiten. Du weißt ja, dass ich zu Hause nie die Ruhe dafür habe.«
Isabel nickte. Dann sah ich aus dem Augenwinkel ihn. Und erstarrte.
Lucas Dunham. Er saß inmitten einer Gruppe von Zwölftklässlern auf einer Bank, hatte den Reißverschluss seines Hoodies bis oben zugezogen, die Ohrhörer eingesteckt und blickte ins Leere. Als wäre er da und doch nicht da. Ein Gefühl, das ich perfekt nachvollziehen konnte.
Isabel folgte meinem Blick und seufzte. »Du solltest ihn einfach ansprechen, weißt du.«
Ich lachte und spürte, wie mir die Hitze in die Wangen schoss. »Schon vergessen, was das letzte Mal passiert ist, als ich das versucht habe?«
»Du bist nervös geworden, das ist passiert.«
»Ich hab keinen Ton rausgebracht. Nicht einen Piep. Er und seine coole Frisur und seine Hipster-Klamotten haben mich eingeschüchtert«, beendete ich den Satz mit einem Flüstern.
Isabel legte den Kopf schief, während sie Lucas betrachtete, als wäre sie mit meiner Einschätzung nicht einverstanden. »Du brauchst einfach ein bisschen Übung. Fang mit jemandem an, den du nicht schon seit zwei Jahren anschmachtest.«
»Ich schmachte Lucas nicht an …«
Ich verstummte, als ihr vielsagender Blick mich durchbohrte. Sie hatte recht. Ich hatte ihn angeschmachtet. Lucas war so ziemlich der coolste Typ, den ich kannte … na ja, ich kannte ihn nicht wirklich, aber das machte ihn irgendwie noch cooler. Er war ein Jahr älter als wir, hatte lange dunkle Haare und seine Outfits bestanden aus Band-T-Shirts oder Oldschool-Polohemden, ein Gegensatz, der es mir unmöglich machte, ihn in eine bestimmte Schublade zu stecken.
»Komm nächsten Freitag mit mir und Gabriel auf ein Doppeldate!«, schlug Isabel plötzlich vor. »Ich such dir eine nette Begleitung.«
»Vergiss es.«
»Komm schon. Es ist ewig her, dass du ein Date hattest.«
»Das liegt daran, dass ich unbeholfen und komisch bin und das Ganze weder mir Spaß macht noch dem armen Kerl, der sich bereit erklärt, mit mir auszugehen.«
»Das stimmt nicht.«
Ich verschränkte die Arme.
»Du musst nur einfach mehr als einmal … oder zweimal … mit jemandem ausgehen, damit derjenige sieht, wie viel Spaß man mit dir haben kann«, wandte Isabel ein und nestelte an den Gurten ihres Rucksacks herum. »Du bist nicht unbeholfen, wenn wir zusammen sind.«
»Ich bin total unbeholfen, wenn ich mit dir zusammen bin, aber du lässt es mir durchgehen, weil du nicht den Druck hast, mich irgendwann küssen zu müssen.«
Isabel lachte und schüttelte den Kopf. »Das ist nicht der Grund. Ich lasse es dir durchgehen, weil ich dich mag. Wir müssen einfach nur einen Typen finden, bei dem du du selbst sein kannst.«
Ich legte mir die Hand aufs Herz. »Und an jenem heißen Herbsttag begann Isabel das aussichtslose Unterfangen, einen Verehrer für ihre beste Freundin zu finden. Es würde zu einer lebenslangen Suche werden, die sowohl ihre Entschlossenheit als auch ihren Glauben auf die Probe stellen sollte. Es würde sie an den Rand des Wahnsinns und –«
»Hör auf«, unterbrach mich Isabel und stieß mich mit der Schulter an. »Genau diese Einstellung macht das Ganze am Ende aussichtslos.«
»Eben das wollte ich damit ausdrücken.«
»Nein, das akzeptiere ich nicht. Du wirst schon sehen. Irgendwo da draußen wartet der richtige Typ auf dich.«
Ich seufzte, während ich den Blick wieder zu Lucas wandern ließ. »Iz, im Ernst, es ist alles gut. Keine Verkupplungsversuche mehr.«
»Na schön, keine Verkupplungsversuche. Aber sei für alles offen, sonst kriegst du am Ende nicht mit, was direkt vor deiner Nase wartet.«
Ich breitete die Arme aus. »Gibt es irgendjemanden, der noch offener ist als ich?«
Isabel warf mir einen skeptischen Blick zu. Sie wollte gerade antworten, als eine laute Stimme von der anderen Seite der Grünfläche zu uns herüberdrang. »Da bist du ja! Alles Liebe zum Zweimonatigen!«
Isabel wurde rot und drehte sich zu Gabriel um. Er joggte zu uns herüber, schloss sie in die Arme und hob sie hoch. Die zwei waren ein attraktives Paar mit ihren dunklen Haaren, den dunklen Augen und der olivfarbenen Haut. Es fühlte sich komisch an, Gabriel hier zu sehen. Er ging auf eine andere Highschool und ich begegnete ihm sonst immer nur nach dem Unterricht und an Wochenenden.
»Hi, Lily«, begrüßte er mich und setzte Isabel ab. »Kommst du mit?« Seine Einladung klang aufrichtig. Er war wirklich ein netter Kerl.
»Ja, ist das okay? Ich hab gehört, dass du zahlst, und da musste ich nicht lange überlegen.«
Isabel lachte.
»Super«, meinte Gabriel.
»Es war ein Witz, Gabe«, sagte Isabel.
»Oh.«
»Ja, ich bin kein Sozialfall.« Langsam kam es mir nämlich so vor, als würden die beiden mich dafür halten.
»Nein, natürlich nicht. Ich hab nur ein schlechtes Gewissen, weil ich dir nicht früher Bescheid gesagt habe«, erwiderte Isabel.
Gabriel nickte. »Es war eine Überraschung.«
»Wenn ihr zwei mich weiter bemuttert, bleibt euch bald nicht mehr genug Zeit zum Essen. Los. Amüsiert euch. Und … äh … herzlichen Glückwunsch. Ich habe kürzlich in einem Buch gelesen, dass das Zweimonatige der Beginn immerwährender Liebe ist.«
»Echt? Cool«, sagte Gabe.
Isabel verdrehte bloß die Augen und boxte mich auf den Arm. »Benimm dich.«
Ich stand jetzt allein auf dem Weg und beobachtete die Schülergrüppchen um mich herum, die sich unterhielten und lachten. Isabels Sorge war unbegründet. Ich hatte kein Problem damit, allein zu sein. Manchmal zog ich es sogar vor.
Mit meinem Notizbuch auf dem Schoß saß ich draußen auf der Schultreppe und zeichnete. Ich fügte dem Rock auf dem Papier ein paar Blumen hinzu und schraffierte die Strumpfhose mit grünem Buntstift. Ich hatte meine Ohrhörer drin und lauschte einem Song von Blackout. Die Leadsängerin Lyssa Primm war mein absolutes Idol, was Mode und Musik betraf – sie war eine geniale Songwriterin, die mit ihren kirschroten Lippen, ihren Vintage-Kleidern und ihrer allgegenwärtigen Gitarre einfach klasse aussah.
»Öffne deine welkenden Blüten und lass das Licht herein«, sang sie. Ich schlug den Takt mit dem Fuß. Ich wollte lernen, diesen Song auf meiner Gitarre zu spielen. Hoffentlich konnte ich später üben.
Der Kleinbus machte genug Lärm, um die Musik zu übertönen, und ich wusste, ohne aufzusehen, dass meine Mom gerade angekommen war. Ich klappte das Notizbuch zu, steckte es in meinen Rucksack, nahm die Ohrhörer heraus und stand auf. Auf der Rückbank konnte ich die Köpfe meiner beiden Brüder sehen. Mom hatte sie wohl zuerst von der Schule abgeholt.
Als ich die Beifahrertür öffnete, dröhnte mir ein alter One-Direction-Song entgegen und der Sitz war von Moms Perlenkasten belegt.
»Kannst du dich hinten reinsetzen?«, fragte Mom. »Ich muss unterwegs noch eine Kette bei einer Kundin abliefern.« Sie drückte auf einen Knopf, die Schiebetür ging auf und dahinter kamen meine beiden kleinen Brüder zum Vorschein, die sich um eine Action-Figur stritten. Ein Plastikbecher rollte auf den Boden. Ich ließ den Blick schweifen, um zu sehen, wie peinlich mir das Ganze sein sollte. Der Parkplatz war nicht mehr ganz so voll. Ein paar Schüler stiegen in ihre eigenen Autos oder riefen ihren Freunden etwas zu. Niemand schien auf mich zu achten.
»Tut mir leid, dass ich zu spät bin«, fügte Mom hinzu.
»Kein Problem.« Ich schloss die Vordertür, hob den Becher vom Asphalt auf und klopfte meinem Bruder auf den Rücken. »Rutsch rüber, Ding Zwei.«
Ich wischte ein paar Kräckerkrümel vom Sitz und stieg ein. »Ich dachte, Ashley würde mich abholen«, sagte ich zu Mom.
Meine ältere Schwester Ashley war neunzehn. Sie hatte ihr eigenes Auto, einen Job und ging aufs College. Aber weil sie immer noch zu Hause wohnte (und mir die Chance auf ein eigenes Zimmer verbaute), musste sie Familienpflichten übernehmen. Wie mich von der Schule abholen.
»Sie arbeitet heute länger im Campusladen«, erinnerte mich Mom. »Hey. Beschwerst du dich etwa darüber, von deiner superhippen Mom abgeholt zu werden?« Sie lächelte mich im Rückspiegel an.
Ich lachte. »Benutzen superhippe Moms das Wort hipp?«
»Cool? Bombe? Hammer?« Mitten in ihrer Auflistung wandte sie sich zu meinem Bruder um. »Wyatt, du bist zehn, lass Jonah damit spielen.«
»Aber Jonah ist sieben! Das ist nur drei Jahre jünger. Warum kriegt er immer alles?«
Bei seinem Versuch, sich die Iron-Man-Figur zu schnappen, rammte mir Jonah einen Ellbogen in den Magen.
»Die gehört jetzt mir«, sagte ich und sorgte für aufgebrachtes Geschrei, als ich die Action-Figur packte und sie nach hinten in den Laderaum warf.
Meine Mom seufzte. »Das war nicht gerade hilfreich.«
»Meine Eingeweide sind mir sehr dankbar.«
Meine Brüder hörten abrupt auf zu jammern und kicherten – das erwünschte Ergebnis meiner Aussage. Ich wuschelte ihnen durchs Haar. »Wie war’s in der Schule, Dinger?«
Meine Mom machte eine Vollbremsung, als ein schwarzer BMW sich knapp vor ihr einfädelte. Ich packte Jonah, damit er nicht mit dem Kopf gegen den Vordersitz knallte. Ich musste keinen Blick auf den Fahrer werfen, um zu wissen, wer es war. Aber ich konnte ihn sowieso sehen, mit seinem perfekt gestylten blonden Haar. Cade sah aus wie der nette Junge von nebenan – hochgewachsen, breites Lächeln, braune Kulleraugen –, ohne die dazu passende Persönlichkeit.
»Da hat jemand wohl die Lektion zum Thema sicheres Fahren verpasst«, murmelte meine Mom, als Cade davonpreschte. Ich wünschte, sie hätte wild gehupt.
»Er hat eine Menge Lektionen verpasst.« Einschließlich die zum Thema Spitznamen und Reime.
»Kennst du ihn?«
»Das ist Cade Jennings, aber die Leute nennen ihn Cade den Kotzbrocken.« Also das war eingängig. Alliteration. Während Magnet und … Lily? Wie merkten sich die Leute das?
»Wirklich?«, fragte meine Mom. »Das ist nicht besonders nett.«
»Nein, keiner nennt ihn so«, murmelte ich. Sollten sie aber. Es klang gut.
»Cade …« Moms Augen verengten sich, während sie nachdachte.
»Isabel war mal mit ihm zusammen. In der neunten Klasse.« Bis Cade und ich uns so oft stritten, dass sich meine beste Freundin notgedrungen für eine Seite entscheiden musste. Sie hatte behauptet, die Trennung wäre nicht meine Schuld, aber vermutlich war das gelogen. Auch wenn ich mich deswegen noch immer irgendwie schuldig fühlte, war ich gleichzeitig davon überzeugt, dass ich sie vor einer Menge Kummer bewahrt hatte.
»Wusst ich’s doch, dass mir der Name bekannt vorkommt«, sagte Mom und bog rechts ab. »War er mal bei uns?«
»Nein.« Zum Glück. Cade hätte sich mit Sicherheit über das ewige Chaos in unserem Haus lustig gemacht. Mit vier Kindern befand es sich in einem dauerhaften Ausnahmezustand.
Isabel hatte mich mal mit zu Cade geschleppt, für die Party zu seinem vierzehnten Geburtstag. Als er uns die Tür öffnete, hatte sein Gesichtsausdruck keinen Zweifel daran gelassen, was er davon hielt, dass ich mitgekommen war.
»Tolle Geburtstagsüberraschung«, hatte er mit einem sarkastischen Tonfall gerufen und war zurück ins Haus marschiert.
»Glaub mir, ich wollte auch nicht kommen«, hatte ich erwidert.
Während Isabel Cade einzuholen versuchte, blieb ich im Eingang stehen. Das Haus war riesig und erschreckend weiß. Sogar die Möbel und die Deko waren weiß. Bei mir zu Hause wäre nichts auch nur eine Sekunde lang so makellos geblieben.
Ich hatte mich langsam im Kreis gedreht und alles auf mich wirken lassen, als Isabel den Kopf um die Ecke streckte und fragte: »Kommst du?«
Die Stimmen meiner Brüder rissen mich aus meinen Gedanken und brachten mich ins Auto zu meiner Familie zurück. Sie stritten sich jetzt um eine Packung M&Ms. »Ich hab sie unterm Sitz gefunden. Sie gehört also mir«, sagte Wyatt.
Ich holte mein Notizbuch heraus und zeichnete an meinem Rock weiter. »Hey, Mom, können wir schwarzen Faden besorgen? Ich hab keinen mehr.«
Mom bog auf die Hauptstraße. »Kann das bis zum Ende der Woche warten? Dein Dad macht gerade eine Auftragsarbeit fertig.«
Mein Dad war freischaffender Möbeldesigner. Wie viel Aufträge er bekam, war unvorhersehbar, und das Gleiche galt für unser Haushaltsbudget. Was meine Familie betraf, war so ziemlich alles unvorhersehbar.
»Ja klar«, erwiderte ich.
Zu Hause stieg ich über die Rucksäcke, die sich direkt hinter der Eingangstür auftürmten. »Ich leih mir den Laptop aus«, rief ich allen zu, die es hören wollten, und schnappte mir den Computer vom Flurtisch.
Niemand antwortete.
Ich ging in mein Zimmer … na ja, zumindest war die Hälfte davon mein Zimmer. Die saubere Hälfte. Die Hälfte voller Stoffmuster und an die Wand gepinnter Farbpaletten. Nicht die Hälfte voller Zeitschriftenausschnitte mit Make-up-Ideen und niedlichen Promis. Auch wenn ich mir diese Hälfte durchaus ab und zu mal gern anschaute.
Weil Ashley nicht da war, konnte ich mich auf mein Bett fallen lassen und YouTube aufrufen. Ich suchte nach einem Tutorial für den Blackout-Song. Es war kein bekannter Song, daher war ich mir nicht sicher, ob ich eins finden würde, in dem der Gitarrenpart erklärt wurde. Nachdem ich durch mehrere Seiten gescrollt war, fand ich schließlich eins. Ich stellte den Laptop auf die Kommode.
Ich bewahrte meine Gitarre unter meinem Bett in einem Hartschalenkoffer auf. Das war keine Sicherheitsmaßnahme. Mit zwei jüngeren Brüdern war es eine absolute Notwendigkeit. Ich zog den Koffer heraus und öffnete ihn. Für diese Gitarre, meinen wertvollsten Schatz, hatte ich sechs Monate lang sparen müssen. Ich hatte jeden einzelnen Freitagabend geopfert, um auf die zweijährigen Zwillingsbrüder von nebenan aufzupassen. Sie waren anstrengender als alle Kinder, für die ich je den Babysitter gespielt hatte. Und wenn man bedenkt, welche Spitznamen ich meinen Brüdern verpasst habe, sagt das eine Menge. Aber es war die Sache wert. Diese Gitarre war alles, was ich mir erträumt hatte. Ihr Klang war perfekt. Und sie zu spielen gab mir das Gefühl, nicht ganz so unbeholfen zu sein wie sonst. Es gab mir das Gefühl, dass ich für etwas bestimmt war. Für das hier. Es ließ alles andere verschwinden.
Na ja, es ließ alles einen kurzen Moment lang verschwinden. Ich war gerade dabei, den ersten Akkord zu greifen, als sich die Tür meines … unseres … Zimmers mit einem Knall öffnete.
»Lily!«, rief Jonah, rannte herein und kam schlitternd vor mir zum Stehen. »Schau mal! Mein Zahn wackelt.« Er riss den Mund weit auf und drückte mit der Zunge gegen seinen rechten Schneidezahn. Er bewegte sich kein bisschen.
»Cool, Kumpel.«
»Okay, tschüss!« Er war genauso schnell wieder draußen, wie er reingestürmt war.
»Mach die Tür zu«, brüllte ich ihm hinterher, doch er hörte mich nicht oder tat einfach nur so. Ich seufzte, stand auf und schloss sie. Dann konzentrierte ich mich wieder auf das Video und meine Gitarre.
Zwei Minuten später klopfte es und Mom erschien. »Du bist dran, die Spülmaschine auszuräumen.«
»Kann ich das hier erst zu Ende machen?«, fragte ich und deutete mit dem Kopf auf meine Gitarre.
»Ich kann erst anfangen Abendessen zu kochen, wenn die Spüle leer ist, und die Spüle kann nicht geleert werden, bevor die Maschine ausgeräumt ist.«
Ich war versucht mir noch fünf Minuten zu erstreiten, aber dann sah ich meine Mom an. Sie wirkte noch müder als sonst.
»Okay, ich komme gleich.« Ich schloss die Augen, strich ein letztes Mal über die Saiten und ließ die Töne durch meine Arme vibrieren. Mein ganzer Körper entspannte sich.
»Beeil dich, Lily!«, rief meine Mom.
Oh Mann.
Am nächsten Morgen ging ich in die Küche, um noch schnell zu frühstücken. Mom hatte Jonah und Wyatt bereits zur Schule gefahren und faltete jetzt Wäsche im Wohnzimmer. Ashley machte sich immer noch fertig (sie brauchte Stunden) und Dad saß am Küchentisch und las Zeitung.
Ich holte die Müslischachtel aus der Speisekammer und kippte gerade etwas davon in eine Schale, als mein Blick auf die Theke fiel. Zwei Halsketten lagen auf der beigefarbenen Granitoberfläche, unter jeder ein Blatt Papier. Auf dem Blatt rechts waren zwei Häkchen. Auf dem anderen auch. Ich schüttelte den Kopf.
»Nein«, sagte ich.
Mein Dad lugte über den Rand seiner Zeitung. »Stimm einfach ab. Ist keine große Sache.«
»Erst sagst du, es ist keine große Sache, und dann machst du doch eine große Sache draus.« Da es schon vier Haken gab, schob ich eine Frage nach: »Wessen Freund hast du diesmal überredet mit abzustimmen?«
»Wählen ist ein Privileg. Niemand muss überredet werden. Das ist alles nur Spaß.«
»Dann sind sie beide gleich hübsch. Ich stimme für beide.«
»Nein. Du musst eine Wahl treffen.«
»Du und Mom habt sie doch nicht alle. Es gibt keine Hoffnung für uns, wenn ihr beide so merkwürdige Sachen veranstaltet.« Ich goss Milch über mein Müsli und setzte mich an den Tisch. Dads Zeitung lag immer noch vor ihm, als würde er sie lesen. Damit versuchte er mich in Sicherheit zu wiegen. So zu tun, als hätte dieser Wettbewerb keine Bedeutung.
»Du weißt, dass Mom dir keine Ruhe lassen wird, bis du abgestimmt hast«, sagte er.
»Ja klar. Mom ist diejenige, der das Ganze so furchtbar wichtig ist. Sag mir einfach, welche deine ist, und ich stimme für sie.«
»Das wäre schummeln, Lil.«
»Warum hast du diese Tradition überhaupt angefangen? Mom übernimmt ja auch nicht deinen Job und versucht deine ausgefallenen Möbel zu überbieten.«
Dad gab ein kleines Lachen von sich. »Sie würde auf jeden Fall gewinnen.«
Ich aß einen Löffel Müsli. Um seine Gedanken auf etwas anderes zu lenken, fragte ich: »Warum bekommen wir immer noch die Zeitung ins Haus? Du weißt schon, dass du dieselben Infos im Internet finden kannst, und zwar … gestern?«
»Ich halte meine Worte gerne in der Hand.«
Ich lachte, hörte aber abrupt auf, als ich auf der Seite, die er hielt, etwas entdeckte, das meine Meinung über Zeitungen schlagartig änderte.
Auf einmal fand ich sie klasse.
Songwriting-Wettbewerb. Gewinne fünftausend Dollar und einen dreiwöchigen Intensivkurs mit einem erstklassigen Dozenten am Herberger Musikinstitut. Mehr Informationen auf unserer Website! www.herbergerinstitute.edu
»Bist du fertig?«, fragte Ashley, als sie in die Küche kam. Sie gähnte, aber wie immer war sie perfekt gestylt in Skinny-Jeans, einem pinkfarbenen T-Shirt mit rundem Halsausschnitt und Plateauschuhen. Ihre Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden und ihr Make-up war makellos. Obwohl wir uns äußerlich ähnelten – wir hatten beide lange dunkelblonde Haare, haselnussbraune Augen und Sommersprossen –, war unser Kleidungsstil völlig gegensätzlich. Ashley hätte gut mit Lauren und Sasha aus der Schule zusammengepasst.
»Was?« Ich blinzelte meine Schwester verwirrt an. »Ach so, ja. Ähm, Dad, kann ich das haben?«
Dad warf einen Blick auf seinen Teller, auf dem ein halb aufgegessener Bagel lag, zuckte mit den Schultern und schob ihn mir zu.
»Igitt. Nein, die Zeitung.«
»Die Zeitung? Du willst die Zeitung lesen?«
»Ja.«
Ashley kam rüber und schnappte sich den Bagel von seinem Teller.
»Hey, der war für Lily.«
»Nein, war er nicht!«, rief ich. »Ich will die Zeitung, nicht den Bagel.«
Er stöhnte. »Nein, das klang auch beim zweiten Mal nicht überzeugend.«
»Sehr witzig, Dad.«
»Du kannst die Zeitung haben, wenn du abstimmst.«
Ich verdrehte die Augen, schob meinen Stuhl nach hinten und ging zur Theke, um mir die Halsketten noch einmal anzusehen. Die auf der rechten Seite hatte Federn. Meine Mom machte gerade eine Feder-Phase durch. Normalerweise war ich ein Fan von ihrem Schmuck, aber die Federn waren ein bisschen zu Hippie für meinen Geschmack. Doch anderen Leuten gefiel das offenbar. Ich hob die linke Kette hoch. »Das ist der Gewinner.«
Mein Dad stieß die Faust in die Luft. »Sie hat für meine gestimmt, Emily!«
Ich streckte die Hand aus.
Dad gab mir die Zeitung, küsste mich auf die Wange und verschwand, bestimmt um meine Mom ausfindig zu machen.
»Es ist schon seltsam, dass sie glauben, wir wüssten nicht, wer welche gemacht hat«, sagte Ashley. »Als würde das Ergebnis sonst jedes Mal so knapp ausfallen.«
»Ich weiß. Wir sollten Mom jedes Mal mit einem Riesenvorsprung gewinnen lassen, dann würden sie vielleicht mit diesem Wettbewerb aufhören.«
»Es ist gut für Dads Selbstwertgefühl. So, auf zur Schule, Schwesterherz.«
Ich drückte die Zeitung an mich, umarmte die Worte und folgte ihr nach draußen. Jetzt musste ich nur noch den perfekten Song schreiben und diesen Wettbewerb gewinnen.
Chemie hatte etwas an sich, das mein Gehirn dazu brachte, gleichzeitig an alles und nichts zu denken. Vielleicht war es die Mischung aus langweiligem Fach, monotonem Lehrer und kaltem Stuhl. Ob es dafür wohl eine chemische Gleichung gab? Diese drei Faktoren zusammengenommen ergaben eine Matschbirne. Nein, das war der falsche Begriff. Mein Hirn wurde nicht lahm. Vielmehr füllte es sich, bis es fast aus allen Nähten platzte. Wurde hyperaktiv. Und das machte es unmöglich, sich auf die trägen Sätze zu konzentrieren, die aus Mr Ortegas Mund kamen. Sprach er langsamer als sonst?
Neben den üblichen Gedanken und Wörtern, die ich jetzt ja nicht mehr in ein Notizbuch schreiben konnte, ging mir heute der Song durch den Kopf, den ich tags zuvor auf der Gitarre geübt hatte. Es war ein qualvoller Song – einer, den ich gleichermaßen toll und ätzend fand. Toll, weil er genial war und in mir die Lust weckte, etwas zu schreiben, das genauso gut war. Ätzend, weil er genial war und mir unmissverständlich klarmachte, dass ich niemals einen Song schreiben würde, der auch nur annähernd so gut war.
Und ich dachte ununterbrochen über diesen Wettbewerb nach.
Wie könnte ich ihn gewinnen? Wie könnte ich überhaupt daran teilnehmen?
Mein Bleistift schwebte über dem weißen Papier – dem von Mr Ortega genehmigten einzelnen Blatt. Wenn ich den Songtext einfach aufschreiben könnte, würde er nicht mehr in meinem Kopf herumschwirren und ich könnte mich auf den Unterricht konzentrieren. Aber dieses Blatt Papier vor mir musste ich in genau fünfundvierzig Minuten Mr Ortega vorlegen. Fünfundvierzig Minuten? Die Stunde zog sich endlos hin. Wovon redete er überhaupt? Eisen. Irgendwas über die Eigenschaften von Eisen. Ich schrieb das Wort Eisen auf die Seite.
Dann, als hätte er seinen eigenen Willen, bewegte sich mein Bleistift vom Papier weg zur Tischplatte und notierte die Zeile, die mir im Kopf herumspukte:
Öffne deine welkenden Blüten und lass das Licht herein.
Daneben zeichnete ich eine kleine Sonne, deren Strahlen ein paar der Wörter berührten. Jetzt waren es nur noch dreiundvierzig Minuten.
Ich lief gerade den Gang entlang und schrieb gleichzeitig in mein Notizbuch – eine Kunst, die ich noch nicht ganz beherrschte, obwohl ich sehr viel Übung darin hatte –, als ich Gelächter hörte.
Ich sah auf, weil ich dachte, dass es mir galt. Das war aber nicht der Fall.
Ein blonder Junge – möglicherweise ein Neuntklässler – stand mitten im Korridor und drückte seine Bücher fest an sich. Auf seinem Kopf balancierte er einen Baseballschläger, der bedenklich schwankte. Cade Jennings stand mit zur Seite ausgestreckten Armen hinter ihm, als hätte er den Schläger gerade erst losgelassen.
»Wirf mir den Ball zu«, forderte Cade seinen Freund Mike auf, der ihm und dem armen Neuntklässler gegenüberstand.
Mike tat wie geheißen und Cade überlegte nun, wie er den Ball oben auf den Schläger platzieren sollte. Der Junge sah zu verängstigt aus, um sich zu bewegen.
»Ich brauche einen Stuhl. Hol mir mal jemand einen Stuhl«, befahl Cade und sofort rannten Leute los. Der Schläger fing an zu wackeln, fiel gleich darauf herunter, sprang über den gefliesten Boden und blieb vor den Spinden liegen.
»Du hast dich bewegt, Alter«, sagte Cade zu dem Jungen.
»Versuch’s noch mal«, rief jemand aus der Menge der Schaulustigen.
Cade lächelte sein großes, strahlend weißes Lächeln. Er benutzte es oft, denn er kannte die Wirkung. Ich runzelte die Stirn. Offenbar war ich die Einzige, die dagegen immun war.
So ungern ich die Aufmerksamkeit auf mich lenken wollte, wusste ich doch, dass ich dem kauernden Jungen helfen sollte.
Aber ich hatte keine Ahnung, wie. Wegen Cade Jennings der Mittelpunkt unerwünschter Blicke zu sein war etwas, womit ich sehr vertraut war …
Ich dachte an ein Basketballspiel in der neunten Klasse zurück. Auch wenn ich nicht zu den Mädchen gehörte, die sich für eine totale Niete hielten, kannte ich meine Schwächen, und Sport war eine davon. Gemischter Basketball wiederum war die ultimative Form von Sport. Daher gab ich mir damals alle Mühe, mich so weit wie möglich vom Ball fernzuhalten.
Aus – wie mir später aufging – vermutlich reiner Bosheit bekam ich ständig den Ball zugespielt. Das galt sowohl für meine Mannschaft als auch für das gegnerische Team. Und es gelang mir nie, ihn zu fangen. Es war, als wäre ich das alleinige Ziel bei einer Partie Völkerball. Ich wurde an der Schulter, im Rücken und am Bein getroffen.
Irgendwann rief Cade, der auf der Zuschauertribüne gesessen hatte, so laut, dass es alle hören konnten: »Es ist, als würde sie mit ihrer Anziehungskraft den Ball direkt auf sich lenken. Wie ein schwarzes Loch. Wie ein Magnet. Lily Abbott, der Magnet.«
Den letzten Teil hatte er so betont, als wäre er der Sprecher in einem Film-Trailer. Und ich eine Art tollpatschige Superheldin. Gleich darauf ahmte ihn die gesamte Turnhalle nach. In genau dem gleichen Tonfall, unter lautem Gelächter.
Alle hatten gelacht und gelacht und dieses Gelächter verfolgte mich noch immer – genau wie der Spitzname »Magnet«.
Und jetzt hallte ein ähnliches Lachen durch den Gang und richtete sich gegen Cades neuestes Opfer.
Ich räusperte mich und sagte: »Sieh mal einer an, ein Spiel, um herauszufinden, wer der größere Vollpfosten ist, Cade oder sein Schläger.« Ich gab dem Jungen ein Zeichen, dass er verschwinden sollte, solange Cade abgelenkt war.
Cades Lächeln wurde doppelt so breit, während er mich musterte. Sein Blick wanderte von meinen Locken – die mir plötzlich noch widerspenstiger vorkamen als sonst – bis hinunter zu meinen Doc Martens mit den unterschiedlichen Schnürsenkeln. »Sieh mal einer an, die Spaßbremse. Haben wir für deinen Geschmack gerade zu viel davon, Lily?«
»Ich sehe nur eine Person, die Spaß hat.«
Er blickte sich im Gang um, der gerammelt voll war. »Dann schaust du nicht richtig hin.« Er senkte die Stimme. »Ich versteh schon. Neben mir verblasst alles und jeder.«
Wenn ich ihm zeigte, wie genervt ich war, würde er den Sieg davontragen. »Ich rette nur ein weiteres armes Opfer vor deiner Arroganz«, gab ich zähneknirschend zurück.
Aber möglicherweise rettete ich gar niemanden. Der Junge hatte sich nicht vom Fleck gerührt. Obwohl ich ihm die Chance gegeben hatte zu verschwinden, stand er immer noch da. Er meldete sich sogar zu Wort und sagte: »Wie wär’s, wenn du erst den Ball auf den Schläger packst und dann den Schläger auf meinen Kopf?«
Cade klopfte ihm auf den Rücken. »Gute Idee. Wo ist der Schläger hin?«
Ich seufzte. Es war nicht nötig gewesen einzugreifen. Dem Jungen gefiel es offenbar, missbraucht zu werden. Ich ging weiter.
»Komm nächstes Mal früher vorbei, Magnet. Wir wollen doch nicht, dass die Dinge außer Kontrolle geraten«, rief Cade mir hinterher und erntete noch mehr Gelächter.
In mir stieg eine Welle der Wut hoch und ich wirbelte herum. »Hast du schon mal was von Alliteration gehört? Solltest du mal probieren.« Es war ein nutzloser Konter. Ein Insider-Argument, das er nicht kapieren würde. Aber etwas Besseres fiel mir einfach nicht ein. Die anderen lachten noch lauter. Ich wandte mich ab und musste meine ganze Willenskraft zusammennehmen, um im normalen Schritttempo wegzugehen.
»Ich werde bei einem Songwriting-Wettbewerb mitmachen«, sagte ich.
Isabel, die mit der Hand nach ihrem Schlafanzug greifen wollte, hielt inne.
Es war Freitagabend und wir waren bei ihr zu Hause. Gleich wollten wir uns einen Horrorfilm ansehen. Ich hatte meinen Entschluss für mich behalten, seit ich am Vortag von dem Wettbewerb gelesen hatte, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher gewesen war. Jetzt, da ich es laut ausgesprochen hatte, musste ich meinen Worten Taten folgen lassen. Und das würde ich auch.
»Echt?« In ihrer Stimme lag mehr als nur ein bisschen Skepsis.
Ich ließ mich nach hinten auf ihr großes Bett fallen und betrachtete das Einstein-Porträt, das an die Zimmerdecke gepinnt war. Wieder einmal fragte ich mich, wie sie unter seinem festen Blick überhaupt schlafen konnte. Mir fiel es immer unheimlich schwer.
Aber ich übernachtete trotzdem total gerne bei Isabel. Sie war Einzelkind, daher wirkte ihr Zuhause auf mich wie eine Oase der Ruhe. Wir aßen immer mit ihren Eltern zu Abend – heute hatte es leckere selbst gemachte Tamales mit Reis und Bohnen gegeben – und gingen dann hoch in ihr riesiges Zimmer, in dem ein ausklappbares Sofa, ein Fernseher und ein winziger Kühlschrank gefüllt mit Cola light und Eis standen.
»Glaubst du, ich kann das nicht?«, fragte ich sie jetzt und runzelte die Stirn.
»Das ist es nicht, Lil. Deine Songs sind bestimmt klasse«, erwiderte Isabel und zog ihren Schlafanzug aus der Kommodenschublade. »Und das würde ich dir mit Sicherheit bestätigen, wenn du mir mal einen vorspielen würdest – mir, deiner, ach ja genau, allerbesten Freundin.«
Ich stöhnte. »Ich weiß. Tut mir leid. Ich hab noch keinen fertig.«
»Das sagst du immer. Wie willst du bei einem Songwriting-Wettbewerb mitmachen, wenn du nicht mal für mich einen deiner Songs spielst?«
Ich hielt mir die Hände vors Gesicht. »Keine Ahnung.«
Sie setzte sich neben mich aufs Bett. »Es tut mir leid. Ich weiß, dass du das schaffst, Lil. Du musst bloß an dich glauben.«
»Danke, Mom.«
»He, ich versuche nur zu helfen.«
Ich nahm die Hände herunter und sah sie an. »Ich weiß.«
»Erzähl mir von dem Wettbewerb.«
Ich stützte mich auf einen Ellbogen. »Das Herberger Institute hat ihn ausgeschrieben«, begann ich.
Isabel schnappte nach Luft und riss ihre dunklen Augen auf. »Oh wow. Die sind total angesehen, Lil!«
Ich nickte und zupfte nervös an einer Haarsträhne. »Ich weiß. Jedenfalls, man kann fünftausend Dollar gewinnen, was natürlich super wäre. Aber noch besser ist, dass der Gewinner einen dreiwöchigen Kurs bei einem ihrer Dozenten macht.«
Isabel lächelte. »Hammer. Einen Dozenten zu kennen, wäre hilfreich, um dort im College aufgenommen zu werden, oder?«
Ich nickte. Ich versuchte, nicht zu sehr über diesen Aspekt nachzudenken. Den Wettbewerb zu gewinnen würde mir nicht nur beim Schulgeld helfen – etwas, das sich meine Eltern nicht leisten konnten –, sondern auch dabei, überhaupt in das Musikprogramm aufgenommen zu werden, von dem ich seit Jahren träumte.
»Zeig mir doch einfach was. Wenigstens eine Song-Idee?« Isabel deutete auf mein grün-violettes Notizbuch, das auf meiner Tasche lag.
Ein Anflug von Schüchternheit überkam mich und ich zuckte mit den Schultern. »Ich hab ein paar Ideen, aber ich muss noch daran feilen. Ich möchte sie dir ja zeigen, nur nicht jetzt.«
Sie verdrehte die Augen und stand auf, um in ihren Schlafanzug zu schlüpfen. »Schisserin.«
Ich bewarf sie mit einer meiner Socken und ließ mich wieder rückwärts aufs Bett plumpsen, sodass das Deckenposter mein ganzes Blickfeld einnahm. Sie hatte recht. Ich war die totale Schisserin. »Ich glaube, Einstein ist nicht sehr beeindruckt von mir.«
»Wahrscheinlich nicht. Vielleicht hat er dein Notizbuch gelesen.«
Ich lachte, stand auf und angelte meinen Schlafanzug aus der Tasche.
Isabel wechselte das Thema, daher musste ich es nicht tun. »Ein Film oder zwei heute?« Das war der Code für: »Wie lange sollen wir aufbleiben?«
Ich lächelte. »Zwei. Wir haben die ganze Nacht.«
Mein Telefon vibrierte an meinem Oberschenkel. Ich setzte mich auf Isabels ausziehbarem Sofa auf und wusste einen Moment lang nicht, wo ich war. Der Fernseher vor mir brummte blau. Schwaches Morgenlicht fiel durch die Spalten der Fensterläden. Mein Handy hörte auf zu vibrieren und fing zehn Sekunden später wieder an.
»Hallo?«, fragte ich müde.
»Lily.« Es war mein Dad. »Dein Bruder hat heute sein letztes Fußballspiel. Du wolltest doch gerne einmal mit dabei sein. Das wäre jetzt deine Chance.«
»Um wie viel Uhr ist das Spiel?«
»Um acht. Also in dreißig Minuten.«
Ich gähnte. Isabel und ich waren erst nach drei eingeschlafen. Aber ich riss mich zusammen. »Ja, ich komme mit.«
»Okay. Ich hol dich in zwanzig Minuten auf dem Weg zum Spiel ab.«
»Danke.«
»Wer war das?«, ächzte Isabel vom Bett herüber. Sie setzte sich auf, ihre sonst so perfekten schwarzen Locken klebten ihr platt am Kopf.
Ich versuchte meine eigenen Haare zu glätten, die morgens eher einer wilden Mähne glichen als sanften Wellen.
»Mein Dad. Schlaf weiter. Ich muss los.«
»Was? Warum? Willst du keine Pfannkuchen?«
»Nächstes Mal. Ding Zwei hat ein Fußballspiel, das ich vergessen hatte.«
»Er hat immer ein Fußballspiel.«
»Ich war dieses Jahr noch bei keinem. Ich hab ihm versprochen, dass ich komme.«
Isabel ließ sich zurück auf ihr Kissen plumpsen, ihre Augen waren bereits geschlossen. »Okay. Dann bis Montag.«

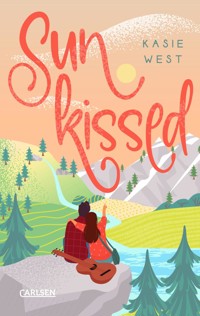
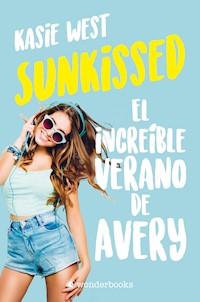
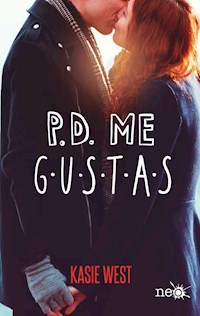















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









