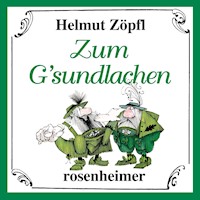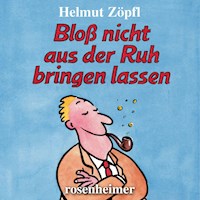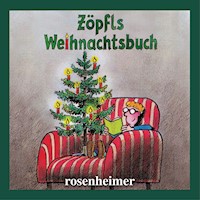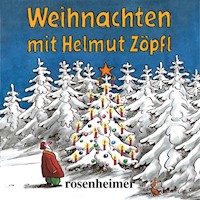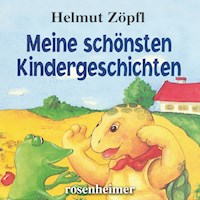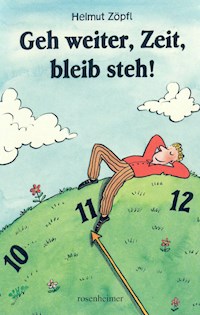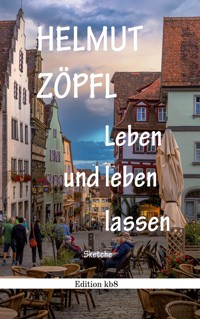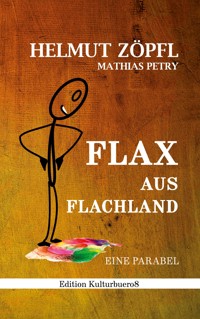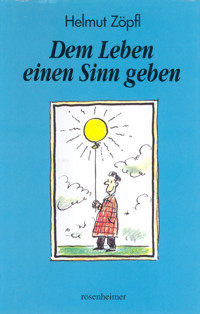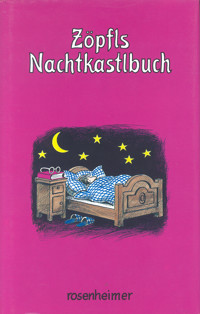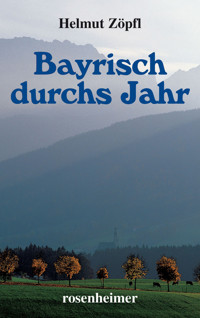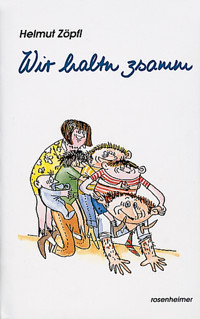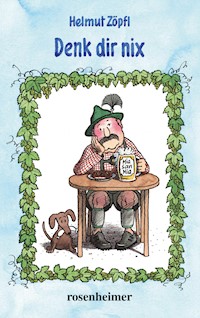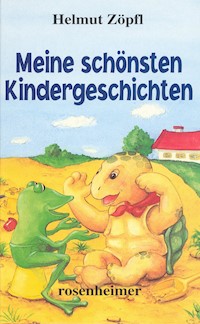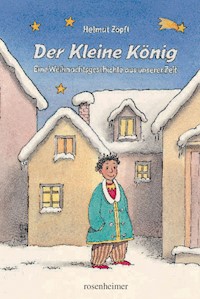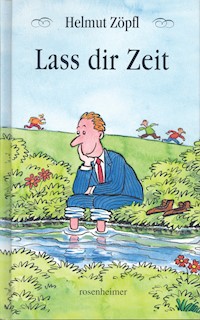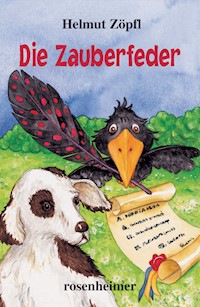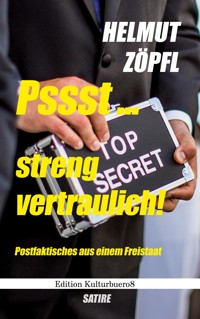
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: edition KB8
- Sprache: Deutsch
Es gibt ja schon so manches, das man mittlerweile über einen gewissen Freistaat erfahren hat. Aber ... pssst! Es gibt da noch viel mehr, das man unbedingt wissen sollte! Postfaktisches aus einem Freistaat. Erzählt von einem der großen Autoren des Landes, einer der schärfsten Zungen Bayerns: Helmut Zöpfl. Diese Geschichte hat alles, was den beliebten Autoren bei seinen Leserinnen und Lesern so beliebt macht: Sein Humor ist auf dem Punkt, er ist nicht berechenbar, seine Gedanken sind nicht vorhersehbar. Hier erfahren Sie, was Sie immer schon über einen gewissen Freistaat vermutet haben. Und noch viel mehr. So lustig kann Spannung sein!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Er gilt als eine der schärfstenZungen Bayerns: Helmut Zöpfl.
Das zeigt er wieder einmal in seiner Gesellschaftssatire „Pssst ... streng vertraulich“, die alles hat, was Helmut Zöpfl bei seinen Lesern so beliebt macht: Sein Humor ist auf dem Punkt, er ist nicht berechenbar, seine Gedanken sind nicht vorhersehbar.
Wie unorthodox Helmut Zöpfl ist, lässt sich allein an seiner wissenschaftlichen Karriere ablesen. Ab 1971 hatte er in München den Lehrstuhl für Schulpädagogik inne. Unter anderem vertrat er die Belange der Schüler in mehreren pädagogischen Kommissionen und gestaltete viele Jahre lang Lehrpläne mit.
Bekannt wurde Helmut Zöpfl zudem durch seine publizistische Tätigkeit. Neben zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten verfasste er auch mehrere Schriftenbände und Kinderbücher sowie einige Gedichtbände in Mundart, nachdem er gemerkt hatte, dass er seine Botschaften leichter in einer Sprache, die für viele Heimat bedeutet, vermitteln kann.
Die Auflage, die seine Bücher erreicht haben, ist siebenstel-lig. Von seinen zahlreichen wissenschaftlichen und literarischen Auszeichnungen freut ihn am meisten der „Ismaninger Kraut-kopf“, den, wie er sagt, bisher kein einziger Literaturnobelpreisträger erhalten hat.
1998 wechselte er die Seite, nahm ein naturwissenschaftliches Studium auf, das er 2002 mit der Promotion im Fach Biologie magna cum laude abschloss. Warum? Weil er es ganz einfach wissen wollte. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Und darum kann er auch nicht zusehen, wie die Welt der Pädagogik, seiner Pädagogik, in eine falsche Richtung abkippt. Er mag nicht zuschauen, wie die Kinder heute immer angepasster werden, weil sie glauben, dass das von ihnen erwartet wird. Ein Helmut Zöpfl schaut nicht zu. Ein Helmut Zöpfl bezieht Position.
Inhaltsverzeichnis
ÜBER DAS BUCH
1. SO FING‘S AN
2. DIE ANFÄNGE DES HERRN HOFEDITZ
3. DER WALDBUND
4. ERNA KOHLHUBER BETRITT DIE BÜHNE
5. EIN PROFESSOR WILL NACH OBEN
6. HOFEDITZ GREIFT DURCH
7. DER KULTUSMINISTER
8. DER MINISTERPRÄSIDENT
9. DAS DUO
10. DIE MINISTERPRÄSIDENTIN WANKT
11. HOFEDITZ TRIFFT DER SCHLAG
12. DIE REVOLUTION BRICHT AUS
13. DER KÖNIGSTREUE
14. DAS MUSICAL
15. DER PROZESS
16. DER WELTUNTERGANG
17. VIRTUELLE UNSTERBLICHKEIT
18. DIE GEGENREVOLUTION
1. SO FING‘S AN
Irgendein gescheiter Mensch hat vor einiger Zeit herausgefunden, dass der Flügelschlag eines ganz winzigen Schmetterlings, sagen wir einmal im fernen Australien, ungeahnte Folgen für die ganze Welt haben kann. Der Flügelschlag löst einen Windhauch aus, dieser Windhauch weht zufällig irgendeinen kleinen Gegenstand weg. Das löst wieder etwas aus, und die Wirkungen schaukeln sich immer mehr auf, werden immer gravierender, bis es schließlich zu einer Klimakatastrophe kommt – und alles nur wegen des Flügelschlags eines winzigen Schmetterlings.
Aber ich will hier nicht zu theoretisch werden. Es gibt es einen Witz, den ich schon vor Jahren gehört habe und der meines Erachtens die grundlegenden Erkenntnisse der ‚Chaosforschung‘ (von nichts anderem spreche ich gerade) auf humorvolle Weise noch besser erklärt.
Ein Golfspieler trifft den Ball mit zu großer Kraft. Der Ball landet auf einem Baum in einem Wespennest. Die Wespen schwirren wütend heraus und auf eine nahe gelegene Straße. Dort attackieren sie einen Radfahrer, der daraufhin vor Schreck von seinem fahrbaren Untersatz herunterfällt und liegen bleibt. Ein Autofahrer will ihm ausweichen, landet dabei aber an einem Baum. Das Auto geht in Flammen auf und steckt das dürre Gras an. Nicht lange, und ein riesiger Waldbrand ist entstanden.
Der Golfspieler, der dies alles verfolgt hat, überlegt: ‚Ich müsste doch wieder einmal eine Trainerstunde nehmen.‘
Genauso beginnt auch die Geschichte, die ich hier erzählen will. Das heißt, nicht genauso, denn ein der Auslöser war kein Golfball, sondern etwas ganz anderes. Die Universität hatte beschlossen, den neuen Lehrstuhl für Bayerische Literatur einzurichten.
Der Begriff ‚Lehrstuhl‘ muss laut Duden bekanntlich mit ‚eh‘ geschrieben werden. Ich bin aber der Meinung, man sollte ihn mit zwei e schreiben. Denn kaum dass so ein Lehrstuhl besetzt ist, kann es sein, dass dessen Besetzer oder Besitzer eigentlich schon wieder weg ist: Er hat an irgendeinem Forschungsvorhaben zu arbeiten begonnen.
Forschung kann etwas sehr Sinnvolles sein, wenn beispielsweise ein Mediziner eine Krankheit erforscht, um sich über mögliche Therapien Gedanken zu machen. Ich kenne aber auch Forschungsvorhaben von ganz anderer Art. Sie beginnen damit, dass der Forscher zunächst einmal danach forscht, wie man einen Forschungsauftrag bekommen könnte.
Dabei sind ein paar Dinge zu beachten. Von entscheidender Bedeutung ist erfahrungsgemäß, dass ein Forschungsauftrag möglichst kompliziert formuliert wird.
Wenn man etwa erforschen will, warum in Grönland weniger Kinder barfuß laufen als in Afrika, ist zunächst ein anspruchsvoller Titel zu wählen. Beispielsweise: ‚Die klimatische Kausalität der Nudopedestrie septentrionischer Regionen im Verhältnis zu meridianischen Regionen‘.
Das Wichtigste aber ist, dass man erforscht, wie für solch eine Forschung die nötigen, meist nicht geringen Mittel zu beschaffen sind. Dazu gibt es seit einiger Zeit das Forschungsvorhaben über die ‚Beschaffung von Forschungsmittel in einer mittellosen Zeit‘. Leider ist noch nicht absehbar, wann es abgeschlossen sein wird. Daher ist der Forscher bis auf Weiteres auf Eigenforschungen angewiesen.
Interessanterweise findet fast jeder Forscher innerhalb recht kurzer Zeit Möglichkeiten für die Beschaffung von Forschungsmitteln. Damit wiederum besorgt er sich zunächst Forschungskräfte und dann Forschungsräume sowie Forschungsmaterial.
Fast alle Forschungen dieser Art enden damit, dass man zu dem Forschungsergebnis gelangt: Um wissenschaftliche Fortschritte auf dem jeweiligen Gebiet zu erzielen, sind weitere Forschungen unabdingbar notwendig.
Aber ich schweife ein wenig ab. Zurück zur meiner Geschichte!
Irgendwann und wie hatte also die Fakultät der Universität beschlossen, diesen Lehrstuhl für Bayerische Literatur einzurichten. Merkwürdigerweise hatten sich nur zwei Kandidaten beworben.
Der eine war Wolfgang Pleiner, ein gebürtiger Salzburger, der aber seit seinem zweiten Lebensmonat in Bayern lebte, viele Jahre als Lehrer gewirkt hatte und alle akademischen Qualifikationen mitbrachte. Dazu hatte er eine ganze Reihe hervorragender Bücher über bayerische Literatur verfasst.
Der zweite Vertreter, ein gewisser Jens-Uwe Hofeditz, stammte aus Bremen. Sein Forschungsgebiet waren Kinderreime aus aller Herren Ländern. Dabei hatte er in seinem großen Buch zu dieser Thematik auch den bayerischen Kinderreimen ein Kapitel gewidmet. Ansonsten hatte er zur bayerischen Sprache weniger Verhältnis als ein Papagei zum Tiefseetauchen.
Der Dekan der Fakultät für Sprachund Literaturwissenschaften, ein gewisser Dieter Klawuttke aus Wernigerode, der den Lehrstuhl für Schwerbehinderten-Linguistik innehatte, war vor Kurzem mit seiner Bewerbung an der Universität Salzburg durchgefallen Er hielt ein flammendes Plädoyer für Jens-Uwe Hofeditz, indem er darauf aufmerksam machte, dass die Fakultät bei einer Berufung dieses Mannes die Aussicht auf enorme zusätzliche Forschungsmittel habe. Und dies gab den Ausschlag, dass Hofeditz am Ende des Berufungsverfahrens als gleich geeignet wie sein österreich-bayerischer Kollege angesehen wurde. Damit lag die Entscheidung beim Kultusministerium.
Da die Universität drängte, blieb den zuständigen Damen und Herren nur eine sehr kurze Überlegungszeit. Wie es der Zufall wollte, wurde der fachkundige Leitende Ministerialrat Winnin-ger aber just in dieser Zeit zum Leiter der Staatsbibliothek in Passau ernannt und war dabei, seine Stelle zu räumen. So musste sich dessen Stellvertreter mit der Sache befassen. Er war mit einer Österreicherin verheiratet und hatte an demselben Tag, an dem er dem Minister seinen Vorschlag unterschriftsreif vorlegen musste, einen Riesenkrach mit seiner Gattin. Die Frau hatte ihn daraufhin noch in den Morgenstunden verlassen und war zu ihrer in Salzburg lebenden Mutter abgereist.
Infolgedessen fand der Minister auf seinem Schreibtisch eine Liste vor, auf der Hofeditz an erster Stelle rangierte. Auch er hatte an diesem Tag gewaltigen Ärger bekommen. Ein Zeitungsjournalist hatte heftige Kritik an ihm geübt, weil er für die Welturaufführung des Werkes ‚Sadom und Sedum‘, das von dem Bremer Zwölftonmusiker
L. A. Bätsch stammte, weniger Mittel zur Verfügung gestellt hatte als für eine Mozartaufführung. Der Artikel erhob den Vorwurf der „Austrophilie“, und zum Beweis wurde unter anderem angeführt, dass die Schwester des Ministers mit einem Grazer verheiratet sei. Das Ganze gipfelte in einer Rücktrittsforderung.
Nach alldem war es kein Wunder, dass der Minister nach genauen Studium der Unterlagen, betreffend die Besetzung des Lehrstuhls für Bayerische Literatur, dem Vorschlag seines Ministerialbeamten folgte. Er sah darin eine Möglichkeit, sozusagen Wiedergutmachung zu leisten.
Das war also der Anfang.
Aber wie das meistens bei den Anfängen ist: Am Anfang ist noch gar nicht sichtbar, welche Folgen diese, wenn man so will, Kleinigkeiten oder Zufälle nach sich ziehen werden.
Sie erinnern sich an den Schmetterling beziehungsweise an den Golfball? Wäre der Schmetterling eine Stunde später weggeflogen, hätte sein Flügelschlag vielleicht keine Klimakatastrophe ausgelöst; hätte der Golfspieler verschlafen, hätte er vielleicht nie zu dem verhängnisvollen Schlag angesetzt. Und hätten nicht die Familie des Ministerialrats gerade an diesem Tag ihren Streit bekommen, vielleicht wäre alles anders ausgegangen.
Aber der Anfang war nun einmal gemacht und hatte den Stein ins Rollen gebracht. Das heißt natürlich nicht, dass es in unserer Geschichte nicht erneut eine ganze Reihe von Kleinigkeiten geben wird, die auf das Gesamtgeschehen einen entscheidenden Einfluss haben.
Denn es ist ja wohl eine in der Naturwissenschaft bekannte Tatsache, dass die Ursache immer im winzig Kleinen liegt. Denken Sie nur an die heute als gültig anerkannte Theorie von der Entstehung der Welt, wo alles aus einem einzigen Teilchen hervorgegangen sein soll.
2. DIE ANFÄNGE DES HERRN HOFEDITZ
Sobald der Ruf an den Lehrstuhl für Bayerische Literatur an ihn ergangen war, traf Hofeditz am neuen Ort seines Wirkens gewisse Vorbereitungen. Denn er hatte, so viel sei an dieser Stelle schon verraten, ganz offensichtlich große Pläne.
Als Erstes trat er aus der Partei aus, der er bisher angehört hatte – sie war in dem Bundesland, in dem er eben noch gewirkt hatte, seit vielen Jahren am Ruder. Dafür wurde er nun Mitglied der Bayerischen Landespartei. Er vollzog diesen Schwenk keineswegs in aller Stille, sondern ließ alle davon wissen, die im Lande etwas zu sagen hatten.
Jedem Minister und auch anderen wichtigsten Persönlichkeiten in hohen Staatsämtern schrieb er einen persönlichen Brief. Darin führte er aus, sein Eintritt in die Partei sei vor allem darauf zurückzuführen, dass er das Wirken des jeweiligen Herrn oder der jeweiligen Dame uneingeschränkt bewundere. Er erbot sich, sein ganzes wissenschaftliches Wirken in den Dienst des Staates zu stellen, der ihn so ehrenvoll berufen habe, aber auch „Ihnen, hochverehrter Herr Minister“ – in anderen Schreiben war es eben eine hochverehrte Frau Ministerin, ein hochverehrter Herr Staatssekretär oder eine hochverehrte Frau Staatssekretärin – zuzuarbeiten. Es sei ihm, so schrieb er weiter, schon an seiner bisherigen Wirkungsstätte ein großes Anliegen gewesen, endlich einen Aufsatz des jeweiligen Herrn oder der jeweiligen Dame für sein weltweit Furore machendes, im Entstehen begriffenes Buch ‚Große Geister unserer Zeit‘ zu gewinnen. Nun, da er sich in Bayern befinde, habe er endlich den Mut gefasst, dieses Anliegen vorzutragen.
Die Angesprochenen oder vielmehr Angeschriebenen fühlten sich sehr geschmeichelt und gaben als Erstes die Anweisung, Hofeditz zu sämtlichen Staatsempfängen einzuladen. Dann beauftragten sie ihre Redenschreiber, einen Beitrag für das Buch zu schreiben und darin ihr Wirken gebührend herauszustellen.
Schon nach kurzer Zeit hatte Hofeditz die Kulturszene des Landes genau erforscht. Er stellte fest, dass es zwei rivalisierende Dichteroder Schriftstellergilden gab. Eine beim Publikum sehr angesehene nannte sich ‚Hofschreiber‘. Ihre Mitglieder waren eher konservativ. Die andere Gruppe waren die aufmüpfigen ‚Li-tokriten‘. Ihr hervorstechendstes Kennzeichen war ihre vollständige Humorlosigkeit. Doch für alle Politiker im Lande, die sich selbst als ‚fortschrittlich‘ ansahen, gehörte es zum guten Ton, die Litokriten großartig zu finden. Und die Konservativen hatten Angst davor, sie nicht großartig zu finden. So kam es, dass die Mitglieder dieser Vereinigung sämtliche Literaturpreise einheimsten, die im Lande zu vergeben waren.
Hofeditz nahm sich zunächst einmal die Hofschreiber vor und schrieb einen umfangreichen Brief an den Präsidenten derselben, einen gewissen Wilhelm Friedrich. Darin erklärte er, dass er an seiner bisherigen Wirkungsstätte schon mehrere Vorlesungen über die literarische Tätigkeit der Hofschreiber gehalten habe und dass es sein sehnlichstes Anliegen sei, die ihm fast unbegrenzt für Literatur zur Verfügung stehenden Geldmittel zur Förderung dieser Schriftstellergruppierung zu nutzen. Er habe auch eine ganze Reihe von Verlagen an der Hand, die nur darauf warteten, Bücher von und mit den Hofschreibern zu gestalten. Eine besondere Ehre und Freude wäre es ihm natürlich, schrieb er, bei einer der Veranstaltungen der Hofschreiber eingeladen zu werden und dort einmal selbst über seine zukünftigen Aufgaben und Vorhaben sprechen zu können.
Es versteht sich wohl von selbst, dass die Einladung von Wilhelm Friedrich nicht lange auf sich warten ließ. Dieser lud sogar kurzfristig den zunächst für die Festansprache der alljährlich stattfindenden ‚Hofschreiberpreisverleihung‘ ausgesuchten verdienten Heimatpfleger Alfons Schottenmüller aus und dafür Hofeditz ein. Und der nutzte natürlich die Gelegenheit, die sich ihm bot, um sich in Szene zu setzen.
Zunächst klärte er die anwesenden, allesamt aus Bayern stammenden Hofschreiber auf, was überhaupt ‚bayerische Literatur‘ sei. Er habe in seinen umfangreichen Forschungen das Wesen des Bayerischen ganz genau ergründet. Ausgehend von diesen neuesten Untersuchungen habe er einige Kriterien aufgestellt und sie dann auf die literarischen Erzeugnisse der Hofschreiber angewandt. Dabei sei, so erklärte er der betrübten Festversammlung, unterm Strich nicht sehr viel übrig geblieben, weder bayerisch noch literarisch. Er bemängelte die Schreibweise der meisten Hofschreiber. Sie stimme in vielen Punkten absolut nicht mit den von ihm festgesetzten allgemeingültigen Mundartfixierungen überein. Mundart, so meinte er feststellen zu können, sei ganz und gar nicht die Stärke der Hofschreiber. Vieles sei fehlerhaft, nicht durchdacht, inkonsequent und mit der bayerischen Sprachgeschichte nicht vereinbar.
Den Schluss der Rede bildete sein hoffnungsvoller Ausblick, dass sich nunmehr alles zum Besseren wenden könne. Durch die Schaffung des Lehrstuhls für Bayerische Literatur und dank seiner Berufung seien die Voraussetzungen geschaffen, die literarische Produktion der Hofschreiber, bisher in vieler Hinsicht laienhaft, auf ein neues Niveau zu heben. „Die bayerische Literatur“, so seine Worte, „ist etwas Wissenschaftliches, ja sogar höchst Wissenschaftliches. Ich werde den Menschen dieses Landes systematisch vermitteln, dass die bayerische Sprache und die bayerische Kultur untrennbar miteinander verbunden sind. Und ich“, rief er leidenschaftlich aus, „ich werde diese bayerische Kultur zu einer neuen Blüte bringen. – All denen, die jetzt aufgrund meiner gerade dargestellten Untersuchungen zu resignieren beginnen, all denen sei gesagt, dass ich ab dem· kommenden Wintersemester Vorlesungen und Seminare anbiete, in denen sie systematisch sprechen und schreiben lernen. Und so lade ich“, schloss er seinen Vortrag, „Sie, verehrte Hofschreiber, ein, sich in meinem eigens für Sie angebotenen Seniorenstudium zu immatrikulieren. So werden Sie dem hehren Anspruch, den die Hofschreiber an sich selbst stellen, wenigstens einigermaßen gerecht werden.“
„Guat hat er gredt“, meinte anschließend beim Hofschreiber-Stammtisch der sich stets modern gebende Hofschreiber Karl-fried Schreiber. Der 93-jährige, schon etwas schwerhörige Senior der Hofschreiber, Erwin Hupfauf, dagegen fragte: „Was hat er denn eigentlich gsagt? I hab des meiste net verstandn.“
„Denk dir nix“, schrie ihm der humorvoll-kritische Herbert Schuster ins Ohr „I hab zwar verstandn, was er gsagt hat, aber er hat eigentlich gar nix gsagt. Des dafür aber sehr ausführlich.“
Hofeditz’ nächster Auftritt war der bei der anderen Schriftstel-lerGruppierung, bei den Litokriten. Dort schlug er ganz andere Töne an, wusste er doch, dass man durch eine gute Beziehung zu ihnen am ehesten zu Literaturpreisen und Forschungsmitteln kommen konnte. Denn es ist eine bekannte Tatsache, dass sich Konservative immer linke Alibis suchen, um ihre Liberalität zu bekunden, und darin bestand das wichtigste Erfolgsgeheimnis der Litokriten. Außerdem hatte jeder im Lande ein wenig Angst, sich mit diesen Leuten anzulegen, da sie erheblich aggressiver waren als die biederen Literaten aus der konservativen Ecke.
Ich habe im Zusammenhang mit den Litokriten gerade das Wort ‚Erfolg‘ gebraucht. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Arten von Erfolg. Wer ganz oberflächlich an die Sache heranging, der hätte gesagt, dass die Hofschreiber ausgesprochen erfolgreich waren. Sie sorgten landauf, landab immer wieder für pu-blikumsträchtige Veranstaltungen. Nur gibt es im Kulturbetrieb eine eiserne Regel, die sich auch hier bewahrheitete: Die Bezu-schussung steht grundsätzlich im umgekehrten Verhältnis zum Publikumsinteresse.
Trotzdem waren die Litokriten nicht immer glücklich mit ihrer Lage. Während nämlich die Hofschreiber jeden Monat bei ihren Lesungen ein ausverkauftes Haus hatten, lasen sie meist nur vor ihrer mitgebrachten Verwandtschaft. Die Veranstaltungen der Litokriten spielten sich meist im sogenannten ‚Kulturpalast‘ in der Landeshauptstadt ab. Die kleinsten Zimmer dort waren für zehn Personen konstruiert. Doch es ließ sich nicht vermeiden, dass selbst sie bei solchen Anlässen recht leer wirkten. Daher wurde im städtischen Kulturreferat der Vorschlag erörtert, die Wände zu verspiegeln, um den Eindruck eines großen Auditoriums zu erwecken.
Ein besonderer Gönner der Litokriten war ein Vertreter der konservativen Partei, ein gewisser Roland Theophil Froschmei-er, der sich selbst als bedeutenden Maler, Lyriker, Essayisten, Bildhauer, Architekten, Komponisten und Klaviervirtuosen einschätzte. Die Litokriten ermöglichten ihm regelmäßig den Zugang zu ihrer bestsubventionierten Zeitschrift. Da durfte er ausgiebig seiner Lyrik frönen.
Zurück zu Hofeditz. Der hatte sich vor seinem Vortrag natürlich genau kundig gemacht und zitierte die Schriften der Litokriten als leuchtende Beispiele engagierter Literatur des Volkes, der Heimat und des Stammes. Er versprach, unter dem Beifall der Anwesenden, sich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln für die Förderung dieser Werte einzusetzen. Und da er sich im Vorfeld auch mit Froschmeier befasst hatte, las er als Beispiel für besonders gelungene Gegenwartslyrik dessen Beitrag mit dem Titel ‚Wanne‘ vor, der folgendermaßen lautete:
Wanne
mei anne
oschaug
dann spanne
ohne mei anne
kanne, ja kanne
nimmermehr sei.
So oder ähnlich verfuhr Hofeditz in der ersten Zeit nach seiner Berufung bei all seinen Auftritten. Kein Wunder, dass er schon nach kurzer Zeit Mittel von der Stadt, vom Kultusministerium und diversen anderen Organisationen erhielt, die ihm erlaubten, eine eigene Zeitschrift herauszugeben. Er nannte sie ‚Der Gegenwartsliterat‘. Die Zahl der Leser blieb zwar auch nach Jahren immer noch eng begrenzt. In der Hauptstadt wurden regelmäßig weniger Exemplare abgesetzt, als von dem ostfriesischen Blatt ‚Der Wattwanderer‘ im Landkreis Freyung-Grafenau verkauft werden konnten. Das betrübte Hofeditz aber keineswegs. Im Gegenteil: Er verkündete bei allen sich bietenden Gelegenheiten, dass ‚Der Gegenwartslisterat‘ das maßgebende Organ für Literatur in unserem Land, ja für die gesamte deutsche Literatur sei.
So ist es nicht erstaunlich, dass Hofeditz schon nach kurzer Zeit sämtlichen Gremien angehörte, die auf dem Gebiet der Kultur irgendetwas zu sagen hatten. Er saß im Medienrat, im Rundfunkrat und ausnahmslos in sämtlichen Jurys, die über die Vergabe von Literaturpreisen entschieden.
3. DER WALDBUND
Der Waldbund war im Lande eine Institution. Keine Volksmusikgruppe konnte es sich leisten, sich mit dieser Brauchtums-vereinigung anzulegen. Der Waldbund bestimmte darüber, was echt und bayerisch war. Wehe, wenn sich irgendeinen Musikant, eine Sängerin oder ein Sänger erdreistete, etwas öffentlich aufzuführen, was nicht vom Waldbund abgesegnet war! Und wehe, wenn der große Vorsitzende desselben, Xaver Wackersbauer, bei irgendeiner Gelegenheit sagte:
»Habt ihr schon die Tissendorfer Dirndln gehört, was die gesungen haben? Da ist eine Zeile dabei, die ist nicht echt.«
Dieses »nicht echt« bedeutete in der Regel das Aus für die jeweilige Gruppe. Wer sich nicht mehr der Gunst des Xaver Wackers-bauer erfreute, dem drohte wie ein Damokles-Schwert dieses Urteil »nicht echt«.
Es gab vieles, was als »nicht echt« eingestuft werden konnte. Beispielsweise eine Kadenz, die – wenigstens nach Wackersbau-ers Urteil – nicht ins volksmusikalische Bild passte. Vor allem aber war es der Text, der sich strikt an die bayerisch-alpenländischen Vorgaben halten musste. Als echt anerkannt wurde für gewöhnlich alles, was sich um Almaufund abtrieb, Jager und Wildschützen, den Jahresablauf, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter und die Liab vom Dirndl zum Buam drehte. Verirrte sich jemand in andere Gefilde, dann wurde es gefährlich.
Nicht nur für den Text gab es strenge Regeln. Ebenso streng war die Kleiderordnung für die Auftritte. Wenn das Gwand und die Tracht nicht ganz genau stimmten, dann war das ähnlich verhängnisvoll, als wenn jemand im Text mit dem Mähdrescher statt mit »de Rooß« über das Feld gefahren wäre.
Auch die Frisuren unterlagen einer Art Zensur. Wehe, die Dirndln ließen sich einfallen, sich die Haare einmal kurz schneiden zu lassen. Als die Hartlfinger Madln sich dies einmal leisteten, wurden sie mit vier Jahren Sperre bestraft. Und da sie damals schon weit über die dreißig waren, mussten sie sich hernach in ‚Hartlfinger-Sängerinnen‘ umbenennen, bekamen aber bei den großen Hoagascht-Veranstaltungen nie mehr einen guten Platz im Programm. Das war ein echter Nachteil, weil einige dieser Veranstaltungen sogar im Rundfunk oder Fernsehen übertragen wurden und dadurch eine gewisse Einnahmequelle bedeuteten. Wobei der Wackersbauer-Xaver immer verkündete, dass es in der Kultur auf keinen Fall ums Geld gehen dürfe.
Beinahe hätte ich es vergessen. Der Wackersbauer-Xaver betrieb zusammen mit seinem Bruder eine große Musikalienhand-lung und hatte außerdem ein eigenes Tonstudio, in dem er die echtesten aller echten Musikstücke und Gesänge aufnahm. Seine Frau hatte ein sehr angesehenes Trachtengeschäft, in dem selbstverständlich nur verkauft wurde, was ebenfalls ganz und gar echt war.
Bei vielen der erwähnten Hoagarten, bei denen vornehmlich gesungen und musiziert, aber auch da und dort ein paar verbindende Worte gesagt wurden, fungierte der Xaver höchstpersön-lich als Sprecher. Die reizvollen Texte zu diesen Darbietungen entwarf er meistens selbst. Hier eine kleine Kostprobe:
»So, liabe Leit, jetzt san ma wieder da. Wir ham uns wieder eingrfunden zu unserem Sängerund Musikantentreffen in Engl-polding. Eine ganze Reihe von Sängerinnen und Musikanten ist dem Aufruf gefolgt, und jetzt, liebe Leitl, horchts euch an, was wir euch vorspuin und vorsingen werdn. Wir fangen an mit den Mitterleitner Buam, die uns des Lied vom ‚Scheena Fruajahr‘ singen werdn. Begleitet werdn sie auf der Zither vom Ampflwacher-Sepp, der jedem echten Volksmusikanten ein Begriff ist. Sepp, hast dei Instrument dabei? Also guat, dann fang ma o! Buama, singts oans!«
Buama, die schon weit in den Sechzigern waren, fingen nun mit einem Lobpreis des Frühjahrs an. In der Regel, jedenfalls wenn er ‚echt‘ sein soll, läuft der Lobpreis so ab: Man freut sich, dass das Frühjahr da ist, weil’s dann wieder aufwärts geht. Der beginnende Lenz dokumentiert sich in dem Lied vor allem dadurch, dass alles wieder grün, oder vielmehr »grea«, wird und dass die Bäume zu blühen beginnen. Ja, häufig ist auch von Vo-gerln die Rede, die jetzt ihr Frühjahrslied singen.
Im Mittelpunkt steht aber fast bei all diesen Frühlingsliedern der Almauftrieb, die Sennerin, die die Küah und Kalma wieder aufetreibt auf die Alma. Als Prototyp eines Frühjahrsliedes können also folgende Zeilen gelten:
Jetzt fangt des scheene Fruahjahr o.
Da treibn mas’ aufi auf de Alma,
unsere Küah und unsere Kalma.
Da treibn mas’ aufi auf die Höh.
Holladiridioh, da drobn is’ schee.
Nachdem das Frühjahrslied beendet ist, tritt der Wackersbauer-Xaver wieder ans Rednerpult, bedankt sich bei den Buam für des »scheene Fruahjahrsliad« und kündigt dann in etwa wie folgt die nächste Gruppe an:
»So, nachdem jetzt unsere Buama des scheene Liad vom Fru-ahjahr gsunga ham, geht’s weiter in unserm Programm. I gfreu mi, dass unsere Mooslechner-Dirndln heut zu uns kemma san. Wenn i mi net täusch, habts ihr aa a Liad mitbracht? Geh, Monika, wia hoaßt’n euer Liad?«
»Jetz fangt da scheene Sommer o.«
»Aha«, meint darauf der Wackersbauer-Xaver, »jetz ham ma schon des Liad vom Fruahjahr ghört, jetz san ma gspannt, was uns da Sommer bringt. Könnts uns des Liad aa singa?«
»Also dann, auf geht’s!«, juchzt die Monika. Die drei Moos-lechnerDirndln, die schon in den Fünfzigern sind, besingen nun den Sommer. Weil es natürlich ein ‚echtes‘ ist, lautet der Text so:
Jetzt fangt der scheene Sommer o.
Da san ma droma auf de Alma,
bei de Küah und bei de Kalma.
Ja, auf da Alm is Sommerzeit.
Holladiridioh, des is a Freud!
Nach diesen eindrucksvollen Zeilen betritt wiederum der Xaver das Rednerpult, bedankt sich bei den ‚Dirndln‘, die in ihrem Lied ein eindrucksvolles Bild des almerischen Lebens im Sommer gezeichnet hätten, und meint, dass es ja nicht nur das Fruahjahr und den Sommer gebe, sondern auch noch den Hirgscht. Und darüber wüssten jetzt die Geschwister Daxlrieder zu berichten Er begrüßt sie mit den Worten:
»Nett, dass’ zu uns kemma seids zu unserm Musikantentreffen. Habts ihr uns aa a Liadl mitbracht, des was’ uns vortragn könnts? Also dann, Quirin, wia waars, wennst as uns singa daadst?«
Und jetzt bekommen die liabn Leit im Saal den Prototyp des Herbstliedes zu hören:·
Jetzt fangt da schöne Hirgscht wohl o.
Da treibn mas’ abe von de Alma,
unsere Küah und unsere Kalma.
Da treibn mas’ abe von der Höh.
Holladiridioh, da drobn war’s schee.
Der Xaver meint am Ende, dass der Herbst wohl schon immer Dichter und Sänger zu besonders eindrucksvollen lyrischen Versen beflügelt habe. Und dass die Geschwister Daxlrieder gerade ein eindrucksvolles Zeugnis dafür geliefert hätten, wie bei uns im Volk die Schönheit des Herbstes in Wort und Ton eindrucksvoll besungen wird. »Ja, aber«, meint er dann, »was wär das Jahr, wenn es nicht auch einen Winter gäbe? Denn wir ham ja bekanntlich nicht nur eine, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern sogar vier Jahreszeiten!« Auch wenn der Winter oft kalt und eisig sei, das hätt trotzdem seine guten Seiten. Und darüber würden wir jetzt ein Lied hören, das der Kuglhafer-Lenz singt.
»Ja, ihr habts schon richtig gehört, der Kugelhafer Lenz, unser letztes bayerisches Original, das wir noch haben. Trotz seiner 87 Jahre hat er es sich nicht nehmen lassen, zu unserem Sängerund Musikantentreffen zu kommen.«
Der Kuglhafer-Lenz singt mit einer für sein Alter erstaunlich kräftigen Stimme ein Lied, das sich mit dem Leben auf den Almen und dem Tal im Winter befasst und etwa so geht:
Jetzt is die kalte Winterszeit.
Da liegt der Schnee wohl auf de Alma,
und die Kuahlan und die Kalma
san jetzt drunt in eahnam Stall.
Holladiridioh, in unserm Tal.
Vor Jahren hatte der Mundartdichter und Sprachforscher Jere-mias Lohhofer für große Aufregung gesorgt. Er hatte nach einer Möglichkeit gesucht, ein wenig neues Leben in die Reihen der »Alma und Kalma« zu bringen, und deshalb eine fünfte Variante der üblichen Jahreszeitenlieder geschrieben. Sie lautete folgendermaßen:
Jetzt kimmt die schöne Fruahjahrszeit.
Heuer kimm i auf die Alma
nimma aufe zwengs meim Rheuma.
’s Rheuma is fürs Bergsteign Gift.
Holladiridioh, i fahr mi’m Lift.
Diese Zeilen hatten für den größten Skandal auf dem ‚Bayerischen Sprachtumsund Musikantenwettbewerb‘ gesorgt. ln der Zeitschrift
‚Der Almauftrieb‘, die übrigens von Xaver Wackersbauer herausgegeben wurde, wurde dieser Veranstaltung eine Sondernummer gewidmet. Dabei wurde auch die »beispiellose Entgleisung« des Jeremias Lohhofer in einem eigenen Artikel gebührend verurteilt. Alle, die sich dem bayerischen Brauchtum verbunden fühlten, wurden angewiesen, Jeremias künftig zu meiden. Sollte der Sünder ein Lokal betreten, sei es die Pflicht jedes aufrechten Brauchtumsschützers, es sofort zu verlassen. Wackersbauer, der als Vertreter für Kulturund Brauchtumspflege auch im Rundfunkrat saß, hatte es durchgesetzt, dass Lohhofer in Sendungen und Veranstaltungen des staatlichen Rundfunks und Fernsehens absolutes Auftrittsverbot erhielt.
Inzwischen hat Lohhofer seine Eigentumswohnung in Rosen-heim verkauft und arbeitet jetzt als Lektor im Schimmelreiter-Verlag in Schleswig-Holstein.
4. ERNA KOHLHUBER BETRITT DIE BÜHNE
Warum ich so ausführlich über den Waldbund geschreiben habe, wird sich gleich herausstellen.
Hofeditz war schon nach relativ kurzer Zeit klar geworden, wie mächtig diese Vereinigung im Lande war, und sann tagaus, tagein darüber nach, wie er sich dort in eine führende Position hineinmanövrieren könnte.
Da kam ihm der Zufall zu Hilfe. Denken wir wieder an den Schmtterling oder den Golfball!
Zur damaligen Zeit gab es im Lande eine Politikerin, die den bedeutenden Rang einer Staatssekretärin einnahm. Sie verdankte das allein der Tatsache, dass sie allen Ansprüchen genügte, die das fast göttlich verehrte Prinzip des Proporzes damals an einen Bewerber stellte. Erstens war sie eine Frau. Zweitens stammte sie aus einem Landesteil, von dem feststand, dass ihm stets eine der führenden Positionen in der Regierung eingeräumt werden musste. Dazu kam, dass sie genau der Konfession angehörte, die für den vollkommenen Proporz in ihrem Ministerium noch gebraucht wurde, und dass sie eine der wenigen Nichtbeamtinnen oder -beamten in den hohen Staatsämtern war.
Ansonsten zeichnete sie nicht viel aus. Dies wirkte sich jedoch auf ihre weitere Karriere nur positiv aus. Bei ihren politischen Auftritten merkte nämlich jedermann, wie es um ihre geistigen Fähigkeiten bestellt war. Das wiederum führte dazu, dass sich die Verantwortlichen in ihrer Partei scheuten, sie vor großem Publikum sprechen zu lassen. So trat sie bald nur noch bei kleinen, scheinbar unbedeutenden Anlässen auf.
Es ist ein großer Irrtum, zu meinen, Politiker erreichten dann am meisten, wenn sie vor einem möglichst großen Publikum sprechen. Bei den Großveranstaltungen der Parteien sind meistens ohnehin nur diejenigen da, die diese Partei sowieso schon wählen – ausgenommen vielleicht ein paar Störer, die man aber sowieso nicht überzeugen kann.
Ah ja, beinahe hätte ich es vergessen, der Name der Politikerin war Erna Kohlhuber. Sie durfte bei kleineren Veranstaltungen allenthalben ihre Grußworte entrichten. Außerdem gehörte sie einer ganzen Reihe von Gremien an, darunter auch solchen, die beträchtlich weniger Geldsorgen hatten als der Finanzminister. Und sie saß in der Vorstandschaft von ein paar Dutzend Vereinen.