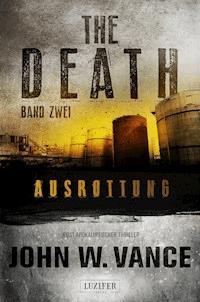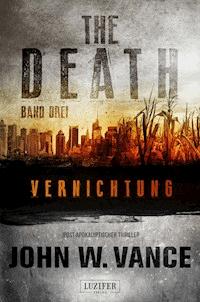Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Death
- Sprache: Deutsch
"Der Tod" wird dich finden ... Devin Chase ging bloß seinem Alltag nach, als die Welt schlagartig aus den Angeln gehoben wurde. Binnen einer Woche suchte ein fatales Virus, dem man den Namen ›Der Tod‹ gab, die Erde heim und streckte 90 Prozent aller Infizierten nieder. Nach sechs Monaten in selbst auferlegter Quarantäne tritt Devin hinaus in eine neue Welt. Unterwegs trifft er andere Menschen, die immun sind wie er, entdeckt aber auch, dass die Welt, wie er sie kannte, nicht mehr existiert. An ihre Stelle ist eine brutale, grausame Welt getreten, in der nur die Regel ›Töten oder getötet werden‹ gilt. Auch die Welt von Lori Roberts, einer Mutter, Ehe- und Geschäftsfrau, steht im Zuge ›des Todes‹ ebenfalls Kopf. Sie und ihre Familie wenden sich hilfesuchend an ein Camp der Katastrophenschutzbehörde, doch was hoffnungsvoll beginnt, wird zu einem Albtraum, nachdem sie zufällig in Erfahrung bringt, was wirklich vor sich geht. Tausende Meilen voneinander entfernt, und dennoch verbunden im gleichen Verlangen, versuchen Devin und Lori "irgendwie" zu überleben. Die Geschichte geht weiter in Band 2: THE DEATH - Ausrottung ---------------------------------------------------------- "Grandioser Endzeit Thriller!" [Lesermeinung] "Es macht Spass, ist beängstigend und man will ständig wissen, wie es weitergeht mit Devin und Lori." [Lesermeinung] "Es gibt keine Gewissheit, außer den Tod - ein fesselnder Reihenauftakt" [Lesermeinung]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
THE DEATH - QUARANTÄNE
John W. Vance
Copyright © 2014 by John W. Vance All rights reserved. No part of this book may be used, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the written permission of the publisher, except where permitted by law, or in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. By arrangement with John W. Vance
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: QUARINTINE Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Andreas Schiffmann
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-035-9
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Romane zu schreiben ist nicht leicht; das weiß ich, weil ich es selbst schon mehrmals getan habe. Aus diesem Grund zögerte ich auch nicht, als mich mein guter Freund John W. Vance um Hilfe bat. Schließlich hatte ich selbst, als ich an meinem Debüt THE END feilte, meine eigene ›Hilfstruppe‹, die mir Beistand leistete und konstruktive Kritik übte, damit mein Traum wahr werden konnte. John W. Vance wendete sich an mich, und ich stand ihm bei der Umsetzung seines Einstandsromans THE DEATH zur Seite, soweit er mich brauchte. Das geschah nicht allzu häufig, weil John eine aufregende, fesselnde Geschichte geschrieben hatte. Er machte sich seine eigenen Erfahrungen aus dem Alltag eines Marinesoldaten und CIA-Beobachters zunutze, um Charaktere zu entwickeln, mit welchen sich jeder identifizieren kann. Sie sind spannend, komplex gestrickt und dennoch sympathisch. Ihr werdet euch dabei ertappen, sie zu vermissen, wenn ihr dieses Buch zugeschlagen habt, genauso wie ich es tat.
Ich bin gespannt, was im Verlauf der Trilogie von THE DEATH aus Johns Welt wird. Dieser Roman markiert einen ausgezeichneten Beginn für eine – das sehe ich voraus – lange Schriftstellerkarriere.
Glückwunsch, John, du bist ein klasse Typ und Freund. Halt die Stellung!
G. Michael Hopf – Bestseller-Autor der postapokalyptischen Reihe THE END
Prolog
Tag 1
2. Oktober 202038.000 Fuß über Illinois
Cassidy Langes Gedanken überschlugen sich nach alledem, was sie in den vergangenen anderthalb Wochen gesehen und getan hatte. Dann geriet die Maschine erneut in Turbulenzen. Wenn sie sich vor Angst nicht gerade so fest an die Armlehne von Sitz 23A klammerte, dass sich ihre Fingerknöchel weiß unter der Haut abzeichneten, bemerkte sie, dass sie immer wieder an dem Verlobungsring nestelte, den ihr Devin keine drei Wochen zuvor geschenkt hatte. Sie konnte kaum erwarten, ihm alles zu erzählen, obwohl sie zunächst diesen dreistündigen Flug von Omaha nach New York hinter sich bringen musste. Die Turbulenzen waren eine Qual für sie, doch zum Glück saß sie an einem Fensterplatz, wo die Zeit rascher verging und die Furcht erträglicher war. Jedes Mal, wenn sich die Maschine schüttelte oder absackte, krallte sie sich krampfhaft an die Lehne, sodass sie befürchtete, das Ding abzubrechen. Unter ihr kroch unterdessen ein Teppich aus Grün-, Braun- und Blautönen vorbei. Die letzten zehn Tage hatten eine Wende in ihrem Leben und ihrer beruflichen Laufbahn eingeleitet. Unter einer Vielzahl von Mitbewerbern war sie für ein Team unabhängiger Wissenschaftlicher ausgesucht worden, am Einschlagskrater des Asteroiden Pandora, wie man ihn getauft hatte, zu forschen.
Dieser war nirgendwo verzeichnet, geschweige denn überhaupt bekannt gewesen, bis er sich drei Wochen zuvor aus dem Nichts am Himmel aufgetan hatte. Nachdem seine voraussichtliche Flugbahn rasch von Astronomen berechnet worden war, hatte sich zum Entsetzen der Menschheit herausgestellt, dass er auf der Erde einschlagen würde. Dies war am 21. September um 12:33 Uhr Central Standard Time auf den weiten Ebenen im Westen Nebraskas geschehen. Bei Pandora handelte es sich um einen verhältnismäßig kleinen Asteroiden – seine Maße entsprachen ungefähr einem Fußballfeld –, doch als er sich mit 60.000 Meilen pro Stunde in den weichen Boden des Flachlands von Nebraska gebohrt hatte, war es im Staat und darüber hinaus nicht unbemerkt geblieben. Aus diesem Naturereignis hätte man keinen Film drehen können; da war kein langer Flammenschweif von blendender Schönheit am Himmel vorbeigerast, den sich jedermann über Minuten hinweg hätte anschauen können. Wäre man am Ort des Aufpralls zugegen gewesen, hätte man keine Warnung erhalten. Allseitiger Ruhe war innerhalb einer Millisekunde eine gewaltige Erschütterung der Erde gefolgt, und einen weiteren Sekundenbruchteil später hatte es ein einziges Mal geblitzt, während der schwere Felsbrocken einen mehr als 1.000 Fuß tiefen Krater mit einem Durchmesser von über einer Meile aufgerissen und Geröll meilenweit in den Himmel geschleudert hatte. Pandora war nicht groß genug, um weltweite Katastrophen auszulösen; streng genommen hatte niemand in einer Entfernung von wenigen Hundert Meilen überhaupt etwas bemerkt, doch dem Aufschlag waren Folgen erwachsen, die kein Forscher, Astronom oder Astrophysiker vorhersah. Der Asteroid verfügte wie die gleichnamige Gestalt aus der griechischen Mythologie sozusagen über eine Büchse, und diese hatte sich an dem Tag geöffnet, als Cassidy mit ihrem Team vor Ort eingetroffen war.
Das Flugzeug bebte erneut. In nervöser Unruhe zurrte sie den Sitzgurt über ihrem Schoß fest. Sie wusste, wie dämlich das war, denn sollte die Maschine abstürzen, würde sie auch kein Sicherheitsgurt mehr retten. Ungeachtet dieser wohlbekannten Weisheit fühlte sie sich durch die straffere Spannung ein wenig sicherer.
Um den ruckeligen Flug zu verdrängen, nahm sie sich vor, ihre Gedanken freizubekommen, indem sie einige der Daten durchging, die sie gesammelt hatte. Sie nahm ihre Ledermappe zur Hand und begann, in den vielen Seiten voller Informationen zu blättern. Cassidy hatte mehr gewollt, doch nach nur wenigen Tagen in der Nähe der Einschlagstelle waren sie angewiesen worden, das Gebiet zu räumen, weil das Militär anrückte und es unter Quarantäne stellte. Auch seinem Widerstand zum Trotz war das Wissenschaftsteam abbestellt und durch ein anderes der Regierung ersetzt worden. Allerdings hatten sie nicht einfach so aufbrechen dürfen, sondern zunächst ein Protokoll zur Dekontamination einhalten und sich impfen lassen müssen. Einige hatten die strengen Richtlinien, die vorgegeben worden waren, verständnisvoll hingenommen, die meisten aber nicht; doch deren Beschwerden waren verpufft, denn Regierung und Militär hatten den Bereich vollständig und ausnahmslos abgeriegelt. Binnen 24 Stunden, nachdem die Armee dort aufgetaucht war, hatte Cassidy ihre Zahl auf Tausende geschätzt. Der Luftraum wurde für den Flugverkehr gesperrt, und das Gelände rings um das Loch war bedeckt mit großen, weißen Kuppeln, die Zelten glichen. Kurz nach der Übernahme durch die Behörden war ihr Team aufgelöst und jedes Mitglied gesondert unter Quarantäne gestellt worden. Cassidy hatte sich gewehrt, sich den gestellten Forderungen aber nach mehreren einsamen Tagen voller langwieriger Verhöre durch Männer und Frauen in Ganzkörper-Schutzanzügen gefügt und eine Spritze geben lassen, um die Regeln ihrer Zwangsisolation einzuhalten.
Die Maschine zitterte im Gegenwind, weshalb Cassidy ihre Armlehne abermals packte. Schweißperlen traten auf ihre Stirn. Sie streckte eine Hand nach oben aus und schaltete die Lüftung ein. Der kühle Strom, der ihr ins Gesicht wehte, tat gut, und sie entspannte sich ein wenig. Ihr erbittertes Klammern und panisches Verhalten bei jeder Bewegung des Flugzeugs fiel einem Mann auf, der in ihrer Reihe am Gang saß.
»Hier, die können Sie auch benutzen.«
Als sie die Augen öffnete, langte er gerade nach oben an die Lüftung über dem unbesetzten Platz in der Mitte. Er schaltete sie ein und drehte sie in Cassidys Richtung.
»Oh, vielen Dank. Ist heiß hier drin, nicht wahr?«, fragte sie, während sich ihr ein Gefühl von Scham aufdrängte.
»Sie sind keine begeisterte Fliegerin?«
»Äh, nein, eigentlich nicht.«
»Was ich dabei am schlimmsten finde, ist das Gefühl, keine Kontrolle zu haben«, gestand er selbst.
»Ha, bei mir ist es die Angst vorm Abstürzen«, scherzte sie, sodass ein Lächeln ihre gebräunte Haut in Falten legte. Sie strich sich eine Strähne ihres glatten, braunen Haars hinters Ohr und ließ sich noch tiefer in den Sitz sacken.
»Darf ich fragen, wohin Ihre Reise geht?«, fuhr er fort.
»Nach Hause, und Sie?«
»Von dort komme ich gerade; ich fliege nach London«, erzählte er. »Zum ersten Mal.«
»London? Das ist schön. Ich bin zwar noch nie dort gewesen, würde es aber sehr gern eines Tages sehen.«
»Was sind Sie von Beruf?«, fragte er weiter.
»Astrobiologin.«
»Verzeihung, was ist das?« Er neigte sich ihr zu, weil er wirklich neugierig zu sein schien.
Sie sah ihn an. Er kam ihr attraktiv vor mit seinem kurzen, braunen Haar, das an den rasierten Seiten grau meliert war, und den stechend blauen Augen. Der Kontrast zwischen dunklem Haar und hellen Augen gefiel ihr generell sehr gut. Er war einer der Gründe dafür, dass sie sich zu ihrem langjährigen Freund Devin hingezogen fühlte. Cassidy erging sich zwar ungern in bemühten Unterhaltungen, zu denen sich viele auf Flügen hinreißen ließen, und versuchte stets, sie zu vermeiden, indem sie Kopfhörer aufsetzte oder so tat, als schlafe sie, doch dieser Mann hatte sie kalt erwischt, wofür sie dankbar war. Seine Aufmerksamkeit wirkte beruhigend, und das brauchte sie.
»Ich erforsche die Ursprünge, Entwicklung, Verbreitung und Zukunft des Lebens im Universum«, zählte sie auf, ein Abspulen erschöpfend einstudierter Antworten auf stets gleiche Fragen, die man ihr schon unzählige Male gestellt hatte.
»Wow, Leben im Universum, so wie E.T.?« Er grinste.
»Wie E.T., genau.«
»Entschuldigung, das kam jetzt hoffentlich nicht falsch rüber. Ich meinte nicht …«
»Keine Bange«, beschwichtigte sie. Sie sah alles ein wenig verschwommen und spürte, dass sich ein weiterer kräftiger Hitzeschub anbahnte. Ihre Stirn wurde noch feuchter, und sie fühlte sogar, dass ihre Hände schmierig waren.
»Geht es Ihnen gut?«, hakte er nach.
Sie antwortete nicht sofort, sondern blinzelte, um wieder klar sehen zu können. Übelkeit drohte, sie zu überwältigen, wofür sie keine Erklärung fand, und dies machte ihre Beklommenheit umso schlimmer.
»Sicher, mir geht es gut, ich bin bloß … sehr müde«, erklärte sie schließlich. »Ich habe gelinde ausgedrückt eine lange Woche hinter mir.« Sie sprach in lang gezogenen Worten.
»Sie sehen blass aus.«
»Ist wirklich nichts weiter, tut mir leid, aber ich denke, ich ruhe mich besser ein wenig aus.« Sie rieb sich ihre rechte Schulter, bevor sie den kurzen Ärmel hochschob und energisch kratzte.
»Autsch, das sieht aus, als würde es wehtun«, bemerkte er.
»Was?« Als sie auf ihren Oberarm schaute, reagierte sie erstaunt angesichts des Flecks an der Stelle, in die man nur 24 Stunden zuvor injiziert hatte.
»Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht?«, beharrte er.
»Absolut, aber ich bin eben müde.«
»Okay, dann gönnen Sie sich etwas Ruhe.«
»Eigentlich müsste ich auf die Toilette? Sind Sie so nett …«
»Kein Problem«, entgegnete er und stand auf.
Als sie sich erhob, fühlte sie sich schwach und bekam ein leichtes Schwindelgefühl. Er sah dies und kam ihr sofort zur Hilfe, indem er ihren Arm festhielt und ihr heraushalf.
Cassidy hatte weiche Knie. Bevor sie auf den Gang trat, hielt sie inne und schaute ihn an. »Wie sehe ich aus?«, wollte sie wissen.
»Nicht gut. Soll ich die Flugbegleitung rufen?«
Sie machte einen weiteren Schritt, da überkam die Schwäche sie, und er musste sie auffangen.
Während er sie sicher festhielt, spürte er die Hitze und den Schweiß durch ihre Kleidung. Er half ihr zurück auf ihren Platz und umschloss dann ihre Hand. Während er ihr in die Augen schaute – sie waren innerhalb weniger Momente stark gerötet – überlegte er, ob sie unter gewöhnlicher Flugkrankheit oder etwas Ernsterem litt. Sobald er sich vergewissert hatte, dass sie bequem saß, drückte er auf die Personalruftaste.
»Devin, bitte geben Sie Devin Bescheid«, murmelte sie.
Er beugte sich nach vorn und fragte: »Was sagten Sie?«
»Devin, bitte verständigen Sie ihn.«
»Okay, ich rufe ihn an«, versicherte er, obwohl er weder wusste, wer Devin war, noch wie er ihn erreichen sollte.
Sie schloss die Augen. Ihre Atemfrequenz hatte sich analog zu ihrem Pulsschlag beschleunigt. Ihre Gedanken waren verworren, und ihr Körper strahlte intensive Wärme ab.
Eine Stewardess kam und erkundigte sich: »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ihr geht es nicht gut, es scheint sie richtig erwischt zu haben«, gab der Mann an und zeigte auf Cassidy.
»Was fehlt ihr denn?«
»Ich weiß es nicht. Vor zehn Minuten wirkte sie noch kerngesund, und jetzt das.«
Die Flugbegleiterin richtete sich an sie: »Ma’am, verstehen Sie mich?«
Cassidy hörte die Stimme, doch diese klang dumpf, als sei sie weit weg oder unter Wasser. Sie wollte antworten, war aber mittlerweile derart erschöpft, dass sie nicht einmal genügend Kraft aufwenden konnte, um zu sprechen.
»Ma’am, ist alles in Ordnung mit Ihnen?« Die Stewardess zwängte sich zwischen die Sitze, um einen genaueren Blick auf Cassidy zu werfen. Als sie eine Hand auf ihren Arm legte, fühlte sie das Fieber, welches in ihrem Körper wütete. Dann schaute sie den Mann an und fragte: »Kennen Sie sie?«
»Nein, es ist keine Viertelstunde her, dass wir miteinander ins Gespräch kamen. Ich weiß nicht einmal, wie sie heißt.« Er zuckte mit den Schultern.
Eine zweite Stewardess kam herbei. »Margaret, ist alles okay hier?«
»Nein, besorgst du mir eine Decke und ein Kissen, bitte?«
Die Frau tat es sofort.
»Das wird schon wieder, meine Liebe«, sagte Margaret dann. »Können Sie mir Ihren Namen nennen?«
Cassidy öffnete den Mund und flüsterte etwas; ihre Augen blieben fest geschlossen.
Da schüttelte Margaret sie kräftig. Cassidy reagierte, indem sie die Lider aufschlug.
»Na also. Erklären Sie uns, was Ihnen Ihrer Meinung nach fehlt. Benötigen Sie Medikamente? Bitte lassen Sie sich helfen.«
Cassidy schob ihren Ärmel wieder hoch, sodass man die rote, dicke Schwellung sah, wo man ihr die Spritze gesetzt hatte. Die Stelle war nun von rötlichen Pusteln umgeben.
»Was ist das?«, staunte Margaret und wich vor ihr zurück, weil sie befürchtete, es handle sich um etwas Ansteckendes.
Cassidy zeigte darauf und antwortete mühselig: »Injektion.«
Die Stewardess wandte sich wieder an den Mann: »Wissen Sie, ob sie Medikamente nimmt?«
»Wie gesagt, ich weiß gar nichts; wir lernten uns gerade erst kennen.«
Plötzlich setzte sich Cassidy aufrecht hin, als sei ihr Körper hochgezogen worden. Sie riss ihre nun stark blutunterlaufenen Augen auf und stierte die Rückenlehne des Sitzes vor sich an.
Margaret und der Mann betrachteten sie verwundert – und jetzt auch mit einiger Unruhe.
Diese Unruhe war nun auch im gesamten Flugzeug spürbar, da die Passagiere entweder zugehört oder versucht hatten, etwas von dem zu sehen, was vor sich ging.
Ein Teenager kniete in Reihe 22 auf seinem Sitz und schaute auf Cassidy hinab. Er filmte mit seinem Smartphone. Wie viele andere seiner Generation hielt er es für nebensächlich, Hilfe zu leisten, und wollte vielmehr jedes tragische oder dramatische Ereignis mit seinem Gerät festhalten. Die Technik bescherte der Gesellschaft genauso viel Gutes wie Schlechtes. Der Bursche nahm alles mit leicht verzückt funkelnden Augen auf und hoffte wohl, es werde ihm zahllose Aufrufe bei Youtube bescheren.
Cassidy machte ihren Hals lang, um Margaret anzusehen. »Ich glaube, die haben mir irgendetwas eingebrockt.«
»Wer hat Ihnen was eingebrockt?«
»Ich … reagiere allergisch auf …« Erneut verwies sie auf ihren rechten Arm.
»Was ist damit?«
So wie ihr der Schweiß in Strömen von Gesicht und Körper lief, sah sie aus, als habe sie gerade auf einem Heimtrainer gesessen. Die Kleider klebten ihr klatschnass am Leib.
Auf einmal erschien der Pilot und fragte: »Margaret, was ist hier los?«
»Ich weiß nicht genau, was sie hat, aber sehen Sie selbst.«
Er beugte sich wie die Stewardess nach vorn. »Ma’am, wie kann ich Ihnen behilflich sein?«
Cassidy blickte zu ihm auf und antwortete: »Devin.«
»Wer ist Devin?«
Da krümmte sie sich und erbrach ohne Vorwarnung gegen die Rückenlehnen von Reihe 22.
Der Teenager rief: »Wie ekelhaft! Ich hab was abbekommen!«
Cassidy würgte erneut. Der Gestank von Galle und halb verdautem Essen stieg allen ringsum in die Nase.
»Ich werde landen. Lassen Sie die Menschen ihre Plätze einnehmen«, ordnete der Pilot an und kehrte ins Cockpit zurück.
Übergab sich Cassidy gerade nicht, schaute sie auf und bettelte: »Helfen Sie mir.«
Die anderen Passagiere starrten bloß. Einige wussten nicht so recht, wie sie helfen konnten; andere schreckten zurück, weil sie Angst hatten, sich eine Krankheit einzuhandeln.
Dann knisterte der Bordfunk: »Hier spricht Ihr Captain. Wie Sie alle wissen, befindet sich eine Passagierin unter uns, der es sehr schlecht geht. Bis nach New York ist noch zu weit, also werde ich in Indianapolis notlanden. Dort erhält die Kranke medizinische Behandlung. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, doch ich darf Ihnen versichern, Sie alle werden Ihr Reiseziel erreichen.«
Tag 183
2. April 2021 Decatur, Illinois
Egal wie oft er sich die zerknitterten Zeitungsschnipsel anschaute, die er mit ihren schmalen Rändern an die nackte Holzwand geklebt hatte, wollte er sich weiterhin einreden, alles sei ein Albtraum gewesen, aus dem er bald in seinem kleinen, aber gemütlichen Appartement neben Cassidy aufwachte. Sein Blick huschte von einem Artikel zum nächsten, während er vergeblich nach einem Hinweis suchte – irgendetwas, das ihm eine Antwort auf den ganzen Wahnsinn geben konnte.
4. Oktober: Rätselhafte Krankheit bricht im Mittleren Westen aus. 5. Oktober: Krankheit verbreitet sich bis an beide Küsten. 6. Oktober: Gouverneure in mehreren Staaten rufen den Notstand aus. 8. Oktober: Krankheit wird zur Pandemie. 10. Oktober: Präsident ruft nationalen Notstand aus. 12. Oktober: Zahl der Opfer erreicht 35 Millionen. 13. Oktober: Ausschreitungen.
Beim Lesen kam er nicht umhin, sich von der roten Farbe ablenken zu lassen, mit der er »Gott steh uns allen bei« über die Ausschnitte gesprüht hatte.
Devin machte sich von diesem qualvollen Ritual los und fuhr mit seiner täglichen Routine fort. Dazu gehörte auch Tagebuchschreiben; es erwies sich als therapeutisch und verband ihn in gewisser Weise mit seiner Vergangenheit. Während die Feder seines Stifts über die dünnen Seiten des Spiralblocks jagte, wurde er von der Sonne geküsst, deren erste Strahlen auf ihn fielen. Er gönnte sich einen Augenblick, um durch die einzige Scheibe des Stalls zu schauen. Ein anderes Fenster zur Welt, außer dieser kleinen Öffnung, hatte er nicht mehr. Draußen bot sich ihm das gleiche Bild wie seit einem halben Jahr: Die unendlich weiten Felder, auf denen sorgfältig Mais angebaut worden und eingegangen war. Die hohen Pflanzen standen da wie Statuen. Sie hatten wie alles andere gelitten und ihr Leben gelassen, aber nicht wegen der Pandemie, sondern aufgrund von Vernachlässigung. Jetzt fungierten sie als Barriere zwischen Devins Unterschlupf in dem alten Stall und dem verseuchten Rest des Planeten.
Er erinnerte sich täglich an seine Reise von Indianapolis zum Haus seines Cousins in Decatur, Illinois. Jene Fahrt als Höllenritt zu bezeichnen, hätte an Untertreibung gegrenzt, denn sie war viel schlimmer gewesen. Man hatte im Zuge der Ausbreitung der Seuche alle Flughäfen geschlossen, sodass er in Indianapolis festsaß, ohne sich an irgendjemanden wenden zu können. So war er einzig anhand der Adresse auf seinem Handy zu Toms Bauernhof gefahren. Er hatte ihn nur zweimal getroffen, und zwar jeweils in frühster Kindheit, den persönlichen Kontakt aber, wie es in vielen Familien der Fall war, nicht aufrechterhalten und nur über Facebook mit ihm kommuniziert. Die sporadischen Konversationen waren stets mit dem üblichen »Treffen wir uns mal irgendwann« versehen worden – natürlich in allen Fällen bedeutungslose Worte und vor allem eine Höflichkeitsfloskel für Unterhaltungen, von der sich die Menschen nicht trennen konnten.
Heute genau vor sechs Monaten hatte er das mit Cassidy erfahren. Im Nachhinein wünschte sich Devin, er wäre vor jener halben Ewigkeit ans Telefon gegangen. Er hatte nie zu den Menschen gehört, die nicht ohne ihr Handy leben konnten; für ihn war es nichts weiter als eine praktische Hilfe im Alltag und insbesondere für Notfälle gewesen. Diese Hassliebe zu Mobiltelefonen hatte dazu geführt, dass sein Gerät stummgeschaltet in einem anderen Zimmer liegen geblieben war.
Devin hatte erfolgreich als Texter gearbeitet und ein Umfeld ohne Ablenkungen gebraucht, um produktiv zu sein. An jenem Tag hatte er die Vibrationen des Gerätes gehört, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Erst beim späteren Nachsehen war ihm aufgefallen, dass er ein halbes Dutzend Anrufe von einer unbekannten Nummer verpasst hatte. Als er die erste hinterlassene Nachricht abhörte, musste er bereuen, nicht reagiert zu haben. Diese Reue war bald zu Verzweiflung geworden. Nachdem ihn mehrere Personen im Krankenhaus durchgereicht hatten, war er endlich an jemanden geraten, der ihm hatte sagen können, was mit Cassidy geschehen war. Daraufhin hatte er sich ohne Zögern in den nächsten Flieger nach Indianapolis gesetzt.
Die Verzögerung, die sich aus seiner Nachlässigkeit ergeben hatte, sein Handy zu überprüfen, hatte fatale Folgen: Zu dem Zeitpunkt, als er die Klinik in Indianapolis erreichte, war es zu spät gewesen. Dort herrschte reges Durcheinander, und als endlich jemand auf ihn eingegangen war, hatte er erfahren, dass Cassidy nicht mehr lebte. Um alles noch schlimmer zu machen, hatte er nie die Gelegenheit erhalten, ihren Leichnam zu sehen, da dieser von Regierungsbeamten beschlagnahmt und fortgeschafft worden war.
Die letzten Eindrücke, die Devin von ihr bekam, stammten aus der Handykamera des Jungen aus Reihe 22. Das unstete, aber gestochen scharfe Bild des Videos ließ ihn schaudern. Cassidy krank und mit Schmerzen zu sehen, war zu viel für ihn gewesen. Er schaffte es nie, den Mitschnitt bis zum Ende zu sehen, doch jeder örtliche Nachrichtensender hatte ihn tagelang ausgestrahlt, von Youtube und den Sozialnetzwerken ganz zu schweigen. Was zunächst ein Einzelfall war, sollte sich bald häufen, und binnen weniger Tage hatten sich allerorts ähnliche Szenen wie in dem Flugzeug abgespielt. Nicht lange, und es wimmelte vor Handyfotos und -videos von Menschen mit den gleichen Symptomen.
Devin schaute hoch in den dunkelblauen Himmel. Immer noch zogen die Wolken willkürlich dahin, doch ihre Begleiter – die Vögel – fehlten. Er hatte seit Monaten weder sie noch andere Lebewesen gesehen. Seine selbst auferlegte Isolation bot Sicherheit, verschwieg ihm allerdings auch, was außerhalb der 20 Morgen des Gehöfts vor sich ging.
Der Tod war in seiner Raserei nicht wählerisch und rasch mutiert, sodass er bald jegliche Tiere erfasst und umgebracht hatte, genauso wie den Menschen.
Irgendwann fiel Devins Blick auf das Hauptgebäude. Er fragte sich, ob der Gestank endlich so weit verflogen war, dass er sich wieder hineinwagen konnte. Allmählich gingen seine Vorräte zuneige; er hatte das Haus gleich nach seiner Ankunft zum ersten und letzten Mal betreten, dabei alles zusammengerafft, was ihm auf die Schnelle in die Hände gefallen war, und es wieder verlassen, ohne etwas darin zu verändern. Er hielt sich fern, weil sein Cousin fest entschlossen gewesen war, nicht zuzulassen, dass die Krankheit seine Familie umbrachte, es deshalb selbst getan und danach Suizid begangen hatte. Devin war nie dazu gekommen, Toms Kinder kennenzulernen, doch auf Fotos sahen sie sehr niedlich aus: Ein Junge und ein Mädchen, die jeweils nicht älter als acht und sechs hatten sein können. Als er hier ankam, hatte er geklopft und geklopft, und war schließlich eingebrochen. Drinnen hatte ihm der Gestank angekündigt, worauf er schlussendlich stoßen sollte – die ganze Familie, vereint im Elternschlafzimmer des Obergeschosses des alten Bauernhauses. Der Anblick hatte ihn schockiert und abgestoßen. In der Zeit, bis er außer Fassung geraten und zum Stall hinübergeeilt war, hatte er so viel zusammengetragen wie möglich. Hier sollte er sicher verborgen bleiben, doch jetzt würde er, so er weiterleben wollte, zurückkehren müssen, und davor graute ihm.
Während der langen Tage und Nächte in seiner freiwilligen Gefangenschaft verfluchte er sich immer wieder dafür, nie Zeit aufgewandt zu haben, Überlebenstechniken zu lernen, geschweige denn etwas darüber zu lesen. Oft hatte er unverhohlen über Personen gelästert, die sich auf ebendiese Situation vorbereitet hatten, in der er sich nun wiederfand. Wörter wie »dämlich«, »albern« oder »naiv« waren ihm über die Lippen gekommen, um diejenigen zu beschreiben, die sich dem verschrieben hatten, gefolgt von »bescheuert«, »abstrus« und »reif für die Klapsmühle«. Jetzt verwendete er sie, um sich selbst zu beschreiben. Obwohl er überhaupt nichts vom Überleben verstand, überraschte es ihn, wie schnell er sich anpasste. Wäre er zuvor gefragt worden, wie hoch er seine Chancen einschätzte, sich im Zuge eines solchen Ereignisses zu behaupten, hätte er geantwortet, sich überhaupt keine auszurechnen.
Während er auf dem unebenen Erdboden im Stall hin und her ging, versuchte er, Mut zu fassen, um ins Haus zurückzukehren. Es war nicht so, dass er Angst hatte, sich irgendetwas einzufangen; vielmehr wollte er nicht noch einmal riechen, was ihm dort in die Nase gestiegen war. Ihm waren Geschichten über den abartigen Gestank von verwesendem Menschenfleisch zu Ohren gekommen, doch diese konnte er erst bestätigen, seitdem er es selbst gerochen hatte. Ein solches Odeur war ihm noch nie untergekommen und hatte ihm, verbunden mit dem Anblick aufgequollener Leichname, heftige Übelkeit bereitet. Er musste aber wieder hineingehen; von dem, was er aus dem Haus mitgebracht hatte, und den Vorräten, auf die er kurz darauf im Stall gestoßen war, war nämlich so gut wie nichts mehr übrig. Er wusste, bald würde er sich über das Haus und den Bauernhof hinaus auf Nahrungssuche begeben müssen. Bei diesem Gedanken graute ihm ebenfalls.
Im Laufe der vielen Monate im Stall hatte er jede Kiste, jeden Schrank und staubigen Winkel durchsucht. Was er auf seinem Abstecher ins Haus verwenden wollte, war eine Atemschutzmaske, die Toms Frau Jessica angezogen hatte, um ihrem Hobby nachzugehen, alte Möbel zu streichen und zu lackieren. So hoffte Devin, sich vor dem Gestank schützen zu können, falls dieser noch nicht verflogen war, denn dadurch würde ihm leichter fallen, was er tun musste.
Als er das verwitterte Tor des Stalls aufzog, fiel das Licht der Sonne auf ihn, die nun zu fortgeschrittener Morgenstunde höher am Himmel stand. Er hielt inne, um ihre Wärme einen Moment zu genießen. Der ausgetretene Pfad vom Stall zum Haus war noch immer sichtbar; er war noch nicht komplett überwuchert. Devin näherte sich langsam dem Haus, bis er die Treppe erreichte. Als sein Blick darauf fiel, wurde ihm bewusst, wie viele Tausende Füße die Stufen betreten hatten. In ihrer Mitte war die weiße Farbe abgeblättert und das Holz durchgetreten.
Nachdem er auf die Veranda getreten war, versuchte er, die Fliegengittertür zu öffnen, die seit seinem ersten Eintritt über ein halbes Jahr zuvor in einer Ecke aufgerissen war. Er zog sie auf und griff den kalten Messingknauf der massiven Eingangstür. Als er daran drehen wollte, kam ihm ein vertrautes, aber lange nicht gehörtes Geräusch zu Ohr: Das tiefe Bellen eines Hundes.
Er blieb stehen und sah sich um.
Erneut gab das Tier Laut.
Seit er einen Hund oder ein anderes Lebewesen gesehen, geschweige denn gehört hatte, waren sechs Monate vergangen. Die Küchentür, durch die er eintreten wollte, befand sich an der Südseite des Gebäudes, die unbefestigte Landstraße hingegen verlief davor in Richtung Norden, und rings um das Haus erstreckten sich Maisfelder.
Wieder bellte der Hund, diesmal näher, und zwar von der Nordseite her. Devin trat rasch ins Haus und schloss die Tür hinter sich. Den Hund gehört zu haben, machte ihm Angst, weil er befürchtete, er komme mit einem Menschen oder sei selbst hungrig. Nie zuvor in seinem Leben hatte er sich vor Hunden gefürchtet, doch jetzt war ihm klar, dass alles, was noch lebte, essen musste, und große Hunde waren definitiv imstande, einen Menschen zu reißen.
Er ging zügig durch die Wohnung und stellte sich an ein breites Erkerfenster, von dem er die geschotterte Einfahrt und die Landstraße dahinter sehen konnte. Er schob die Vorhänge beiseite und warf einen Blick hinaus, konnte aber nichts Auffälliges entdecken. Sein Herz raste, und er fing an zu schwitzen. »Komm runter, Dev, es ist bloß ein Hund«, redete er sich ein.
Da bellte das Tier wieder.
Er ließ den Blick weiterhin schweifen. Nicht eher wollte er sich auf die Suche nach Nahrungsmitteln begeben, bis er sicher sein konnte, wo der Hund war und wer ihn vielleicht begleitete.
Auf einmal sah er ihn. Es war ein großer Deutscher Schäferhund, der sich auf der Landstraße näherte. Merkwürdigerweise wirkte der Hund vergnügt. Devin wusste nicht, wie er darauf gekommen war, hatte sich sein Aussehen aber bedrohlicher vorgestellt.
Er neigte sich näher zur Scheibe, als würde es ihm helfen, besser zu sehen.
Plötzlich pfiff es laut, und das Tier blieb stehen.
Jemanden pfeifen zu hören, jagte Devin einen kalten Schauer über den Rücken. Er spürte, wie sich sein Herzschlag weiter beschleunigte und Panik in ihm aufstieg. Er sah hektisch hin und her, um die Person zu entdecken, die gepfiffen hatte.
Der Hund blieb vor der Einfahrt stehen und blickte die Straße zurück, doch die toten Maispflanzen hinderten Devin daran, zu erkennen, auf wen das Tier wartete. »Dev, reiß dich zusammen«, murmelte er und konzentrierte sich wieder aufs Atmen.
Er hatte seit seiner langen Reise nach Decatur keinen anderen Menschen mehr getroffen, und jene letzte Begegnung war nicht gewaltfrei gewesen. Schon damals hatte er sich kaum retten können, und jetzt konnte er sich nur zu gut vorstellen, dass die Menschen noch aggressiver waren. Er wusste, Lebensmittel waren unweigerlich knapp, also sollte es ihn nicht überraschen, auf andere Menschen zu stoßen, doch nachdem ihm sechs Monate lang niemand über den Weg gelaufen war, hatte er allmählich geglaubt, er sei der einzige Überlebende.
Schweiß lief ihm von der Stirn in die Augen. Er wischte ihn hastig weg und fuhr sich durch sein ungekämmtes, kurzes Haar; die nasse Hand wischte er daraufhin an seiner Hose ab. Während seines abgeschotteten Aufenthalts im Stall hatte er weiterhin Wert auf Körperhygiene gelegt, so gut es ging. Da er langes Haar nicht mochte, hatte er seinen dichten, schwarzen Schopf mit einer Schere kurzgehalten, die er fand. In seinen gleichfalls schwarzen Bart mischten sich nun graue Stellen. Er stutzte ihn regelmäßig, damit er nicht zu lang wurde.
Devins blaue Augen starrten eindringlich auf den Rand des Maisfelds, während er ungeduldig darauf wartete, wer hervortreten würde. Der Hund begann, am Boden zu schnuppern, und kam dann näher.
Devins quälende Warterei fand ein Ende, als eine schlanke Frau auftauchte. Da sie noch etwa 200 Fuß entfernt war, konnte Devin ihr Alter und ihre Verfassung nicht einschätzen. Sie trug Jeans und Stiefel sowie eine enge Lederjacke. Ihr langes, braunes Haar hatte sie zusammengebunden und hinten durch eine Baseballmütze gezogen. Sie hielt eine Waffe in den Händen – ein AR-Sturmgewehr, soweit er erkennen konnte.
Die Frau wies den Hund an, zum Haus zu gehen.
Devin schnellte zurück und duckte sich, damit sie ihn nicht entdeckte. Jetzt wünschte er sich, all die vergangenen Monate dazu genutzt zu haben, um sich auf angemessene Weise zu wappnen, statt sich in seinem Tun von Emotionen und einem schwachen Magen leiten zu lassen. Er brauchte irgendetwas, um sich zur Wehr setzen zu können – und zwar schnell. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass sie ihn nicht sah, eilte er in den einzigen Raum, der ihm einfiel: die Küche. Dort schnappte er sich ein langes Fleischmesser. Als er die Edelstahlklinge betrachtete, fühlte er sich ein wenig sicherer. Dann drängte sich ihm ein Bild auf: Er erinnerte sich, eine Flinte über dem Kamin im Wohnzimmer gesehen zu haben. Warum sie ihm zunächst nicht hatte einfallen wollen, diese Frage würde er sich später stellen. Jetzt lief er nach nebenan und nahm die Waffe herunter. Er kannte sich nicht damit aus – mit keinerlei Waffen. Sein ganzes bisheriges Leben war er davon überzeugt gewesen, keine zu brauchen. Einmal mehr wünschte er sich, die Zeit zurückdrehen zu können, um seine blauäugige Einstellung zu ändern. Er wusste nicht, wie man mit einer Flinte schoss, und jetzt war seine Zeit abgelaufen.
Die Bohlen unter dem Vorbau knarrten, als die Frau und der Hund heraufkamen. Dessen lange Nägel verursachten Klickgeräusche auf dem Holz, während er auf der überdachten Terrasse herumschnüffelte, die rund ums Haus führte.
Devin ging hinter einem breiten Schaukelsessel in Deckung, kniete sich hin und machte sich darauf gefasst, entdeckt zu werden.
Jetzt blieb ihm nur noch sein Hörsinn, weil seine Sicht eingeschränkt war. Angestrengt lauschend erkannte er, dass die beiden die Vordertür erreicht hatten. Er warf einen verstohlenen Blick über den Sessel hinweg zum Eingang, der nur 15 Fuß entfernt war, und sah den Messingknauf wackeln, als sie daran rüttelte, nur um herauszufinden, dass sie vor verschlossener Tür stand.
Devin sah, wie sie zu dem breiten Erkerfenster weiterging, an dem er zuvor gestanden hatte. Dort hörten ihre Schritte auf. Er konnte sich nur vorstellen, wie sie hereinschaute. Ein Winseln machte ihn und die Frau darauf aufmerksam, dass der Hund an der Hintertür stand.
Devin fiel ein, dass er sie nicht verriegelt hatte. Jetzt war er hin und her gerissen: Sollte er versuchen, dies nachzuholen, oder einfach zulassen, dass die beiden hereinkamen? Schließlich sah er ein, dass sie dies sowieso tun würden, abgesperrte Tür hin oder her.
Er schloss die Augen und lauschte weiter. Mit jedem Schritt, den die Frau um das Haus machte, nahm sein Blutdruck zu. Er packte die Flinte fester, während ihm der Schweiß von der Stirn rann.
Schließlich kam sie an der Hintertür an; er konnte hören, wie sie dem Hund etwas zuflüsterte.
Da kam ihm eine Idee: Er wusste nun, was er zu tun hatte.
Zwischen ihm und der Tür in der Küche befand sich eine Wand; er stand auf und lehnte sich dagegen. Jetzt war die Frau nur acht Fuß von ihm entfernt. Er wartete auf das Geräusch, das ihn zur Tat schreiten lassen würde.
Der Knauf drehte sich, und die Tür wurde einen Spaltbreit aufgestoßen; das alte Erlenholz ächzte, als sie vollständig geöffnet wurde.
Das war Devins Zeichen. Er trat mit der Flinte im Anschlag hinter der Wand hervor. Aber wer auch immer diese Frau war – sie hatte sich auf so etwas gefasst gemacht und legte bereits auf ihn an.
»Sofort stehen bleiben, das ist mein Haus!«, schrie er sie an.
»Tun Sie nichts Unbesonnenes, ich suche nur etwas zu essen«, erklärte die Frau. »Es sah so aus, als sei niemand hier.«
»Tja, da täuschen Sie sich!«, krächzte Devin, während er den Griff der Flinte mit seiner klammen Hand noch fester packte. Sein rechter Zeigefinger lag am Abzug, schussbereit falls nötig.
»Nehmen Sie einfach die Waffe runter, dann tue ich es auch«, verlangte die Frau in ruhigem Ton, während sie Devin über den kurzen Lauf ihres AR-15 hinweg anstarrte.
»Sie zuerst«, entgegnete er.
Der Hund begann, kaum hörbar zu knurren. Er fletschte die Zähne und ging in Angriffsstellung. Als Devin ihn ansah, wusste er, dass er unterliegen würde.
»Brando, ganz ruhig. Dieser freundliche Mann wird uns nicht erschießen«, beschwichtigte die Frau, ohne ihre wachsamen Augen von Devin abzuwenden.
Brando trat einen Schritt vorwärts.
Devin war drauf und dran, den Kopf zu verlieren. »Sagen Sie dem Köter, er soll Sitz machen oder so!«
»Er folgt nur, wenn er will.«
Devin wusste nicht, was er tun sollte; Furcht bestimmte sein Verhalten.
Brando hob langsam seine rechte Vorderpfote und stellte sie wieder hin. Er bewegte sich zaghaft auf Devin zu, pirschte sich an wie ein Raubtier auf Beutezug.
»Verschwinden Sie jetzt!«, schrie Devin, dessen Stimme wegen der Schutzmaske dumpf klang.
»Wir gehen ja schon, keine Sorge. Knallen Sie uns bloß nicht von hinten ab.«
Nachdem er das gehört hatte, verspürte Devin einen Hauch von Überlegenheit.
»Komm, Brando, so freundlich ist unser Gastgeber doch nicht.«
Doch der Hund ließ nicht von Devin ab. Sein Knurren war lauter geworden, und seine weißen Zähne ließ er jetzt deutlich erkennen.
Die Frau ging rückwärts, bis sie gegen die Fliegengittertür stieß.
»Brando, Junge, jetzt komm«, befahl sie.
Das Tier wollte nicht hören; ein Streifen seines dichten, schwarzen Rückenfells sträubte sich.
»Ich schieße auf das Vieh, ich sag’s Ihnen!«
»Egal, was Sie tun, zielen Sie nicht auf ihn. Ich bringe ihn dazu, bei Fuß zu kommen, geben Sie mir bloß etwas Zeit«, bat sie.
Brando knurrte immer lauter, bis er wieder bellte. Devin zuckte zusammen und richtete die Flinte auf ihn. Der Hund sperrte sein Maul auf und stürzte los. Er vergrub die Zähne in Devins rechtem Arm. Der schrie vor Schmerz auf und drückte ab, doch nichts geschah, weil die Flinte nicht entsichert war.
Brando schüttelte heftig den Kopf, während er fester zubiss. Solche Schmerzen hatte Devin noch nie erlebt. Er ließ die Waffe fallen und taumelte rückwärts, ehe er über die Kante eines dicken Perserteppichs im Wohnzimmer stolperte.
Das Tier ließ ihn einfach nicht los. Schließlich ging Devin rücklings nieder, und der Hund mit ihm. Dabei brüllte er noch vor Schmerz, was jedoch abrupt aufhörte, als er mit dem Kopf gegen den Couchtisch schlug. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass sein Blickfeld verschwamm, bevor es endgültig schwarz wurde.
Lager 13 der Katastrophenschutzbehörde, Region VIII, 50 Meilen östlich des internationalen Flughafens Denver
Aus den Lautsprechern plärrte der Morgenappell und beendete Lori Roberts’ kurzen Schlaf. Nachdem sie sich die ganze Nacht lang hin und her gewälzt hatte, war sie gerade eine Stunde zuvor erschöpft weggetreten. Die anderen, mit denen sie in dem großen Allzweckzelt lag – ihr Ehemann David und ihr Sohn Eric – waren schon wach und machten sich für den bevorstehenden Tag fertig, von dem Lori wusste, dass er exakt so verlaufen würde wie der vorige und der davor.
Am morgigen Tag lebten sie genau vier Monate in Lager 13, doch dies gab keinen Anlass zum Feiern. Was sie als Symbol der Hoffnung und Rettung vor der Seuche aufgefasst hatten, stand jetzt für Verzweiflung.
Ihr Mann David verglich das Lager oft scherzhaft mit einer Kakerlakenfalle: »Man kommt rein, aber nicht mehr raus.«
Genau so war es auch: Als sie vor knapp vier Monaten eingetroffen waren, hatten sie sich gefreut, noch am Leben zu sein und die Chance zu einem Neuanfang zu erhalten, doch diese Zuversicht sollte sich bald zerschlagen, als drastisch klar wurde, wie schlimm die Dinge wirklich standen, sogar für die Regierung.
»Schatz, steh auf. Lass uns vor der Morgenversammlung noch etwas frühstücken«, sagte David, während er sich ein Shirt überstreifte.
Lori wälzte sich herum und sah ihn an, wobei das Morgenlicht nur einen Teil seines Gesichts erhellte. »Du und Eric, esst ruhig etwas; wir sehen uns dann bei der Versammlung.«
»Bist du sicher?«
»Ja, ich bin müde und möchte noch eine Weile liegen bleiben.«
Er kniete sich neben sie und nahm ihre Hand. Nachdem er diese geküsst hatte, fragte er: »Wieder eine schlaflose Nacht?«
»Ich habe alles versucht, liege dann aber doch wach und grüble.«
»Geh heute zu einem Arzt, der soll dir etwas verschreiben.«
»Vergiss es, ich setze mich nicht acht Stunden oder länger in eine Schlange.«
»Was hast du denn sonst zu tun? Du musst ja diese Woche nicht zum Arbeitskreis.«
»Mal sehen. Geh jetzt, nimm auch ein Päckchen Erdnussbutter und Kekse für mich«, erwiderte sie und rieb seinen Arm.
»Geht es Mom gut?«, fragte Eric, der nun auf die beiden hinabschaute. Er war 16 und kam ganz nach seinem Vater: braunhaarig, groß und schlank. Lori witzelte häufig, sie wisse nur deshalb, dass er ihr Sohn sei, weil sie bei seiner Geburt gesehen habe, wie er aus ihrem Körper gekommen war.
»Okay«, sagte David, stand auf und ging los, hielt aber noch einmal inne. »Und nicht verschlafen.«
Ein Streifen Tageslicht fiel in ihr staubiges Zelt, als David und Eric es verließen. Lori kniff die Augen zu, als es auf sie traf, gerade als sie sich umdrehte. Dass sie nicht aufstehen konnte, lag nicht etwa an körperlicher Schwäche, sondern an seelischer Ermattung. David wusste dies, behielt es aber für sich.
Nachdem die beiden endlich gegangen waren, lag sie allein im Zelt, doch diese Einsamkeit – ein Gefühl der Entrückung – spürte sie auch, wenn sie von den Tausenden im Lager umgeben war.
Lori war eine fähige Frau und Teilhaberin an einem Architekturbetrieb gewesen, bevor der Tod Einzug gehalten und alles zunichtegemacht hatte. Früher war sie oft nachdenklich und dankbar für das Leben gewesen, das sie sich hatte schaffen können, doch dann – von einem Moment auf den nächsten – war alles dahin. Sie erinnerte sich noch an die Nachrichten im Fernsehen über die anfängliche Ausbreitung des Virus, wobei sie wie so viele andere geglaubt hatte, es sei etwas, das sie nicht betreffe. Wie oft sahen Menschen etwas und dachten, es sei nur das Elend anderer? Niemand rechnet jemals damit, es könne ihm selbst widerfahren. Wäre sie imstande, in der Zeit zurückzugehen und eines zu ändern, dann wäre dies ihre damalige Ichbezogenheit. Sie wünschte sich, auf das Bauchgefühl ihres Ehemanns gehört und die Kinder aus der Schule genommen zu haben. Allerdings war sie davon ausgegangen, die Obrigkeit kümmere sich bereits um die Krankheit, weshalb sie unmöglich in dem hübschen, kleinen Nest Castle Rock in Colorado einfallen könnte.