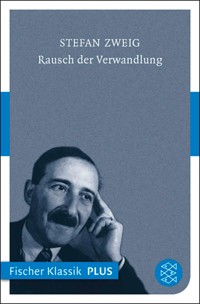
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gesammelte Werke in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Mit einem Nachwort von Knut Beck. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Sommer 1926. Christine Hoflehner hat eine bescheidene Anstellung als Postassistentin gefunden. Die Sorgen der Nachkriegszeit sind überwunden, doch vor ihr liegt ein freudloses, ärmliches Leben. Ein Telegramm reißt sie völlig unerwartet aus der Monotonie ihres Daseins: Amerikanische Verwandte laden sie zu einem Urlaub ins Engadin ein. Zuerst verschüchtert, gerät sie rasch in den Sog dieser »Welt ohne Arbeit, ohne Armut, die sie nie geahnt«. Doch ihr Rausch der Verwandlung ist nicht von Dauer. Als sie Ferdinand kennenlernt, einen »mit dem Geist der Revolte geladenen Menschen«, durch Krieg und Gefangenschaft um seine Jugend und die Möglichkeit einer gesicherten Existenz betrogen, fasst er einen anarchischen Plan – und sie sagt laut und leidenschaftlich ja dazu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Ähnliche
Stefan Zweig
Rausch der Verwandlung
Roman aus dem Nachlaß
Fischer e-books
Mit einem Nachwort von Knut Beck.
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Ein Dorfpostamt in Österreich unterscheidet sich wenig vom andern: wer eines gesehen, kennt sie alle. In der gleichen franziskojosephischen Zeit aus dem gleichen Fundus mit den gleichen kärglichen Einrichtungsgegenständen bedacht oder vielmehr uniformiert, entäußern sie allerorts den gleichen mürrischen Eindruck ärarischer Verdrossenheit, und bis unter den Atem der Gletscher, in die abgelegensten Gebirgsdörfer Tirols bewahren sie hartnäckig jenen unverkennbaren altösterreichischen Amtsgeruch aus kaltem Knaster und muffigem Aktenstaub. Überall ist die Raumeinteilung die gleiche: in einem genau vorgeschriebenen Verhältnis teilt eine vertikale, mit Glasscheiben durchbrochene Holzwand das Zimmer in ein Diesseits und Jenseits, in eine allgemein zugängliche und in die dienstliche Sphäre. Daß der Staat auf ein längeres Verweilen seiner Bürger innerhalb der allgemein zugänglichen Abteilung geringes Gewicht legt, wird durch das Fehlen von Sitzgelegenheiten und jeder sonstigen Bequemlichkeit augenfällig. Als einziges Möbel lehnt im Publikumsraum meist nur ein zittriges Stehpult ängstlich an der Wand, den rissigen Wachsleinwandüberzug von unzähligen Tintentränen geschwärzt, obwohl sich niemand erinnern kann, jemals in dem eingesenkten Tintenfaß etwas anderes als eingedickten, mulmigen, schreibuntauglichen Brei wahrgenommen zu haben, und wenn zufällig eine Feder zur Stelle in der gehöhlten Rinne liegt, so erweist sie sich zuverlässig als abgespragelt und schreibuntauglich. Ebensowenig wie auf Komfort legt das sparsame Ärar auf Schönheit Gewicht: als künstlerischer Raumschmuck könnten, seit die Republik das Bild Franz Josephs abgeräumt hat, höchstens die Plakate angesprochen werden, die grellfarbig auf der schmutzigen Kalkwand zu längst geschlossenen Ausstellungen, zum Ankauf von Lotterielosen und in manchen vergeßlichen Amtsstuben sogar noch zur Zeichnung von Kriegsanleihen einladen. Mit dieser billigen Wandfüllung und allenfalls einer von niemand beachteten Aufforderung, nicht zu rauchen, ist die Generosität des Staates im Publikumsraume zu Ende.
Respektheischender dagegen repräsentiert sich die Abteilung jenseits der dienstlichen Schranke. Hier entfaltet im engsten Beieinander der Staat symbolisch die unverkennbaren Zeichen seiner Macht und Weiträumigkeit. In der geschützten Ecke steht ein eiserner Geldschrank, und die Vergitterung der Fenster läßt vermuten, daß er zeitweilig wirklich gelegentlich beträchtliche Werte birgt. Auf dem Lauftisch blinkt als Prunkstück ein Morseapparat in wohlgescheuertem Messing, bescheidener schläft daneben auf schwarzer Nickelwiege das Telefon. Diesen beiden allein ist ein gewisser Lust- und Respektsraum zugeteilt, denn sie verbinden, an Kupferdrähte angeschlossen, das winzige und abseitige Dorf mit den Weiten des Reichs. Die andern Utensilien des postalischen Verkehrs jedoch müssen sich zusammendrängen, Paketwaage und Briefsäcke, Bücher, Mappen, Hefte, Registratur und die runden klirrenden Portokassen, Waagen und Gewichte, schwarze, blaue, rote und tintenviolette Bleistifte, Spangen und Klammern, Spagat, Siegellack, Wasserschwamm und Löschwiege, Gummiarabikum, Messer, Schere und Falzbein, das ganze vielfältige Handwerkszeug postalischen Dienstes knüllt sich auf der ellbogenengen Fläche des Schreibtisches gefährlich wirr durcheinander, und in den vielen Laden und Kasten schichtet sich unbegreifliche Fülle immer anderer Papiere und Formulare. Aber das scheinbar Verschwenderische dieser Ausbreitung ist in Wahrheit nur Augentrug, denn im geheimen zählt der Staat jedes Stück seiner billigen Utensilien unerbittlich mit. Vom abgeschriebenen Bleistift bis zur zerrissenen Marke, vom ausgefransten Löschblatt bis zur weggeschwemmten Seife in der blechernen Waschschüssel, von der Glühbirne, die den Amtsraum beleuchtet, bis zum Eisenschlüssel, der ihn verschließt, fordert das Ärar von seinen Angestellten für jedes benutzte oder verbrauchte Stück der Einrichtung unerbittlich Rechenschaft. Neben dem eisernen Ofen hängt, mit Schreibmaschine geschrieben, amtlich gestempelt und von unleserlicher Unterschrift bekräftigt, ein ausführliches Inventar, das das Vorhandensein auch des geringsten und wertlosesten Betriebsgegenstandes des betreffenden Postamtes mit arithmetischer Unerbittlichkeit bezeichnet. Kein Gegenstand darf im Dienstraum Hausung halten, den dieses Verzeichnis nicht enthält, und umgekehrt, jedes Stück, das er einmal gezählt hat, muß vorhanden und jederzeit faßbar sein. So will es das Amt, die Ordnung und die Rechtlichkeit.
Strenggenommen müßte in diesem schreibmaschinierten Gegenstandsverzeichnis auch der Jemand verzeichnet sein, der alltäglich morgens um acht Uhr die Glasscheibe hochzieht und die bisher leblosen Utensilien in Bewegung setzt, der die Postsäcke öffnet, die Briefe stempelt, die Anweisungen auszahlt, die Empfangsscheine schreibt, die Pakete wiegt, der die blauen, die roten, die tintenfarbigen Stifte und merkwürdigen Geheimzeichen über das Papier laufen läßt, der vom Telefon den Hörer befreit und dem Morseapparat die Spule ankurbelt. Aber aus irgendeiner Art Rücksichtnahme ist dieser Jemand, vom Publikum meist als Postassistent oder Postmeister angesprochen, auf der Pappliste nicht verzeichnet. Sein Name steht auf einem andern Dienstblatt registriert, und dieses liegt in einer andern Lade, einer andern Abteilung der Postdirektion, aber gleicherweise in Evidenz gehalten, revidiert und kontrolliert.
Innerhalb dieses, durch den Amtsadler geheiligten Dienstraums ereignet sich niemals sichtbare Veränderung. An der ärarischen Schranke zerschellt das ewige Gesetz von Werken und Vergehen; während außen um das Haus Bäume blühen und wieder kahl werden, Kinder aufwachsen und Greise sterben, Häuser zerfallen und in andern Formen wieder erstehen, erweist das Amt seine bewußt überirdische Gewalt durch zeitlose Unabänderlichkeit. Denn jeder Gegenstand innerhalb dieser Sphäre, der sich abnützt oder verschwindet, der sich verwandelt und zerfällt, wird durch ein anderes Exemplar genau derselben Type von der vorgesetzten Behörde angefordert und geliefert und somit dem Wandelhaften der übrigen Welt ein Beispiel der Überlegenheit des Staatlichen gegeben. Der Inhalt verfließt, die Form bleibt beständig. An der Wand hängt ein Kalender. Jeden Tag wird ein Blatt abgerissen, sieben in der Woche, dreißig im Monat. Ist am 31. Dezember der Kalender dünn und zu Ende, so wird ein neuer angefordert, gleichen Formats, gleicher Größe, gleichen Drucks: das Jahr ist ein anderes geworden, der Kalender derselbe geblieben. Auf dem Tisch liegt ein Abrechnungsbuch mit Kolonnen. Ist die Seite links volladdiert, so wird der Betrag auf der rechten Seite weitergeführt, und so von Blatt zu Blatt. Ist das letzte vollgeschrieben und das Buch beendet, so wird ein neues begonnen, gleicher Type, gleichen Formats, vom früheren nicht zu unterscheiden. Was verschwindet, ist am nächsten Tage wieder da, gleichförmig wie der Dienst, und so liegen auf derselben Holzplatte unabänderlich die gleichen Gegenstände, immer wieder die gleichförmigen Blätter und Bleistifte und Spangen und Formulare, immer andere und immer die gleichen. Nichts verschwindet in diesem ärarischen Raum, nichts kommt hinzu, ohne Welken und Blühen herrscht hier dasselbe Leben oder vielmehr derselbe andauernde Tod. Einzig der Rhythmus der Abnutzung und Erneuerung bleibt innerhalb der vielfältigen Reihe der Gegenstände verschieden, nicht ihr Schicksal. Ein Bleistift dauert eine Woche, dann ist er zu Ende und wird durch einen neuen, gleichen ersetzt. Ein Postbuch dauert einen Monat, eine Glühbirne drei Monate, ein Kalender ein Jahr. Dem Strohsessel werden drei Jahre zugemessen, ehe er erneuert wird, dem Jemand, der auf diesem Sessel sein Leben absitzt, dreißig Dienstjahre oder fünfunddreißig, dann wird ein neuer Jemand auf den Sessel gesetzt. Im letzten ist kein Unterschied.
In der Amtsstube Klein-Reifling, einem belanglosen Dorf unweit Krems, etwa zwei Eisenbahnstunden von Wien, gehört im Jahre 1926 dieser auswechselbare Einrichtungsgegenstand ›Beamte‹ dem weiblichen Geschlecht an und wird behördlicherseits, da diese Station einer niederen Zählklasse angehört, mit dem Titel Postassistentin angesprochen. Durch die Glasscheibe erspäht man von ihr nicht viel mehr als ein sympathisch unauffälliges Mädchenprofil, ein wenig schmal an den Lippen, ein wenig blaß an den Wangen, etwas grau unter den Augenschatten; abends, wenn sie die scharf markierende elektrische Lampe anschalten muß, merkt ein genauer Blick an Stirn und Schläfen schon einige leichte Kerben und Falten. Aber immerhin, mit den Malven am Fenster und dem breiten Holunderbusch, den sie sich heute in die blecherne Waschschüssel getan hat, stellt dieses Mädchen noch immer den weitaus frischesten Gegenstand inmitten der Postamtsutensilien von Klein-Reifling dar, mindestens noch fünfundzwanzig Jahre scheint sie diensthaltbar. Tausend und aber tausend Mal wird diese blaßfingerige Frauenhand noch dieselbe klapperige Glasscheibe auf und niederlassen. Hunderttausende und vielleicht Millionen Briefe wird sie noch mit der gleichen rechtwinkeligen Bewegung auf das Stempelpult werfen können und hunderttausend- oder millionenmal mit dem gleichen kurzen Krach den geschwärzten Messingstempel auf die Marken stoßen. Wahrscheinlich wird sogar immer besser, immer mechanischer das eingeübte Gelenk funktionieren, immer unbewußter, immer abgelöster vom wachen Leib. Die hunderttausend Briefe werden unablässig andere Briefe sein, aber immer Briefe. Die Marken andere Marken, aber immer Marken. Die Tage andere, aber jeder ein Tag von 8 Uhr bis 12 Uhr, von 2 Uhr bis 6 Uhr, und in all den Jahren des Wachsens und Welkens der Dienst immer der gleiche, der gleiche, der gleiche.
Vielleicht sinnt hinter ihrem Glasfenster die aschblonde Postassistentin in dieser lautlosen Sommervormittagsstunde selbst solchen Zukünftigkeiten nach, vielleicht träumt sie nur lose vor sich hin. Jedenfalls ihre Hände sind vom Arbeitstisch unbeschäftigt nieder in den Schoß geglitten, dort ruhen sie zusammengefaltet, schmal, müde, blaß. An einem so blau brennenden, so feurig brütenden Julimittag hat die Post von Klein-Reifling wenig Arbeit zu befürchten, der Morgendienst ist erledigt, die Briefe hat der bucklige, tabakkauende Briefträger Hinterfellner längst ausgeteilt, vor abends kommen keine Pakete und Warenproben von der Fabrik zu spedieren, und zum Schreiben haben die Landleute jetzt weder Lust noch Zeit. Die Bauern harken, mit meterbreiten Strohhüten bewehrt, weit draußen in den Weingärten, die Kinder tummeln sich schulfrei mit nackten Beinen im Bach, leer liegt das buckelige Steinpflaster vor der Tür in der brodelnden, messingenen Glut des Mittags. Gut ist es jetzt, zu Hause zu sein und gut träumen zu dürfen. Im künstlichen Schatten der herabgelassenen Jalousien schlafen die Papiere und Formulare in ihren Laden und Regalen, faul und matt blinzelt das Metall der Apparate durch die goldene Dämmerung. Stille liegt wie ein dicker goldener Staub über den Gegenständen, nur zwischen den verschlossenen Fenstern machen die dünnen Violinen der Mücken und das braune Cello einer Hummel eine liliputanische Sommermusik. Das einzige, was sich im gekühlten Raum unaufhörlich regt, ist die holzgefaßte Wanduhr zwischen den Fenstern. Jede Sekunde schluckt sie mit einem ganz kleinen Gluck einen Tropfen Zeit, aber dieses dünne, monotone Geräusch schläfert eher ein statt zu erwecken. So sitzt die Postassistentin in einer Art wachen, wohligen Lähmung inmitten ihrer kleinen schlafenden Welt. Eigentlich hatte sie eine Handarbeit machen wollen, man sieht es an der vorbereiteten Nadel und Schere, aber die Stickerei ist zerknüllt auf die Erde gefallen, ohne daß sie Wille oder Kraft hätte, sie wieder aufzuheben. Weich und fast atemlos lehnt sie im Sessel und läßt sich, geschlossenen Auges, überrieseln von dem wunderbar seltenen Gefühl berechtigten Müßigganges.
Da plötzlich: Tack! Sie schreckt auf. Und nochmals, härter, metallener, unduldsamer: Tack, Tack, Tack. Der Morse hämmert ungebärdig, das Uhrwerk schnarrt: ein Telegramm – seltener Gast in Klein-Reifling – will respektvoll empfangen sein. Mit einem Ruck reißt sich die Postassistentin aus dem duseligen Faulenzergefühl, springt hin zum Lauftisch und schaltet den Streifen ein. Aber kaum sie die ersten Worte der rundlaufenden Schrift entziffert, braust ihr das Blut hoch bis unters Haar. Denn zum erstenmal, seit sie hier Dienst tut, sieht sie ihren eigenen Namen auf einem telegrafischen Blatt. Sie liest einmal, zweimal, dreimal die nun schon fertig gehämmerte Depesche, ohne den Sinn zu verstehen. Denn wie? Was? Wer telegrafiert da aus Pontresina an sie? »Christine Hoflehner Klein-Reifling, Österreich, aufrichtig willkommen, erwarten dich jederzeit, jeden beliebigen Tag, anmelde nur vorher telegrafisch Ankunft. Herzlichst Claire – Anthony.« Sie sinnt nach: Wer ist diese oder dieser Anthony, der sie erwartet? Hat sich ein Kamerad einen einfältigen Scherz geleistet? Aber dann fällt ihr plötzlich ein, die Mutter hat ihr schon vor Wochen erzählt, die Tante käme diesen Sommer nach Europa herüber, und richtig, die heißt doch Klara. Und Anthony, das muß der Vorname ihres Mannes sein, die Mutter hat ihn nur immer Anton genannt. Ja, und jetzt erinnert sie sich schärfer, vor einigen Tagen hat sie doch selbst einen Brief aus Cherbourg an die Mutter gebracht, und die hat damit geheimnisvoll getan und kein Wort vom Inhalt erzählt. Aber das Telegramm ist doch an sie gerichtet. Soll sie am Ende selbst hinauf nach Pontresina zu der Tante? Davon war doch nie die Rede. Und immer wieder starrt sie den noch unaufgeklebten Streifen an, das erste Telegramm, das sie hier persönlich empfangen, immer wieder überliest sie ratlos, neugierig, ungläubig, verwirrt das merkwürdige Blatt. Nein, unmöglich, bis Mittag zu warten. Gleich muß sie die Mutter fragen, was das alles bedeutet. Mit einem Riß greift sie den Schlüssel, sperrt den Amtsraum ab und läuft hinüber zur Wohnung. In der Erregung vergißt sie, den Hebel des Telegrafenapparats abzustellen. Und so tackt und tackt und tackt im leeren Raum, wütend über die Mißachtung, der messingene Hammer wortlos weiter und weiter auf den leeren Streifen los.
Immer wieder erweist sich die Schnelle des elektrischen Funkens unausdenkbar, weil sie geschwinder als unsere Gedanken. Denn diese zwölf Worte, die wie ein weißer, lautloser Blitz im dumpfen Brodem des österreichischen Amtsraums landeten, waren erst wenige Minuten vorher drei Länder weit im blaukühlen Schatten von Gletschern unter einem enzianisch reinen Engadinhimmel hingeschrieben worden, und noch war die Tinte nicht eingetrocknet auf dem Absenderformular, als schon ihr Sinn und Ruf einschlug in ein bestürztes Herz.
Folgendes war dort geschehen: Anthony van Boolen, Holländer, aber seit vielen Jahren eingesessener Baumwollmakler in den amerikanischen Südstaaten, Anthony van Boolen also, ein gutmütiger, phlegmatischer und im Grunde höchst unbeträchtlicher Mann, hatte eben sein Frühstück auf der Terrasse – ganz aus Glas und Licht – des Palace Hotels beendet. Nun kam des Breakfasts nikotinische Krönung, die knollige, schwarzbraune Havanna, eigens in luftdichter Blechdose vom Pflanzort herübergebracht. Um den ersten allererquicklichsten Zug mit dem gelernten Behagen eines erfahrenen Rauchers zu genießen, polsterte der etwas fettleibige Herr seine Beine auf einem gegenüberliegenden Korbsessel hoch, dann entspannte er das riesige, quadratische Papiersegel des ›New York Herold‹ und entreiste mit ihm ins unermeßliche Letternmeer der Kurse und Maklernotierungen. Seine Gattin, ihm am Tisch quer gegenüber, Claire, früher höchst simpel Klara genannt, zerteilte inzwischen gelangweilt die morgendliche Grapefruit. Sie wußte aus vieljähriger Erfahrung, daß jeder Versuch, mit einem Gespräch die allmorgendliche Papierwand zu durchbrechen, bei ihrem Gatten völlig aussichtslos blieb. So geschah es nicht unwillkommen, daß der putzige Hotelboy, braunbekappt und apfelwangig, plötzlich scharf mit der Morgenpost auf sie losschwenkte: das Tablett enthielt nur einen einzigen Brief. Immerhin, sein Inhalt schien sie lebhaft zu beschäftigen, denn, unbelehrt von vielfachen Erfahrungen, versuchte sie die Morgenlektüre des Mannes zu unterbrechen: »Anthony, einen Augenblick«, bat sie. Die Zeitung rührte sich nicht. »Ich will dich nicht stören, Anthony, nur eine Sekunde hör zu, die Sache hat Eile. Mary –« sie sprach es unwillkürlich englisch aus, »– Mary schreibt mir eben ab. Sie kann nicht kommen, sagt sie, so gern sie möchte, aber es stünde schlecht mit ihrem Herzen, furchtbar schlecht, und der Arzt meint, sie würde die zweitausend Meter nicht durchhalten. Es sei ganz ausgeschlossen. Aber wenn wir einverstanden wären, würde sie statt ihrer gern für vierzehn Tage Christine zu uns schicken, du weißt ja, die jüngste, die blonde. Du hast ja einmal vor dem Kriege ein Foto von ihr bekommen. Sie hat zwar Arbeit in einem Post-Office, aber sie hat noch nie rechten Urlaub genommen, und wenn sie darum einreicht, bekommt sie ihn sofort, und sie wäre natürlich glücklich, nach so vielen Jahren ›Dir, liebe Klara, und dem verehrten Anthony ihre Aufwartung zu machen‹ usw. usw.«
Die Zeitung rührte sich nicht. Claire wurde ungeduldig. »Nun, was meinst du, soll man sie kommen lassen? … Schaden möchte es dem armen Ding nicht, ein paar Löffel frischer Luft zu trinken, und schließlich, es gehört sich doch. Wenn ich einmal hier herüben bin, sollte ich doch wirklich das Kind meiner Schwester kennenlernen, man hat ja gar keinen Zusammenhang mehr. Hast du etwas dagegen, daß ich sie kommen lasse?«
Die Zeitung knisterte ein wenig. Erst stieg ein Havannakringel über die weiße Kante, rund, schön blau, dann erst kam in schwerfälliger und gleichgültiger Stimme nach: »Not at all. Why should I?«
Mit diesem lakonischen Bescheid war das Gespräch beendet und ein Schicksal begann. Ein Zusammenhang war erneuert über Jahrzehnte hinweg, denn trotz des beinahe adelig klingenden Namens, dessen »van« nur ein gewöhnliches holländisches war, und trotz der ehelichen englischen Konversation war jene Claire van Boolen niemand anderes als die Schwester der Marie Hoflehner und demnach unbezweifelbar Tante der Postassistentin in Klein-Reifling. Daß sie Österreich vor mehr als einem Vierteljahrhundert verlassen hatte, war im Zuge einer etwas dunklen Geschichte geschehen, an die sie sich – das Gedächtnis ist uns immer gern gefällig – nur ungenau mehr erinnerte und über die auch ihre Schwester ihren Töchtern nie deutlichen Bericht gegeben hatte. Seinerzeit aber hatte die Affaire allerhand Aufsehen erregt und hätte noch größere Folgen gezeitigt, wenn nicht rechtzeitig kluge und geschickte Männer der allgemeinen Neugier einen willkommenen Anlaß entzogen hätten. Zu jener Zeit war jene Frau Claire van Boolen bloß das Fräulein Klara in einem vornehmen Modesalon auf dem Kohlmarkt gewesen, ein simples Probierfräulein. Aber flinkäugig und geschmeidig, wie sie damals war, hatte sie einen ältlichen Holzindustriellen, der seine Frau zur Anprobe begleitete, in verheerender Weise beeindruckt. Mit dem ganzen verzweifelten Ungestüm der Torschlußpanik vernarrte sich innerhalb weniger Tage der reiche und noch ziemlich wohlkonservierte Kommerzialrat in ihre mollige und zugleich lustige Blondheit, und eine selbst in jenen Kreisen ungewöhnliche Freigebigkeit beschleunigte seine Werbung. Bald konnte die neunzehnjährige Probiermamsell, sehr zur Entrüstung ihrer soliden Familien, die schönsten Kleider und Pelze, die sie bisher nur kritteligen und meist anspruchsvollen Kunden vor dem Spiegel vorparadieren durfte, als eigenen Besitz in einem Fiaker spazierenfahren. Je eleganter sie wurde, desto mehr gefiel sie dem ältlichen Gönner, und je mehr sie dem von seinem unvermuteten Liebesglück ganz wirr gewordenen Kommerzialrat gefiel, desto verschwenderischer stattete er sie aus. Nach wenigen Wochen hatte sie ihn so völlig weichgeknetet, daß bei einem Rechtsanwalt in aller Heimlichkeit bereits Scheidungsakten vorbereitet wurden und sie auf bestem Wege war, eine der reichsten Frauen von Wien zu werden – da fuhr die Gattin, durch anonyme Briefe gewarnt, mit einer energischen Dummheit dazwischen. Tollwütig gemacht von ihrer berechtigten Erbitterung, nach dreißig Jahren ungestörter Ehe plötzlich abgehalftert zu werden wie ein lahm gewordenes Pferd, kaufte sie einen Revolver und überfiel das ungleiche Paar bei einer Schäferstunde in einem neueingerichteten Absteigequartier. Ohne weitere Einleitung, toll vor Zorn, feuerte sie geradewegs auf die Ehestörerin zwei Schüsse, von denen einer fehlging und der andere den Oberarm traf. Die Verletzung erwies sich zwar als gänzlich unernst, sehr peinlich dagegen die üblichen Begleiterscheinungen: herbeieilende Nachbarn, laute Hilferufe durch zerschlagene Fenster, aufgesprengte Türen, Ohnmachten und Szenen, Ärzte, Polizei, Tatbestandsaufnahmen und hinter allem, scheinbar unvermeidlich, die Gerichtsverhandlung, wegen des Skandals gleichgefürchtet von allen Beteiligten. Glücklicherweise gibt es für reiche Leute nicht nur in Wien, sondern überall gerissene Anwälte, geübt im Verdunkeln ärgerlicher Affairen, und ihr erprobter Meister, der Justizrat Karplus, bog sofort der Angelegenheit die drohende Spitze ab. Er rief Klara höflich in sein Büro. Sie erschien höchst elegant mit einem koketten Verband und las neugierig den Vertrag durch, dem zufolge sie sich verpflichten sollte, noch vor der Zeugenladung nach Amerika abzureisen, wo ihr, außer einer einmaligen Schadensvergütung, durch fünf Jahre, vorausgesetzt, daß sie sich ruhig verhielte, am Ersten eines jeden Monats bei einem Lawyer eine bestimmte Geldsumme ausgezahlt werden sollte. Klara, die ohnedies wenig Lust hatte, nach diesem Skandal in Wien wieder Probiermamsell zu werden und außerdem von ihrer eigenen Familie aus dem Haus gewiesen war, überlas ohne Entrüstung die vier Folioseiten des Vertrages, rechnete rasch die Summe durch, fand sie überraschend hoch und schlug aufs Geratewohl noch eine Forderung von tausend Gulden dazu. Auch diese wurden ihr zugebilligt, und so unterschrieb sie mit einem raschen Lächeln den Vertrag, fuhr über das große Wasser und hatte ihren Entschluß nicht zu bereuen. Schon auf der Überfahrt boten sich ihr allerhand eheliche Möglichkeiten und bald eine entscheidende: im Boarding-house in New York lernte sie ihren van Boolen kennen, damals nur kleiner Kommissionär für ein holländisches Exporthaus, aber rasch entschlossen, mit dem kleinen Kapital, das sie einbrachte und dessen romantischen Ursprung er niemals ahnte, sich im Süden selbständig zu machen. Nach drei Jahren hatten sie zwei Kinder, nach fünf Jahren ein Haus, nach zehn ein stattliches Vermögen, das der Krieg, statt wie in Europa das Erworbene grimmig zu zerstampfen, auf jedem andern Kontinent damals üppig mehrte. Jetzt griffen schon zwei Söhne, herangewachsen und geschäftstüchtig, in dem väterlichen Maklerhause zu, so durften nach Jahren die beiden ältern Leute sich sorgenlos eine größere gemächliche Reise nach Europa erlauben. Und sonderbar: im Augenblick, da aus dem Nebel die flachen Ufer von Cherbourg sich vorschoben, in dem Blitzlauf einer Sekunde erlebte plötzlich Claire eine völlige Umstellung des Heimatgefühls. Längst innerlich Amerikanerin geworden, empfand sie bloß von der Tatsache, daß dieser Strich Land Europa war, einen unvermuteten Stoß Sehnsucht nach der eigenen Jugend: nachts träumte ihr von den kleinen Gitterbetten, in denen sie und ihre Schwester nebeneinander geschlafen, tausend Einzelheiten fielen ihr wieder ein, und mit einmal schämte sie sich, jahrelang der verarmten, verwitweten Schwester keine Zeile geschrieben zu haben. Es ließ ihr keine Rast: gleich von der Landungsbrücke sandte sie jenen Brief, der einen Hundertdollarschein enthielt und die Bitte, zu kommen.
Nun aber die Einladung auf die Tochter übertragen werden sollte, brauchte Frau van Boolen nur zu winken, und schon schoß wie ein brauner Bolzen der livrierte Boy heran, holte, knapp bedeutet, ein Telegrammformular und sauste, die Kappe eng an den Ohren, mit dem beschriebenen Blatt zum Postamt. Wenige Minuten darauf sprangen die Zeichen vom klappernden Morseapparat zum Dach hinauf in die schwingende Kupfersträhne, und schneller als die klirrenden Bahnen, unsagbar geschwinder als die staubaufwirbelnden Autos spritzte mit einem einzigen Funkblitz die Botschaft tausend Kilometer Draht durch. Ein Nu und die Grenze war übersprungen, ein Nu und das tausendgipfelige Vorarlberg, das putzige Liechtenstein, das tälerreiche Tirol durchstoßen, und schon zischte das magisch verwandelte Wort aus Gletscherhöhen mitten ins Donautal, in Linz in einen Transformator. Dort hielt es einige Sekunden Rast, dann, rascher, als man das Wort »rasch« auszusprechen vermag, schoß die Botschaft den Dachschalter in Klein-Reifling herab in den aufschreckenden Empfangsapparat und von dort wieder mitten in ein erstauntes, verwirrtes, von Neugier heiß überflutetes Herz.
Quer um die Ecke, eine dunkle knarrende Holzstiege hinauf, und schon ist Christine daheim in dem gemeinsamen kleinfenstrigen Mansardenzimmer eines engbrüstigen Bauernhauses. Ein breit vorgeschobener Dachgiebel, Schneefang im Winter, kargt dem Oberstocke tagsüber jeden Faden Sonne weg; nur abends kriecht manchmal ein dünner und schon kraftloser Strahl bis zu den Geranien des Fensterbrettes. Immer muffelt es darum in der düstern Dachbodenstube nach Sumpfigem und Dumpfem, nach faulem Firstholz und modrigen Laken; uralte Gerüche sitzen wie Pilze im Holz; wahrscheinlich hätte in gewöhnlichen Zeitläuften diese Kammer nur als Speicher gedient. Aber die Nachkriegszeit mit ihrer grimmigen Wohnungsnot hatte bescheiden gemacht und dankbar, überhaupt nur zwei Betten, einen Tisch und alten Kasten irgendwo zwischen vier Wände stellen zu dürfen. Selbst der ererbte Lederpolstersessel verstellte zu viel Platz, billig ging er an einen Trödler, und das erwies sich später als arger Mißgriff, denn immer wenn jetzt der alten Frau Hoflehner die aufgeschwollenen, wassersüchtigen Füße versagen, bleibt ihr als einzige Ruhestätte immer wieder und wieder nur das Bett.
Diese kranken, zu breiten Klumpen gequollenen Beine, die unter den Flanellbandagen gefährliches Venenblau zeigen, dankt die abgemüdete, früh gealterte Frau dem zweijährigen Dienst in einem nicht unterkellerten Bodengelaß eines Kriegsspitals, dem sie (man mußte verdienen) als Beschließerin zugeteilt war. Seitdem ist ihr Gehen nur mehr ein mühsames Sichfortkeuchen, und immer wenn sie sich anstrengt oder aufregt, muß die massige Frau sich plötzlich ans Herz greifen. Sie wird, das weiß sie, nicht alt. Ein Glück darum, daß nach dem Umsturz der Schwager Hofrat noch rechtzeitig die Posthilfsstelle aus dem Wirrwarr für die Christine herausfischte, erbärmlich zwar bezahlt und in einem ganz abseitigen Nest. Aber immerhin: eine Handvoll Sicherheit, ein paar Schindeln über dem Kopf, ein Stück Raum für den Atem, knapp ausreichend zum Leben und eher Gewöhnung schon an den noch engern Sarg.
Immer riecht es nach Essig und Feuchtem, nach Krankheit und Bettlägerigkeit in dem schmalen Geviert, und von der winzigen Küchenkammer nebenan kriecht durch die schlecht schließende Tür ein fader Geruch und Dunst von aufgewärmten Speisen wie ein schwelender Schleier herein. Die erste unwillkürliche Bewegung, kaum daß sie das Zimmer betritt, ist, daß Christine das geschlossene Fenster aufreißt. Von dem klirrenden Ruck erwacht die alte Frau auf dem Bett und stöhnt. Sie kann nicht anders, immer, bei jeder Bewegung stöhnt sie, so wie ein zerbrochener Kasten knarrt, noch ehe man ihn anrührt, bloß wenn man ihm nahetritt: es ist eine wissende Vorausangst des rheumatischen Körpers vor dem Schmerz, der von jeder Bewegung ausgeht. Erst stöhnt sie also, die alte Frau, und dann erst, nach diesem unerläßlichen Seufzer, fragt sie auftaumelnd: »Was ist?« Bis unter den Schlummer weiß der benommene Sinn, es kann noch nicht Mittag, noch nicht Essenszeit sein. Etwas Besonderes muß sich ereignet haben. Da reicht ihr die Tochter das Telegramm.
Umständlich, jede Bewegung tut weh, tastet die verwitterte Hand nach der Brille auf dem Nachtkasten, es dauert, bis sie die stahlgeränderten Gläser unter dem Apothekerkram gefunden und vor die Augen gestülpt hat. Aber kaum die alte Frau das Blatt entziffert, fährt’s wie ein elektrischer Schlag durch den schweren Leib, die ganze breite Masse jappt auf, ringt nach Atem, taumelt und wirft sich schließlich mit ihrer ganzen unwiderstehlichen Wucht auf Christine. Heiß hält sie sich an der erschrockenen Tochter, schauert, lacht, keucht, will reden und vermag es noch nicht, schließlich sinkt die alte Frau erschöpft, die Hände ans Herz gepreßt auf den Sessel, atmet tief und hält eine Minute keuchend inne. Dann aber bricht es heraus aus dem zuckenden, zahnlosen Munde, wirr, nur halbverständlich in zitternden, stotternden und halbverschluckten Satztrümmern, immer wieder überschwemmt von wirrem und triumphierendem Lachen, und während sie, statt sich verständlich zu machen, immer heftiger stammelt und gestikuliert, fließen ihr schon die Tränen breit über die Backen in den welken und zuckenden Mund. Durcheinander wirft sie einen erregten Wortschwall auf die von dem lächerlich wilden Anblick völlig verwirrte Tochter; Gott sei Dank, jetzt sei alles beim guten Ende, jetzt könne sie ruhig sterben, sie unnütze, alte, kranke Frau. Nur deshalb habe sie ja die Wallfahrt gemacht vorigen Monat, im Juni, nur das, nur das eine habe sie dort erbeten, daß Klara, die Schwester, noch einmal herüberkäme, ehe sie sterbe, und sich um sie, armes Kind, kümmere. So, jetzt sei sie zufrieden. Da – da stehe es ja – nicht bloß geschrieben hat sie’s, nein, telegrafiert für teures Geld, daß Christi hinaufkommen solle in ihr Hotel, und hundert Dollar hätte sie schon vor zwei Wochen geschickt, ja, sie habe immer ein goldenes Herz gehabt, die Klara, immer sei sie gut und lieb gewesen. Und nicht nur hinfahren könne sie mit diesen hundert Dollar, nein, auch vorher sich ausstaffieren wie eine Fürstin, ehe sie Besuch macht bei der Tante in dem noblen Bad. Ja, dort werde sie Augen machen, dort werde sie einmal sehen, wie die vornehmen Leute, die Leute mit Geld, sich’s leicht sein lassen. Zum erstenmal werde sie’s einmal selbst, gottlob, so gut haben wie die andern, und bei allen Heiligen, sie hat sich’s redlich verdient. Was habe sie denn bisher gehabt von ihrem Leben – nichts, immer nur Arbeit und Dienst und Plackerei und dazu noch die Sorge um die alte, unnütze, kranke, unfreudige Frau, die längst schon unter die Erde gehöre und nichts Klügeres tun kann, als endlich abzufahren. Die ganze Jugend habe sie, Christi, um ihretwillen und durch den verfluchten Krieg verpfuscht gehabt, das Herz hätte es immer ihr alten Frau abgerissen, wie sie ihre besten Jahre versäumt. Jetzt aber könne sie ihr Glück machen. Nur recht höflich solle sie sein zum Onkel und zur Tante, immer höflich und bescheiden und sich nicht schrecken vor der Tante Klara, die habe ein goldenes Herz, gut sei sie, und gewiß werde sie ihr weghelfen aus diesem stickigen Nest da, aus diesem Bauerntrog, wenn sie selber einmal unter der Erde läge. Nein, sie solle keine Rücksicht nehmen, wenn am Ende gar die Tante ihr anbietet, mitzufahren, nur weg soll sie aus diesem verkommenen Staat, von diesen schlechten Menschen hier und sich nicht um sie kümmern. Sie selber fände immer einen Platz im Versorgungshaus und schließlich, wie lange wird’s noch dauern … Ah, jetzt könne sie ruhig sterben, jetzt sei alles gut.
Immer wieder torkelt sie auf, die alte, aufgeschwemmte, in Tücher und Unterröcke schwer eingemummte Frau, und schwankt und stapft auf ihren elefantischen Beinen hin und her, daß die Dielen krachen. Immer muß sie wieder das große rote Taschentuch sich vor die Augen stopfen, denn die Tränen schluchzen ihr in den Jubel hinein, immer heftiger gestikuliert sie, und immer muß sie in ihrer tumultuarischen Begeisterung innehalten, um sich wieder hinzusetzen, zu stöhnen, sich zu schneuzen und für neuen Wortschwall Atem zu holen. Und immer fällt ihr noch etwas Neues ein, immer redet und redet und lärmt und jubelt sie und stöhnt und schluchzt durcheinander über ihre gelungene Überraschung. Da plötzlich, in einem Augenblick der Erschöpfung, merkt die Mutter, daß Christine, der sie all diesen Jubel zuwirft, ganz blaß, benommen und geniert dasteht, die Augen verwundert und eher verwirrt, und gar nicht weiß, was sie antworten soll. Das ärgert die alte Frau. Mit Kraft fährt sie noch einmal vom Sessel empor und auf sie zu, herzhaft packt sie die Verstörte an, küßt sie fest und feucht, reißt sie an sich, schüttelt und rüttelt sie hin und her, als wolle sie die Erschreckte aus dem Schlaf aufwecken: »Ja, warum sagst du denn nichts? Wen geht’s denn an als dich, was hast denn, du Dummerl? Stehst ja wie ein Holz und sagst nichts und red’st nichts, und so ein Glücksfall! So freu dich doch! Ja, warum freust dich denn nicht?«
Das Reglement verbietet strengstens allen Postangestellten ein längeres Verlassen des Dienstraumes während der Amtsstunden, und auch der wichtigste private Umstand besteht nicht vor dem ärarischen Gesetz: erst das Amt, dann der Mensch, erst der Buchstabe, dann der Sinn. So sitzt nach flüchtiger Unterbrechung die Postassistentin von Klein-Reifling wenige Minuten später wieder pflichtbereit hinter der Glasscheibe. Niemand hat unterdessen nach ihr verlangt. Verschlafen wie vordem liegen die losen Schriftblätter auf dem verlassenen Tisch, stumm und gelb glänzt der abgestellte Telegrafenapparat, der ihr eben noch so viel Hitze ins Blut gejagt, im dämmerigen Raum. Gottlob, niemand ist gekommen, nichts ist versäumt. Guten Gewissens kann die Postassistentin nun der verwirrenden Nachricht nachsinnen, von der sie im Tumult der Überraschung noch gar nicht begriffen hat, ob sie peinlich oder willkommen aus den Drähten ins Haus sprang. Erst allmählich ordnen sich die Gedanken. Sie soll fort, zum erstenmal fort von der Mutter, für vierzehn Tage, vielleicht für länger, zu fremden Leuten, nein, zur Tante Klara, der Schwester ihrer Mutter, in ein vornehmes Hotel. Sie soll Urlaub haben, wirklichen ehrlichen Urlaub, nach unzähligen Jahren einmal ausruhen dürfen, einmal die Welt sehen, etwas Neues, etwas anderes. Sie denkt nach, immer wieder, immer wieder. Es ist eigentlich doch gute Botschaft, und die Mutter hat recht, wirklich, sie hat recht, wenn sie darüber so froh ist. Ehrlich gedacht doch die beste Nachricht seit Jahren und Jahren, die ihr ins Haus kam. Zum erstenmal sich vom Dienst abhalftern zu dürfen, frei sein, neue Gesichter sehen, ein Stück Welt, ist das nicht wirklich Geschenk aus blauem Tag? Und plötzlich klingt sie ihr im Ohr, die staunende, erschreckte, fast zornige Frage der Mutter: »Ja, warum freust du dich denn nicht?«
Sie hat recht, die Mutter, wirklich recht: warum freue ich mich nicht? Warum regt sich nichts in mir, warum faßt’s mich nicht und schüttelt mich um und um? Immer wieder horcht sie, ob sich nicht innen eine Antwort melden wollte auf diese aus dem Himmel hereingeschmetterte gute Überraschung, aber nein: nur Verwirrung spürt sie und fragendes Erschrecktsein. Sonderbar, denkt sie, warum freue ich mich nicht? Hundertmal, wenn ich aus dem Postsack Ansichtskarten zum Einschachteln nahm und sie dabei ansah, graue norwegische Fjorde, die Boulevards von Paris, die Bucht von Sorrent, die steinernen Pyramiden von New York, habe ich sie nicht immer mit einem Seufzer aus der Hand gelegt? Wann ich? Wann ich auch einmal? Was denn habe ich geträumt, an diesen langen leeren Vormittagen, als einmal ausgekettet zu sein aus diesem sinnlosen Handlangern, aus diesem mörderischen Wettlauf mit der Zeit. Einmal ausruhen dürfen, Zeit groß und ganz haben, nicht immer so zerstückt und zerrissen, daß sie einem die Finger zerschneidet. Einmal nur nicht diesen täglichen Gang, vom Wecker, dem schlafmörderischen Verfolger, der einen jagt, aufzustehen, sich anziehen, einheizen, Milch holen, Brot holen, Feuer zünden, stempeln, schreiben, telefonieren, und dann wieder zu Hause gleich an das Bügelbrett, an den Kochherd, waschen, kochen, flicken, Pflegedienst tun und endlich dann todmüde hin in den Schlaf. Tausendmal habe ich das geträumt, Hunderttausende Male, hier an diesem selben Tisch, hier, in diesem verwitterten Käfig, und jetzt bricht’s endlich auf mich los, ich soll reisen, soll fort, frei sein, und doch – die Mutter hat recht – warum freue ich mich nicht? Warum bin ich nicht bereit?
Mit starren Augen, mit matten Schultern sitzt sie und starrt auf die fremde kalte Wand, und wartet und wartet, ob, so stark angerufen, nicht doch eine verspätete Freude sich rühre. Unbewußt hält sie den Atem an und horcht wie eine Schwangere in den eigenen Leib, horcht und beugt sich tief in sich selbst hinab. Aber nichts rührt sich, stumm bleibt es und leer, wie ein Wald ohne Vogelruf, und immer angestrengter sucht sie sich, die Achtundzwanzigjährige, zu erinnern, wie ist das überhaupt, wenn man sich freut, und mit Erschrecken erkennt sie, sie weiß es nicht mehr: es ist wie eine fremde Sprache, in der Kindheit einmal gelernt, und man hat sie vergessen und weiß nur, man hat sie einmal gewußt. Sie denkt nach, wann habe ich mich zum letztenmal gefreut, heftig denkt sie nach, und zwei kleine Falten schneiden sich streng in die gesenkte Stirn. Allmählich erinnert sie sich: wie aus einem erblindeten Spiegel tritt ein Bild heraus, ein dünnbeiniges blondes Mädel, die Schultasche frech schlenkernd über kurzem Kattunrock. Ein Dutzend anderer wirbeln um sie herum: Schlagballspiel in einem Garten der Wiener Vorstadt. Jeden Augenblick zuckt ein heller Triller Übermut, eine Rakete Lachen mit dem Federball hoch, jetzt erinnert sie sich, wie leicht, wie locker dies Lachen damals in der Kehle gesessen, ganz nah war es immer, es kitzelte nur so unter der Haut, es quirlte und gärte im Blut; nur anzuschütteln brauchte man und schon kollerte es über die Lippen, so locker saß es im Hals, fast zu locker. Festhalten mußte man sich in der Schule mit den Händen an der Bank und die Lippen beißen, damit es nicht losknatterte mitten in der französischen Stunde bei irgendeinem komischen Wort, bei irgendeiner Albernheit. Denn jedes Nichts kitzelte damals dieses schaumige, sich selbst übersprühende Kleinmädchenlachen heraus. Ein Lehrer stotterte, eine Grimasse vor dem Spiegel, eine Katze, die komisch ihren Schweif ringelte, ein Offizier, der einen anblickte auf der Straße, jedes Nichts, jede winzige sinnlose Spaßigkeit, man war ja so randvoll mit Lachen geladen, daß es bei jedem Funken explodierte. Immer war es da und bereit, dieses lockere lausbübische Lachen, und selbst im Schlaf zeichnete es seine heitere Arabeske auf den kindlichen Mund.
Und plötzlich, das alles schwarz und ausgelöscht wie ein erdrückter Docht. 1914, ersten August. Nachmittags war sie im Schwimmbad gewesen; wie einen hellen Blitz hatte sie, in der Kabine aus dem Hemd fahrend, ihren straffen sechzehnjährigen Körper nackt gesehen, voll sich rundend, weiß, heiß, geschmeidig und gesund. Herrlich hatte sie ihn dann gekühlt, patschend und schwimmend, mit den Freundinnen wettjagend auf den knatternden Planken – noch hört sie das Lachen und Prusten des halben Dutzends halbwüchsiger Mädchen. Dann war man heimgetrabt, rasch, rasch, mit flinken Schritten, denn selbstverständlich hatte man wieder die Zeit verpaßt, und sie sollte der Mutter doch Einpacken helfen: in zwei Tagen sollten sie hinüber ins Kamptal auf Sommerfrische. Drei Stufen auf einmal war sie darum die Treppen hinauf, jagenden Atems geradehinein in die Tür. Aber sonderbar, kaum sie eintrat, hörten Vater und Mutter mitten im Wort zu sprechen auf, beide blickten heftig an ihr vorbei. Der Vater, den sie ungewohnt laut sprechen gehört, beginnt mit einem verdächtigen Eifer Zeitung zu lesen, die Mutter muß geweint haben, denn nervös knüllt sie das Taschentuch und geht hastig zum Fenster. Was ist geschehen? Haben sie Streit gehabt? Nein, nie, das kann nicht stimmen, denn jetzt wendet der Vater sich plötzlich um und legt der Mutter, nie hat sie ihn so zart gesehen, die Hand auf die zuckende Schulter. Aber die Mutter hebt nicht den Blick zurück, nur heftiger flackert das Zucken unter der stummen Berührung. Was ist geschehen? Keiner von beiden kümmert sich um sie, keiner von beiden sieht sie nur an. Noch jetzt, nach zwölf Jahren erinnert sie sich an ihre Angst von damals. Sind sie ihr böse? Hat sie am Ende etwas angestellt? Erschreckt – immer steckt ja ein Kind randvoll mit Angst und Schuldgefühl – schleicht sie hinaus in die Küche, dort belehrt sie Božena, die Köchin, Geza, der Offiziersdiener von nebenan, und der muß es wissen, habe gesagt, jetzt ginge es los und man werde sie auf Goulasch pracken, die verdammten Serben. Da muß der Otto mit als Reserveleutnant und auch der Mann ihrer Schwester, alle beide, darum sei der Vater so verstört und die Mutter. Tatsächlich, am nächsten Morgen steht Otto, ihr Bruder, plötzlich im Zimmer, hechtblaue Jägeruniform, die Feldbinde quer übergeschnallt, am Säbel goldenes Portepée. Sonst trägt er als Gymnasialsupplent meist einen schwarzen, schlecht gebürsteten Bratenrock, beinahe lächerlich macht ihn das Würdeschwarz, den blassen, dünnen, hochgeschossenen Burschen mit seinem strohstoppeligen, kurzgeschnittenen Haar und dem weichen dotterfarbigen Flaum an den Wangen. Jetzt aber, einen energischen Zug krampfhaft um die Lippen, aufgestrafft im engtaillierten Waffenrock, scheint er der eigenen Schwester ganz neu und anders. Mit einem dummen, kindischen Backfischstolz sieht sie auf zu ihm und schlägt die Hände zusammen: »Donnerwetter, fesch siehst du aus.« Da gibt ihr die Mutter, die sonst so sanfte, einen Stoß, daß sie mit dem Ellbogen an den Kasten fliegt: »Schämst du dich nicht, du herzloses Ding?« Aber dieser Zornausbruch, er war nur Trost für den zurückgestauten Schmerz, jetzt schütterte über den zuckenden Mund breites Schluchzen, an den Rändern grelle und scharf einschneidende Schreie, und mit der ganzen Wucht ihres Körpers klammert sie sich, die Verzweifelte, an den jungen Menschen, der gewaltsam den Kopf wegdreht, sich männliche Haltung abzuzwingen sucht und etwas von Vaterland redet und von Pflicht. Der Vater hat sich abgewandt, er kann nicht zusehen, so muß sich der junge Mensch, blaß im Gesicht und mit verbissenen Zähnen, beinahe gewaltsam aus der ungestümen Umfassung seiner Mutter lösen. Plötzlich küßt er der Mutter rasch und fluchthaft die Wangen, dem Vater, der sich unnatürlich straff hält, gibt er hastig die Hand, an ihr, an Christine, huscht er mit raschem Servus vorbei. Und schon klirrt der Säbel die Treppe hinab. Nachmittag kommt der Mann der Schwester Abschied nehmen, Magistratsbeamter seines Zeichens und Feldwebel beim Train. Da ist es leichter, er weiß sich außer Gefahr, tut sich breit und macht, als sei es Spaß, tröstet mit behaglichen Witzen und geht. Aber hinter den beiden bleiben zwei Schatten, die Frau des Bruders, schwanger im vierten Monat, und die Schwester mit ihrem kleinen Kind. Jeden Abend sitzen die beiden nun mit ihnen zu Tisch, und immer ist es dann, als ob die Lampe dunkler brenne. Wenn Christine arglos etwas Heiteres sagt, sehen sie sofort alle Augen streng an, und sie schämt sich noch unter der Bettdecke, wie schlecht sie ist, wie wenig ernst, wie kindisch noch. Unwillkürlich wird sie schweigsam. Das Lachen ist ausgestorben in den Zimmern, dünn wird der Schlaf zwischen den Wänden. Nur nachts, wenn sie zufällig mal aufwacht, hört sie manchmal von nebenan ein leises, stetes Geräusch wie gespenstigen Tropfenfall: es ist die Mutter, die stundenlang (sie kann nicht schlafen) auf den Knien vor dem erleuchteten Marienbilde für den Bruder betet.
Und dann 1915: siebzehn Jahre. Die Eltern gealtert um ein Jahrzehnt. Der Vater, als ob irgendeine Lauge innen an ihm zehrte, schrumpft zusammen, gelb und gebückt quält er sich von einem Zimmer ins andere, und alle wissen, er hat Sorgen mit dem Geschäft. Seit sechzig Jahren, noch vom Großvater her, gab’s keinen in der ganzen Monarchie, der Gamskrickel so zu richten und Waidbeute so kunstvoll auszustopfen verstand als Bonifazius Hoflehner und Sohn. Den Esterházy, den Schwarzenberg, den Erzherzogen sogar hat er die Jagdtrophäen für die Schlösser präpariert, mit vier oder fünf Gehilfen gearbeitet, fleißig, sauber und ehrenhaft, von morgens bis spät in die Nacht. Aber in dieser so mörderischen Zeit, da man einzig auf Menschen schießt, steht die Klinke wochenlang still, aber das Kindbett der Schwiegertochter und die Krankheit des Enkels, alles kostet Geld. Immer tiefer biegen sich die Schultern des schweigsam gewordenen Mannes herunter, und eines Tages knicken sie völlig ein, wie der Brief vom Isonzo kommt, zum erstenmal nicht Ottos Schrift, des Sohnes, sondern die seines Hauptmanns, und da wissen sie schon: Heldentod an der Spitze der Kompanie, dauerndes Gedenken usw. Immer stiller wird es im Haus; die Mutter hat aufgehört zu beten, das Licht über dem Marienbilde ist erloschen; sie hat vergessen, das Öl nachzufüllen.
1916, achtzehn Jahre. Ein neues Wort geht unermüdlich im Haus um: zu teuer. Die Mutter, der Vater, die Schwester, die Schwägerin flüchten vor ihren Sorgen in den kleinen Jammer der Papierzettel hinein, von früh bis nachts rechnen sie einander das arme tägliche Leben vor. Zu teuer das Fleisch, zu teuer die Butter, zu teuer ein Paar Schuh: kaum wagt sie selber, Christine, noch zu atmen, aus Furcht, es sei zu teuer. Wie erschreckt flüchten die notwendigsten Dinge des nackten Lebens zurück und verkriechen sich hinab in Hamsterhöhlen und erpresserische Dachsbauten, man muß ihnen nachspüren, das Brot will erbettelt sein, die Handvoll Gemüse erschlichen bei der Krämerin, die Eier vom Lande hereingeholt, die Kohlen mit dem Handwagen vom Bahnhof gekarrt, tägliche Wettjagd Tausender frierender, hungernder Frauen und täglich kärglicher die Beute. Dabei hat’s der Vater mit dem Magen, er braucht besondere, bekömmliche Kost. Seit er das Schild ›Bonifazius Hoflehner‹ herunternehmen mußte vom Laden und das Lokal verkaufen, spricht er zu niemand mehr, nur manchmal preßt er die Hände scharf an den Leib und stöhnt, wenn er sich allein glaubt. Eigentlich sollte man den Arzt holen. Aber: zu teuer, sagt der Vater und krümmt sich lieber heimlich in seiner Not.
Und 1917 – neunzehn Jahre; zwei Tage nach Silvester haben sie den Vater begraben, das Geld im Sparkassenbuch reichte gerade noch, die Kleider schwarzfärben zu lassen. Das Leben wird immer teurer, zwei Zimmer haben sie schon vermietet an ein Flüchtlingspaar aus Brody, aber es reicht nicht, es reicht nicht, ob man auch von morgens bis tief in die Nacht robotet. Schließlich besorgt ihnen Onkel Hofrat im Ministerium eine Stellung im Korneuburger Spital, für die Mutter als Beschließerin, sie selbst als Kanzlistin. Wenn es nur nicht so weit wäre, im Morgengrauen hinaus im eiskalten, ungeheizten Waggon und abends erst zurück. Dann aufräumen, flicken, scheuern, stopfen und nähen, bis man ohne zu denken, ohne etwas zu wünschen, wie ein umgestürzter Sack in einen ungütigen Schlaf fällt, aus dem man am liebsten nicht mehr erwachte.
Und 1918 – zwanzig Jahre. Noch immer Krieg, noch immer kein freier, sorgloser Tag, noch immer nicht Zeit, einen Blick in den Spiegel, einen Sprung auf die Gasse zu tun. Die Mutter beginnt zu klagen, die Beine schwellen ihr an in dem feuchten, nicht unterkellerten Spitalsraum, aber sie hat kaum mehr Kraft für Mitgefühl. Sie wohnt zu lang mit Gebrest im selben Haus; irgend etwas in ihr ist stumpf geworden, seit sie täglich siebzig bis achtzig grauenhafte Verstümmelungen auf der Schreibmaschine registrieren muß. Manchmal stapft auf seiner Krücke – das linke Bein ist zerschmettert – ein kleiner Leutnant aus dem Banat zu ihr ins Büro, goldblond das Haar wie der Weizen in seiner Heimat und doch schon Schreckfalten in dem noch ungewissen Kindergesicht. Aus Heimweh erzählt er in seinem altschwäbischen Deutsch Geschichten von seinem Dorfe, seinem Hund, seinen Pferden, armes blondes verlorenes Kind. Einmal küssen sie sich abends auf einer Bank im Garten, zwei, drei matte Küsse, mehr Mitleid als Liebe, dann sagt er, er wolle sie heiraten, sobald der Krieg vorbei sei. Sie lächelt erschöpft an seinen Worten vorbei; daß der Krieg je zu Ende gehen könne, wagt sie gar nicht zu denken.
Und 1919 – einundzwanzig Jahre. Wirklich, der Krieg ist vorbei, das Elend nicht. Nur geduckt hat sich’s unter dem Trommelfeuer der Verordnungen, nur listig verkrochen unter den papierenen Kasematten der drucknassen Banknoten und Kriegsanleihen. Jetzt kriecht es hervor, hohläugig, breitmaulig, hungrig und frech, und frißt den letzten Abhub aus den Kloaken des Krieges. Ein ganzer Winter von Nennern und Nullen schneit vom Himmel herunter, Hunderttausende, Millionen, aber jede Flocke, jeder Tausender zergeht leer in der heißen Hand. Während man schläft, schmilzt das Geld, während man die zerrissenen, holzbestöckelten Schuhe wechselt, um ein zweites Mal zum Verkaufsstand zu rennen, ist es zerblättert; immer ist man unterwegs, doch immer schon zu spät. Das Leben wird Mathematik, Addieren, Multiplizieren, ein toller, wirbeliger Kreis von Ziffern und Zahlen, und dieser Quirl reißt die letzten Habseligkeiten in sein schwarzes unersättliches Nichts: die Goldspange der Mutter vom Halse, den Ehering vom Finger, den damastenen Überzug vom Tisch. Aber soviel man hineinwirft, vergebens, man kann es nicht zustopfen, das schwarze höllische Loch, es hilft nichts, daß man Wollsweater wirkt bis tief in die Nacht und alle Zimmer vermietet und selbst zu zweit in der Küche schläft. Aber der Schlaf, dies ist noch das einzige, das man sich gönnen kann, das einzige, was nichts kostet; spätabends den abgejagten, mager gewordenen, blassen, den noch immer unberührten Leib auf die Matratze werfen, sechs Stunden, sieben Stunden nichts zu wissen von dieser apokalyptischen Zeit.
Und dann 1920–1921. Zweiundzwanzig, dreiundzwanzig Jahre, Blüte der Jugend, so heißt es doch. Aber ihr sagt es keiner, und sie selber weiß es nicht. Von morgens bis abends nur ein Gedanke: wie auskommen mit dem ewig dünner werdenden Geld? Um einen Strich ist es besser geworden. Noch einmal hat der Onkel Hofrat geholfen, persönlich ist er zu seinem Tarockfreund in die Direktion gegangen, eine Postaushilfsstelle herauszubetteln, in Klein-Reifling zwar, erbärmliches Weinbauernnest, aber immerhin eine Anstellungsanwartschaft, eine Planke Sicherheit. Für einen reicht das knappe Gehalt, aber da der Schwager keinen Platz hat im Hause, muß sie die Mutter zu sich nehmen und jedes Eins zu Zwei strecken: noch immer beginnt jeder Tag mit Sparen und endet mit Rechnen. Jedes Zündholz ist gezählt, jede Bohne im Kaffee, jeder Mehlkrümel im Teig. Aber immerhin, man atmet, man lebt.
Und 1922, 1923, 1924 – vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig Jahre. Ist man noch jung? Wird man schon alt? Ein paar Falten kritzeln sich leise in die Schläfen, müde sind ihr manchmal die Beine, und im Frühjahr tut der Kopf ihr sonderbar weh. Aber doch, es geht vorwärts, es geht besser. Das Geld liegt wieder hart und rund in der Hand, sie ist fix angestellt, heißt Postassistentin, auch der Schwager schickt der Mutter zwei, drei Banknoten am Monatsanfang. Jetzt wäre es Zeit, ganz leise zu versuchen, wieder jung zu sein; die Mutter drängt selbst, sie solle doch ausgehen, sich vergnügen. Schließlich setzt die Mutter durch, daß sie sich im Nachbarort in eine Tanzstunde einschreiben läßt. Leicht wird dies rhythmische Tanzenlernen nicht, die Müdigkeit sitzt schon zu tief im Blut, manchmal ist ihr, als seien ihr die Gelenke schon irgendwie eingefroren, auch die Musik taut sie nicht auf. Mühsam übt sie die vorgeschriebenen Schritte, aber es packt sie nicht recht, es reißt sie nicht hin, zum erstenmal ahnt sie: zu spät, die Jugend verquält, zerrissen vom Krieg. Eine Feder muß innen zerbrochen sein, und irgendwie spüren das wohl auch die Männer, denn keiner wirbt recht um sie, obwohl ihr zartes blondes Profil wie adelig wirkt unter den apfelrunden und apfelroten groben Gesichtern der dörfischen Mädeln. Aber die warten dafür nicht so still und geduldig, diese Siebzehnjährigen, Achtzehnjährigen des Nachkriegs, bis einer sie will und wählt. Sie fordern Vergnügen als ihr Recht und fordern es so ungestüm, als wollten sie nicht nur ihre eigene Jugend leben, sondern dazu noch die der hunderttausend Toten und Verscharrten. Mit einer Art Schreck beobachtet die Sechsundzwanzigjährige, wie selbstsicher und begehrlich, mit wie wissenden und frechen Augen, mit wie provozierenden Hüften diese Neuen, diese Jungen sich gebärden, wie unzweideutig sie unter den verwegensten Griffen der Burschen lachen und wie sie ohne Scham eine vor der andern beim Nachhauseweg jede mit einem Mann gegen den Wald hin abbiegen. Es ekelt sie. Uralt und müde, unnütz und überrannt fühlt sie sich inmitten dieses gierigen und groben Nachkriegsgeschlechtes, unwillig und unfähig, mit ihnen wettzueifern. Überhaupt: nur nicht kämpfen mehr, nur nicht mehr sich mühen! Nur ruhig atmen, still vor sich hinträumen, seinen Dienst tun, die Blumen gießen am Fenster, nichts wollen, nichts wünschen. Nur nichts herausfordern mehr, nichts Neues, nichts Erregendes: selbst zur Freude hat die Sechsundzwanzigjährige, um ihr Jahrzehnt Jugend durch den Krieg bestohlen, keinen Mut mehr und keine Kraft.
Unwillkürlich seufzt Christine aus ihren Gedanken heraus. Schon das Darandenken, an all das Grauenhafte ihrer Jugend, macht sie müd. Unsinn das alles, was die Mutter angezettelt hat! Wozu jetzt von hier fort und zu einer Tante, die sie nicht kennt, unter Menschen, mit denen sich Christine nicht versteht? Aber mein Gott, was soll sie tun, die Mutter will’s und es macht ihr Freude, so darf sie sich wohl nicht wehren: überhaupt, wozu sich wehren? Man ist ja so müd, so müd! Langsam resigniert nimmt die Postassistentin aus dem obern Fach ihres Schreibtisches einen Foliobogen, faltet ihn sorgfältig in der Mitte, legt ein Linienblatt unter und schreibt sauber, klar, mit schönen Haar- und Schattenstrichen an die Postdirektion in Wien, den ihr gesetzlich zustehenden Urlaub sofort wegen einem Familienanlaß antreten zu dürfen und um Entsendung einer Stellvertreterin von nächster Woche an. Dann bittet sie noch die Schwester, ihr in Wien das Schweizer Visum zu besorgen, einen kleinen Koffer zu leihen und herüberzukommen, um mancherlei wegen der Mutter zu besprechen. Und in den nächsten Tagen bereitet sie alles langsam, sorgfältig und genau für die Reise vor, ohne Freude, ohne Erwartung, ohne Anteil, als gehörte dies nicht zu ihrem Leben, sondern zu dem einzigen, das sie führt: ihrem Dienst und ihrer Pflicht.
Die ganze Woche ist gerüstet worden. Die Abende vergehen angestrengt mit Nähen, Flicken, Putzen und Umbessern des alten Bestandes, außerdem hat die Schwester, statt für die gesandten Dollars etwas zu kaufen – besser sie aufsparen, meint die kleine ängstliche Bürgerin –, einiges ihrer eigenen Garderobe geliehen, einen gelbgrellen Reisemantel, eine grüne Bluse, eine von der Mutter bei der Hochzeitsreise in Venedig gekaufte Mosaikbrosche sowie einen kleinen Strohkoffer. Das werde schon genügen, meint sie, im Gebirge mache man keine Toilette, und was allenfalls Christine fehle, kaufe sie besser an Ort und Stelle. Endlich kommt der Abreisetag. Den flachen Strohkoffer trägt der Schullehrer des Nachbarortes, Franz Fuchsthaler, eigenhändig zur Station, er will sich diesen Freundschaftsdienst nicht nehmen lassen. Gleich auf die erste Nachricht ist der kleine schwächliche Mann mit seinen hinter Brillen ängstlich versteckten blauen Blicken zu den Hoflehners gekommen, um ihnen seine Hilfe anzubieten; sie sind die einzigen, mit denen er in dem abgelegenen Weinbauernort Freundschaft hält. Seine Frau liegt seit mehr als einem Jahr, von allen Ärzten aufgegeben, in der staatlichen Tuberkuloseanstalt Alland, die beiden Kinder teilen auswärtige Verwandte in Kost; so sitzt er fast allabendlich allein in seinen beiden ausgestorbenen Zimmern und tut lautlos und mit viel bastlerischer Liebe kleine unscheinbare Dinge. Er legt Pflanzen in Herbarien, kalligrafiert in Rondeschrift mit roter Tinte die lateinischen, mit schwarzer die deutschen Namen unter die flach getrockneten Blumenblätter, bindet eigenhändig seine geliebten ziegelroten Reclamhefte in buntgemusterte Pappe und ahmt auf den Buchrücken mit mikroskopischer Genauigkeit und einer ganz fein gespitzten Zeichenfeder täuschend genau Drucklettern nach. Ganz spät, wenn er alle Nachbarn schlafend weiß, spielt er, von selbstkopierten Notenblättern, ein wenig steif, aber reichlich bemüht Violine, meist Schubert und Mendelssohn, oder schreibt aus entliehenen Büchern die schönsten Verse und Gedanken auf weiße zartgekörnte Quartbogen, die er, immer wenn die Hundertzahl erreicht ist, zu einem neuen Albumheft mit Glanzpapier und einem bunten Schildchen heftet. Wie ein arabischer Koranschreiber liebt er die zarten Rundungen, das sachte und dann wieder mit starken Schlagschatten Ausschwingende der Schrift um der stummen Freude willen, die lautlos und doch lebendig von seiner innerlich gespannten Mühe ins Sichtbare übergeht: Bücher sind für diesen bescheidenen, stillen, vegetativen Menschen, der keinen Garten vor seiner Gemeindewohnung hat, die Blumen im Hause, und er liebt, sie im Regal anzureihen zu bunten Alleen; mit einer altväterischen Gärtnerfreude hütet er jedes einzelne, nimmt, wie man Zerbrechliches faßt, sie in seine schmalen, blutarmen Hände. Nie betritt er das Dorfwirtshaus. Er haßt Bier und Rauch mit der Angst der Frommen vor dem Bösen; hört er von außen hinter einem Fenster die klobigen Stimmen von Streitenden oder Berauschten, so geht er mit schnellen und erbitterten Schritten hastig vorbei. Die einzigen Menschen, mit denen er seit der Krankheit seiner Frau Umgang pflegt, sind die Hoflehners. Zu ihnen kommt er öfters nach dem Abendessen, um zu plaudern oder – sie haben es gerne – mit seiner eigentlich trockenen, aber in der Ergriffenheit musikalisch aufschwingenden Stimme aus Büchern vorzulesen, am liebsten aus den ›Feldblumen‹ des heimatlichen Adalbert Stifter. Seine schüchterne und etwas enge Seele fühlt sich dann immer unmerkbar geweitet, wenn er, aufschauend vom Buch, das horchende und gebeugte Blond des jungen Mädchens sieht; in der Art ihres innerlichen Zuhörens fühlt er sich verstanden. Die Mutter merkt, was in ihm wächst und daß er, sobald das unvermeidliche Schicksal seiner Frau sich erfüllt haben wird, mit einem neuen und kühneren Sinn seinen Blick auf die Tochter richten wird. Die aber, geduldig geworden, schweigt: sie hat längst verlernt, an sich selbst zu denken.
Der Lehrer trägt den Koffer auf der rechten, etwas niedrigeren Schulter, gleichgiltig gegen die lachenden Schuljungen. Die Last drückt nicht sehr, aber doch muß er den ganzen Weg den Atem scharf anspannen, um mit Christine Schritt zu halten, so ungeduldig und nervös hastet sie voraus; der Abschied hat sie unerwartet grausam erregt. Dreimal ist ihr die Mutter, trotz des ärztlichen ausdrücklichen Verbotes, die Treppen bis in den Hausflur nachgestolpert, als ob sie aus einer unerklärlichen Angst, sich an ihr festhalten wollte, dreimal hat sie, obwohl die Zeit drängt, die breite, strömend schluchzende alte Frau wieder die Treppen hinaufführen müssen. Und dann ist es geschehen, wie so oft in den letzten Wochen: mitten im Schluchzen und erregt ausfahrenden Wort verlor die alte Frau plötzlich den Atem und mußte keuchend hingebettet werden. In diesem Zustand hat Christine sie verlassen, und nun erschüttert sie die Besorgnis wie eine persönliche Schuld: »Mein Gott, wenn ihr etwas zustößt, so aufgeregt habe ich sie nie gesehen, und ich bin nicht da«, klagt sie. »Oder wenn sie etwas braucht in der Nacht, und die Schwester kommt doch nur über den Sonntag aus Wien. Das Mädel von der Bäckerei, sie hat’s mir zwar heilig versprochen, daß sie abends bei ihr bleibt, aber auf die ist kein Verlaß; wenn’s ans Tanzen geht, lauft die der eigenen Mutter weg. Nein, ich hätte es nicht tun, mich nicht bereden lassen sollen. Reisen, das taugt nur für solche, wo kein Kranker im Haus ist, nicht für unsereins, und gar so weit weg, wo man nicht jeden Augenblick heim kann; was hab’ ich denn von der ganzen Reiserei? Wie soll ich mich an was freuen können, wenn mir’s keine Ruh läßt, wenn ich jede Minute denken muß, ob ihr nichts abgeht, und niemand ist da in der Nacht, und die Klingel hinunter hören sie nicht, oder wollen sie nicht hören. Sie mögen uns ja nicht im Haus, die Wirtsleute; wenn’s nach denen ging, hätten sie uns längst ausgemietet. Und die Assistentin, die aus Linz, die hab ich zwar auch gebeten, sie soll mittags und soll abends auf einen Sprung herüberkommen, aber nur ›Ja‹ hat sie gesagt, diese kalte, verhutzelte Person, so ein Ja, wo man nicht weiß, ob sie’s wirklich tut oder nicht. Ob ich nicht doch lieber abtelegrafieren soll? Was liegt der Tante denn wirklich dran, ob ich komm’ oder nicht, das redet sich die Mutter doch nur ein, daß es denen um uns zu tun ist. Sonst hätten sie längst zwischendurch aus Amerika schreiben können oder damals in der Notzeit ein Paket mit Lebensmitteln herüberschicken, wie’s Tausende getan haben. – Wieviel hab ich selber expediert, und nie ist eins an die Mutter gekommen von der leibhaftigen Schwester. Nein, ich hätt’ nicht nachgeben sollen, und wenn’s nach mir ging, möcht ich jetzt noch absagen. Ich weiß nicht warum, aber ich hab’ so eine Angst. Ich sollt’ doch jetzt nicht fort, ich sollt’ nicht fort.«
Der kleine, blonde, schüchterne Mann an ihrer Seite nimmt mitten im hastigen Nachschreiten immer wieder seinen Atem zusammen, um sie zu beruhigen. Nein, nicht sorgen, er selbst werde jeden Tag, das verspreche er ihr, nach der Mutter sehen. Wenn jemand, so habe sie ein Recht, endlich einmal sich Urlaub zu gönnen, seit Jahren hätte sie keinen Tag ausgespannt. Er selbst wäre doch der Erste ihr abzuraten, wenn’s gegen ihre Pflicht ginge; aber nur keine Sorge, jeden Tag würde er ihr Nachricht geben, jeden Tag. Sehr hastig, kreuz und quer durcheinander keucht er, was ihm gerade einfällt, um sie zu beruhigen, und wirklich, sein dringliches Zureden tut ihr wohl. Sie hört gar nicht deutlich hin, was er sagt, sie fühlt nur, einer ist da, auf den sie sich verlassen kann.





























