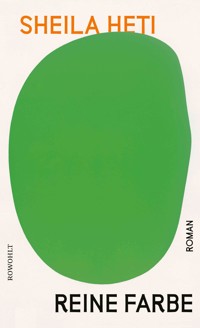
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Englisch
Nach Wie sollten wir sein? und Mutterschaft ein neues Werk von der Vordenkerin einer neuen Weiblichkeit. Wie alle Bücher von Sheila Heti oszilliert auch dieses zwischen den Genres. Reine Farbe ist philosophisches Traktat, modernes Märchen und die realistische Erzählung einer Freundschaft zwischen zwei jungen Frauen in schwierigen Zeiten. Die Prämisse: Gott schuf die Welt in sechs Tagen, betrachtet sie seit nunmehr 4,5 Milliarden Jahren mit dem Pinsel in der Hand und überlegt, ob es nicht klüger wäre, eine neue, bessere Version anzugehen. Mira ist aber in dieser ersten Welt zu Hause. Sie teilt die Menschen in Vogel-, Fisch- und Bärenwesen; sie selbst ist ein Vogel (flüchtig, scheu), ihre Freundin Annie ein Fisch (sozial, engagiert, ein Schwarmtier). Miras Vater wiederum, der einen starken Einfluss auf sie ausübt, ist ein (machtvoll emotionaler) Bär. Und sein Tod für sie kaum zu verwinden. Ein modernes Märchen über die Macht der Liebe und das Ende der Welt. Von einer der eigensinnigsten und überraschendsten Schriftstellerinnen unserer Tage. «Einzigartig. Dieses Buch erzählt uns etwas Neues über die schwierigen Zeiten, in denen wir leben.» Anne Enright «Sheila Heti beschreitet völlig neue Wege.» Rachel Cusk «Ein beglückendes Buch, das mich zum Schreiben inspiriert hat.» Sally Rooney über Wie sollten wir sein?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sheila Heti
Reine Farbe
Roman
Über dieses Buch
Nach Wie sollten wir sein? und Mutterschaft ein neues Werk von der Vordenkerin einer neuen Weiblichkeit. Wie alle Bücher von Sheila Heti oszilliert auch dieses zwischen den Genres. Reine Farbe ist philosophisches Traktat, modernes Märchen und die realistische Erzählung einer Freundschaft zwischen zwei jungen Frauen in schwierigen Zeiten. Die Prämisse: Gott schuf die Welt in sechs Tagen, betrachtet sie seit nunmehr 4,5 Milliarden Jahren mit dem Pinsel in der Hand und überlegt, ob es nicht klüger wäre, eine neue, bessere Version anzugehen.
Mira ist aber in dieser ersten Welt zu Hause. Sie teilt die Menschen in Vogel-, Fisch- und Bärenwesen; sie selbst ist ein Vogel (flüchtig, scheu), ihre Freundin Annie ein Fisch (sozial, engagiert, ein Schwarmtier). Miras Vater wiederum, der einen starken Einfluss auf sie ausübt, ist ein (machtvoll emotionaler) Bär. Und sein Tod für sie kaum zu verwinden.
Ein modernes Märchen über die Macht der Liebe und das Ende der Welt. Von einer der eigensinnigsten und überraschendsten Schriftstellerinnen unserer Tage.
Vita
Sheila Heti, geboren 1976 in Toronto, wo sie heute noch lebt, ist die Autorin des internationalen Bestsellers Wie sollten wir sein? (dt. 2014), der ein Generationenbuch für die Millennials wurde. Mit Leanne Shapton und Heidi Julavits verfasste sie Frauen und Kleider (dt. 2015), ebenfalls ein programmatischer Band mit Texten, Bildern und zahlreichen Interviews zum Thema Frauen und Mode. 2019 erschien Mutterschaft. Heti schreibt u. a. für den New Yorker und die New York Times; ihr vielfältiges Werk, vom Drama bis zur Bühnenshow, vermischt auf raffinierte Weise Elemente von Kunst, Autobiografie und Journalismus. Die New York Times listete sie unter den 15 bedeutsamsten Frauen, die bestimmen, wie wir im 21. Jahrhundert Literatur lesen und schreiben werden.
Thomas Überhoff studierte Anglistik, Amerikanistik und Germanistik und arbeitete lange als Lektor und Programmleiter Belletristik beim Rowohlt Verlag. Er übersetzte unter anderem Nell Zink, Jack Kerouac und Denis Johnson.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel «Pure Colour» bei Farrar, Straus and Giroux, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Pure Colour» Copyright © 2022 by Sheila Heti
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München,
nach dem Origianl von Penguin Random House UK; Design by Na Kim
Coverabbildung Ellsworth Kelly – Green,1964–1965, © Ellsworth Kelly Foundation, Courtesy Matthew Marks Gallery
ISBN 978-3-644-01004-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Eins
Als Gott Himmel und Erde erschaffen hatte, trat er zurück, um die Schöpfung zu betrachten, wie ein Maler von der Staffelei.
Dies ist der Moment, in dem wir leben – der Moment, in dem Gott zurücktritt. Wer weiß, wie lange er schon dauert. Zweifellos seit Anbeginn der Zeiten. Aber wie lange ist das? Und wie lange wird der Moment noch anhalten?
Man sollte meinen, Gottes Innehalten beim Schritt zurück, bevor er wieder vortritt und sein Werk abschließt, wäre augenblicklich wieder vorbei – aber es scheint ewig zu dauern. Und wer weiß auch schon, wie lang- oder kurzlebig diese unsere Welt vom Fluchtpunkt der Ewigkeit aus erscheint?
Heute erwärmt sich die Erde im Vorgriff auf ihre Zerstörung durch Gott, der entschieden hat, dass die erste Version des Daseins zu fehlerhaft war.
Bereit, sich ein zweites Mal an der Schöpfung zu versuchen und sie diesmal besser hinzukriegen, erscheint Gott, teilt und manifestiert sich in Gestalt dreier Kunstkritiker am Himmel – ein großer Vogel, der von oben her urteilt, ein großer Fisch, der aus der Mitte heraus urteilt, und ein großer Bär, der urteilt, während er die Schöpfung in den Armen wiegt.
Aus dem Vogelei geborene Menschen interessieren sich für Schönheit, Ordnung, Harmonie und Sinn. Sie betrachten die Natur abstrahiert von oben und nähern sich der Welt aus der Distanz. Diese Menschen sind wie schwebende Vögel – flüchtig, fragil und kräftig.
Aus dem Fischlaich geborene Menschen entschlüpfen Gelschnüren, und in diesen Schnüren, die Hunderttausende Eier enthalten, kommt es nicht auf das einzelne Ei an, sondern auf die Verfassung der vielen. Fische kümmern sich nicht so sehr um ihre einzelnen Eier, sondern darum, dass alle zu den besten Bedingungen gelegt werden, dorthin, wo die Temperatur möglichst genau stimmt und die Strömung sanft ist, damit die Mehrheit überlebt. Für sie zählen die Konditionen des Kollektivs. Fischgeborene kümmern sich also zuvörderst um Fairness hier auf Erden: darum, dass die Menschheit die Temperatur für die vielen passend regelt. Fischen kommt es auf tausend Eier an, während die oder der Bärengeborene eine einzige Person so fest wie möglich in die Arme schließt.
Aus dem Bärenei Geborene gleichen Kindern, die ihre Lieblingspuppe umklammern. Bären kennen kein pragmatisches Denken, aufgrund dessen sie ihre Liebsten irgendeinem höheren Zweck opfern könnten. Sie befassen sich ausschließlich mit ihresgleichen. Sie erheben Anspruch auf ein paar Menschen, die sie lieben und beschützen, und treffen diese Wahl ganz unbekümmert; sie sind denen zugeneigt, die sie riechen und berühren können.
Aus diesen drei unterschiedlichen Eiern geborene Menschen werden einander nie richtig verstehen. Sie werden immer glauben, wer einem anderen Ei entschlüpft sei, setze ganz falsche Prioritäten. In Gottes Augen jedoch sind Vogel, Fisch und Bär alle gleich wichtig, und die Welt wäre nicht besser, wenn es nur Fische gäbe; sie wäre auch nicht besser, wenn es nur Bären gäbe. Gott will seine Schöpfung von allen dreien bewertet wissen. Doch hier auf Erden ist das schwer nachvollziehbar: Fische finden die Anliegen der Vögel oberflächlich, während Vögel auf das Urteil der Fische mit Ungeduld reagieren. Nichts gibt einem Menschen dringlicher das Gefühl, sein Lebenswerk – oder sein Wesen – werde zu wenig wahrgenommen, als wenn ihn jemand aus einem anderen Ei beurteilt.
Trotzdem sollten die Vögel dafür dankbar sein, dass jemand die Struktur beurteilt, damit sie es nicht müssen. Und die Fische dafür, dass jemand ästhetisch urteilt, damit sie sich auf das Strukturelle konzentrieren können.
Am stolzesten ist Gott auf die Schöpfung als ästhetisches Objekt. Man braucht sich nur die erlesene Harmonie von Himmel, Bäumen, Mond und Sternen anzuschauen, um zu erkennen, was für großartige Arbeit er in ästhetischer Hinsicht geleistet hat. Darüber freuen sich die aus einem Vogelei Geborenen am meisten. Die aus dem Fischlaich beunruhigt es am stärksten, und die aus dem Bärenei sind auch nicht allzu glücklich darüber.
Vielleicht sollte Gott die Schöpfung beim nächsten Mal nicht als Kunstwerk betrachten; dann wird er es auch mit Fairness und Intimität in unserem Leben besser hinbekommen. Aber ist das überhaupt möglich – ein Künstler, der sein Werk in eine Form bringt, die am Ende nicht doch künstlerisch ist?
Diese Geschichte hier handelt von einer vogelgleichen Frau namens Mira; sie ist hin- und hergerissen zwischen der Liebe zur rätselhaften Annie, die ihr wie ein distanzierter Fisch vorkommt, und der zu ihrem Vater, der wie ein warmherziger Bär auftritt.
Das Herz des Künstlers ist ein bisschen hohl. Die Knochen des Künstlers sind ein bisschen hohl. Das Hirn des Künstlers ist ein bisschen hohl. Doch das erlaubt es ihm zu fliegen. Wer nicht einem Vogelei entschlüpft ist, mag sich fragen, wieso ausgerechnet die Vögel – deren Gedanken nur um sie selbst kreisen – dazu geboren sind, der Welt ihre Metaphern, Bilder und Geschichten zu schenken. Warum sollte das den Vögeln überlassen sein?
Ein Vogel kann auf der Erde laufen lernen wie ein Bär, und er kann sein ganzes Leben laufend verbringen – aber er wird so niemals glücklich werden. Während ein an Land geworfener Fisch sogleich verzweifelt nach Luft schnappt und zurück ins Meer zu kommen versucht.
Wie gern wäre Mira aus einem Bärenei geboren! Wie gern wäre sie Botschafterin einer sanften, dauerhaften Liebe hier unten auf Erden. Aber wann immer sie derlei Herzensangelegenheiten angeht, wünscht sie sie herbei, kämpft darum und kommt doch kaum voran. Jemanden richtig zu lieben – darin ist sie am wackligsten, ungereimtesten, wirrsten, und die Liebe ist stets an allem schuld.
Aber es sollte sie nicht grämen, aus einem Vogelei geboren zu sein, denn wie schön sind doch die Blumen an ihrem Fenster, dort auf dem Sims. Wie ihre Blüten und Blätter jeden Passanten zum Lächeln bringen, darüber, dass jemand das Schöne liebt und hegt. Ihre Blumen lassen uns an die Blumen in der Seele dessen denken, der sie dort hingestellt hat. Die Blumen in der Seele dessen, der sie dort hingestellt hat, machen uns glücklich und lassen uns das Herz aufgehen. Die Schönheit dieser Blumen ist ein Hinweis auf die Schönheit eines menschlichen Herzens. Sie lassen in dieses Herz blicken wie durch ein Schlüsselloch.
Auch die gute Tat eines Fisches, selbst noch so unbedeutsam, aber effektiv ausgeführt, gestattet einen Blick in ein menschliches Herz. Und ein Blick in ein Herz ist ein Blick in viele. Und die ganze Menschheit teilt die Hoffnungen des Bären. Und was ein Herz aufschließt, schließt viele auf.
Mira zog von zu Hause aus. Dann besorgte sie sich Arbeit in einem Lampengeschäft. Das verkaufte Tiffany- und andere Buntglaslampen. Jede einzelne kostete ein Vermögen. Die billigste vierhundert Dollar. Für Mira war das ein Monatslohn. Jeden Tag, bevor sie abends schlossen, musste sie die Lampen einzeln ausschalten. Das dauerte ungefähr elf Minuten. Meist zog sie dabei an mit Glasperlen geschmückten Kordeln. Sie musste aufpassen, dass die nicht zurückschnappten und die Birne oder Lampe trafen. Also zupfte sie ganz vorsichtig an den Kordelenden. Es war mühselig. Mira hatte keine Morgenschicht. Die Morgenschicht musste die Lampen anschalten. Deren Job war nicht besser als ihrer.
Auf der anderen Straßenseite lag noch ein Beleuchtungsgeschäft. Ihres war ein schlichter Lampenladen, das andere verkaufte auch diverses Zubehör sowie mit Ventilatoren bestückte Deckenlampen – sehr moderne Leuchten im Gegensatz zu ihrer altmodischen Ware. Die Leute bevorzugten das Geschäft gegenüber. Der Besitzer von Miras Laden hatte gerade noch genug Kunden, um sich über Wasser zu halten, weil die meisten Paare auf die andere Straßenseite gingen und ihr Geld für modernistische weiße Leuchten oder milchfarbene Plexiglaslampen ausgaben. Miras Kolleginnen sagten selbstmitleidig, diese Leute hätten keinen Geschmack. Zum Ladenschluss sah Mira den dünnen Mann, der gegenüber arbeitete, jede einzelne Lampe ausschalten. Beide verrichteten die gleiche abendliche Pflicht. Mira schien es, als verstünde kein Mensch auf der Welt sie, aber sie fragte sich, ob er es vielleicht tat. Und doch, peinlich berührt von ihrer Ähnlichkeit, vermied sie jeglichen Blickkontakt.
Sie fühlte sich so allein in diesen Tagen. Nicht dass es sie groß störte. Erst wenn du älter wirst, reden dir alle das Alleinsein schlecht oder lassen durchblicken, dass es irgendwie besser sei, mit jemandem zusammenzuleben, weil es beweise, dass du sympathisch bist.
Aber sie war nicht allein, weil sie unsympathisch wirkte. Sie war allein, damit sie sich beim Denken zuhören konnte. Sie war allein, damit sie sich beim Leben zuhören konnte.
Wie kam Mira zu ihrer Arbeit im Lampenladen? Sie musste daran vorbeigegangen sein und den kleinen Zettel gesehen haben. Wie fanden die Leute damals Arbeit, damals, bevor jeder wusste, was alle wollten? Durch kleine Papierzettel.
Und wie fand sie das Zimmer, in dem sie wohnte? Wahrscheinlich war irgendwo ein Zettel angeklebt oder im Café um die Ecke an die Korkwand gepinnt. Im ersten Stock des Hauses befanden sich zwei Zimmer und ein Bad, das sie sich teilten. Im Erdgeschoss war ein großes Apartment, bewohnt von einem blonden Schwulen, der eines Abends ganz blutig und zerschlagen nach Hause kam. Zufällig trafen sie sich auf der Treppe, und aufgebracht und erbost wandte er sich ab.
Auf Miras Etage lebte ein einsamer Mann, der etwa zehn Jahre älter war als sie und den sie nur zweimal zu Gesicht bekam. Er war schweigsam und schüchtern. Die Wanne in ihrem gemeinsamen Bad war schmutzig, deshalb badete sie nie und duschte auch selten. Weil der Mann sein Abendessen in der Küche zubereitete, kaufte sie sich eine Kochplatte für ihr Zimmer.
Ihr Zimmer ging auf eine Art zugige Veranda mit Wänden aus Holzlatten hinaus, in die auf allen drei Seiten leicht verzogene Fenster eingesetzt waren. Wenn schönes Wetter gewesen wäre, hätte man sich hübsch in diesem Raum aufhalten können. Aber Mira zog im Herbst ein, und im Vorfrühling war sie schon wieder weg. Alle Bücher, die sie besaß, standen auf einem Regal in diesem frostkalten Zimmerchen. Als die Zeit zum Auszug gekommen war, machte sie die Tür auf, um ihre Bücher einzusammeln, und stellte fest, dass sie in der feuchten, tiefen Winterkälte allesamt Schimmel angesetzt und sich gewellt hatten.
Mira fing eine Ausbildung an. Sie wurde in die Amerikanische Akademie für amerikanische Kritiker aufgenommen, in eine der internationalen Dependancen. Es war nicht leicht, da hineinzukommen. Alle, die Kritiker werden wollten, bewarben sich. Es gab nur ein paar Plätze pro Jahr, und wer akzeptiert wurde, hatte gleich etwas zum Angeben. Allein schon die Aufnahme warf ein gewisses Licht auf deine Persönlichkeit und deine geistige Verfassung. Sie bedeutete, dass du besser warst als der Rest.
In der Akademie gab es einen großen Raum, tetraederförmig überkuppelt, mit billigen Tischen, Plastikstühlen und hellen, rauchverfärbten Wänden. Dort hingen die Studierenden ab. An einer winzigen Durchreiche konnten sie Croissants und Kräutertee kaufen, und die Leute, die hinter der Wand arbeiteten, waren kaum je zu sehen.
In diesem großen Raum stellten sich die Studierenden auf die Tische und schwangen Reden. Unter lautem Gelächter machten sie ihre Ansagen, und es war der einzige Ort im ganzen Gebäude, wo sie nicht das Gefühl hatten, für ihre Professoren zu performen. Der einzige Ort, an dem sie sich frei fühlten. Sie barsten geradezu vor Selbstgefälligkeit! Ihnen war daran gelegen, ihre Erkenntnisfähigkeit zu schärfen. Sie wussten, dass sie einen Schreib- und Denkstil entwickeln mussten, der jahrhundertelang haltbar war und zugleich ihre eigene Generation auf prägnante Weise kenntlich machte. Deshalb waren sie an dieser Akademie – sie, die Auserwählten. Sie glaubten, die Zukunft werde sicher in der Form ruhen, die sie gegossen hatten. Es war wichtig zu wissen, wie man Dinge einschätzte – was man von der Welt hielt und wie man glaubte, dass sie sein sollte.
Sie rechneten nur nicht damit, dass sie eines Tages mit Telefonen herumlaufen würden, aus denen Leute mit weitaus mehr Charisma als sie einen endlosen Strom von Bildern und Worten fließen ließen. Sie hatten einfach keine Ahnung, dass die Welt so groß und der Wettbewerb so scharf werden würde.
Sie aßen Croissants und tranken Tisane. Sie rauchten Gras und gingen bekifft in den Unterricht. Sie hatten wenige Seminare, und was dort angeboten wurde, war wertlos und hinter der Zeit zurück.
Jeden Morgen mussten sie im Keller der Akademie Tai-Chi machen. Die Stunden wurden von einem schmalen, flotten Mittfünfziger geleitet. Die stillschweigende Annahme war, dass sie ebenso energiegeladen und leistungsfähig würden wie er, wenn sie ihr Leben lang jeden Morgen Tai-Chi machten. Alle gingen hin außer Matty, der nicht glaubte, dass man als Kritiker Tai-Chi zu können brauchte. Schon die pure Existenz dieser Kurse regte ihn auf. Er fand, sie sollten ausschlafen können. Bei der Einschreibung hatte man ihm nicht gesagt, dass jeden Morgen um acht Tai-Chi für Studierende obligatorisch war. Hätte er das gewusst, hätte er sich gar nicht erst beworben. Ob er seinen Körper bewegen wollte oder nicht, war seine Sache, das ging nur ihn etwas an. Seine Kommilitonen teilten zwar seine Meinung, gingen aber trotzdem zum Tai-Chi.
Mira war erst seit ein paar Tagen an der Akademie, als sie Matty vom See heraufkommen sah, wo er nackt gebadet hatte. Er sah sie und nickte ihr zu. Sie sah ihn, nickte zurück und schaute schnell beiseite. Er war groß, kräftig, sein Penis hing tief, sein Hodensack war rot, sein Körper überall behaart, das Haar fiel ihm übers Gesicht, seine Lippen waren aufgedunsen und die Augen gerötet vom Wasser, und er musterte sie träge, hob langsam die Hand zum Gruß, und Mira hoffte nur, dass sie ihm während ihrer Zeit dort nie wieder begegnen würde.
Ihr alter Prof Albert Wolff stand vor einer Leinwand, auf die ein Dia vom Gemälde eines Spargels projiziert wurde. Er machte eine große Show aus der Suche nach dem, was er nicht sah, während ihn die Studierenden im abgedunkelten Raum umstanden. Er erklärte, die Welt sei noch immer nicht über ihre Vorliebe für den nie aus der Mode geratenden Manet hinaus, aber schon bald werde jeder seine Ansicht teilen.
«Édouard Manet ist ein merkwürdiger Typ. Als Maler hat er ein Auge, aber kein Händchen. Die gute Fee, die seine Geburt begleitete, schenkte ihm zwar die vorrangigen Eigenschaften eines Künstlers, aber bald trat die böse Fee an seine Wiege und sagte: Kind, aus dir wird niemals etwas werden. Kraft meiner Macht nehme ich dir die Eigenschaften, die am Ende den Künstler ausmachen.»
Während Mira sich dort an die Wand lehnte, durchlief ein wunderbares Zittern ihre Brust, als hätte sich etwas Eintritt in sie verschafft und hauche nun sein Leben aus. Doch nur Augenblicke später überlief es sie heiß, und sie empfand Scham über die Diskrepanz zwischen dem, was Albert Wolff sagte, und dem, was das Bild sie empfinden ließ. Er sagte, das Bild weise zwar einige künstlerische Eigenschaften auf, jedoch fehle ihm etwas, nämlich das Wesentliche, der Funke, der verkünde: Ich bin mehr, als ich zu sein scheine.
«Das Bild hängt vor dem Betrachter, spiegelt aber nur die nichtssagende Eindeutigkeit dessen, der vor ihm steht. Weder vermag es aufzubauen noch sonst wie zu erheben. Vor diesem Bild zu stehen inspiriert mich nicht mehr dazu, mich für einen besseren Menschen zu halten, als stünde ich vor einer Backsteinwand. Ich denke: Die Menschheit ist von Anfang an geschlagen, wir brauchen es also gar nicht erst zu versuchen. Aber die Kunst soll uns doch das Gegenteil empfinden lassen – dass menschliche Bemühungen Flügel haben! Ein Gemälde sollte uns zu spirituellen Höhenflügen veranlassen, aber ein Bild wie dieses hat keine Schwingen, es gibt uns das Gefühl, so etwas wie Flügel existiere gar nicht. Dieser Spargel sitzt uns wie ein Stein auf der Seele und zieht unsere spirituellen Ambitionen ins Lächerliche. Aber Spiritualität ist nicht gleich Ambition. Spiritualität ist wie ein Lied, und das Lied in Manets Herzen ist das Geheul eines Nebelhorns. Wir sollten Mitleid haben mit diesem verzweifelt suchenden Kind von einem Maler, dem das Wesentliche fehlt und der das nicht einmal merkt. Dabei müsste er sich doch nur in irgendeinem Museum vor sein Bild stellen, nach rechts und links schauen, sehen, wie die Werke anderer Maler der Seele Schwingen verleihen, und sich dann wieder seinem eigenen Bild zuwenden – diffus, plump hingeschmiert, uninspiriert und mitnichten erhebend. Wie kann er das nicht erkennen? Ein Maler ohne Auge! Oder mit von der Hand getrenntem Auge! Warum wenden sich Menschen an die Kunst, außer damit sie ihnen hilft, ihr inneres Auge zu finden, das der gesamten Existenz Bedeutung verleiht – denn was anderes bedeutet Kunst, als Materie den Atem Gottes einzuhauchen? Der Künstler, der das nicht kann, malt bedeutungs- und leblose Formen. Warum die Kritiker gelacht haben, ist offenkundig, denn sie waren verblüfft, nicht zu sehen, was zu sehen sie ein Recht hatten! Jemand, der ausgeht, wirft sich in Schale, und auch die Kunst muss sich in Schale werfen. Aber Manets Bilder sind nackt und bloß – nicht nur hinsichtlich ihrer lächerlichen Motive, sondern auch im spirituellen Sinn.»
«Ein Künstler weiß doch, ob er ein Künstler ist, falls er aufrichtig zu sich ist», sagte Matty. «Hätte Manet da beim Malen nicht ein gewisses Unwohlsein beschleichen müssen – irgendeine Ahnung, dass ihm das Wesentliche fehlte?» Matty stand lässig da und rauchte; er war die große, leuchtende Hoffnung der Akademie.
Wolff nickte. «Ein großer Künstler ruht gelassen im bequemen Sessel seines Talents, als ruhte er in der warmen Hand Gottes. Aber Manets Talent kennt keine Gelassenheit, und er ist sich seines Strauchelns nicht bewusst. Er ist wie ein dreibeiniger Hund, der sich nicht für anders hält als einer, der auf vier Beinen läuft! Er nimmt das Publikum für seine Arbeit in Regress – es hat sich gefälligst bezaubert zu fühlen. Er verlangt ihm ab, sein Bild zu vervollständigen, weil er selbst faul und unfähig ist. Er muss zutiefst frustriert sein, während er arbeitet und sich Mühe gibt, das Unrettbare zu retten. Also pinselt er hektisch vor sich hin, denn er will gar nicht sehen, was er da erschaffen hat. Deshalb sind seine Bilder so hingeschludert. Er hat keinen seelischen Kompass, das verwirrt ihm den Blick. Man spürt den Neid in seinem Herzen, und doch weiß er nicht einmal, um was er andere Maler beneiden soll! Da er Schönheit nicht hinbekommt, verbirgt er sich hinter einer Hässlichkeit, die er Schönheit nennt, und seine Bilder wirken beschämend, deshalb beschämen ihn die Kritiker, denn wir schämen uns für ihn. Worauf er einfach weiter seine Bilder malt, die nichts zu bieten haben, sich umdreht und den Kritikern ihre ‹Untaten› vorwirft.»
E





























