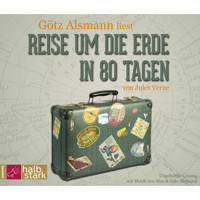
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacheles!
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jules Verne bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Jules Verne bei Null Papier Komplett neu überarbeitet; reichhaltig illustriert und kommentiert Jeder kennt die Geschichte: Der exentrische Gentleman Phileas Fogg wettet mit seinen nicht minder exzentrischen Klubfreunden, dass er es schafft, in 80 Tagen die Welt zu umreisen. Der Wetteinsatz: sein gesamtes Vermögen. Zusammen mit seinem frisch eingestellten Diener Passepartout macht er sich umgehend auf, der Welt zu beweisen, dass ein englischer Gentleman mit genauer Planung und einer gefüllten Geldtasche überall seinen Mann stehen kann, ob im tiefsten Indien, fernsten China oder wildesten Westen. Sicherlich Vernes bekanntestes Werk, das vielfach verfilmt, längt Eingang gefunden hat in den Bildungskanon und Zitatenschatz der Welt. Ein Füllhorn an Traumzielen; zu lesen als Reisebericht, Kulturführer oder schlicht als spannende Abenteuergeschichte. Illustriert mit den wundervollen Zeichnungen von Léon Benett. Mit einführendem Aufsatz zu Leben und Werk des Autors. Null Papier Verlag
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:3 Std. 48 min
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jules Verne
Reise um die Erde in 80 Tagen
Illustrierte Fassung
Jules Verne
Reise um die Erde in 80 Tagen
Illustrierte Fassung
(Le Tour du monde en quatre-vingts jours)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2025Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]: Alphonse de Neuville, Léon BenettFußnoten und Übersetzung: Jürgen Schulze EV: A. Hartleben’s Verlag, 1873 4. Auflage, ISBN 978-3-954182-82-4
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Jules Verne – Leben und Werk
Frontispiz
Erstes Kapitel – Phileas Fogg und Passepartout nehmen sich einander als Herr und Diener an.
Zweites Kapitel – Passepartout hat sein Ideal gefunden.
Drittes Kapitel – Eine Unterredung, die Phileas Fogg teuer zu stehen kommen kann.
Viertes Kapitel – Phileas Fogg setzt seinen Diener Passepartout in Bestürzung.
Fünftes Kapitel – Ein neues Wertpapier erscheint auf dem Platz London.
Sechstes Kapitel – Der Agent Fix zeigt eine Ungeduld, die nicht unbegründet war.
Siebentes Kapitel – Ein neuer Beweis, wie unnütz Pässe in Polizeisachen sind.
Achtes Kapitel – Passepartout spricht ein wenig mehr, als vielleicht sich gehörte.
Neuntes Kapitel – Das Rote und das Indische Meer zeigen sich Phileas Foggs Absichten günstig.
Zehntes Kapitel – Passepartout kann sich glücklich schätzen, dass er mit dem Verlust seiner Fußbekleidung durchkommt.
Elftes Kapitel – Phileas Fogg kauft um fabelhaften Preis ein Reittier.
Zwölftes Kapitel – Phileas Fogg und seine Gefährten machen einen abenteuerlichen Ritt durch indische Waldung.
Dreizehntes Kapitel – Ein abermaliger Beweis, dass das Glück dem Kühnen hold ist.
Vierzehntes Kapitel – Phileas Fogg fährt das wundervolle Gangestal hinab, ohne dass er sich kümmert, es zu sehen.
Fünfzehntes Kapitel – Der Banknotensack wird abermals um einige tausend Pfund leichter.
Sechzehntes Kapitel – Fix stellt sich, als wisse er nichts davon, was ihm erzählt ward.
Siebzehntes Kapitel – Von Singapur nach Hongkong.
Achtzehntes Kapitel – Phileas Fogg, Passepartout und Fix bekommen alle zu tun.
Neunzehntes Kapitel – Passepartout nimmt zu lebhaften Anteil an seinem Herrn
Zwanzigstes Kapitel – Fix tritt zu Phileas Fogg in unmittelbare Beziehung.
Einundzwanzigstes Kapitel – Der Patron der Tankadère in Gefahr, eine Prämie von zweihundert Pfund zu verlieren.
Zweiundzwanzigstes Kapitel – Passepartout überzeugt sich, dass es selbst bei den Antipoden geraten ist, etwas Geld in der Tasche zu haben.
Dreiundzwanzigstes Kapitel – Passepartout bekommt eine über die Maßen lange Nase.
Vierundzwanzigstes Kapitel – Fahrt über den Stillen Ozean.
Fünfundzwanzigstes Kapitel – Überblick von San Francisco. Ein Meeting.
Sechsundzwanzigstes Kapitel – Expresszug auf der Pazifikbahn
Siebenundzwanzigstes Kapitel – Ein Stück Mormonengeschichte
Achtundzwanzigstes Kapitel – Passepartout vermochte nicht, der Stimme der Vernunft Gehör zu verschaffen
Neunundzwanzigstes Kapitel – Einiges, was nur auf amerikanischen Eisenbahnen vorkommt.Einiges, was nur auf amerikanischen Eisenbahnen vorkommt.
Dreißigstes Kapitel – Phileas Fogg tut nur seine Schuldigkeit.
Einunddreißigstes Kapitel – Der Polizei-Agent Fix nimmt sich sehr ernstlich der Interessen Foggs an.
Zweiunddreißigstes Kapitel – Phileas Fogg in unmittelbarem Kampf mit dem Missgeschick.
Dreiunddreißigstes Kapitel – Phileas Fogg auf der Höhe der Lage.
Vierunddreißigstes Kapitel – Fix wird gebührend bezahlt.
Fünfunddreißigstes Kapitel – Passepartout lässt sich einen Auftrag nicht zweimal sagen.
Sechsunddreißigstes Kapitel – Phileas Fogg steigt abermals auf dem Geldmarkt.
Siebenunddreißigstes Kapitel – Beweis, dass Phileas Fogg durch seine Reise um die Erde nichts gewann, außer sein häusliches Glück.
Ein Nachwort
Danke
Danke, dass Sie dieses E-Book aus meinem Verlag erworben haben.
Jules Verne gehört zu den Autoren, die jeder schon einmal gelesen hat. Eine Behauptung, die man nicht über viele Schriftsteller aufstellen kann. Die Geschichten von Verne sind unterhaltend, lehrreich und immer sehr atmosphärisch.
In unregelmäßiger Folge wird mein Verlag die Werke von Verne veröffentlichen – die bekannten wie die unbekannten. Immer in der überarbeiteten Erstübersetzung, um den (sprachlichen) Charme der Zeit beizubehalten.
Korrigiert und kommentiert werden Orts- und Personennamen oder offensichtlich falsche Angaben. Sie finden die Erläuterungen in Fußnoten.
Ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, die ursprünglichen Namen zu verwenden: Aus dem Johann wird so wieder der ursprüngliche Jean, aus Ludwig wieder Louis und aus Marianne wieder Marie. Ich denke, das tut den Geschichten nur gut.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze null-papier.de/kontakt
Jules Verne bei Null Papier
Reise um die Erde in 80 Tagen
Michael Strogoff - Der Kurier des Zaren
Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer
Eine Idee des Doktor Ox
Eine Überwinterung im Eis
Schwarz-Indien – Oder: Die Stadt unter der Erde
Fünf Wochen im Ballon
Robur der Eroberer
Der Herr der Welt
Von der Erde zum Mond
und weitere …
Jules Verne – Leben und Werk
Beinahe wäre Klein-Jules als Schiffsjunge nach Indien gefahren, hätte eine Laufbahn als Seemann eingeschlagen und später unterhaltsames Seemannsgarn gesponnen, das vermutlich nie die Druckerpresse erreicht hätte.
Jules Verne
Verliebt in die abenteuerliche Literatur
Glücklicherweise für uns Leser hindert man ihn daran: Der Elfjährige wird von Bord geholt und verlebt weiterhin eine behütete Kindheit vor bürgerlichem Hintergrund. Geboren am 8. Februar 1828 in Nantes, wächst Jules-Gabriel Verne in gut situierten Verhältnissen auf. Als ältester von fünf Sprösslingen soll er die väterliche Anwaltspraxis übernehmen, weshalb er ab 1846 in Paris Jura studiert.
Viel spannender findet er schon zu dieser Zeit allerdings die Literatur. Verne freundet sich sowohl mit Alexandre Dumas als auch mit seinem gleichnamigen Sohn an. Gemeinsam mit Vater Dumas verfasst er Opernlibretti und erste dramatische Werke. Nach dem Abschluss seines Studiums beschließt er, nicht nach Nantes zurückzukehren, sondern sich völlig der Dramatik zu widmen.
Zwar schreibt er nicht ganz erfolglos – drei seiner Erzählungen erscheinen in einer literarischen Zeitschrift. Doch zum Leben reicht es nicht, weshalb der junge Autor 1852 den Posten eines Intendanz-Sekretärs am Théâtre lyrique annimmt. Immerhin wird diese Arbeit zuverlässig vergütet und Verne darf sich als Dramatiker betätigen. In seiner Freizeit verfasst er weiterhin Erzählungen, wobei ihn abenteuerliche Reisen am meisten interessieren.
Als er 1857 eine Witwe heiratet, die zwei Töchter in die Ehe mitbringt, muss sich der Literat nach einer besser bezahlten Einkommensquelle umsehen. Während der nächsten zwei Jahre schlägt er sich als Börsenmakler durch, wobei er genug Zeit findet, längere Schiffsreisen zu unternehmen, bevor 1861 sein Sohn Michel geboren wird.
Verliebt ins literarische Abenteuer
Letztlich ist es einer besonderen Begegnung im Jahr 1862 geschuldet, dass alles, was der Autor bisher »geistig angesammelt« hat, in seinen künftigen Romanen kulminieren darf: Der Jugendbuch-Verleger Pierre-Jules Hetzel veröffentlicht Vernes utopischen Reiseroman »Fünf Wochen im Ballon«. Dieses von ihm ohnehin bevorzugte Sujet wird den Schriftsteller nie wieder loslassen – die abenteuerlichen Reisen, auf welcher Route auch immer sie absolviert werden. Hetzel verlegt Vernes noch heute beliebteste Schriften: 1864 »Reise zum Mittelpunkt der Erde«, im folgenden Jahr »Von der Erde zum Mond«, 1869 »Reise um den Mond« und »Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer«. Mit »Reise um die Erde in 80 Tagen« erscheint 1872 Jules Vernes erfolgreichster Roman überhaupt.
Die Zusammenarbeit mit Hetzel, der gleichzeitig als sein Mentor fungiert, sorgt in den späten 1860er Jahren dafür, dass der höchst produktive Schriftsteller seiner Familie einigen Wohlstand bieten und sich selbst »jugendtraumhafte« Reisewünsche erfüllen kann. Sein Verleger stellt ihn namhaften Wissenschaftlern vor – in Kombination mit den erwähnten Reisen entsteht auf diese Weise ein ungeheurer Fundus der Inspiration: Jules Vernes Zettelkasten enthält angeblich 25.000 Notizen!
Zwar ist er seit »Reise um den Mond« gleichermaßen wohlhabend und geachtet; er engagiert sich seit den späten 1880er Jahren sogar als Stadtrat in Amiens, wohin er 1871 mit seiner Familie übergesiedelt war. Der »Ritterschlag« aber bleibt aus: In der Académie française möchte man den Jugendbuchautor nicht haben, er gilt als nicht seriös genug.
Den Zenit seines Schaffens hat der Literat bereits überschritten, als er 1888 bleibende Verletzungen durch den Schusswaffen-Angriff eines geistesgestörten Verwandten davonträgt. Dennoch arbeitet der Autor ununterbrochen weiter. Als Jules Verne im März 1905 stirbt, hinterlässt er ein gewaltiges Gesamtwerk: 54 zu Lebzeiten erschienene Romane, weitere elf Manuskripte bearbeitet sein Sohn Michel nach dem Tod des Vaters. Ergänzt wird Vernes Œuvre durch Erzählungen, Bühnenstücke und geografische Veröffentlichungen.
Geliebt und missachtet
Jenes zwiespältige Verhältnis, das sich bereits in der Ablehnung der Akademiemitglieder äußert, kennzeichnet die akademische Rezeption bis heute: Jules Verne ist eben »nur ein Jugendbuchautor«. Weniger befangene Rezipienten freilich schreiben ihm eine ganz andere Bedeutung zu, die dem Visionär und leidenschaftlichen Erzähler besser gerecht wird.
Wenngleich der alternde Literat zum Ende seines Schaffens durchaus nicht mehr in gläubiger Technikbegeisterung aufgeht, bleiben uns doch genau jene Werke in liebevoller Erinnerung, in denen technische und menschliche Großtaten die Handlung bestimmen: »Reise um die Erde in 80 Tagen« oder »Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer« beispielsweise. Wer als Kind von Nemo und seiner Nautilus liest, wird unweigerlich gefangen von diesem technischen Wunderwerk und dessen Kapitän. Vernes Romane gehören zu jenen Jugendbüchern, die man als Erwachsener gerne nochmals zur Hand nimmt – und man staunt erneut, erinnert sich, lässt sich wiederum einfangen und fragt sich, warum man eigentlich so selten Verne liest…
So wie der Autor sich selbst durch Reisen und Wissenschaft inspirieren lässt, dienen seine Werke seit jeher der Inspiration seiner Leserschaft. Wie präsent dieser exzellente Unterhalter in den Köpfen seiner Leser bleibt, belegen Benennungen in See- und Raumfahrt: Das erste Atom-U-Boot der Geschichte ist die amerikanische USS Nautilus. Ein Raumtransporter der Europäischen Raumfahrtagentur heißt »Jules Verne«, ein Asteroid und ein Mondkrater tragen ebenfalls den Namen des Schriftstellers. Die »Jules Verne Trophy« wird seit 1990 für die schnellste Weltumsegelung verliehen, was dem begeisterten Jachtbesitzer Verne gewiss gefallen hätte.
Der kommerzielle Literaturbetrieb sowie die Filmwirtschaft betrachten den französischen Vater der Science-Fiction-Literatur ebenfalls mit Wohlwollen: Unzählige Neuauflagen der Romanklassiker, Hörbücher und Verfilmungen der rasanten, stets mitreißenden Handlungen sprechen Bände. Mittlerweile gelten die ältesten Verfilmungen selbst als kulturelle Meilensteine, die keineswegs nur ein junges Publikum erfreuen.
Jules Vernes Bedeutung für die Literatur
Der Einfluss Vernes auf nachfolgende Science-Fiction-Autoren ist gar nicht hoch genug einzuschätzen: Aus heutiger Sicht ist er einer der Vorreiter der utopischen Literatur Europas, der noch vor H. G. Wells (»Krieg der Welten«) und Kurd Laßwitz (»Auf zwei Planeten«) das neue Genre begründet. Seinerzeit gibt es diesen Begriff noch nicht, weshalb Hetzel die Romane seines Erfolgsschriftstellers als »Außergewöhnliche Reisen« vermarktet
Der Franzose sieht, anders als Wells und ähnlich wie Laßwitz, im technischen Fortschritt das künftige Wohl der Menschheit begründet. Trotzdem ist Jules Verne vor allem Erzähler: Er will weder warnen wie Wells noch belehren wie Laßwitz, sondern in erster Linie unterhalten. Im Vergleich zum spröden Realismus eines Wells wirken seine Romane für moderne Leser ausufernd, vielleicht sogar geschwätzig. Dennoch sind sie leichter zugänglich als das stilistisch ähnliche Schaffen des Deutschen Laßwitz, weil sie Utopie und Technikbegeisterung nicht zum Zweck ihres Inhalts machen, sondern lediglich zu dessen Träger: Schließlich ist es einfach aufregend, in einem Ballon eine Weltreise anzutreten oder Kapitän Nemo in sein geheimes Reich zu folgen.
Erstes Kapitel
Phileas Fogg und Passepartout nehmen sich einander als Herr und Diener an.
Im Jahr 1872 wohnte in dem Haus Nummer 7, Savile Row, Burlington Gardens – in dem Sheridan im Jahr 1814,1 starb – Phileas Fogg, Esq.2 –, eines der ausgezeichnetsten und hervorragendsten Mitglieder des Reformclubs3 zu London, der jedoch dem Anschein nach beflissen war, nichts zu tun, das Aufsehen erregen konnte.
Dieser Phileas Fogg, Nachfolger eines der größten Redner, die Englands Zierde sind, war ein rätselhafter Mann, von dem man nichts weiter wusste, als dass er ein recht braver Mann und einer der schönsten Gentlemen der vornehmen Gesellschaft sei.
Man sagte, er gliche Byron – sein Kopf, denn seine Füße waren tadellos – aber ein Byron mit Schnurr- und Backenbart, ein Byron mit leidenschaftslosen Zügen, der tausend Jahre alt werden konnte, ohne zu altern.
Ein echter Engländer unstreitig – war Phileas Fogg vielleicht kein Londoner. Man sah ihn nie auf der Börse, noch auf der Bank, noch auf irgendeinem Handelskontor der City. Nie sah man in den Bassins und Docks zu London ein Schiff, dessen Eigner Phileas Fogg gewesen wäre. In keinem Komitee der Verwaltung hatte dieser Gentleman einen Platz; nie hörte man seinen Namen in einem Anwaltskollegium, oder in Middle Temple, in Lincoln’s Inn oder Gray’s Inn.4 Er plädierte niemals – weder beim Obergerichtshof noch bei der King’s Bench,5 beim Schatzkammergericht oder einem geistlichen Hof. Er war weder ein Industrieller, noch ein Großhändler, noch Kaufmann oder Landbauer. Er gehörte weder dem Königlichen Institut, noch dem Institut von London, noch sonst irgendeiner Anstalt der Kunst, Wissenschaft oder Gewerbe an; noch endlich einer der zahlreichen Gesellschaften, von denen die Hauptstadt Englands wimmelt – von der Harmonie bis zur entomologischen Gesellschaft, welche hauptsächlich den Zweck verfolgt, die schädlichen Insekten zu vertilgen.
Phileas Fogg war Mitglied des Reformclubs, nichts weiter.
Wundert man sich, dass ein so mysteriöser Gentleman unter den Gliedern dieser ehrenwerten Gesellschaft zählte, so dient zur Antwort, dass er auf Empfehlung des Hauses „Gebrüder Baring“,6 – bei dem er sein Geld angelegt hatte – aufgenommen wurde. Daher ein gewisses Ansehen, das er dem Umstand verdankte, dass von dem Soll seines Kontokorrents seine Wechsel bei Sicht pünktlich gezahlt wurden.
War dieser Phileas Fogg reich? Unstreitig. Aber wie er sich dieses Vermögen gemacht hatte, konnten die Besser Informierten nicht sagen, und Herr Fogg war der Letzte, an den man sich wenden durfte, um es zu erfahren. Jedenfalls war er nicht verschwenderisch, aber auch nicht geizig; denn überall, wo es für eine edle, nützliche oder großmütige Sache an einem Betrag mangelte, schoss er ihn im Stillen bei – und das selbst anonym.
Im Allgemeinen war dieser Gentleman sehr wenig mitteilsam. Er sprach so wenig wie möglich und schien umso geheimnisvoller, je schweigsamer er war. Doch lag seine Lebensweise jedem vor Augen, während das, was er tat, so mathematisch stets eines und dasselbe war, dass die unbefriedigte Einbildungskraft weit hinaus forschte.
Hatte er Reisen gemacht? Vermutlich, denn kein Mensch war besser als er in aller Welt auf der Karte bekannt. Auch vom entlegensten Ort schien er genaue Kenntnis zu haben. Manchmal wusste er – in wenigen, kurzen und klaren Worten konnte er die tausend Äußerungen, die im Club über verlorene oder verirrte Reisende zirkulierten, berichtigen –, und seine Worte schienen oft, als würden sie von einem zweiten Gesicht eingegeben, denn jedes Ereignis rechtfertigte sie schließlich. Es war ein Mann, der überallhin – im Geiste wenigstens – gereist sein musste.
Zuverlässig jedoch war Phileas Fogg seit vielen Jahren nicht aus London hinausgekommen. Wer ihn etwas näher kennengelernt hatte, bezeugte, dass man ihn nie woanders gesehen hatte als auf dem geraden Weg von seinem Haus zum Club, den er tagtäglich machte. Sein einziger Zeitvertreib bestand im Lesen der Journale und im Whistspiel. Bei diesem schweigsamen Spiel, das seiner Natur so sehr entsprach, gewann er oft; seine Gewinne flossen jedoch nie in seine eigene Börse, sondern bildeten einen erheblichen Posten auf seinem Barmherzigkeits-Konto. Übrigens ist wohl zu merken, dass Herr Fogg offenbar um des Spiels willen spielte und nicht, um zu gewinnen. Das Spiel war ihm ein Ringen mit einer Schwierigkeit, das jedoch keine Bewegung, keine Platzveränderung, keine Ermüdung kostete – und das passte zu seinem Charakter.
Man wusste bei Phileas Fogg nichts von Weib oder Kind – was den ehrenhaftesten Menschen passieren kann – noch von Verwandten oder Freunden, was allerdings seltener der Fall war. Phileas Fogg war der einzige Bewohner seines Hauses in Savile Row, und kein anderer Mensch trat in dieses Haus, abgesehen von einem einzigen Diener, der ihm genügte. Was im Innern des Hauses vorging, war niemals die Rede. Er frühstückte und speiste zu Mittag im Club – zu chronometrisch bestimmten Stunden, in demselben Saal, an demselben Tisch – trat niemals einen Kollegen an, lud nie jemanden auswärts ein und kehrte nur zum Schlafen – Punkt 12 Uhr nachts – nach Hause zurück, ohne jemals von den wohnlichen Gemächern Gebrauch zu machen, die der Reformclub7 seinen Mitgliedern zur Verfügung hielt. Von den 24 Stunden des Tages verbrachte er 10 in seiner Wohnung – teils zum Schlafen, teils zur Beschäftigung mit seiner Toilette. Spazieren ging er unabänderlich, mit gleichmäßig gemessenem Schritt – im parkettierten Eingangssaal oder auf dem Rundgang, über den ein blaues Glasgewölbe auf zwanzig ionischen Säulen aus rotem Porphyr ruhte. Bei der Mahlzeit oder beim Frühstück lieferten die Küche und Speisekammer, die Konditorei, der Fischbehälter und die Milchstube ihre besten Gerichte; die Clubdiener – gesetzte Leute in schwarzer Kleidung und mit Moltonschuhen,8 – bedienten ihn auf besonderem Porzellan und Tafelweißzeug von kostbarer sächsischer Leinwand; seinen Sherry oder Porto, seinen mit feinstem Zimt und Orangenblüten gemischten Claret,9 trank er aus dem seltensten Kristall des Clubs; und das Eis, das der Club mit schweren Kosten aus den Seen Amerikas bezog, erhielt seinen Trunk in erquicklicher Frische.
Wenn man ein Leben in solchen Verhältnissen exzentrisch nennt, so muss man zugeben, dass Exzentrizität etwas Gutes enthält!
Phileas Fogg
Das nicht gerade prachtvolle Haus in Savile Row empfahl sich durch größte Bequemlichkeit. Übrigens beschränkte sich seine Bedienung, bedingt durch die unabänderlichen Gewohnheiten des Mieters, auf geringe Anforderungen. Doch verlangte Phileas Fogg von seinem einzigen Diener eine außerordentliche Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit. An diesem Tag, dem 2. Oktober, hatte Phileas Fogg seinen Burschen James Forster entlassen, weil dieser ihm zum Rasieren Wasser gebracht hatte, das vierundachtzig statt sechsundachtzig Grad Fahrenheit heiß war, und er erwartete den Nachfolger, der sich zwischen 11 und 11:30 Uhr vorstellen sollte.
Jean Passepartout
Phileas Fogg saß breit in seinem Fauteuil,10 beide Füße beieinander, wie ein Soldat auf der Parade, die Hände auf die Knie gestützt, den Leib gerade, den Kopf aufrecht, und sah auf die Pendeluhr, die Stunden, Minuten, Sekunden, Tag und Datum anzeigte. Nach seiner Gewohnheit sollte Herr Fogg um halb zwölf sein Haus verlassen und sich in Richtung Reformclub begeben.
In diesem Augenblick klopfte es an der Tür des kleinen Salons, in dem sich Phileas Fogg aufhielt.
Der entlassene Diener trat ein.
»Der neue Diener«, sagte er.
Ein Bursche von etwa 30 Jahren trat ein und grüßte.
»Sie sind Franzose und heißen John?« fragte Phileas Fogg.
»Jean, belieben Sie, mein Herr«, erwiderte der neue Diener, »Jean Passepartout – ein Beiname, der mein natürliches Geschick, mich aus Verlegenheiten zu ziehen, bezeichnet. Ich glaube, ein braver Bursche zu sein, mein Herr, doch, offen gesagt, habe ich schon mehrere Geschäfte getrieben. Ich war Bänkelsänger, Bereiter in einem Zirkus, voltigierte wie Leotard und tanzte auf dem Seil gleich Blondin;11 darauf wurde ich Lehrer der Gymnastik, um meine Talente nützlicher zu machen, und zuletzt Sergeant bei den Pompiers12 in Paris. Ich habe merkwürdige Brände auf meiner Liste. Nun aber habe ich vor fünf Jahren Frankreich verlassen und bin, um das Familienleben zu genießen, Kammerdiener in England. Da ich jetzt ohne Stelle bin und vernommen habe, dass Herr Phileas Fogg der pünktlichste und zurückgezogenste Mann im Vereinigten Königreich sei, habe ich mich bei ihm vorgestellt – in der Hoffnung, bei demselben ruhig zu leben und gar den Namen Passepartout zu vergessen…«
»Passepartout ist ganz passend für mich«, erwiderte der Gentleman. »Sie wurden mir empfohlen. Man hat mir gute Auskunft über Sie gegeben. Kennen Sie meine Bedingungen?«
»Ja, mein Herr.«
»Gut. Wie viel Uhr haben Sie?«
»11:22«, erwiderte Passepartout, während er eine große silberne Uhr aus seiner Hosentasche hervorzog.
»Sie liegen mit der Zeit zurück«, sagte Herr Fogg.
»Verzeihen Sie, mein Herr, aber das ist nicht möglich.«
»Um vier Minuten sind Sie zurück – gleichviel. Merken wir uns nur die Abweichung. Also: Von diesem Augenblick an, um 11:29 vormittags an einem Mittwoch, dem 2. Oktober 1872, sind Sie in meinem Dienst.«
Hierauf stand Phileas Fogg auf, nahm seinen Hut in die Linke, setzte ihn mit einer automatischen Bewegung auf und verschwand wortlos.
Passepartout hörte, wie sich die Haustür schloss – zuerst der neue Herr, dann, beim zweiten Mal, auch sein Vorgänger James Forster.
Allein befand sich Passepartout im Haus in Savile Row.
Zweites Kapitel
Passepartout hat sein Ideal gefunden.
»Meine Treue«, sagte sich Passepartout, der anfangs etwas verdutzt war, »ich finde, dass die Hampelmännchen bei Madame Tussaud ebenso lebendig sind wie mein neuer Herr!«
Die Hampelmännchen bei Madame Tussaud sind nämlich Wachsfiguren, die in London sehr gern betrachtet wurden – und bei denen man in der Tat nur bedauerte, dass sie nicht reden konnten.
Während der wenigen Augenblicke, in denen er mit Phileas Fogg beisammen war, hatte Passepartout seinen künftigen Herrn rasch, aber doch genau gemustert. Der Mann von edler und schöner Gestalt, hohem Wuchs – dem einige Wohlbeleibtheit nicht übel stand – mochte etwa vierzig Jahre alt sein, hatte blondes Haar und Bart, eine glatte Stirn, ohne auch nur einen Hauch von Runzeln an den Schläfen, ein eher bleiches als gerötetes Angesicht und prachtvolle Zähne. Er schien in hohem Maße zu besitzen, was die Physiognomisten1 »Ruhe in der Tätigkeit« nennen – eine Eigenschaft, die all denen gemein ist, die mit wenig Geräusch ihre Arbeit verrichten. Mit Seelenruhe und Phlegma begabt, mit reinem Auge und unbewegten Wimpern, war er der vollendete Typus jener kaltblütigen Engländer, wie man sie im Vereinigten Königreich recht häufig antrifft und deren etwas akademische Haltung Angelika Kauffmanns2 Pinsel zum Staunen darstellte. Sah man diesen Gentleman in seinen verschiedenen Tätigkeiten, vermittelte er den Eindruck eines Geschöpfes, dessen sämtliche Teile wohl im Gleichgewicht standen und richtig abgewogen waren – so vollkommen wie ein Chronometer von Leroy3 oder Earnshaw.4
Und in der Tat war Phileas Fogg die personifizierte Genauigkeit – wie man deutlich an »dem Ausdruck seiner Füße und Hände« sah, denn beim Menschen, wie bei den Tieren, sind die Glieder selbst ausdrucksvolle Organe der Leidenschaften.
Phileas Fogg gehörte zu den mathematisch exakten Menschen, die niemals eilig und stets bedächtig, mit sparsam gesetzten Schritten und Bewegungen dahertraten. Er hob sein Bein nicht, wenn es nicht nötig war, und ging stets den kürzesten Weg. Kein Blick in die Decke war bei ihm vergeblich, keine Handbewegung überflüssig. Man sah ihn nie in Gemütsbewegung oder Unruhe. Kein Mensch auf der Welt war weniger hastig, und doch kam er stets zur rechten Zeit.
Man wird jedoch begreifen, dass dieser Mann einsam lebte – sozusagen außerhalb aller gesellschaftlichen Beziehungen. Er wusste, dass es im Leben unvermeidlich Reibungen gibt, und da diese hemmen, rieb er sich an niemandem.
Was Jean, genannt Passepartout, betrifft, so war er ein echter Pariser und hatte, seit er fünf Jahre in England wohnte und in London Kammerdiener gewesen war, vergeblich einen Herrn gesucht, an den er sich fest anschließen konnte.
Passepartout gehörte nicht zu denen, die sich in die Brust werfen – mit kecker Nase, zuversichtlichem Blick und trockenem Auge – und dabei wie unverschämte Tölpel daherkommen. Nein, Passepartout war ein braver Bursche mit freundlich wirkendem Gesicht, etwas hervorstehenden Lippen und einem sanften, geschmeidigen Charakter; mit einem gutmütigen, runden Kopf, wie man ihn gerne auf den Schultern eines Freundes sieht. Er hatte blaue Augen, einen belebten Teint und ein Gesicht, das voll genug war, um selbst die Wölbung seiner Wangen wahrzunehmen; er hatte eine breite Brust, eine starke Taille und einen Muskelbau von herkulischer Kraft, der durch die Übungen seiner Jugendzeit erstaunlich entwickelt worden war. Seine braunen Haare spielten etwas ins Rötliche. Während die Bildhauer des Altertums achtzehn verschiedene Arten kannten, das Haupthaar der Minerva zu frisieren, wusste Passepartout, dass es für sein Haar nur eine Methode gab: drei Striche mit dem Scheitelkamm – und der Hauptschmuck war vollendet.
Ob der mitteilsame Charakter dieses Burschen zu dem des Phileas Fogg passen würde, war nach einfachster Voraussicht nicht zu sagen. Sollte Passepartout — der so gründlich exakte Diener sein, den sein Herr bedurfte? — ließ sich dies nur aus der Erfahrung ablesen. Nachdem er, wie wir wissen, eine ziemlich vagabundierende Jugend gehabt hatte, trachtete er nach einem ruhigen Leben. Da man ihm die regelmäßige Pünktlichkeit und sprichwörtliche Kälte der Gentlemen gepriesen hatte, versuchte er in England sein Glück. Aber bisher hatte ihm das Schicksal nicht gewogen – er hatte nirgends Wurzeln fassen können und schon zehnmal den Herrn gewechselt. Überall war es fantastisch, ungleich, abenteuerlich, von Land zu Land schweifend – was für Passepartout nicht mehr in Frage kam. Sein letzter Herr, der junge Lord Longsferry, Parlamentsmitglied, kam oft – wenn er seine Nacht in den »Austernstuben« im Haymarket verbracht hatte –, auf den Schultern der Polizeileute nach Hause getragen. Passepartout, der vor allem die Ehre seines Herrn wahren wollte, machte einige respektvolle Bemerkungen, die jedoch übel aufgenommen wurden, und so verließ er den Dienst. Daraufhin hörte er, dass Phileas Fogg, Esq., einen Diener suche, und erfuhr von ihm, dass ein Mann mit so geregeltem Leben – der nicht auswärts schlief, keine Reisen machte, niemals auch nur einen Tag abwesend war – ihm nur angenehm erscheinen konnte. Er stellte sich vor und wurde, wie wir wissen, angenommen.
Passepartout befand sich also, nachdem halb zwölf vergangen war, allein im Haus in Savile Row. Sogleich machte er sich daran, dieses Haus vom Keller bis zum Speicher zu besichtigen. Das reinliche, geordnete, strenge, puritanische – wohl für den Dienst eingerichtete – Haus gefiel ihm. Es machte auf ihn den Eindruck eines schönen Schneckenhauses, das jedoch mit Gas erleuchtet und geheizt war, denn der kohlenstoffhaltige Wasserstoff war hinreichend vorhanden für alle Bedürfnisse der Beleuchtung und Erwärmung. Passepartout fand im zweiten Stock leicht das für ihn bestimmte Zimmer, und es gefiel ihm. Durch elektrische Glocken und Hörrohre stand das Zimmer in Verbindung mit den Gemächern des Zwischenstocks und der ersten Etage! Auf dem Kamin prangte eine elektrische Uhr, die mit der Uhr im Schlafzimmer von Phileas Fogg übereinstimmte – und beide schlugen im selben Augenblick dieselbe Sekunde.
»Das steht mir an, das gefällt mir!« sagte Passepartout.
Er bemerkte in seinem Zimmer über der Standuhr ein angeheftetes Merkblatt mit der Vorschrift des täglichen Dienstes. Dieses enthielt – von 8:00 vormittags, der Stunde, in der Phileas Fogg aufstand, bis zu halb zwölf, wenn er zum Frühstück in den Reformclub zog – alle Einzelheiten des Dienstes: Tee und geröstete Brotschnitten um 8:23; Wasser zum Rasieren um 9:07; Frisieren um 9:40 usw. Nachmittags – von halb zwölf vormittags bis 12:00 nachts, wenn der methodische Gentleman zu Bett ging – war alles aufgezeichnet, vorgesehen, geregelt. Passepartout bereitete sich mit Freude darauf vor, dieses Programm zu studieren und sich die verschiedenen Punkte einzuprägen.
Die Garderobe des Herrn war sehr gut ausgestattet und merkwürdig gehaltvoll. Jede Hose, jeder Rock oder jede Weste war mit einer Ordnungsnummer versehen, die in einem Register eingetragen wurde – worauf das Datum vermerkt war, wann, der Jahreszeit nach, diese Stücke getragen werden sollten. Eine gleichmäßige Anordnung galt auch für die Fußbekleidung.
Im Allgemeinen war dieses Haus in Savile Row – das zur Zeit des berühmten, aber zerstreuten Sheridan ein Tempel der Unordnung gewesen sein musste – bequem möbliert und einer hübschen Gemächlichkeit entsprechend eingerichtet.
Keine eigene Bibliothek, keine Bücher, die für Herrn Fogg überflüssig gewesen wären, da der Reformclub ihm zwei Bibliotheken zur Verfügung stellte – eine für Literatur, die andere für Recht und Politik. Im Schlafzimmer befand sich ein Kassenschrank mittlerer Größe, der gegen Feuersgefahr und Diebstahl gesichert war. Keine Waffen im Haus, nichts von Jagd- oder Kriegsgeräten. Alles zeugte von den friedlichsten Gewohnheiten.
Nachdem Passepartout diese Wohnung im Detail gemustert hatte, rieb er sich die Hände, sein breites Gesicht ward heiter, und er sagte wiederholt freudig:
»Das steht mir an! Hier ist mein Platz! Herr Fogg und ich – wir verstehen uns vollkommen. Das ist ein geregelter Mann, ein Zimmerhüter! Eine wahre Maschine! Nun, ich bin ganz zufrieden, eine Maschine zu bedienen!«
Als Physiognomik bezeichnet man die »Kunst«, aus dem unveränderlichen physiologischen Äußeren des Körpers, besonders des Gesichts, auf die seelischen Eigenschaften eines Menschen – also insbesondere dessen Charakterzüge und/oder Temperament – zu schließen. Nachdem sie seit der Antike als Geheimwissen zirkulierte und im Zeitalter der Aufklärung zu einer populärwissenschaftlichen Blüte kam, wurde sie im 19. und 20. Jahrhundert als wissenschaftlicher Unterbau für Rassismus und Eugenik herangezogen. <<<
Angelika Kauffmann (✳ 30. Oktober 1741 in Chur, Freistaat Drei Bünde; † 5. November 1807 in Rom) war eine schweizerisch-österreichische Malerin des Klassizismus <<<
Le Roy, Bazile, geboren 1731, gestorben 1804, Gründer der Uhrmacherdynastie LeRoy und Vater von Bazile-Charles Leroy <<<
Thomas Earnshaw (✳ 4. Februar 1749 in Ashton-under-Lyne; † 1. März 1829 in London) war ein englischer Uhrmacher, der als erster den Bau von Marinechronometern vereinfachte, damit sich eine breitere Öffentlichkeit solche Instrumente leisten konnte <<<
Drittes Kapitel
Eine Unterredung, die Phileas Fogg teuer zu stehen kommen kann.
Phileas Fogg hatte um halb zwölf sein Haus in Savile Row verlassen und erreichte nach fünfhundertfünfundsiebzigmal, seinen rechten Fuß vor den linken, und fünfhundertsechsundsiebzigmal, seinen linken Fuß vor den rechten gesetzt zu haben, den Reformclub – ein ungeheuerliches Gebäude in Pall Mall,1 – dessen Bau nicht weniger als drei Millionen Pfund gekostet hat.
Phileas Fogg begab sich sogleich in den Speisesaal, dessen neun Fenster den Blick auf einen Garten mit Bäumen boten, die bereits im herbstlichen Goldschmuck prangten. Er setzte sich an die gewohnte Tafel, an der sein Gedeck auf ihn wartete. Sein Frühstück bestand aus einem Nebengericht, gesottenem Fisch in einer vorzüglichen »reading sauce«,2 einem scharlachroten Roastbeef, gewürzt mit »mushroom«,3 einem Kuchen mit Füllsel aus Rhabarberstängeln und grünen Stachelbeeren, einem Stückchen Chester – alles begleitet von einigen Tassen vortrefflichem Tee, der eigens für die Küche des Reformclubs gesammelt wurde.
Um 12:47 stand dieser Gentleman auf und begab sich in den großen Salon, der prachtvoll mit Gemälden in reichen Rahmen verziert war. Dort reichte ihm ein Diener die noch nicht aufgeschnittene »Times« – die Phileas Fogg mit sicherer Hand auseinanderfaltete, was eine große Übung in dieser schwierigen Operation darstellte. Mit der Lektüre dieses Journals war Phileas Fogg bis 3:45 beschäftigt; sodann las er den »Standard« bis zum Diner. Diese Mahlzeit verlief ähnlich wie das Frühstück, nur dass noch die »royal british sauce«4 hinzukam.
Um 5:40 erschien der Gentleman erneut im großen Salon und vertiefte sich in die Lektüre des »Morning Chronicle«.
Eine halbe Stunde später traten verschiedene Mitglieder des Reformclubs ein und näherten sich dem Kamin, an dem ein Kohlenfeuer loderte. Es waren die üblichen Spielkameraden des Herrn Phileas Fogg – ebenso leidenschaftliche Whistspieler wie er selbst: der Ingenieur Andrew Stuart, die Bankiers John Sullivan und Samuel Fallentin, der Brauer Thomas Flanagan, Walther Ralph sowie einer der Administratoren der Bank von England – reiche und angesehene Männer, selbst in diesem Club, der die hervorragendsten Vertreter der Industrie und Finanzwelt in seinen Reihen zählt.
»Nun, Ralph, wie steht es mit dem Diebstahl?« fragte Thomas Flanagan.
»Nun«, erwiderte Andrew Stuart, »die Bank wird um ihr Geld kommen.«
»Ich hoffe im Gegenteil«, sagte Walther Ralph, »dass wir den Dieb in die Finger bekommen werden. Es sind äußerst geschickte Polizeileute nach Amerika und Europa – in alle hauptsächlichen Landungs- und Einschiffungshäfen – abgeschickt worden, denen jener Herr wohl schwerlich entrinnen wird.«
»Hat man überhaupt das Signalement5 des Diebes?« fragte Andrew Stuart.
»Vor allem – es ist kein Dieb«, erwiderte Walther Ralph ernsthaft.
»Wie, dieses Individuum, das fünfundfünfzigtausend Pfund in Banknoten (2.100.000 Mark) entwendet hat, ist nicht als Dieb zu bezeichnen?«
»Nein«, versicherte Walther Ralph.
»Also ein Industrieller?« sagte John Sullivan.
»Das ‹Morning Chronicle› versichert, es sei ein Gentleman.«
Der Mann, der diese Äußerung machte, war niemand anderes als Phileas Fogg, dessen Kopf inmitten der aufgetürmten Papiere plötzlich auftauchte. Zugleich grüßte er seine Kollegen, die seinen Gruß erwiderten.
Der fragliche Vorfall, den die verschiedenen Journale des Vereinigten Königreichs eifrig besprachen, hatte sich drei Tage zuvor, am 29. September, zugetragen. Ein Paket von Banknoten im Wert von 105.000 Pfund war aus dem Fach des Hauptkassierers der Bank von England verschwunden.
Wunderte man sich, dass ein solcher Diebstahl so leicht geschehen konnte, so antwortete der Untergouverneur Walther Ralph lediglich, dass der Kassierer eben damit beschäftigt gewesen sei, einen Einnahmeposten von 3 Schilling und 6 Pence einzutragen, und dass man seine Augen nicht überall zugleich haben könne.
Aber es sei hier bemerkt – was die Tatsache noch erklärlicher macht –, dass dieses staunenswerte Institut der Bank von England äußerst um die Würde des Publikums bemüht ist. Keine Wachen, keine Invaliden, keine Gitter! Das Gold, das Silber, die Noten lagen ganz frei da – sozusagen dem Belieben des erstbesten Kunden preisgegeben. Es käme einem nicht in den Sinn, hinsichtlich der Ehrenhaftigkeit irgendeines Vorübergehenden Verdacht zu hegen. Einer der besten Beobachter englischer Gebräuche berichtet sogar Folgendes: In einem der Säle der Bank, in dem er sich eines Tages befand, war er derart neugierig, einen etwa 7–8 Pfund schweren Goldbarren näher zu betrachten; er nahm denselben, betrachtete ihn, übergab ihn seinem Nachbarn, der ihn wiederum einem anderen übergab – und so wanderte der Barren von Hand zu Hand bis in einen dunklen Gang, wo er erst nach einer halben Stunde an seinen Platz zurückkehrte, ohne dass der Kassierer auch nur den Kopf danach hob.
Ich wette um 4000 Pfund!
Aber am 29. September lief es nicht ganz so. Das Paket von Banknoten kam nicht zurück, und als die prachtvolle Uhr, die über dem Geschäftssaal angebracht war, um 5:00 den Schluß der Büros anläutete, blieb der Bank von England nichts anderes übrig, als 105.000 Pfund auf das Verlustkonto zu buchen.
Als der Diebstahl gehörig festgestellt worden war, wurden ausgesuchte Agenten – Detektive – in die bedeutendsten Häfen zu Liverpool, Glasgow, Le Havre, Suez, Brindisi, New York etc. abgeschickt, und es wurde eine Prämie von 2.000 Pfund nebst 5% der wiedergefundenen Summe für die Aufklärung ausgeschrieben.
Während diese Agenten die Auskünfte abwarteten, die die unverzüglich eingeleitete Untersuchung zu liefern versprach, erhielten sie den Auftrag, alle ankommenden und abreisenden Passagiere sorgfältig zu beobachten.
Nun hatte man Grund, gerade als das »Morning Chronicle« seinen Kommentar abgab, anzunehmen, dass der Täter keiner der organisierten Diebesgesellschaften Englands angehörte. Im Laufe des 29. Septembers war man wiederholt in den Zahlungssälen – wo der Diebstahl geschehen war – auf einen wohlgekleideten Gentleman mit guten Manieren und vornehmer Miene gestoßen. Die Untersuchung ermöglichte es, recht genau ein Signalement dieses Gentlemen aufzustellen, das augenblicklich an alle Detektive im Vereinigten Königreich und auf dem Kontinent abgeschickt wurde. Einige kluge Köpfe – unter ihnen auch Walther Ralph – schöpften daher Hoffnung; der Dieb würde nicht entrinnen.
Man kann sich leicht vorstellen, dass dieser Vorfall in London und ganz England das Tagesgespräch dominierte. Man stritt leidenschaftlich für und wider die Erfolgsaussichten der Polizei in der Hauptstadt. Kein Wunder also, dass die Mitglieder des Reformclubs denselben Gegenstand besprachen – umso mehr, als einer der Untergouverneure der Bank anwesend war.
Der ehrenwerte Walther Ralph wollte am Erfolg der Nachforschungen nicht zweifeln und meinte, die ausgeschriebene Prämie müsse den Eifer und die Spürkraft der Agenten beflügeln. Aber sein Kollege Andrew Stuart teilte diese Zuversicht keineswegs. Der Wortstreit dauerte daher unter den Gentlemen an, die an einem Spieltisch Platz genommen hatten – Stuart gegenüber Flanagan, Fallentin gegen Phileas Fogg. Während des Spiels schwieg man, doch zwischen den Mitspielern wurde die unterbrochene Unterhaltung umso lebhafter fortgeführt.
»Ich behaupte«, sagte Andrew Stuart, »dass der Dieb unfehlbar ein gewandter Mensch ist, der alle Aussicht hat, zu entkommen.«
»Ei doch!« erwiderte Ralph, »es gibt ja nicht ein einziges Land mehr, in dem er Zuflucht fände.«
»Das wäre!«
»Wo meinen Sie denn, dass er hingehen soll?«
»Das weiß ich nicht«, versicherte Andrew Stuart, »aber trotz allem gibt es auf der Erde viel Raum.«
»Das war ehedem der Fall…«, sagte Phileas Fogg halblaut. Daraufhin: »Sie müssen abheben, mein Herr«, und er reichte Thomas Flanagan die Karten.
Der Disput ruhte während des Robbers. Aber bald begann er von Neuem, als Andrew Stuart sagte:
»Wieso? Ehedem! Ist die Erde etwa kleiner geworden?«
»Allerdings«, entgegnete Walther Ralph. »Ich bin der Meinung von Herrn Fogg. Die Erde hat an Umfang verloren, weil man jetzt zehnmal rascher als vor hundert Jahren um sie herum reisen kann. Und deshalb werden auch in unserem gegebenen Fall die Nachforschungen weit schneller angestellt.«
»Und auch die Flucht des Diebes wird dadurch leichter!«
»Sie sind an der Reihe, Herr Stuart!« sagte Phileas Fogg.
Doch der ungläubige Stuart war nicht überzeugt. Als die Partie beendet war, sagte er:
»Man muss gestehen, Herr Ralph, Sie hatten da einen scherzhaften Einfall, als Sie sagten, die Erde sei kleiner geworden! Also, weil man jetzt in drei Monaten um sie herumreist …«
»In achtzig Tagen nur«, warf Phileas Fogg ein.
»Wirklich, meine Herren«, fügte John Sullivan hinzu, »achtzig Tage, seit auf der großen Indischen Eisenbahn die Strecke zwischen Rothal und Allahabad eröffnet worden ist. So berechnet das ›Morning Chronicle‹ die Route:
Von London nach Suez über den Mont Cenis und Brindisi, per Eisenbahn und Paketschiff: 7 Tage
Von Suez nach Bombay, Paketschiff: 13 Tage
Von Bombay nach Kalkutta, Eisenbahn: 3 Tage
Von Kalkutta nach Hongkong, Paketschiff: 13 Tage
Von Hongkong nach Yokohama in Japan, Paketschiff: 6 Tage
Von Yokohama nach San Francisco, Paketschiff: 22 Tage
Von San Francisco nach New York, Eisenbahn: 7 Tage
Von New York nach London, Paketschiff und Eisenbahn: 9 Tage
Summe: 80 Tage.«
»Ja! Achtzig Tage!«, rief Andrew Stuart, der aus Unachtsamkeit eine schlechte Karte abhob, »aber das rechnet weder schlechte Witterung, widrige Winde, Schiffbruch noch Entgleisungen usw. mit ein.«
»Alles inbegriffen«, erwiderte Phileas Fogg und spielte weiter; diesmal nahm das Gespräch keinerlei Rücksicht auf das Spiel.
»Selbst wenn die Hindus oder die Indianer die Schienen aufreißen!«, rief Andrew Stuart, »wenn sie Züge aufhalten, um die Gepäckwagen zu plündern und die Passagiere zu skalpieren!«
»Alles inbegriffen«, entgegnete Phileas Fogg, warf sein Blatt hin und sagte: »Zwei Haupttrümpfe!«
Andrew Stuart, der nun geben musste, nahm die Karten wieder auf und meinte:
»Theoretisch haben Sie recht, Herr Fogg, aber in der Praxis …«
»… gilt das Gleiche, Herr Stuart.«
»Ich wünschte, Sie dabei zu sehen.«
»Das hängt nur von Ihnen ab. Machen wir die Reise gemeinsam.«
»Der Himmel behüte mich!«, rief Stuart. »Aber ich wäre bereit, um viertausend Pfund zu wetten, dass eine solche Reise unter derartigen Bedingungen unmöglich ist.«
»Sehr wohl möglich«, erwiderte Herr Fogg.
»Nun, dann unternehmen Sie die Reise!«
»Die Reise um die Welt in achtzig Tagen?«
»Ja.«
»Ich bin einverstanden.«
»Wann?«
»Augenblicklich. Nur erlauben Sie mir den Hinweis, dass ich sie auf Ihre Kosten antrete.«
»Das ist Narrheit!«, rief Andrew Stuart, dem das Drängen seines Spielgenossen lästig wurde. »Spielen wir lieber weiter.«
»Dann geben Sie bitte noch einmal«, sagte Phileas Fogg, »denn die Karten sind verteilt.«
Andrew Stuart nahm die Karten zitternd in die Hand, legte sie jedoch plötzlich wieder auf den Tisch und sagte:
»Nun gut, Herr Fogg, ja, ich wette um viertausend Pfund! …«
»Lieber Stuart«, mischte sich Fallentin ein, »regen Sie sich nicht auf. Das ist doch nicht ernst gemeint.«
»Wenn ich sage: Ich wette«, entgegnete Andrew Stuart, »dann meine ich es ernst.«
»Ich schlage ein!«, sagte Herr Fogg und wandte sich an seine Kollegen. »Ich habe zwanzigtausend Pfund bei den Gebrüdern Baring hinterlegt. Die setze ich gern ein …«
»Zwanzigtausend Pfund!«, rief John Sullivan. »Zwanzigtausend Pfund, die Sie wegen einer unvorhergesehenen Verspätung verlieren könnten!«
»Es gibt nichts Unvorhergesehenes«, erwiderte Phileas Fogg gelassen.
»Aber, Herr Fogg, diese achtzig Tage sind nur als Mindestmaß gemeint!«
»Wenn man ein Mindestmaß gut nutzt, reicht es immer aus.«
»Aber um es nicht zu überschreiten, muss man von den Eisenbahnen praktisch nahtlos auf die Paketschiffe umsteigen und umgekehrt!«
»Ich werde den Wechsel mathematisch genau vollziehen.«
»Das ist doch bloß Spaß!«
»Ein guter Engländer scherzt nie, wenn es um eine so ernste Sache wie eine Wette geht«, erwiderte Phileas Fogg. »Ich wette mit jedem, der Lust hat, um zwanzigtausend Pfund, dass ich die Reise um den Erdball in höchstens achtzig Tagen mache, das heißt in 1.920 Stunden oder 115.200 Minuten. Sind Sie damit einverstanden?«
Die Herren Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan und Ralph berieten sich kurz und erklärten dann: »Wir nehmen die Wette an.«





























