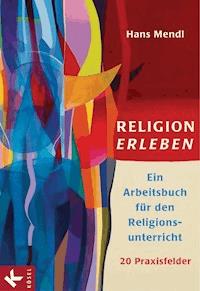
23,99 €
23,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nur wer Religion erlebt, kann auch etwas über Religion lernen
Religionsunterricht sollte mehr sein als nur Reden über Religion. Denn Religion muss man erleben, um sie zu verstehen. Doch Kinder und Jugendliche bringen heute oft kaum noch religiöse Erfahrungen mit. In 20 Kapiteln zeigt der bekannte Religionspädagoge Hans Mendl praxisnah, wo und wie sich gelebte Religion in der Schule entdecken und erfahren lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 754
Veröffentlichungsjahr: 2009
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
TEIL I - Performativer Religionsunterricht: Erfahrungsräume des Religiösen eröffnen
A. Religion erleben - Problemanzeige und aktuelle Herausforderungen
1. Die Diskussion um performative Elemente im Religionsunterricht
2. Auseinanderdriften von subjektiver und objektiver Religion
3. Der Religionsunterricht als Ort der Begegnung mit Religion
B. Aporien: Die Suche nach einem tauglichen Konzept
1. Die Last der Geschichte
2. Die Unterscheidung von Religionsunterricht und Katechese
3. Grenzen eines primären Reflexionsmodells
4. Der Streit um das Verständnis von Korrelation zwischen Glauben und Leben
C. Religion erleben - Begründungsmomente
1. Religion »in Form«: Die Bedeutung der Praxis des Glaubens
Copyright
Vorwort
Theorie ohne Praxis ist leer, freilich ist auch die Praxis ohne Theorie blind. Mein Interesse besteht darin, die Tragfähigkeit performativer Theorien und auch die kritischen Anfragen vor dem Hintergrund der praktischen Religionsdidaktik auf möglichst vielen Feldern zu durchleuchten. Denn bei allen Diskursen auf der Theorieebene möchte ich immer wieder die praktische Gretchenfrage stellen, was das denn nun für ganz konkrete Handlungsvollzüge im Religionsunterricht bedeutet. Deshalb wird das einleitende theoretische Kapitel zur Herkunft und zum Konzept eines performativ ausgerichteten Religionsunterrichts relativ knapp gehalten sein, auch wenn es für die folgenden Konturen und Grenzziehungen selbstverständlich grundlegend und handlungsleitend ist. Der Schwerpunkt liegt im ausführlichen Praxisteil.
Die Ausgangsfrage lautet: Wie kann objektive Religion heute überhaupt noch verständlich werden angesichts eine Schülergeneration, die mehrheitlich dazu keine intensiven Bezüge hat? Diese Frage bestimmt die inhaltliche Reihung der vier großen Blöcke.
▶ Im ersten großen Block »Fremde Heimat erkunden« geht es um Möglichkeiten, der Innenseite gelebter Religion zu begegnen: Räume, Menschen, Erinnerungen, Zeitrhythmen.
▶ Der zweite Block »Gott und das Leben feiern« ist von der Beobachtung geprägt, dass sich Diskussionen um die Grenzwertigkeit performativer Elemente häufig an den Themenfeldern Liturgie und Gebet entzünden. Deshalb werden Gebet und Meditation, liturgische Elemente, heilende und leibliche Vollzüge und die Erfahrbarkeit der Schöpfung in den Blick genommen. Gerade in diesen Feldern wird der spezifische Modus einer religiösen Wirklichkeitserfassung und -deutung verständlich - oder eben nicht!
▶ Der dritte Block »Konsequenzen des Glaubens erleben« thematisiert Inhaltsfragen des Religionsunterrichts (Bibelarbeit, interreligiöses Lernen, Ethik lernen, der Umgang mit Glaubensfragen und biografisches Lernen). Diese sollen ja nicht nur als »Fragen an sich«, sondern in ihrer Bedeutung als »Fragen für mich« didaktisch ins Spiel kommen, wenn es um den Erwerb von religiöser Kompetenz geht; auch hier wird reflektiert, welchen Wert performative Elemente haben, um sowohl der Eigenart des Lerngegenstandes gerecht zu werden als auch die Nachhaltigkeit von Lernprozessen zu unterstützen.
▶ Im vierten Block schließlich lege ich einen methodischen Fokus an, da sich performative Elemente vor allem auf der Ebene der Lernwege manifestieren, ohne dass allerdings die Diskussion um die Bedeutung des Performativen auf Handlungsorientierung beschränkt werden darf. Der performative Umgang mit den ausgewählten exemplarischen Medien (Sprache, Bilder, Kunstwerke, Musik, PC und Internet) soll sich dabei in mehrfacher Hinsicht als produktiv erweisen: im Sinne einer Ausdrucksförderung bei den Kindern und Jugendlichen und als Chance, die Erkenntnislogik des jeweiligen Mediums in seinem religionshermeneutischen Eigenwert besser zu begreifen.
Den 20 praxisorientierten Kapiteln liegt jeweils die gleiche Struktur zugrunde:
▶ Zunächst wird beschrieben, worin die Herausforderung des jeweiligen Themenfeldes besteht und wieso meines Erachtens ein primär kognitiver Zugriff auf den jeweiligen Wirklichkeitsausschnitt nicht genügt, um vernünftig und persönlich Religion zu lernen und dem jeweiligen Teilgegenstand von Religion selbst gerecht zu werden.
▶ Danach werden die besonderen Lernchancen performativer Unterrichtsansätze skizziert.
▶ Anschließend diskutiere ich kritische themenbezogene Anfragen, die von ganz unterschiedlichen Seiten geäußert werden.
▶ Die Leitfrage für den nächsten Abschnitt lautet dann: Welche spezielle Kompetenzen benötigen die Lehrenden, um diese Art von Unterricht durchzuführen?
▶ Und schließlich folgen exemplarische Hinweise auf Praxisprojekte, die meines Erachtens zur beschriebenen performativen Lerndynamik gehören. Dabei unterscheide ich nicht zwischen verschiedenen Schulstufen, da ich auf die Kompetenz der Leserinnen und Leser vertraue, das jeweils für die eigenen Lerngruppen Passende zu entdecken.
Bei einer Reihe von Fortbildungen in den letzten Jahren von Luxemburg bis Linz und von Hildesheim bis Tirol habe ich die Inhalte, die nun in diesem Buch versammelt sind, immer wieder vorstellen können. Etliche Lehrkräfte, vor allem an Grundschulen, fanden, dass sie durch die präsentierte Theorie und die Praxisbeispiele Bestätigung für die alltäglich bereits praktizierte Didaktik erfahren, andere dagegen haben mitunter Unbehagen geäußert, ob mit bestimmten Elementen nicht das Maß des Zulässigen überschritten wird. Im Gegenzug gab es auch kritische Anfragen bezüglich der konkreten Gestalt des Religionsunterrichts ab der Sekundarstufe, besonders an Gymnasien, wo der Präsentationsmodus häufig eben nicht als handlungsund lebensweltorientiert erfahren wird - zwei zentrale Kriterien für die Akzeptanz des Religionsunterrichts bei Kindern und Jugendlichen (vgl. Bucher 2000). Ich danke den Praktikern vor Ort für die vielen inspirierenden Rückmeldungen, die dieses Buch erst ermöglicht haben!
Natürlich soll das vorliegende Buch die Diskussion um einen performativ ausgerichteten Religionsunterricht vorantreiben. In erster Linie ist es aber für Lehrerinnen und Lehrer geschrieben, die an einer Reflexion, Vertiefung und vielleicht Innovation des eigenen unterrichtlichen Handelns und durchaus auch an einer Veränderung (ich meine: Verbesserung) der Schulkultur interessiert sind. Da ich um das enge Zeitbudget von Lehrkräften, Seminarlehrern und Religionspädagogen der verschiedenen Phasen der Lehrerbildung weiß, habe ich mich schon bei der Strukturierung des Buches um Leserfreundlichkeit bemüht. Gerade die 20 praxisorientierten Kapitel im zweiten Teil des Buches haben einen überschaubaren Umfang von je 10 bis 20 Seiten. Sie sind als abgeschlossene Einheit geschrieben; dort, wo es für ein umfassenderes Verständnis nötig ist, wurden behutsam Querverweise eingefügt. Der Preis dieser Darstellung sind gewisse Redundanzen, die mir diejenigen, die das ganze Buch lesen sollten, nachsehen mögen. Eine leicht zu bewältigende Lektüre eines Teilkapitels zum Tagesausklang oder eine anregende (oder aufregende, wenn man zur oben angedeuteten Gruppe der Skeptiker gehört) zum Tagesbeginn - das wäre ein möglicher Sitz im Leben. Selbstverständlich eignet sich das Buch aber auch zum intensiven Studium, zur Gestaltung von Seminaren und zur Aufbereitung von Prüfungsstoff. Vor allem aber soll es helfen, die Vorstellung von einem guten Religionsunterricht auszubilden.
Schließlich danke ich den Mitarbeitern an meinem Lehrstuhl für die kritische Begleitung des Projekts; für die Sorgfalt bei der Manuskripterstellung bedanke ich mich bei Frau Elfriede Seitz-Rodatus und bei Frau Ulrike Oerterer sowie bei Frau Margarete Stenger, die das Buch nicht nur lektoriert, sondern während der Entstehungsphase motivierend begleitet hat.
Ein Wahlspruch, der die Notwendigkeit einer Inszenierung des Religionsunterrichts untermauert, könnte ein Satz aus dem Exerzitien-Büchlein von Ignatius von Loyola sein: »Nicht das Vielwissen sättigt die Seele und gibt ihr Genüge, sondern das Fühlen und Kosten der Dinge von innen« (Ignatius von Loyola 1956, 7). In diesem Sinne möchte ich dazu ermuntern, mutig die Inszenierung von Religion(sunterricht) zu wagen!
Hans Mendl
TEIL I
Performativer Religionsunterricht: Erfahrungsräume des Religiösen eröffnen
A. Religion erleben - Problemanzeige und aktuelle Herausforderungen
Wie viel an Erfahrung im Religionsunterricht darf sein? So einfach die Frage klingt, so vielfältige Problemfelder eröffnen sich, wenn man sich gründlich mit ihr beschäftigt:
▶ Bedeutet eine stärkere Erfahrungsorientierung im Religionsunterricht nicht eine Grenzüberschreitung innerhalb eines ordentlichen Schulfaches an öffentlichen Schulen? Diese erste zentrale Anfrage ist eine systemische: Welche Art des Zugriffs auf die Wirklichkeit erscheint schulischem Lernen als angemessen? Und wie konkretisiert sich dies für die Möglichkeiten methodischen Arbeitens im Religionsunterricht? Darf man mit Kindern und Jugendlichen meditieren, beten, Kirchenräume mit allen Sinnen erleben oder Sozialprojekte durchführen?
▶ Muten erfahrungsintensive Elemente und Übungen gerade auf dem Feld der Spiritualität und des Meditativen nicht wie ein Rückfall in längst überwundene katechetische oder missionarische Zeiten des Religionsunterrichts an? Diese Anfrage ist eine religionspädagogisch-konzeptionelle. Wie unterscheiden sich Lernprozesse in der Katechese und im Religionsunterricht? Was verbindet beide Lernorte - warum und auf welchen Gebieten müssen sie sogar stärker miteinander in Beziehung gebracht werden? Können bestimmte Formen mit unterschiedlichen Zielsetzungen nicht hier und dort eingesetzt werden?
▶ Welche Qualität haben solche Erlebnisse im Religionsunterricht - sind es authentische Erfahrungen von Religion oder »nur« Als-ob-Erfahrungen? Diese Anfrage ist eine hermeneutische. Sie liegt im Schnittfeld einer theologischen und anthropologischen Reflexion bezüglich der Würde von Glaubensvollzügen und der Religionsfreiheit der Schülerinnen und Schüler. Ist ein authentischer Glaubensvollzug in der Schule überhaupt möglich und statthaft?
▶ Und schließlich grundsätzlich: Was versteht man überhaupt unter »Erfahrung«? Diese erkenntnistheoretische Anfrage bedeutet mehr als ein definitorisches Glasperlenspiel in einer pädagogischen Provinz ohne Lebensbezug. Sie ist nötig, um genauer beschreiben zu können, auf welche Art objektive und subjektive Religion in Beziehung gebracht werden können. Was geschieht bei der Konfrontation mit fremden Erfahrungen? Wie werden Erlebnisse zu eigenen Erfahrungen?
Man könnte die Frage aber auch anders nuancieren: Wie viel Erfahrung im Religionsunterricht muss sein?
▶ Wer für eine stärkere Erfahrungsorientierung plädiert, befindet sich insofern in guter Gesellschaft, als er sich damit in die große Linie der Reformpädagogik, der Konzeptionierung offener Unterrichtsformen, des Projektunterrichts und der großen - und leider häufig auch sehr verschwommenen didaktischen Worte wie »Ganzheitlichkeit« und »Subjektorientierung« begibt. Was diese verschiedenen Richtungen vereint, ist ein kritischer Blickwinkel auf eine dominante Sachorientierung und eine kognitive Verengung des Lernens - das ist die Gegenfolie - sowie ein deutliches Plädoyer für das Postulat »Im Mittelpunkt der Mensch« - das ist der positive Fokus.
▶ Wie muss der Religionsunterricht gestaltet sein, damit Kinder und Jugendliche religiös kompetent werden? Diese Frage hat durchaus auch eine sachorientierte Konnotation. Ein schulisches Fach, das die Schülerinnen und Schüler bis zu 1000 Stunden »genießen«, muss sich auch hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit (wieder so ein »großes« Wort!) legitimieren: Welche Lernformen eignen sich in besonderem Maße für Lernprozesse, die den spezifischen religiösen Modus der Weltbegegnung und -aneignung zu vertiefen in der Lage sind?
▶ Wie kann also angesichts der viel bemühten Rede vom Traditionsabbruch und der faktischen Ferne vieler Schülerinnen und Schüler zum Glauben und Leben konfessioneller Religion der Gegenstand selbst verständlich werden? Genügt hier ein Reden »über« Religion? Oder müssen nicht vielmehr Kontaktzonen mit konkreten Erfahrungsräumen des Religiösen geschaffen werden, damit Kinder und Jugendliche überhaupt die Eigenart von Religion begreifen können?
In der religionspädagogischen Zunft werden diese Fragen unter dem Stichwort des »performativen Religionsunterrichts« kontrovers diskutiert. Meines Wissens stammt der Begriff von Rudolf Englert. Er hat ihn als bündelnden Suchbegriff für neuere Entwicklungen in der Religionspädagogik formuliert, als es um die Gestaltung eines Themenheftes der Zeitschrift »Religionsunterricht an höheren Schulen« (Heft 1/2002) ging: »Ohne dass damit ein neues religionspädagogisches Modewort kreiert werden soll, könnte man abgekürzt vielleicht auch von einem ›performativen Religionsunterricht‹ sprechen« (Englert 2002a, 1).
Um die theoretische Fundierung des Performativen bemühen sich vor allem evangelische Religionspädagogen, besonders Bernhard Dressler, Thomas Klie und Silke Leonhard. Als Quellen, aus denen sich der Inszenierungsgedanke speist, geben sie die Zeichendidaktik, die post-strukturalistische (»profane«) Religionspädagogik und die Gestaltpädagogik an (vgl. Klie/Leonhard 2003, 17-20). Ich selbst werde im Folgenden (S. 36ff) den Fokus auf andere Wissenschaftszweige richten, mit denen sich meines Erachtens die Bedeutung performativer Elemente im Religionsunterricht trefflich begründen lassen (besonders konstruktivistische, wissens- und lernpsychologische Argumente). Dies geschieht auch deswegen, weil ich bei aller Sympathie für den Begriff des Performativen (der zu meiner Studienzeit so etwas wie einen verbindenden interdisziplinären Rahmen über meine Fächer hinweg - Theologie, Germanistik und Sprachwissenschaft - bedeutet hat) inzwischen unsicher bin, ob die Begründung auf der Basis von zunächst sprachwissenschaftlichen Performationstheorien ausreicht. Doch das Modewort ist kreiert, und deshalb soll es als Leitbegriff auch für die folgende Darstellung verwendet werden.
1. Die Diskussion um performative Elemente im Religionsunterricht
Das Kind hat viele Väter und Mütter: Es lässt sich belegen, dass die Diskussion um einen performativen Religionsunterricht von verschiedenen parallel ablaufenden Prozessen angeregt wurde. »Der Begriff ›performativer Religionsunterricht‹ ist ein Versuch, so etwas wie ein einigendes Band um die verschiedenen in jüngster Zeit entwickelten Ansätze eines erfahrungsöffnenden Lernens zu legen«, leitet Rudolf Englert seine zusammenfassende Würdigung verschiedener performativer Ansätze ein (Englert 2002b, 32).
Die zentrale Herausforderung besteht darin, wie mit dem heute deutlich spürbaren sogenannten Traditionsabbruch umzugehen ist. »Zumal im Raum der Schule kann religiöse Bildung nicht mehr reflexiv-nachdenkend bearbeiten, was bislang noch als in Familie und Kirche vermittelter Gegenstand des aufarbeitenden Nachdenkens vorauszusetzen war« (Dressler 2002, 12). Die veränderte Situation erfordert deshalb auch einen veränderten Präsentationsmodus von Religion: »Es geht hier durchgängig darum, heutigen Schülerinnen und Schülern in der tätigen Aneignung und Transformation vorgegebener religiöser Ausdrucksgestalten (insbesondere aus der jüdisch-christlichen Tradition) eigene religiöse Erfahrungen zu eröffnen« (Englert 2002b, 32).
Wie bereits erwähnt, waren evangelische Theologen und Religionspädagogen federführend bei der Reflexion über die Bedeutung des Performativen (bes. Klie/Leonhard 2003; vgl. dazu Domsgen 2005). Wieso dies so ist, darüber lässt sich trefflich spekulieren (vgl. Englert 2002b, 34): Besteht im evangelischen Milieu, das in einer wort- und textbezogenen reformatorischen Tradition steht, ein größerer Kompensationsbedarf im Vergleich zum katholischen Religionsunterricht, bei dem die ästhetische Dimension religiösen Lernens gerade durch verschiedene konzeptionelle Projekte in den letzten Jahrzehnten stärker ausgeprägt war? Oder sind die »Evangelen« wieder einmal nur schneller als die »Katholen«, wenn es um die Reaktion auf Veränderungen geht?
Eine gemeinsame Spur lässt sich sicher in der anthropologischen und empirischen Wendung der Religionspädagogik sehen, die didaktisch unter den Stichworten einer stärkeren Erfahrungs-, Subjekt- und Prozessorientierung konkretisiert wurden (vgl. meine eigene Deutung zu einer Didaktik, in der »Im Mittelpunkt der Mensch« steht: Mendl 2004a; siehe auch: Ziebertz 2000). Ich war überrascht, als ich im Zuge meiner ersten Vorträge zur Notwendigkeit der Ausgestaltung performativer Elemente im Religionsunterricht (vgl. Mendl 2005c) den Hinweis bekam, dass eine Verlautbarung der Deutschen Bischofskonferenz unmittelbar bevorstehe, die ähnliche argumentative Strukturen aufweist: »Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen« (Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 2005) heißt die Schrift und eine viel zitierte Textstelle lautet so: »Der Religionsunterricht macht mit Formen gelebten Glaubens vertraut und ermöglicht Erfahrungen mit Glaube und Kirche« (ebd. 23). Als isoliertes Zitat löst das ebenso Unbehagen aus wie die bündelnde Feststellung Rudolf Englerts, performative Ansätze ließen sich auf die Formel eines erfahrungsöffnenden Lernens bringen (siehe oben; Englert 2002b, 32), weil der Anschein erweckt werden könnte, man lande nun mit handlungs- und erfahrungsorientierten Ansätzen im Straßengraben eines reflexions- und denkfreien Raums. Es wird in diesem Buch zu zeigen sein, dass eine Zunahme performativer Elemente im Religionsunterricht tatsächlich nur legitimiert werden kann, wenn die Balance zwischen Handeln und Deuten (vgl. Klie/Leonhard 2003, 18), zwischen Erleben und Nachdenken, zwischen Inszenieren und Reflektieren eingehalten wird. Wenn man Menschen in einen Raum potenzieller religiöser Erfahrung hineinholen will, dann müssen solche Prozesse verantwortlich unter den Postulaten von Freiheit und Reflexivität vonstatten gehen.
Inzwischen hat auch im katholischen Bereich eine intensive Diskussion bezüglich der Bedeutung und Grenzen des performativen Religionsunterrichts eingesetzt (vgl. Religionspädagogische Beiträge 58/2007 mit den Beiträgen von Norbert Mette, Albert Biesinger, Monika Jakobs, Burkard Porzelt und Mirjam Schambeck; Rendle 2006 mit weiterführenden Fragen nach den Konsequenzen für die verschiedenen Phasen der Lehrerbildung, darin Mendl 2006c).
Diejenigen, die die Verabschiedung von einem katechetischen Konzept des katholischen Religionsunterrichts oder von der evangelischen Unterweisung im evangelischen Religionsunterricht als Wende für einen pluralitätsoffenen Religionsunterricht schätzen gelernt haben, auch weil sie eventuell selbst noch über leidvolle Erfahrungen mit einem Religionsunterricht nach dem »alten« Konzept berichten können, befürchten, dass ein performatives Modell die schulische Verankerung des Faches gefährden könne. Befürworter argumentieren entgegengesetzt: Wenn sich der Religionsunterricht nicht stärker hin zu einer performativen Gestalt ändert, erweist er sich als nicht zukunftsfähig, weil es ihm nicht mehr gelingt, den Gegenstand adäquat didaktisch ins Spiel zu bringen. Letztere Position, die ich auch selbst vertrete, soll im Folgenden begründet werden.
2. Auseinanderdriften von subjektiver und objektiver Religion
In der theologischen und religionspädagogischen Diskussion ist vielfach vom Traditionsabbruch die Rede, der dazu führt, dass die Glaubensweitergabe gefährdet sei. Diese These soll in einem ersten Schritt phänomenologisch differenziert werden, damit davon ausgehend entsprechende Konsequenzen und Möglichkeiten für religiöse Lernprozesse diskutiert werden können.
Dass kirchliche Religion in der Wahrnehmung heutiger Menschen verglichen mit früheren Zeiten verdunstet, ist evident. Wenn man heutigen Kindern und Jugendlichen die christliche Religion nahebringen wolle, dann sei das so, als wolle in Amerika ein amerikanischer Koch McDonalds-gewöhnte Jugendliche in die Kunst der italienischen Pizza-Kultur einführen, behauptet Thomas Ruster (vgl. Ruster 2002, 198). So fremd sei diese Religion für heutige Kinder und Jugendliche (und, das ist die zweite Unterstellung: auch für die Lehrenden). Auch wenn die soziologischen Säkularisierungstheorien, nach denen Religion und Religionen in der modernen Gesellschaft überflüssig werden und verschwinden, inzwischen mit der vorsichtigeren Transformations-These vom »Wandel der Religion« ergänzt wurden, muss man von einem konfessionellen Standpunkt aus doch nüchtern feststellen: Der Prozess der Entkirchlichung unserer Gesellschaft schreitet zügig voran. Dies wird in der Religionssoziologie mit den Schlagworten von der »Marginalisierung institutionalisierter Religion«, der Zunahme von »kirchendistanzierter Religiosität« und von »Religions-Äquivalenten« zu beschreiben versucht. Auf mehreren Ebenen kann dieser Prozess belegt werden, der zu einem Auseinanderdriften von objektiver und subjektiver Religion führt (vgl. dazu auch Mendl 2005d):
Phänomenologisch
Explizite Religion ist heute weit weniger wahrnehmbar als noch in vergangenen Zeiten: Man möge nur die Bilder aus David Macaulays »Sie bauten eine Kathedrale« (11. A. Düsseldorf 1998) mit heutigen Stadtansichten vergleichen. Die Kathedralen der Neuzeit sind Bank-Türme und Fußballstadien, Konzertsäle und Einkaufs-Galerien. Relikte der Vergangenheit werden durch die aufdringlichen (Werbe-)Bilder der Neuzeit überdeckt und übertroffen. Wer sich heute auf die Spurensuche begibt, tut gut daran, von der Tatsache auszugehen, dass es sich bezüglich der Wahrnehmbarkeit von konfessioneller Religion von der Schülerperspektive aus betrachtet um eine mannigfaltig »verstellte Religion« handelt. Doch auch wenn Religion und konfessioneller Glaube in unserer Gesellschaft und Kultur verstellt sind: Oft wird übersehen, dass beides immer noch in reichhaltigem Ausmaß zu entdecken ist, wenn man nur genau hinschaut!
Gesellschaftlich
Wie in verschiedenen Studien aufgezeigt wurde, hat die Kirche innerhalb von wenigen Generationen einen massiven Vertrauensverlust erlitten (vgl. Mendl 2004a, 17f). Diese Vertrauenskrise wirkt sich auch auf den Religionsunterricht aus, der zwar im schulischen Kontext einen guten Stand hat und letztlich das Flaggschiff eines gesellschaftsoffenen Christentums darstellt, aber dennoch unter permanentem Begründungszwang steht. So plädierten nach einem ZDF-Politbarometer im April 2005 56% der Befragten dafür, ähnlich wie in Berlin geplant auch bundesweit den Religionsunterricht durch ein übergreifendes Fach »Ethik und Werte« zu ersetzen; nur 37% sprachen sich dagegen aus. An diesem Bedeutungsschwund ändert auch die mediale Dichte der Berichterstattung etwa beim Tod des Papstes, bei der Wahl und Einsetzung eines deutschen Papstes und dem Weltjugendtag wenig. Man darf sich davon keine Re-Missionierung des Westens erhoffen (vgl. die kritische Diskussion zur »Renaissance der Religion«: Herder Korrespondenz Spezial 2006). Gesellschaftlich betrachtet wird konfessioneller Glaube zunehmend als »unansehnliche Religion« bewertet - es gibt Attraktiveres! Das hat auch viel mit der mangelhaften Fähigkeit von Kirche, sich ästhetisch ansprechend in der Welt zu präsentieren, zu tun: Um diese These zu veranschaulichen, möge man den durchschnittlichen Schaukasten einer Pfarrei mit einer durchschnittlichen Werbetafel oder ein Pfarrblatt mit einer Speisekarte vergleichen. So verwundert es nicht, dass nach der Sinus-Milieu-Studie die Kirche nur noch wenige gesellschaftliche Milieus erreicht (vgl. Wippermann 2005).
Individuell
Entgegen der Säkularisierungsthese kann man feststellen, dass durchaus ein echtes Bedürfnis und eine Sehnsucht nach Religion vorhanden sind, sich die entsprechenden Ausdrucksgestalten aber immer weniger innerhalb, sondern vielmehr außerhalb der Kirchen und in vielfältig individualisierter Weise manifestieren. Wer ausschließlich mit der konfessionellen Brille das Phänomen Religion erfassen will, verfehlt diese wichtige Ressource der »unsichtbaren Religion«. Die Kirchen tun sich nach wie vor schwer mit einem offenen Religionsbegriff, der sich individuell in vielfältigen außerkirchlichen Spielarten manifestiert. Die Kehrseite der Medaille: Gleichzeitig gehören viele traditionelle Formen kirchlicher Religiosität nicht zum Verhaltensrepertoire, nicht nur von Jugendlichen. Man kennt die Rituale eines Rockkonzerts oder eines Stadionbesuchs, fühlt sich aber unsicher bei einem Gottesdienst anlässlich der Hochzeit eines Freundes: Die Abfolge von normierten Handlungsschritten bleibt unverständlich, weil man nicht mehr über die entsprechenden Wahrnehmungen und Routinen verfügt. So führt das wechselseitige Nicht-Wahrnehmen auf der Subjektseite dazu, dass konfessionelle Religion bereits phänomenologisch unverständlich und in ihrer Tiefendimension nicht mehr deutbar ist.
Verstellte, unansehnliche, unsichtbare und unverständliche Religion: So lautet die Ausgangsbasis bezüglich des eigenen konfessionellen Glaubens für viele Kinder und Jugendliche, die den konfessionellen Religionsunterricht besuchen. Um nicht missverstanden zu werden: Guter Religionsunterricht zielt nicht ausschließlich und nicht einmal primär auf konfessionellen Glauben, sondern ist darauf angelegt, die religiöse Kompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Dennoch erscheint die Frage bedeutsam, wie innerhalb eines konfessionellen Religionsunterrichts zentrale Aspekte christlichen Glaubens überhaupt eingebracht, von den Schülerinnen und Schülern verstanden und gelegentlich vielleicht sogar als hilfreich empfunden werden können - zunächst einmal unabhängig von dem damit verbundenen Zielhorizont. Denn angesichts der Prozesse der Individualisierung und Pluralisierung hat sich die Frage ja noch verschärft: Wie kann diese wechselseitige Fremdheit zwischen objektiver Religion und subjektiver Religion, genauer: zwischen objektiver und anderen Religionen und verschiedenen subjektiven Lebensentwürfen, angemessen didaktisch aufgegriffen werden? Stellte die Würzburger Synode noch eine Unkorreliertheit von Glauben und Leben fest, so hat sich die Zeitdiagnose noch deutlich verschärft auf die Frage nach einer Unkorrelierbarkeit der beiden Größen, aber auch des fragmentarischen Subjekts mit sich selbst (vgl. Grümme 2007, 17).
Welche Bedeutung haben also Tradition, Konfession und Institution nach dem Traditionsabbruch? Rudolf Englert meint: Der Rückgriff darauf bewahrt gerade die subjektive Religion vor Geschichtslosigkeit, Gedankenlosigkeit und sozialer Folgelosigkeit (vgl. Englert 1998, 10f). Wie dies unter den Modalitäten eines performativen Religionsunterrichts praktisch aussieht, soll in diesem Buch von vielen Perspektiven aus betrachtet werden.
3. Der Religionsunterricht als Ort der Begegnung mit Religion
Konfessionsdistanz bei Jugendlichen
Es besteht Konsens darüber, dass die Schule die kirchliche Gemeinde und andere Handlungsfelder als wichtigsten Ort religiöser Kommunikation abgelöst hat. Die Mehrzahl der Jugendlichen hat keinen unmittelbaren Kontakt zur kirchlichen Gemeinde und kennt, abgesehen von medialen Sonderfällen, kaum Menschen, die für sie als Christen identifizierbar sind. Dass gerade die mediale Präsentation von Religion, aber auch die Selbstpräsentation von Kirche, besonders auch aus den Reihen des Episkopats (vgl. die aussagekräftigen Schlagzeilen in »DIE ZEIT«: »Warum die Kirche nervt«, Nr. 39/2007 v. 27.9.07), nicht immer förderlich für eine positive Rezeption von Kirche ist, verwundert nicht.
Von daher hat das Ergebnis der Shell-Studie 2006, dass Jugendliche mehrheitlich der Aussage »gut, dass es die Kirche gibt« (Gensicke 2006, 216) zustimmen, eher überrascht. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Einschätzung zunächst eine Außenbeobachtung darstellt. Sie ist zu interpretieren in Verbindung mit dem Wunsch, Kirche möge sich ändern, und der Einschätzung, dass sie keine Antworten auf die Fragen, die Jugendliche bewegt, hat (alle drei Items bejahen ca. zwei Drittel der Jugendlichen). Die entsprechenden religionssoziologischen Eckdaten bezüglich der Kirchendistanz von Jugendlichen brauche ich hier nicht differenziert wiederholen, auch nicht die wichtige Unterscheidung zwischen konfessioneller Bindung und religiöser Sinnsuche (»Jugendliche sind nicht nicht religiös!«). Bei aller Kritik am Religionsbegriff und methodischen Vorgehen der Shell-Studien stimmen die angegebenen Größenverhältnisse (immerhin ca. 30%, deren Religiosität als »kirchennah« bezeichnet wird - vgl. Gensicke 2006, 211) mit den Größenangaben zu einer kirchlich gebundenen oder zumindest christlich orientierten Religiosität bei anderen Studien (z.B. Ziebertz/Kalbheim/Riegel 2003) halbwegs überein. Nach dem Gottesdienstbesuch wird gar nicht mehr gefragt; bereits die Shell-Studie 2000 konstatierte im Langzeitvergleich einen Rückgang bei den »Jugendlichen West« auf 16%, die in den letzten vier Wochen zumindest einmal im Gottesdienst waren (vgl. Fuchs-Heinritz 2000, 162); dieses empirische Ergebnis kann man jeden Sonntag mit Blick in die Sonntagsgemeinde bestätigen.
Religion als Religion (in) der Schule
Das bedeutet: Kinder und Jugendliche lernen Religion heute mehrheitlich fast ausschließlich als Religion (in) der Schule kennen. Der Religionsunterricht ist die zentrale Kontaktzone zur objektiven Religion schlechthin. Das leuchtet inzwischen auch den Kirchenoberen ein, die nicht immer dem Religionsunterricht und den dort Agierenden gegenüber so positiv eingestellt waren, wie es derzeit der Fall zu sein scheint, und die die Problemlage deutlich und in aller Breite vor Augen haben: »Eine wachsende Zahl der Schülerinnen und Schüler, die am Religionsunterricht teilnehmen, macht kaum noch Erfahrungen mit gelebtem Glauben. Nach Auskunft von Religionslehrerinnen und Religionslehrern kennen viele Schülerinnen und Schüler weder Kreuzzeichen noch Vaterunser. Auch das Kirchengebäude oder die sonntägliche Liturgie sind den meisten fremd und das karitative und missionarische Handeln der Kirche unbekannt … Für die meisten ist … der Religionsunterricht in der Schule der wichtigste Ort der Begegnung mit dem christlichen Glauben« (Kirchliche Richtlinien zu Bildungsstandards, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 2006, 13f).
Freilich hinterlässt dieses aufkeimende Interesse für den Religionsunterricht gelegentlich einen faden Beigeschmack, weil man manchmal mehr oder weniger ungeschminkt Argumente hört, mit denen dem Religionsunterricht wieder katechetische Aufgaben zugeschoben werden, da man anders ja nicht mehr an Kinder und Jugendliche »herankäme«. Neben den noch darzustellenden historischen Vorbehalten rücken solche überraschenden Koalitionspartner die Bemühungen um einen performativen Religionsunterricht in eine Ecke, in die er nicht gehört. Es wird auch weiter unten nochmals deutlich zu wiederholen sein: Der Religionsunterricht hat keine katechetische Funktion und auch keine katechetische Dimension (vgl. Mendl 2007a)!
Religion verstehen - aber wie?
Aus all dem folgt für den Religionsunterricht die problematische »Aufgabe, einen Phänomenbereich begreifbar und nachvollziehbar zu machen, den die Schüler/innen von innen her (biografisch, lebensweltlich, alltägliche Verortung) nicht kennen« (Porzelt 2005, 24). Man kann im Religionsunterricht nicht mehr auf explizite Vorerfahrungen zurückgreifen, die die Kinder und Jugendlichen von der Familie, Gemeinde oder Jugendgruppe mitbringen.
Diese Situationsbestimmung hat auch Folgen für die Rolle des Religionslehrers. Wenn Schülerinnen und Schüler in der Mehrzahl keine direkten Kontakte mit Menschen, die glaubwürdig den Glauben vertreten, haben, werden Religionslehrer umso mehr als Repräsentanten der objektiven Religion betrachtet. Sie stellen die primär erfahrbaren Kontaktpersonen zur Kirche dar. Die Rollenbeschreibung der Religionslehrkräfte als »Brückenbauer« zwischen unterschiedlichen soziologischen Systemen, Schule und Kirche, verbinden die deutschen Bischöfe zum einen mit der Wertschätzung ihrer Arbeit als auch mit dem Hinweis auf notwendige Unterstützungen (vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 2006, 34f). Neuere Untersuchungen zum Selbstverständnis von Religionslehrenden haben Folgendes ergeben: Sie »fühlen sich nicht durch ihre schulischen Arbeitsbedingungen belastet, sondern dadurch, dass die religiöse Sozialisation ihrer Schülerinnen und Schüler abgenommen hat und weiter abnimmt« (Tzscheetzsch 2006, 219). Was ein performatives Konzept des Religionsunterrichts deshalb für die Lehrenden bedeutet, wird weiter unten (S. 82-84) und dann in jedem Praxiskapitel themenbezogen reflektiert. Die bereits oben gestellte Frage, wie objektive Religion zur Ausbildung der subjektiven didaktisch ins Spiel kommen kann, muss also institutionell vertieft werden: Wie kann das an der öffentlichen Einrichtung Schule und in einem staatlichen Unterrichtsfach gelingen?
B. Aporien: Die Suche nach einem tauglichen Konzept
1. Die Last der Geschichte
Dass wir heute nicht blauäugig für eine Inszenierung von Religion plädieren können, hat viel mit der Geschichte des Faches Religionsunterricht und seiner Entwicklung zu tun. Autobiografische Zeugnisse belegen, dass die These, eine gewisse Art religiöser Erziehung habe auch zu einem »Religionsverlust« (Ringel/Kirchmayer 1986) oder zu einer »Gottesvergiftung« (Moser 1976) geführt, sehr berechtigt ist. Zwei Belege mögen genügen: Der aus Passau stammende Unternehmer Edgar Forster schreibt in seiner Autobiografie auch über den Unterricht, wie er ihn in den 1950er-Jahren erlebt hat:
»In der zweiten Klasse besuchte ich die Katholische Volksschule für Knaben Eggendobl, eine zwei(t)klassige Zwergschule. Unsere Lehrerin war die Pfrein Pfister, eine bigotte alte Jungfer mit Dutt im Gnack, Nickelbrille auf der Nase und angetan mit schwarzgrau-braunem Sack-und-Asche-Gewand; am liebsten veranstaltete sie wahre Gebetsorgien im Unterricht. (...) Dem Pfarrer Fischer machte sie jede Woche zweimal Meldung einer Meß- und Gebetsstatistik, wie viele von uns ca. 45 Buben beim Aufstehen nicht gebetet hatten, wie viele vor und wie viele nach dem Frühstück das Beten versäumt hatten, wie viele den Engel des Herrn vergessen hatten, wie groß die Zahl der Nichtbeter vor und nach dem Mittagessen war usw. usw.« (Forster 2000, 8f).
Auch der Bestseller von Frank McCourt »Die Asche meiner Mutter« (McCourt 1998, bes. 157-183) - die Beschreibung einer ärmlichen Kindheit in Irland - ist durchzogen mit alltagsverwobenen Rückerinnerungen an eine religiöse Erziehung, die als autoritär, angsteinflößend, freiheitshinderlich empfunden wurde. Frank McCourt widmet dem Thema Beichte und Erstkommunion ein ganzes Kapitel; es dominieren Leistungsanforderungen und Drohungen:
»Der Lehrer sagt uns, wir müssen den Kathezismus [sic] rückwärts, vorwärts und seitwärts auswendig können. Wir müssen die Zehn Gebote kennen, die sieben Tugenden - göttlich sowie moralisch -, die sieben Sakramente, die sieben Todsünden. Wir müssen alle Gebete auswendig können, das Ave-Maria, das Vaterunser, das Confiteor, das Apostolische Glaubensbekenntnis, das Bußgebet, die Litanei unserer Allerheiligsten Jungfrau Maria... Er sagt uns, bei uns ist sowieso Hopfen und Malz verloren, die schlechteste Klasse, die er je im Erstkommunionunterricht hatte, aber so wahr Gott die kleinen Äpfel erschuf, so wahr wird er Katholiken aus uns machen, er wird die Faulenzerei aus uns raus- und die göttliche Gnade in uns reinprügeln« (McCourt 1998, 164-165).
Religionsverlust durch religiöse Erziehung
Diese drastischen Situationsbeschreibungen - die leider mit anderen ergänzbar wären (z.B. Reitmajer 2000) - weisen auf ein problematisches Konzept religiöser Erziehung in der Schule hin, das letztlich zur massiven Krise des Religionsunterrichts in den 1960er-Jahren führte: Die materialkerygmatische Konzeption katholischerseits und das evangelische Modell einer Evangelischen Unterweisung stimmten in der grundsätzlichen Anlage überein: Es handelte sich um das Konzept eines Religionsunterrichts als Kirche an der Schule, dessen Aufgabe die Verkündigung des Glaubens und dessen Ziel in der Einführung in diesen Glauben bestand. Religionslehrer erhielten die zentrale Rolle als Zeugen des Glaubens und Vertreter der Gemeinde. Der Religionsunterricht wurde als verlängerter Arm einer kirchlichen Katechese verstanden und gelegentlich leider auch mit nicht unbedingt menschenfreundlichen Repressalien durchgeführt. Im Religionsunterricht fand, wie das Beispiel aus Niederbayern zeigt, eine doppelte Sozialkontrolle statt: Einerseits wird die Inszenierung von Religion im Unterricht selbst eingefordert (»Gebetsorgien«) und andererseits wird die Autorität der Religionslehrkraft auch auf den außerschulischen Bereich geweitet, indem die häusliche Gebetspraxis einer Überprüfung unterzogen wurde. Dass solche didaktischen Elemente wie eine Gebetsstatistik keine Einzelfälle darstellen, sondern als traditionell bewährte Maßnahmen eines zeitgemäßen Religionsunterrichts erachtet wurden, verdeutlicht ein knapper Hinweis in den Katechetischen Blättern fünfzig Jahre zuvor: Geworben wird für eine »praktische Kontrollkarte für den Schulgottesdienst«:
»Die Kinder erhalten zu Beginn eines jeden Monats im Kuvert eine Kontrollkarte, welche Rubriken für Sonn-, Fest- und Werktage, für Beicht und Kommunion enthält. Vor oder nach dem Schulgottesdienst erhalten die Kinder (bei der Kirchentüre oder auf ihrem Platze) eine Kontrollmarke. Zu Hause klebt das Kind die gummierte Marke in die Rubrik der Karte. Der Katechet sammelt nach Belieben, jedenfalls am Schluss des Monats die Kontrollkarte ein und sieht sie zu Hause durch. So erspart man viel Zeit, welche durch das lästige Umfragehalten verloren geht. Auf diese Weise können auch die Eltern ihre Kinder überwachen; dem Katecheten bieten diese Kontrollkarten zugleich ein Dokument gegenüber schwierigen und kurzsichtigen Eltern« (KatBl 36 (1910) 135).
Krise des Religionsunterrichts
Ein solches Eindringen in die Privatsphäre wurde im Prozess der Moderne immer deutlicher als eine unangemessene Grenzüberschreitung empfunden. Die Folge war eine dramatische Krise des Religionsunterrichts, welche sich in deutlichen Abmeldezahlen niederschlug.
Wenn wir heute über die Möglichkeiten eines stärker erfahrungsorientierten Religionsunterrichts nachdenken, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass diese Last der Geschichte eine Hypothek darstellt, mit der wir zu rechnen haben. Deshalb muss immer wieder betont werden: Zu einem solcherart vereinnahmenden Modell von Religionsunterricht wollen wir nicht zurück!
Die Funktionsträger in Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, die Eltern- und besonders Großelterngeneration heutiger Schüler, also die heute ca. 50-bis 70-Jährigen haben häufig einen solchen Religionsunterricht erlebt und äußern sich von den eigenen Erfahrungen her oft kritisch über den Religionsunterricht, ohne wahrzunehmen, dass sich dieser konzeptionell längst vom missionarischen Modell entfernt hat. Die eigene Erfahrung erweist sich somit als Wahrnehmungsfilter, mit dem dann auch der aktuelle Religionsunterricht rezipiert wird. So polemisiert beispielsweise der bekannte Gehirnforscher Manfred Spitzer in seinem im Jahre 2002 erschienenen Buch »Lernen« (Spitzer 2007, 432-446; vgl. kritisch dazu Mendl 2004b) mit den entsprechenden Negativbeispielen gegen den Religionsunterricht und ist für dessen Abschaffung - und verfehlt mit seiner Darstellung doch das weiterentwickelte Modell eines Religionsunterrichts. Dass auch schulische Funktionsträger und Verantwortliche für den Religionsunterricht zu dieser Generation gehören, erschwert die konzeptionelle Entwicklung performativer Elemente zusätzlich: denn auch sie argwöhnen, man falle damit katholischerseits »hinter die Würzburger Synode« und evangelischerseits in eine »Evangelische Unterweisung« zurück.
2. Die Unterscheidung von Religionsunterricht und Katechese
Vom missionarischen zum diakonischen Konzept des Religionsunterrichts
Gegenüber dieser Ausgangslage eines gesellschaftlich und auch theologisch nicht mehr tragfähigen Konzepts des Religionsunterrichts stellt der Beschluss der Würzburger Synode aus dem Jahre 1974 auf katholischer Seite das »Dokument einer Wende« dar, wie es der Religionspädagoge Wolfgang Nastainczyk (Nastainczyk 1984) einmal bezeichnet hat. Dieses Dokument markiert eine Befreiung von der konfessionalistischen Engführung religiöser Erziehung und bedeutet den Übergang vom missionarischen zum diakonischen Konzept religiösen Lernens in der Schule: Das Handeln der Kirche in der Schule versteht sich nunmehr auf allen Feldern als selbstloser Beitrag für die Identitätsentwicklung junger Menschen und für die Humanisierung des Schullebens.
Ausdifferenzierung von Gemeindekatechese und Religionsunterricht
Damit verbunden war eine konsequente Trennung von Gemeindekatechese und Religionsunterricht in Adressatenkreis, Inhalten und einer je eigenen Didaktik. Fortan bemühte man sich in allen kirchlichen Dokumenten, auch nur den Anschein einer Grenzüberschreitung zu vermeiden. Auch wenn diese Unterscheidung gelegentlich arg rigoristisch wirkt, so z.B. bei der starren Trennung von Schulpastoral und Religionsunterricht (vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 1996a, 18), stellte diese Ausdifferenzierung für den Religionsunterricht freilich eine Chance zur Professionalisierung dar. Die Frucht dieser Bemühungen sieht man am aktuellen Stellenwert des Religionsunterrichts, der besonders in der Grundschule breit anerkannt ist (vgl. Bucher 2000).
Ziele des Religionsunterrichts in Pluralität
Die grundlegende Zielbestimmung dieses diakonischen Religionsunterrichts besteht nicht in der existenziellen Glaubenseinführung, nicht in der konfessionellen Sozialisation oder in der Hinführung zur Pfarrgemeinde; der Religionsunterricht nach der Würzburger Synode ist für eine disparate Schülerschaft (gläubige, suchende, ungläubige … Schüler) gedacht, er »soll zu verantwortlichem Denken und Verhalten im Hinblick auf Religion und Glaube befähigen«, er »weckt und reflektiert die Frage nach Gott« (Der Religionsunterricht in der Schule 1976, 2.5.1) - das ist die zentrale Aufgabe. Dies bedeutete einen wichtigen Schritt nach vorne hin zu einem gesellschaftsoffenen Konzept von Religionsunterricht.
3. Grenzen eines primären Reflexionsmodells
Das Reflexionsmodell schulischen Lernens
Allerdings brachte die Angst, nicht ins alte missionarische Fahrwasser zu verfallen, Probleme mit sich, die wir heute aus der Distanz und unter deutlich zugespitzten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen deutlicher erkennen. Besonders problematisch ist die dominante Anlage des Faches nach dem Reflexionsmodell schulischen Lernens. Dieses stellt zunächst keine Besonderheit dar, sondern entspricht der Eigenart des Handlungsortes Schule. Im Biotop Schule als »Moratorium des Lebensernstes« (Dressler 2004, 263) wird auf reflektierte Art und Weise auf Wirklichkeit zugegriffen. Unterricht und damit auch Religionsunterricht ist zunächst kein Ort unmittelbarer religiöser Erfahrung. Vielmehr baut unterrichtliches Lernen darauf auf, dass Erfahrungen mit Religion mitgebracht werden; der Religionsunterricht ist dann der Ort des Reflektierens und des Deutens. Dieses Modell funktionierte bei einer halbwegs vorhandenen Einbettung der Schülerinnen und Schüler ins konfessionelle Milieu, mutierte insgesamt aber zu einer »Als-ob«-Didaktik (als ob alle irgendwie geartete religiöse Erfahrungen mitbrächten) bzw. führte zur Aporie, wenn durchschaut wurde, dass dergleichen nicht mehr gelingen konnte.
Kognitive Engführung des Religionsunterrichts
Ein zweites Problem stellt die Rezeption der Curriculumtheorie im Religionsunterricht dar - in der Didaktik ein Meilenstein zur Professionalisierung des Unterrichts und damit auch des Religionsunterrichts, freilich mit dem Nachteil, dass dies gelegentlich zu einem kognitiv fixierten Religionsunterricht führte, weil mit dieser Lerntheorie nur der Bereich der Kenntnisse und des Wissens einer Evaluation zugeführt werden konnte. Emotionales und handlungsorientiertes Lernen kam innerhalb der systemischen Grenzen zu kurz.
Wenn aber der Religionsunterricht mehr ist als »nur« Religionskunde, dann reicht ein Unterricht »über« Religion nicht aus, sondern es muss auch ein Unterricht »in« Religion und »von Religion aus« erfolgen. Das hat Folgen für die inhaltliche Gestaltung und das Rollenverständnis des Religionslehrers. Die entsprechenden Sollbruchstellen zwischen dem curricularen Anspruch und dem Selbstverständnis eines »starken« (das Konzept des Religionsunterrichts) und nicht nur »schwachen« Modells (das wäre Religionskunde) wurden bis heute nicht ausreichend reflektiert.
Der Prozess einer Verschulung von Katechese
Die Frage kann geschichtlich durchaus umfassend vertieft werden: Was geschieht, wenn Religion in die Schule geht (vgl. dazu auch Mendl 2005b)? Die historisch breiter angelegte Ausgangsthese lautet: Der prinzipielle Ansatz des Religionsunterrichts seit seiner Entstehung, der über alle verschiedenen Konzepte hinweg dem Schulfach zugrunde lag, funktioniert heute nicht mehr.
Der Prozess einer »Verschulung von Katechese« ist in größeren historischen Zeitläufen einer Geschichte des Christentums betrachtet noch verhältnismäßig jung (vgl. Mendl 2006d): Er beginnt mit breiterer Wirksamkeit erst im Zeitalter der Glaubensspaltung. Seither geht Religion in die Schule und ist mit den entsprechenden Vorstellungen dessen, was Schule und schulisches Lernen leisten sollen und können, verbunden. Der Religionsunterricht zielte auf die intellektuelle Vertiefung alltäglich gelebten Glaubens, von der Entstehungssituation in der Reformationszeit her durchaus mit dem Ziel einer Abgrenzung von der je anderen christlichen Religion. Dieses Reflexionsmodell religiösen Lernens erwies sich damals deshalb als sinnvoll, da man von einer breiten und stabilen religiös-kirchlichen Sozialisation bei den Schülerinnen und Schülern ausgehen konnte. In diesem gesellschaftlichen Kontext gelang auch ein Katechismus-Unterricht, der zwar zu allen Zeiten von den Lernenden als religiöses Trockenfutter empfunden wurde, aber immerhin darauf bauen konnte, dass die in diesem Rahmen begegnende religiöse Sprache, die Themen und Gebete den Schülerinnen und Schülern nicht völlig fremd waren. Denn den Referenzrahmen für die kognitive Fundierung von Religion stellten die religiösen Erfahrungen dar, die die Schüler von daheim (Pfarrgemeinde, Familie) mitbrachten. Das bedeutet freilich nicht, dass sich der Religionsunterricht auf kognitive Elemente beschränkte, wie die drastischen Eingangsbeispiele oben (S. 21f) zeigen.
Grenzen des historisch gewachsenen Reflexionsmodells heute
Was aber geschieht nun, wenn Kinder keine Gebete mehr kennen, keine Gottesdienstpraxis mitbringen, nicht wissen, was an Weihnachten und Ostern gefeiert wird und zu welcher Pfarrei sie gehören? Die Defizite im Bereich explizit religiös-konfessionellen Wissens und der entsprechenden Grunderfahrungen sind bei heutigen Schülerinnen und Schülern evident. Das bedeutet zwar nicht, dass die Schülerinnen und Schüler nicht originäre menschliche Erfahrungen und Sehnsüchte und individuelle religiöse Erfahrungen mitbringen. Dennoch: Religiöses Basiswissen (Gebete, biblische, liturgische, geschichtliche Kenntnisse), die Fähigkeit zur Entschlüsselung religiöser Codes (C+M+B, INRI, Michelangelos »Erschaffung des Adam«), Verhaltenssicherheit (Kreuzzeichen, Verhalten bei der Liturgie oder im Kirchenraum) oder eine religiöse Sensibilität (»hinter die Dinge schauen«) und eine Gemeindenähe oder gar kirchliche Beheimatung können nicht mehr vorausgesetzt werden. Ein drastisches Beispiel wiederum aus Niederbayern, wo unter der Decke eines traditionsorientierten Christentums (Religion als »Trachtenverein für die Seele«, wie das Otfried Fischer einmal in einem Interview treffend bezeichnet hat) sich auch zunehmend eine »religionsfreundliche Gottlosigkeit« (Johann Baptist Metz) breitmacht: Auf den Hinweis eines Religionslehrers in einer 7. Klasse, Jesus sei nur dreißig Jahre alt geworden, fragt ein Schüler allen Ernstes betroffen nach: »Was hat ihm denn gefehlt?«
Der garstige Graben zwischen dem Erfahrungswissen und dem Glaubenswissen, dem Depositum fidei, hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte massiv verbreitert. Wie aber kann ein produktives Spannungsverhältnis zwischen beiden Größen aufgebaut werden, sodass die Schülerinnen und Schüler zumindest eine Fragehaltung entwickeln? »Der Religionsunterricht weckt und reflektiert die Frage nach Gott«, lautet die Zielbestimmung des Religionsunterrichts nach der Würzburger Synode. Wie muss Unterricht organisiert sein, wie müssen Gegenstände didaktisch ins Spiel kommen, damit die Schülerinnen und Schüler daran ihre Fragen entwickeln? Auch in anderen Religionen weiß man, dass eine Kultur des Fragens am besten kontextuell verortet ist, zum Beispiel in einer passenden rituellen Handlung: Nicht von ungefähr wird beim jüdischen Pessach-Mahl dem Jüngsten die Rolle des Fragenden zugewiesen.
Die Voraussetzungen für ein primäres Reflexionsmodell des Lernens im Religionsunterricht scheinen immer weniger gegeben zu sein (vgl. auch die differenzierte Argumentation dazu: Bahr 2000, 214f). Bereits die Würzburger Synode thematisierte dieses Problem und stellte es drastisch dar: »Wenn der Lehrer dennoch versucht, in den Glauben und in das Leben der Kirche einzuweisen und einzuüben, so ist es oft, wie wenn er zu Blinden von Farbe spricht« (Der Religionsunterricht in der Schule 1976, 1.1.1). In unseren Ohren klingt der erste Teilsatz noch wie ein Relikt aus einer katechetischen Zeit. Vom Konzept eines »Einweisens« und »Einübens« haben wir uns längst und aus guten Gründen verabschiedet. Aber damit verschärft sich die Feststellung einer »Farbenlehre für Blinde« eher noch: Führt die Reduktion auf eine erfahrungsferne Präsentation von Religion im Klassenzimmer nicht dazu, dass das Dargestellte überhaupt keine Konturen und Tiefendimensionen, geschweige denn Farben hat?
Deutungs- und Partizipationskompetenz
In einer postchristlichen Gesellschaft erscheint ein primäres Reflexionsmodell religiösen Lernens nicht mehr als tragfähig, wenn es das Ziel ist, dass Kinder und Jugendliche religiös kompetent werden. Der Pädagoge Dietrich Benner folgert: »Damit Welterfahrung und Menschenumgang unterrichtlich und schulisch erweitert werden können, bedarf es zunächst einmal grundlegender Welt- und Umgangserfahrungen. Wo diese Voraussetzung nicht durch vorschulische Erziehung und Sozialisation gesichert ist, muss sie zum Zwecke einer nachfolgenden unterrichtlichen Unterweisung zunächst einmal künstlich mit Hilfe schulischer Erkundungen, Hospitationen,Exkursionen und Übungen gestiftet und gesichert werden« (Benner 2004, 14). In curricularen Zeiten wurde in den Hintergrund gedrängt, dass seit Herbart die moderne öffentliche Schule eine doppelte Zweckbestimmung hat: nicht nur eine Weltdeutung, sondern auch die Fähigkeit zum Umgang mit der Welt. Insofern muss heute die Fähigkeit zur Deutung von Religion ergänzt werden mit einer Partizipationskompetenz, weil nur auf diese Weise das Wissen durch Erfahrung erweitert und im Gegenzug ein tieferes Verständnis des eigenen und fremden Handelns möglich werde, meint Benner. Beides, Erfahrungserweiterung und Deutung von Erfahrung, kommt dann als Aufgabenbeschreibung auf den gesamten Religionsunterricht zu (siehe die Ergänzungen am Grundschema, das von Benner 2004, 15, stammt). Religiöses Lernen scheint also »auch in posttraditionalen und säkularen Zeiten kaum ohne eine vorreflexive Reflexionsgrundlage« (Porzelt 2004, 67) auszukommen.
Wenn also die Voraussetzungen der lernenden Subjekte ernst genommen werden, dann bedarf es anderer Präsentationsmodi als nur reflexiver, um Religion verstehen zu können. Das muss aber auch vom Gegenstand her noch näher durchdacht werden: Welcher Präsentationsmodus ist der objektiven Religion angemessen, damit diese selbst verständlich wird (siehe dazu S. 37ff)?
Diese Problembeschreibung kann über den Religionsunterricht auf andere religionspädagogische Handlungsfelder hin erweitert werden. Das Verstehen einer anderen Religion beschränkt sich ja nicht nur auf das Wissen um deren ideologische Grundlagen. Birgit Zweigle konkretisiert dies sehr eindrucksvoll mit Beobachtungen bei der Ausbildung von LER-Lehrern: Wie kann man Menschen, die in keiner religiösen Tradition aufgewachsen sind, eine Ahnung von Religion beibringen? »Das Problem lag natürlich nicht in der intellektuellen Aufnahmefähigkeit. Sachinformationen zu den unterschiedlichen Religionen konnten von allen verstanden und reproduziert werden. Doch das Verständnis für Religion als Lebenshaltung, für ihre Sprache, ihre liturgischen Vollzüge blieb den meisten verschlossen« (vgl. Zweigle 2005, 286) - eine Einschätzung, die übrigens die betroffenen LER-Lehrer selbst teilten.
Matthias Bahr beschreibt angesichts veränderter Rahmenbedingungen, die ein Reflexionsmodell schulischen Lernens als nicht mehr ausreichend erscheinen lassen, folgende Chancen eines praktischen Lernens im Religionsunterricht:
▶ »Dem Glauben als dem ›Glauben in der Konkretion‹ begegnen …
▶ Die Gestaltungskraft des Glaubens für das Handeln erleben …
▶ Die solidarische und emanzipatorische Grundperspektive des Glaubens wahrnehmen …
▶ An der Überwindung der Diskrepanz von Urteilen und Handeln arbeiten …
▶ Kirche als ›Kirche in der Welt‹ verstehen lernen …
▶ Im schöpferischen Handeln sein Menschsein vollziehen …« (Bahr 2000, 218).
Es ist nicht alles Katechese, was sich so anfühlt
Die grundlegende Frage lautet: Wie verhalten sich »Erfahrung« und »Reflexion« im Religionsunterricht zueinander? Wie viel an Erfahrung ist nötig, wünschenswert, möglich? Wie viel Religion darf oder muss sogar sein, damit der Gegenstand angemessen verhandelt werden kann? Darf man im Religionsunterricht (Rosenkranz?) beten, Gottesdienst feiern, meditieren? Gerade der spirituell-liturgische Bereich scheint ein besonders sensibler zu sein, an dem sich die Geister »pro« und »kontra« scheiden.
Verständlicherweise stellt sich die Befürchtung ein, damit sei ein konzeptioneller Paradigmenwechsel verbunden, mit dem man über die Hintertüre wieder das missionarische Konzept von »Kirche in der Schule« einführen wolle. Eine Reflexion über die Notwendigkeit, performative Elemente im Religionsunterricht zu verstärken, hat jedoch innerhalb des diakonischen Modells eines »Religionsunterrichts für alle« stattzufinden. Wenn man über das Ziel heutigen Religionsunterrichts nachdenkt, muss man deshalb zunächst einige nicht tragfähige Zieloptionen ausscheiden: Problematische Globalziele wären etwa das Erlangen einer konfessionellen Identität der Schülerinnen und Schüler, die vollständige Eingliederung in die Kirche oder die Einübung in den Glauben. Das alles wäre »zu viel«. Genauso problematisch, weil »zu wenig«, wäre nur ein Wissen über Religion.
Wenn heute über das Ziel religiösen Lernens am Handlungsort Schule nachgedacht wird, dann fällt, gerade im Kontext der Diskussion um Bildungsstandards, immer wieder der Begriff der »religiösen Kompetenz«. Rudolf Englert hat diese in dreifacher Hinsicht als Fähigkeit zur religiösen Weltdeutung, Fähigkeit zur Interpretation religiöser Traditionen und Fähigkeit zur persönlichen religiösen Positionierung beschrieben (Englert 1998). Diese Beschreibung ist zwar einerseits innovativ, weil die individuelle Entwicklung einer religiösen Gestalt in den Blick kommt. Sie ist andererseits noch der Ebene einer reflektierten Auseinandersetzung mit Religion verhaftet. Wie bereits oben erwähnt halte ich den Vorschlag von Dietrich Benner für weiterführend (Benner 2004): Die Deute-Kompetenz muss mit einer Partizipationskompetenz ergänzt werden, denn wenn originäre religiöse Erfahrungen fehlen, dann müssen diese im Unterricht erst zugänglich werden, um Wissen mit Erfahrung zu erweitern.
Meine »Kompetenz-Formel« lautet so: Lernende werden »in Sachen Religion« kompetent, wenn sie in Auseinandersetzung mit den religiösen Konstruktionen anderer und unterstützt durch das Deutungs- und Praxisangebot christlicher Tradition ein selbstständiges und vor der Vernunft verantwortbares Urteil in Fragen der Religion sowie je eigene religiöse Spuren entwickeln (Deutungs- und Partizipationskompetenz). Die Herausforderung dieser Beschreibung besteht darin, dass einerseits weit deutlicher die Praxis von Religion didaktisch ins Spiel kommt, ohne zugleich den Anspruch auf das Konzept von Bildung als Selbstbildung in Freiheit aufzugeben. Das unterscheidet diesen Ansatz von älteren missionarischen Konzepten und auch denen einer modernen Katechese, bei der man ja zumindest von einer wenn auch zeitlich begrenzten Zustimmung zum Glauben und entsprechenden Selbstverpflichtungen ausgeht. Selbst wenn manche unterrichtliche Verfahren im Kontext eines performativen Konzepts so anmuten wie praktische Vollzüge, die man von anderen Handlungsorten (Gemeinde, Jugendarbeit) her kennt, meine ich in Anlehnung an ein Diktum von Matthias Kroeger (vgl. Kroeger 1996): »Es ist nicht alles Katechese, was sich so anfühlt!«
4. Der Streit um das Verständnis von Korrelation zwischen Glauben und Leben
Dennoch bleibt die Frage, wie objektive und subjektive Religion aufeinander bezogen werden können. Dass die Erfahrungsdimension bei unterrichtlichen Lernprozessen bedeutsam ist, scheint auch innerhalb eines eher kognitiven Konzepts unumstritten zu sein. Denn eine Reduktion von Religion auf die Ebene des abstrakten religiösen Wissens wird dem Gegenstand selbst nicht gerecht. Die kritische Anfrage richtet sich vielmehr auf die Art und Weise der Präsentation gelebter Religion und auf die Intensität, mit der die Schülerinnen und Schüler in diese Erfahrungen hineingeführt werden - bis hin zur Bestreitung, dass eine Anteilnahme an fremden Erfahrungen überhaupt möglich ist.
Korrelation - Glauben und Leben aufeinander beziehen
In der katholischen Religionspädagogik gilt seit der Würzburger Synode das Korrelationsprinzip als der goldene Weg zwischen einer einseitigen Sachorientierung und einer ebenso einseitigen Subjektorientierung: Leben und Glauben sollen in einen produktiven Dialog kommen. Es ist schon paradox, dass Theorie und Praxis des Religionsunterrichts seit der Würzburger Synode von einem Prinzip bestimmt werden, welches umstritten ist wie kein anderes, vielfach modifiziert wurde und übereinstimmend daran krankt, dass es nie zu einem unterrichtsdidaktischen Konzept ausgearbeitet wurde; nicht von ungefähr wird das aus der evangelischen Religionspädagogik übernommene Modell der Elementarisierung als angewandte Religionsdidaktik verstanden und als brauchbares Modell einer korrelativen Unterrichtsvorbereitung in der Lehrerbildung eingeübt (vgl. Mendl 2002c).
Die Diskussion um die Korrelationsdidaktik innerhalb der Religionspädagogik hat bei aller Widersprüchlichkeit zumindest in einer pädagogischen Grundüberzeugung eine Übereinstimmung hervorgebracht: Von einem Lernverständnis, das von einem extremen Instruktivismus geprägt ist, hat sich die Religionspädagogik längst verabschiedet. Das lernende Subjekt ist nicht einfach eine tabula rasa, die mit Fremderfahrungen beschrieben werden könnte; Lernen funktioniert nicht einfach nach dem Modell der Weitergabe feststehender Wissensbasics oder auch Erfahrungen. Vielmehr handelt es sich um vielschichtige Konstruktionsprozesse, wenn die Wahrnehmungen anderer Wirklichkeitsphänomene mit bereits vorhandenen Einstellungen und Erfahrungen verbunden werden (vgl. Mendl 2005b).
Didaktik der Aneignung als Befähigung zur Auseinandersetzung mit Fremdem
Deshalb darf auch der derzeit bevorzugte Begriff einer »Didaktik der Aneignung« (im Kontrast zu einer »Didaktik der Vermittlung«) nicht so verstanden werden, als wäre eine unproblematische Übernahme fremder Denkstrukturen, Meinungen und Erfahrungswelten möglich. Dies würde weder der eigenen Würde des lernenden Subjekts entsprechen noch der des Erkenntnisgegenstands oder Gegenübers; »Aneignung« steht im Verdacht, dass damit begrifflich ein gewisser »Herrschaftsgestus« signalisiert sei (vgl. Greiner 2000, 291). »Aneignung« bedeutet aus konstruktivistischer Sicht aber vielmehr, dass die Wahrnehmung und Verarbeitung von äußerer Wirklichkeit nach sehr individuellen autopoietischen Gesetzmäßigkeiten vonstatten geht und es bei der selbsttätigen Auseinandersetzung mit Lerngegenständen zu vielfältigen Transformationen kommt (vgl. unten genauer zum Konstruktivismus: C. 6, S. 57ff).
Die Frage bleibt also bestehen: Wie lassen sich die radikal veränderten heutigen Erfahrungen mit überlieferten Erfahrungswelten zusammenbringen?
Deduktion, Reduktion, Induktion
Nach Peter Berger verbieten sich die Wege der reinen Deduktion (hier kommt das Subjekt nur als Adressat ins Spiel) und der reinen Reduktion (weil hier die Tradition zu kurz kommt; vgl. Berger 1980). Vielmehr spricht vieles für ein induktives Verfahren, das Werner Ritter so interpretiert: »Einmal wird die menschliche Erfahrung als Ausgangspunkt religiöser Reflexion verstanden, zum anderen werden mittels unterschiedlicher Methoden jene Erfahrungen thematisiert, welche sich in verschiedenen Religionstraditionen verdichtet haben, damit sie zu gegenwärtigen Erfahrungen in eine produktive Beziehung gesetzt werden« (Ritter 1998, 158). Religionsunterricht benötigt also einen doppelten Erfahrungsbezug: Er muss geschichtliche und gegenwärtige Glaubenserfahrungen von Menschen der Tradition aufspüren und muss markante Selbst-, Welt- und Fremderfahrungen von Menschen früher und heute thematisieren (vgl. Ritter 1998, 160). Wie diese Erfahrungen dann aufeinander bezogen werden (können) und wo Grenzen solcher wechselseitigen Korrelationen zu markieren sind, muss noch geklärt werden.
Weiterentwicklung des Korrelationsprinzips
In der Religionsdidaktik wurden in den letzten Jahren einige neuere Entwürfe vorgestellt, die sich entgegen einem naiven Verständnis von Korrelation, welches in den einschlägigen Darstellungen zum Korrelationsprinzip hinreichend beschrieben wurde (Stichworte sind etwa: einlinige Frage-Antwort-Korrelation, Umklapp-Korrelation usw.), um eine angemessene Interpretation und Anwendung des Korrelationsprinzips bemühten:
▶ Gottfried Bitter (vgl. Bitter 1996) spricht von einer »kritisch-produktiven Korrelation von Lebenswirklichkeiten«: Nicht Glaube und Leben, sondern bereits gedeutete Lebenskonstrukte stoßen aufeinander. In einem Prozess der Selbst- und Fremdprüfung geht es um die Suche nach Grundeinsichten (z.B. die Bedeutung von Sinn, Gemeinschaft, Solidarität) in bekannten (z.B. in der Schulklasse: die Vorkonstrukte der Schülerinnen und Schüler) sowie unbekannten Lebenszeugnissen (z.B. in der Bibel). Die Erforschung verschiedener Lebenswirklichkeiten führt zum Aufspüren sinnverdächtiger Signale, die sich hier und da bewährt haben, deren aktueller »Wahrheitstest« (Evangelii Nuntiandi 24) allerdings noch unternommen werden muss. Den Erfahrungshorizonten der Tradition kommt also nicht a priori eine höhere Würde zu, sie müssen ihre Plausibilität im Prozess der Auseinandersetzung beweisen.
▶ Der Ansatz einer »abduktiven Korrelation« (vgl. Prokopf/Ziebertz 2000) geht davon aus, dass lernende Subjekte in ihrem existenziell-fragenden Zugang auf die Wirklichkeit Gedankengänge entwickeln, die Bezüge zur christlichen Tradition aufweisen; werden diese latenten Sinnstrukturen aufgedeckt, können sowohl traditionelle Argumentationsstrategien als auch subjektbezogene Fragehaltungen in einen produktiven Dialog gebracht werden.
▶ Nach dem Modell einer Dekonstruktion (vgl. Kropač 2001) werden auf paradoxe Weise Destruktion und Konstruktion miteinander verbunden: Sowohl die fremde Welt der Bibel als auch die lernenden Subjekte sind diesem Prozess der Dekonstruktion ausgesetzt: Eingeschliffene und linear-einfache Deutungskonstrukte biblischer Texte werden destruiert; biblische Texte werden in ihrem vielfältigen Sinnpotenzial für jeweils sich mit ihnen beschäftigende Subjekte freigegeben. Andererseits irritieren biblische Texte auch das Selbstverständnis eigener Selbst-, Welt- und Gottesbilder und bieten den Schülerinnen und Schülern Gegenwelten, die für konstruktiv verändernde Prozesse offenstehen.
▶ Vom Leitbegriff der »Beziehung« aus entwickelt Reinhold Boschki eine kreativ-dialogische Religionsdidaktik, mit der der Begriff der Korrelation als kommunikatives Geschehen interpersonal und subjektorientiert ausdifferenziert und letztlich ersetzt werden soll (vgl. Boschki 2003). Diese beziehungshermeneutische Grundlegung müsste freilich deutlicher hinsichtlich der Differenzerfahrungen bei dialogischen Prozessen reflektiert und didaktisch durchbuchstabiert werden.
▶ Vom Blickwinkel eines pädagogischen Konstruktivismus (vgl. Mendl 2005b; siehe auch unten S. 37ff), erfolgt Lernen immer aktiv, subjektgesteuert und individuell. Fremde Bildungsgehalte (also auch die Fremdheit der biblisch-christlichen Botschaft) stellen nach diesem Denkmuster Informationen dar, die im besten Fall zu einer »Perturbation« (Verstörung) des Lernenden führen, im schlechtesten Fall dagegen als unbedeutend ausgefiltert und ignoriert werden. Die pädagogische Verantwortlichkeit erstreckt sich deshalb auch darauf, wie diese fremden Informationsbausteine in je individuelle Lernlandschaften eingepasst werden bzw. diese verändern können.
▶ Am radikalsten wird jeglicher Versuch, vorschnell Verstehensprozesse zwischen fremden und eigenen Erfahrungen anzunehmen, von den Vertretern alteritätsdidaktischer Entwürfe bestritten, die von da aus mehr oder weniger deutlich das Korrelationsdenken verabschieden. Ulrike Greiner setzt der korrelationsdidaktischen Versuchung einer Horizontverschmelzung verschiedener Identitäten die These von der bleibenden Differenz zwischen singulären Identitäten entgegen (Greiner 2000, 282) und entwickelt von da aus das Modell einer Differenzhermeneutik. Bernhard Grümme plädiert für einen Erfahrungsbegriff, »der die Andersartigkeit gegenüber einer ungebrochenen Subjektzentrierung stark macht und doch das Ankommenkönnen dieser Alterität im Subjekt bedenkt« (Grümme 2007, 144). Erfahrung wird somit immer auch Differenzerfahrung. Lernende Subjekte sind in der Auseinandersetzung mit Fremdem selbst an der Produktion von Bedeutungen beteiligt, die allerdings nicht ungebrochen vonstatten geht: »Eine kritische Subjektorientierung hingegen betont das Moment des Fremden, des Irritierenden, des Unerhörten, des radikal Neuen, des Undenkbaren, die Anerkennung der Andersheit des Anderen« (Grümme 2007, 321). Ulrike Greiner bezeichnet dies im Umgang mit der buchstäblichen Fremdheit der Glaubenstradition als ein »Lernen am ›Widerstand‹ ohne dessen ›Überwindung‹« (Greiner 2000, 280). Und Bernhard Grimme resümiert: »Gerade eine alteritätstheoretische Subjektorientierung kann die Autorität der Botschaft und damit die Bedeutung der Inhalte für den Prozess religiösen Lernens sichern, ohne die Subjekte zu überspielen. Vielmehr werden dort die Subjekte in ihrer eigenen Lebensgeschichte religionspädagogisch gewürdigt. Sie werden in ihren lebensweltlichen Erfahrungen zu Subjekten ihrer eigenen, religionspädagogisch unhintergehbaren Glaubensbiografie erhoben, die freilich immer auch in einem kritisch-prophetischen wie produktiven Dialog mit den Erfahrungen anderer Subjekte stehen« (Grümme 2007, 322). Meines Erachtens trägt gerade dieser fundamentalkritische Ansatz zur differenzierten pluralitätsfähigen Weiterentwicklung des Korrelationsgedankens bei. Denn nicht mehr »Glauben« und »Leben« stehen einander gegenüber, sondern vielfältige mögliche Glaubensformen, zu denen innerhalb eines konfessionellen Religionsunterrichts natürlich in erster Linie die eigene Glaubenstradition gehört, aber selbstverständlich auch andere, und vielfältige mögliche Lebensentwürfe - mindestens so viele, wie Schülerinnen und Schüler und die Lehrkraft in einer Lerngruppe sind. Wenn diese verschiedenen Deutungskonstrukte von Wirklichkeit - traditionelle gemeinschaftsbezogene und individuell disparate - unterrichtlich aufeinanderprallen, ereignet sich im besten Fall ein Lernen im Fragment.
Gerade die zuletzt knapp skizzierten alteritätsdidaktischen Entwürfe halte ich neben einer grundlegenden konstruktivistischen Lerntheorie für zentrale theoretische Eckpfeiler, um von daher genauer zu bestimmen, was bei erfahrungsorientierten Lernprozessen im Religionsunterricht geschieht und welche Formen der Teilhabe an fremden Erfahrungen überhaupt möglich sind. Bevor dies geschieht, muss aber noch von verschiedenen Seiten her begründet werden, wieso gerade eine performative Religionsdidaktik zur konzeptionellen Weiterführung des Korrelationsgedankens führen kann.
C. Religion erleben - Begründungsmomente
Nach der aufgezeigten Aporie bezüglich der Grenzen eines kognitiven Verstehens von Religion und der Problemskizze zum Korrelationsprinzip sollen nun positive Begründungsmomente für die unerlässliche erfahrungsbezogene Ausgestaltung religiöser Lernwege skizziert werden. Sie zielen alle in dieselbe Richtung: Belegt wird, dass eine solche Inszenierung nicht ein verzichtbares Bonuspaket darstellt, sondern unabdingbar ist, will der Religionsunterricht nicht den Gegenstand und die lernenden Subjekte verfehlen. Eine performative Didaktik wäre missverstanden, wenn sie nur »als methodisch-didaktisches Prinzip (›Handlungsorientierung‹) gilt, durch das Lernprozesse anschaulicher und deshalb nachhaltiger werden« (Dressler 2007, 281).
In einem ersten Schritt soll gezeigt werden, dass der Gegenstand Religion theologisch und religionswissenschaftlich betrachtet von seiner Eigenart her in seinen kognitiven Oberflächenstrukturen nicht ausreichend erfasst werden kann (1). Diese These wird im Anschluss daran sprachtheoretisch untermauert - wobei wir dann beim Kern eines performativen Konzepts angelangt sind (2). Da mir diese Begründung noch nicht als ausreichend erscheint, referiere ich kurz zum einen weitere theoretische Begründungslinien, die sowohl im engeren Umfeld des Performativen (3) als auch im weiteren verschiedener religionspädagogischer Ansätze angesiedelt sind(4). Zum anderen und hauptsächlich fokussiere ich meine Argumentation dann aber auf eine lernpsychologische (5) und konstruktivistische Untermauerung des in diesem Buch vorgestellten Ansatzes (6).
1. Religion »in Form«: Die Bedeutung der Praxis des Glaubens
Dass die veränderte Situation nach dem Traditionsabbruch einen veränderten Präsentationsmodus religiöser Ausdrucksformen erfordere (vgl. Englert 2002b, 33), ist ein Argument, das zunächst von der Perspektive des lernenden Subjekts aus formuliert ist. Aber auch von der Sachseite, nämlich der Eigenart der objektiven Religion aus, drängt sich die Frage auf, welche Präsentationsform denn dem Gegenstand selbst als angemessen erscheint. Derzeit wächst jedenfalls die Sensibilität dafür, »dass die Vermittlung des gelehrten Glaubens nicht ohne Bezug zum gelebten Glauben gelingen kann« (Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 2005, 24). Diese These muss begründet werden - theologisch und religionswissenschaftlich.
Religion - mehr als kondensiertes Glaubenswissen
Die Eigenart einer objektiven Religion kann nicht ausschließlich über die Ebene kognitiver Wissenssysteme erfasst werden. Denn der Versuch, Religion nur begrifflich zu fassen, verfehlt bereits bei einer religionswissenschaftlich-funktionalen Betrachtung die vielfältigen Wissensdomänen, auf die sich Religion bezieht und aus denen heraus sie sich konstituiert. Nach dem klassischen Modell von Charles Y. Glock erstreckt sich Religion auf fünf Dimensionen: Ritual, Glaube, Wissen, Konsequenzen und Erleben. Diese Dimensionen sind wechselseitig miteinander verschränkt: So ist z.B. das Ritual die Außenseite des Glaubens, aus dem Glaubenswissen ergeben sich Konsequenzen für die Lebenspraxis, im emotionalen Erleben korrelieren Glaubensüberzeugungen mit Lebensbedürfnissen usw. »Auch die christliche Religion ist demnach gleichermaßen ein existenziell erfahrenes wie kognitiv gewusstes, sie ist ebenso ein bekenntnishaft geteiltes wie betendes, feierndes und sich auf den Alltag auswirkendes Geschehen« (Porzelt 2005, 23).
Religion verstehen: Zwischen Vogel- und Froschperspektive
Wenn also Religion in ihrer ganzen Breite und Tiefe erschlossen werden soll, darf sich der Religionsunterricht nicht nur auf die Ebene des kondensierten Glaubenswissens beschränken, sondern muss auch die verschiedenen Ausdrucksdimensionen, Lebensbezüge und Erfahrungsdimensionen verstehbar machen. Das kann aber von einer reinen Vogelperspektive aus nicht gelingen. Denn dem religionswissenschaftlichen Zugriff von außen auf das komplexe System Religion sind schon deshalb Grenzen gesetzt, weil der Gegenstand hier nur von der Rolle des Beobachters aus in den Blick kommt. Der Religionswissenschaftler beteiligt sich ja nicht an der beobachteten Religion, er analysiert sie von außen. Eine solche Beschränkung auf die Beobachterperspektive würde dem Bildungsverständnis, das dem Religionsunterricht zugrunde liegt, nicht gerecht werden. Denn im Religionsunterricht wird nicht nur der distanzierte Blick von außen auf Religion und Religionen gerichtet, das Fach intendiert nicht nur eine halbwegs religionskundliche Außenerfassung des Gegenstands Religion, es zielt vielmehr auf eine vielfach ausgestaltete und auszugestaltende religiöse Kompetenz, die sich auch auf den Umgang mit der eigenen Religion bezieht.
Bernhard Dresslers Bild vom »Froschvogel«, das er in mehreren unveröffentlichten Vorträgen verwendet hat, bringt diese doppelte Perspektive für die Herausforderung, der sich religiöse Bildung in postmoderner Pluralität heute stellen muss, treffend auf den Punkt. Man kann und muss Religion gleichzeitig aus der Froschperspektive miterleben und aus der Vogelperspektive kritisch betrachten. Durch die Verschränkung beider Perspektiven ergibt sich ein vertieftes Verständnis von Religion. Dabei dürfen diese beiden Blickwinkel nicht gegeneinander ausgespielt werden. Dasselbe gilt auch für die »vier Modi einer schulischen Vermittlung von Religion« (religiöses Probehandeln im Unterricht, Wechsel des Lernortes, Erkundung religiöser Zeugnisse im Unterricht selbst, religionskundliche Phasen und Elemente im Unterricht), die Burkard Porzelt benennt (Porzelt 2005, 26-29), die als einzelne erst in ihrer wechselseitigen Verschränkung didaktisch gerechtfertigt werden können.
Von der Eigenart des christlichen Glaubens
Diese Skepsis bezüglich der Möglichkeit, die vielfältigen Dimensionen von Religion von außen und über primär kognitive Modi zu erschließen und verstehen zu können, wird vertieft, wenn man die Frage inhaltlich auf die Eigenart des christlichen Glaubens konkretisiert. Die folgenden Argumente, mit denen die performative Eigenart des Gegenstands begründet werden soll, beziehen sich deshalb enger auf die christliche Religion - geschichtlich und systematisch.
Christentum als Lebens- und Erzählgemeinschaft
Dass der Versuch, die christliche Religion über dogmatische Aussagen allein zu erschließen, letztlich ortlos ist, zeigt bereits ein Blick in die Geschichte des Christentums: Das Christentum entstand nicht als Lehreinrichtung, sondern als Lebens- und Erzählgemeinschaft derer, die vom Christusereignis getroffen wurden. Die theologische Reflexion war deshalb immer nachrangig gegenüber der christlichen Praxis. Das Widerfahrnis der Christusbegegnung war für die Jünger Jesu der Auslöser für die Reflexion, Konstruktion und Weitergabe des dann zunehmend verbal konturierten Glaubens. Dabei zeigt gerade die erste Phase des Christentums, dass die Weitergabe des Glaubens nicht im Sinne der Belehrung in einer philosophischen Wissensdomäne konstituiert wurde; am Anfang stand keine Idee, sondern ein »Ereignis, das erzählt und/oder rituell vergegenwärtigt wird« (Dressler 2007, 282).
Wissen durch Mitgliedschaft
Also kann die christliche Religion nicht mitgeteilt, ohne immer zugleich auch in ihren Vollzügen konkretisiert und dargestellt zu werden; man kann nicht theoretisch Christ werden, sondern nur mit seiner ganzen Existenz. Bereits das Wort »Katechese« besticht hier durch seine Mehrdeutigkeit. Katechein heißt »mitteilen« und »unterweisen«. Es geht also um die Mitteilung einer Botschaft und eine Unterweisung in ihr; Inhalt und Form einer Einführung in den Glauben können voneinander nicht getrennt werden. Bereits die Würzburger Synode verwies auf diese soziologische Eigenart des Glaubens im Sinne eines »Wissens durch Mitgliedschaft« (Der Religionsunterricht in der Schule 1976, 2.7.2). Eine performative Didaktik ist also theologisch von seinem Gegenstand her begründet, »insofern Religion eine Praxis ist, also mehr als ein kognitiver oder mentaler Gehalt, der durch einen verbalsprachlichen Ausdruck zu erfassen wäre« (Dressler 2007, 281).
Der Spagat wird sein, diese Eigenart des Gegenstands zu sichern und zugleich der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es sich im Religionsunterricht eben gerade nicht um Katechese und ein »Christ-Werden« handelt.
Vom Überschuss der Form
Das Christentum an sich kann also nicht verstanden werden, wenn man nicht auch mit der Christentum-Praxis vertraut wird. Auf analoge Weise bleibt auch die Grundstruktur des geoffenbarten Glaubens insgesamt ohne Berücksichtigung der Form unverständlich: Deutliche Belege für diese These sind beispielsweise die Berufungsgeschichte des Mose vor dem brennenden Dornbusch oder die Emmaus-Perikope, die jeweils nicht ohne die narrative und bildliche Gestalt verstehbar sind und deshalb auch nicht satzhaft reduziert werden können. Auch die Botschaft Jesu vom Reich Gottes lässt sich nicht satzhaft verkürzt zusammenfassen, sie lebt von der Erzähldynamik der Gleichnisse in ihren Erzählkontexten und den immanenten Handlungsaufforderungen.


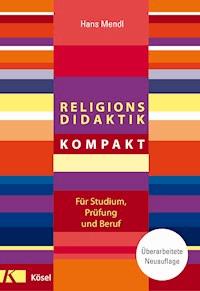














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











