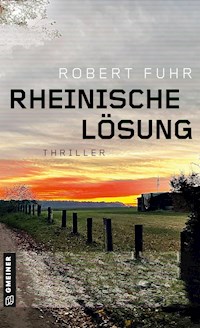
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Thriller im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Welt seiner Familie besteht, seit Karl Ruf denken kann, aus einer Firma, die von sogenannten „Staatsaufträgen“ lebt. Allesamt haben sie mit dem Militär zu tun. Als Karl angeboten wird, eine künstliche Intelligenz zu vermarkten, an der alle großen Geheimdienste Interesse haben, sieht er die Chance, das in Schieflage geratene Familienunternehmen zu retten. Sofort lässt er seine Kontakte zur US-Regierung spielen. Zu spät merkt Karl, dass es noch unbekannte Mitspieler gibt. Er gerät immer tiefer in ein Chaos von Attentaten, Morden und Gier. Eine scheinbar ausweglose Situation. Schließlich wählt er die einzig mögliche Lösung …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 458
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Fuhr
Rheinische Lösung
Thriller
Zum Buch
Die Macht am Niederrhein Die Familie Ruf verkauft Sicherheitstechnik und Know-how an wichtige Institutionen und Persönlichkeiten. Doch durch politische Intrigen geraten das Unternehmen und damit das komplette Vermögen der Familie in Schieflage. Für Sohn Karl gibt es nur eine Option, er muss Geld beschaffen – egal wie. Als er die Chance bekommt, eine künstliche Intelligenz zu vermarkten, ist er hin- und hergerissen zwischen der Rettung seiner Familie und seiner Moral. Die künstliche Intelligenz, die er voranbringen soll, eröffnet Chancen – eine Medizin für jede Krankheit, eine Lösung für jedes Problem zu finden. Doch diesen unschätzbaren Vorteilen stehen die Gefahren eines totalen Überwachungsstaats mit all seinen Nachteilen gegenüber. Als mysteriöse Mordfälle an einigen Beteiligten das gesamte Projekt überschatten, entschließt sich Karl zu einem unvorhersehbaren Ausweg aus dem moralischen Dilemma …
Robert Fuhr, 1962 in Mönchengladbach geboren, studierte in Köln und Mönchengladbach BWL. Anschließend absolvierte er ein Maschinenbau-Traineeprogramm und wickelte militärische Staatsaufträge auf der ganzen Welt ab. Bereits seit seiner Kindheit betreibt er Kampfkünste: Kenpo Karate, philippinische Kampfkünste, französisches Savate und russisches Systema. Zum Schreiben seiner authentischen Krimis kam er durch Ereignisse, die sein Leben vollkommen auf den Kopf stellten. Heute betreibt Robert Fuhr eine Schule für Kenpo Karate und Management-Training in Mönchengladbach. Wenn er nicht gerade auf einem seiner Motorräder die Eifel „unsicher“ macht, lebt er mit seiner Frau Monika und der Bulldog-Hündin Fallon in Wegberg.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Robert Fuhr
ISBN 978-3-8392-7370-8
Vorwort
Die Krimis, die ich schreibe, sind authentisch, was nichts anderes bedeutet als glaubwürdig.
Dies erreicht ein Autor entweder durch ein hohes Maß an Fantasie oder durch genaue Beobachtung und eigene Erlebnisse.
Ich bevorzuge die zweite Methode und vermute daher einen erschreckenden Mangel an Fantasie bei mir.
Prolog
Als Karl den Kopf hebt, glaubt er, sich in einem Traum zu befinden. Er sieht durch das Glasdach seines Wagens Vögel auffliegen, riecht nasses Gras durch die geöffnete Scheibe an seiner Fahrertür. Er nimmt den frisch gepflügten Acker wie einen dumpfen Unterton seiner Emotionen wahr, die er ganz und gar nicht einordnen kann, außer einer: Ihm ist schlecht in der Magengegend, als hätte man ihm hineingeschlagen. Erst dann bemerkt er, dass er sich mitten in dieser merkwürdigen Szene befindet. Alles ist Realität. Er schnallt sich vom Gurt los, öffnet die Fahrertür, versucht auszusteigen, fällt aber sofort ins Gras. Seine Beine versagen. Sein alter Bekannter, an den er sich nie gewöhnen würde, ist mal wieder da: der Schock. In der Bodenlage kann er wenigstens die Unterseite seines Wagens sehen, die voller Erdreich ist, der Frontspoiler ist abgerissen. Er muss irgendwo verloren gegangen sein. Die gute Nachricht, denkt er: keine Anzeichen eines Sprengsatzes. Er erinnert sich nicht daran, was passiert ist. Kein anderes Fahrzeug in der Nähe, kein Mensch, keine sichtbare Unfallursache, nur er war dort. Er denkt sofort wieder an einen Anschlag. Es war keine Bombe. War es ein Projektil? Aber da ist nichts, soweit er es sehen kann. Kein Einschuss, nicht einmal ein Kratzer am Lack. Ihn, der nicht in Israel draufgegangen war, nicht in Afrika, nicht in den USA, sollte es hier vor seiner Haustür erwischen?
Jetzt umgibt ihn Frieden, eine Ruhe, die er nur aus der Wüste kennt. So laut, dass sie ihn anschreit, darüber nachzudenken, was bloß passiert war. Langsam kehrt die Erinnerung wieder, so langsam, dass er ungeduldig mit sich selbst wird. Er beschließt, sich einfach Fragen zu stellen, damit er wieder in der Realität landen würde: Wozu hatten sie ihn getrieben, wozu hatte er sich getrieben? Er erinnert sich an die Waffe mit einem Schock, der ihn ganz ins Hier und Jetzt holt. Er kennt die Waffe, er kennt den Ursprung, die Erfinder, die Konstruktion. Er hatte sie mitentwickelt, sie erst waffenfähig gemacht. Am Schluss hatte er sie verkauft. Wozu hatte er das getan? Er erinnert sich nicht mehr für einen Moment, bis sie wiederkehrt, diese Erinnerung, blass, fast zart. Diese Erinnerung, die sein Leben komplett bestimmt hat, ist jetzt kaum mehr als ein Schatten in seinem Hirn. Jetzt erscheint sie ihm als unwichtig: das Geld.
Besser gesagt: das Geld zum Überleben seiner Familie, was die Sache rechtfertigt, aber keinesfalls besser macht. Es ist ihm klar, dass er es anders schaffen würde, es müsste ohne die Waffe gehen, aber nur mit der Waffe kann er es schaffen, sie zu eliminieren; auch wenn es nur für eine kurze Dauer war. Ihm wird klar, dass er daran weiterarbeiten müsste.
1. Israel
Es ist nicht statthaft, aus dem Lande Israel ins Ausland auszuwandern.
Babylonischer Talmud
Als Karl über 30 ist, glaubt er, angekommen zu sein: Frau, Haus, Porsche und einen Job, der ihn heute da und morgen da sein lässt. Ein Traumjob für seine Freunde, Routine für ihn. Er wundert sich kaum noch, dass auf den Zeichnungen für seine »Spezialtore« nach der Aufsicht durch einige staatliche Stellen Maße eingetragen sind, die keinen Sinn ergeben, weswegen er immer eine sogenannte Naturmaßnahme durchführen muss. Sein Job bringt Geld, sehr viel Geld, obwohl es ihm als nicht wichtig erscheint. Er hat genug davon und nicht wirklich die Zeit, es zu genießen.
Heute ist er 35, und alles ist anders. Er hat nichts bemerkt; weder warum seine große Liebe Silke sich von ihm getrennt hat, noch wie das Schiff seiner Firma langsam leckzuschlagen scheint. Was ihm bleibt, ist die Bulldogge zumindest phasenweise für Spaziergänge, ein paar Möbel, die weitgehend seine Erbstücke sind, sein Dienstwagen. Er zieht in eine Penthouse-Wohnung in einem der Häuser seiner Eltern. Noch gehören sie seiner Familie, aber der Druck der Banken wächst – trotz der Gelder, die sie auf allen Besitz aufgenommen haben. Geld ist wohl immer nur wichtig, wenn man keines mehr hat, denkt Karl oft. Genau da setzt seine neue, alte Welt wieder an: beim Geld. Er braucht dringend Aufträge, um genauer zu sein, lukrative Aufträge, deren Fertigungsmaterial er aber kaum noch vorfinanzieren kann, weil die Banken seine »finanzielle Krawatte« immer enger drehen.
An einem wirklich sehr kalten rheinischen Wintermorgen merkt Karl die aufziehende Nässe ganz besonders. Er hat eine Menge Nasenbrüche hinter sich, um genau zu sein, 14 nach der letzten Computertomografie. Bänderrisse, Rippenbrüche, einiges eben nach einem Leben als Kampfsportler. Genau da merkt er die Nässe als Erstes: in den Brüchen. Schon mit 33 Jahren fällt ihm das Aufstehen morgens schwer. Nach dem morgendlichen Bad in Salzlake, meistens ist es Totes-Meer-Salz, ist er erst richtig Mensch, wie er sich oft sagen hört. Heute ist wieder so ein Tag. Er braucht die nasse Straße nicht aus dem Fenster zu sehen, seine Knochen sprechen vorher zu ihm. Wie eigentlich immer, wenn er keinen frühen Flug bekommen muss, steht er um 6 Uhr auf; besser gesagt, muss er aufstehen, um alles für den Tag in den Griff zu bekommen. Im Dunkeln aufstehen, ist das, was er am meisten hasst, mehr noch als die Schmerzen. Der Tagesbeginn ohne Tageslicht, anzufangen zu arbeiten wie eine willenlose Maschine, ist Höchststrafe für ihn. Er badet wie immer, rasiert sich wie immer. Spätestens beim Rasieren sind wieder all seine Probleme da: die Banken, die Regierung, die vermeintlichen Freunde, die ihn haben sitzen lassen. Er zwingt sich, es loszulassen, denn negative Gedanken haben noch niemandem genutzt, ganz im Gegenteil. So ist er ausgebildet worden; so ist seine Philosophie.
Noch im Auto ruft ihn Reuven Ksir an. Er sagt, dass er einen Auftrag habe, dass Karl nach Israel kommen solle. Karl mag den Gedanken an das warme Mittelmeerland sehr, aber Zeit hat er auch nicht wirklich.
»Bitte, Reuven, nicht wieder so ein Kleinmist!«
Reuven legt allen Pathos eines Mannes in die Stimme, der wirklich etwas will: »Nein, nein, Karl, es geht darum, Militärmaschinen zu sichern, ein riesiges Tor mit dem Schutz des Umfeldes. Du lieferst das Tor, dann kommt noch ein fetter Auftrag als Consultant für die Beratung dazu. Wir brauchen dich hier!«
Reuven hat es wieder einmal geschafft: Karl ist angefixt. Trotzdem gibt er sich militärisch kühl: »Daten?«
»Ich schätze, zwei bis drei Millionen US-Dollar!«
Karl will mehr wissen, das so schnell wie möglich: »Wer finanziert?«
Reuven weiß spätestens jetzt, dass er ihn am Haken hat: »Lass das meine Sorge sein. Ich habe da eine US-Stiftung, die deine Bank sein wird!«
Karl kann es sich nicht leisten, eine Vergnügungsfahrt zu machen in der prekären Situation, in der seine Firma steckt: »Du weißt, dass ich nicht bürgen kann. Die Banken geben mir für Vorauszahlungen von einem Kunden keinerlei Bürgschaften!«
Reuven ist schnell mit seiner Antwort. Überlegen in seiner Position, nahezu voraussendend, sagt er: »Wenn wir uns einig werden, bürgt der Staat Israel für dich!«
»Wann und wo melde ich mich, Sir?«
Reuven ist genauso knapp, weil er weiß, dass jedes weitere Wort zu viel ist: »Sei bitte morgen um 10 Uhr in der israelischen Botschaft. Da erledigen sie die Formalitäten sehr schnell. Glaub mir, die werden sehr schnell sein. Ich habe dein Kommen letzte Woche schon angekündigt.«
Karl weiß, was zu sagen ist, ohne die Unverschämtheit, über seinen Kopf hinweg zu planen, zu würdigen: »Roger and out!« Dann legt er auf. Karl lächelt, ist zufrieden, einen Auftrag zu übernehmen, dabei aus der Kälte zu kommen in dieses wunderbare Land; ganz zu schweigen davon, den Banken ein Schnippchen geschlagen zu haben.
Deutschland widert ihn manchmal an mit seinen Vorschriften, Regeln, vor allen Dingen mit der Bürokratie, deren beamtenschaftliche Blüten ihn schon von jeher auf die Palme trieben. Diese Typen, deren Leben nur auf Vorschriften beruht, damit sie sich jeder menschlichen oder sinnvollen Verantwortung entziehen können. Israel ist anders, ganz anders. Die Dinge müssen funktionieren. Das ist die oberste Maxime. Er ist lange nicht mehr in Israel gewesen. Teilweise fand seine Ausbildung dort statt. Manchmal hat er die eine oder andere Beratung dort abgewickelt. Karl befürchtet, als er fliegt, schon, Ronny könnte ihn abholen, der ihn zu seiner damaligen Ausbildungsstätte gebracht hat. Sie können sich nicht leiden, weil Ronny ihm die Mitschuld am Holocaust gibt. Widersinnig, emotional, aber deutlich spürbar unausgesprochen. Er hält alle Deutschen für Bestien, die man nicht erwecken sollte aus ihrem Pazifistenschlaf. Er fürchtet die Deutschen, wobei sein Mittel der Wahl die Ablehnung ist – in Ermangelung besserer Mittel gegen einen Verbündeten. Während der Monate in Israel war er der Einzige, der Karl genau das spüren ließ. Alle anderen sind froh, dass sie leben und wie sie leben. Der Terror, der Krieg, die ständige Unsicherheit, das warme Klima lässt sie jeden Tag leben wie den letzten Tag, den sie auf der Erde verbringen würden.
Karl nimmt sich seit dieser Zeit vor, es ihnen gleichzutun, genau das zu fühlen, genauso intensiv zu sein in allem, was er tun würde. Eine Woche business as usual, dann ist der alte Trott wieder stark genug, um das meiste davon zu vergessen. Das Aufsetzen der Maschine reißt Karl aus seinen Gedanken.
*
Er steht auf, nimmt seine Sachen aus dem Gepäckfach, zwängt sich mit den Mitreisenden durch den Gang. Als er die Treppe hinuntergeht zum Flugfeld, steht sie da. Es ist einer der wenigen Momente der Gewissheit, die man im Leben hat. Gewissheit, wer sie ist; Gewissheit, was passieren wird. Unausweichlich! Nicht eine Beziehung oder Heirat, nicht die große Liebe, vielleicht nicht einmal Freundschaft, aber etwas anderes, was weder zu beschreiben noch aufzuhalten ist. Es ist die Art der Anziehung, die man ausdrücken will, ausdrücken muss, es jedoch niemals kann. Die einzige Möglichkeit, es zu versuchen, ist Sex, aber das reicht nicht aus, wie jeder schon vorher weiß. Trotzdem wird nichts anderes passieren, sondern genau das. Lange schwarze Locken, schwarze Augen, ein einfaches weites Leinenkleid, kurz, hellbeige. Sonst hat sie nur ein Lächeln angezogen.
»Ich bin Raquel und hole Sie ab«, spricht sie ihn lächelnd an.
»Hallo, Raquel, ich bin Karl, aber das wissen Sie ja schon … Da Sie an der Treppe am Flieger stehen trotz der höchsten Sicherheitsvorschriften der Welt, weiß ich auch, wer Sie geschickt hat!«
Raquel muss lachen, nicht aus Höflichkeit, sondern weil sie ihn zu mögen scheint. Auf den ersten Blick.
»In dem Fall muss ich mich vorstellen als Major Raquel Weizmann!«
Karl schmunzelt, sieht einen kurzen Moment auf den Boden, um das Lächeln zu verbergen: »Bitte nicht salutieren auf dem Flugfeld, nicht vor einem Zivilisten. Das würde die Tarnung auffliegen lassen.«
Raquel mag den Mann, lächelt bezaubernd und merkt ironisch an: »Jetzt kommen Sie aber. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, hier Witze zu machen, Zivilist Karl!« Sie betont Zivilist fast wie eine scherzhafte Beleidigung. Ganz sicher mit sehr viel Ironie.
Kaum aus der Halle, steigen sie in einen unauffälligen alten Renault. Raquel sagt, dass sie das Fahrzeug noch ein paar Mal wechseln würden, bevor es zur Botschaft gehe. Seine Koffer und die Ausrüstung seien bereits da. Sein Ingenieur aus Deutschland werde in einer Stunde landen. Man werde sich um ihn kümmern. Raquel ist überaus gesprächig in charmanter Konversation. Sie reden über Ronny, darüber, was für ein schwieriger Mensch er sei, dass er den Deutschen die Kollektivschuld für den Massenmord an den Juden gebe.
Sie sagt, er gehöre zu jenen, die es den Überlebenden des Holocaust nicht einmal verzeihen würden, dass sie überlebt hätten. In Israel habe es deswegen sehr viele Demonstrationen gegeben.
Karl geht einen Moment in sich. Er grübelt mal wieder über die verdrehte Welt, als ihm auffällt, dass wohl die attraktivste Frau der Welt neben ihm sitzt und sich charmant um ihn bemüht. Er hat es kaum bemerkt, aber sie flirtet mit ihm. Noch viel weniger hat er bemerkt, wie gut es ihm tut. Irgendwann platzt es aus ihm heraus, er könnte sich direkt dafür ohrfeigen, weil es verfrüht, weil es überhastet ist, weil er, als er es gesagt hat, sich ganz sicher ist, dass diese dumme Frage alles zerstören wird: »Dürfen Sie mit mir zu Abend essen?«
Wie konnte er nur dermaßen dumm und plump sein? Er weiß doch, wie »das Spiel« läuft: vorsichtige Annäherung statt eines plumpen Spruchs.
Jetzt sitzt er da, unendliche zwei Sekunden in der Erwartung, die verbale Ohrfeige zu bekommen, die er sich redlich verdient hat.
Raquel tut erleichtert: »Puh … seid ihr Deutschen kompliziert …! Also erstens entscheide ich, mit wem ich ausgehe, solang Sie kein Staatsfeind sind. Das scheint mir eher nicht der Fall zu sein.«
Auweia, denkt Karl, jetzt kommt die Klatsche … »Und zweitens?«, fragt er zögerlich.
Raquel nimmt die Frage sofort auf: »… und zweitens habe ich gedacht, dass du wohl nie mehr fragen würdest, denn wir sind gleich da. Du musst wissen, dass ich echt alles gegeben habe …!«
Beide lachen laut. Ein Lachen der Erleichterung, der Freude. Fast wie Kinder, fast unschuldig. Sie verabreden sich für den Abend. Raquel will um 20 Uhr in seinem Hotel sein, um ihn in ein Lokal am Meer auszuführen. Wie eigentlich immer, wenn man einen Touristen beeindrucken will, denkt er etwas enttäuscht.
Raquel wechselt das Thema. Sie ist schließlich geschäftlich bei Karl. »Du triffst Helger noch heute um 13 Uhr. Der Oberst holt ihn ab!«
Helger ist einer der Ingenieure aus der Firma. Er ist der Spezialist für Flugzeughallentore. Ingenieur durch und durch. Ein Technokrat der reinsten Sorte. Karl fragt, mehr um das Gespräch nicht abreißen zu lassen: »Wer ist denn der Oberst?«
Raquel ist erstaunt: »Na, Reuven. Den kenne ich nur als Oberst Ksir!«
Karl tut erstaunt: »Wusste gar nicht, dass er so ein hohes Tier in der Reserve ist!«
Raquel glaubt ihm kein Wort, als sie leicht ironisch antwortet: »Da habe ich auch kein Geheimnis ausgeplaudert. Reuven kennt jeder in Israel!«
Sie sind angekommen, verabschieden sich, Raquel regelt die Formalitäten an der Rezeption. Karl geht nach kurzer Verabschiedung auf sein Zimmer, um die Kleidung zu wechseln. Er liebt es, endlich aus dem Anzug zu kommen in das, was er als wirkliche Kleidung empfindet. Es ist wie eine Befreiung aus der Welt, die er nicht mag; der Welt, in der er das Leben anderer Menschen lebt mit ihren ungeschriebenen Gesetzen, von denen eines »Anzug und Krawatte« heißt. Auch wenn ihm seine Eltern noch so am Herzen liegen, ist das auch ihre Welt, die er gerade verlässt. Seine Cargohosen, das T-Shirt, das Drillichhemd als Jacke darüber getragen: Das ist seine Welt. Hier und an diesem Ort zieht er keine schwarzen Sachen an wie in Europa. Zum einen wegen der Sonne, zum anderen wegen der blöden Witze, die man machen würde wegen der deutschen Vergangenheit. Also wählt Karl einen hellen Ton, der an Kitt erinnert. Er zieht seine Militärstiefel an, denn er vermutet, dass es dahin geht, wo man nie weiß, worauf man tritt: in die Wüste. Er schafft es gerade noch, fertig zu werden, bevor sein Handy klingelt. Helger ist in der Leitung. Er berichtet, dass er startklar sei. Sie könnten loslegen. Er warte in der Halle.
Helger ist ein Mann in mittleren Jahren. Man könnte die Vermutung anstellen, dass er immer schon in diesem Alter gewesen sei, wenn man ihn ansieht. Nichts an ihm deutet auf eine mögliche Jugend hin, in der er vielleicht etwas Unbedachtes getan haben könnte. Er ist ein ziemlich guter Techniker, der sich vom Schlosser zum Ingenieur hochgearbeitet hat. Ziemlich gut bedeutet, dass man ihm nicht zu viel Freiheit in der Verhandlung oder auf der Baustelle geben darf. Er hat die Neigung, bereits verkaufte Ware so zu optimieren, dass es auf Kosten seines Arbeitgebers geht. Immer geht es nur darum, sich wichtig damit zu machen, zu zeigen, dass es technisch immer noch besser geht, was seinen Status erhöht. Helger ist mittelgroß, hat mittleres Gewicht, sieht mittelgut aus. Er ist die Personifizierung des Durchschnittsdeutschen. Karl schätzt ihn aufgrund seines soldatischen Wesens: Er ist immer zur Stelle, immer pünktlich, immer korrekt. Heimlich verachtet er ihn auch wegen einer der schlimmsten Eigenschaften, die er kennt: chronischer Geiz! Er trug so lange die Hemden aus den 70er-Jahren in Orange oder Gelb mit langen Krägen, bis Karls Vater das als unzumutbar für die Kundschaft empfand. Natürlich sagte Ruf senior es ihm.
Ganz Soldat, fügte er sich, was seinen Geschmack mit dem Hang zum Geiz allerdings nicht beeinflusste. Jetzt ist seine Kleidung zwar moderner, aber man sieht »das Billige« trotzdem überall durchscheinen. Er fährt einen Diesel. Nicht, weil er die Umwelt schonen wollte, sondern weil er alleine damit 24.000 Euro netto im Jahr zusätzlich auf Firmenkosten »einfahren« kann.
Nie geht er an einer Raststätte mit den Kollegen essen, sondern hat immer seine Butterbrotdose dabei, deren Inhalt er gierig am Wagen vertilgt. Nie lädt er jemanden ein, nicht einmal zu einem Getränk, lässt sich aber jederzeit gerne einladen. Karl ist mehr als angeekelt von Helgers Musikgeschmack, der die übelste Sorte der Deutschtümelei ist; trotzdem, an guten Tagen ist Helger ihm nicht unsympathisch. Die Gespräche sind unkompliziert, aber nicht ohne Niveau. Geradezu entspannend. Jetzt begrüßt er Helger in Israel.
Helger kommt freudig auf Karl zu: »Hallo, Chef, guten Flug gehabt?«
Karl entgegnet: »Ja, danke, und Sie auch, wie ich sehe!« Karl sieht auf Helgers Imitatjeans, auf eine Art Paisleyhemd in einer Farbe, die keinen Namen verdient. Karl kann es nicht fassen. Der Mann ist nicht einmal schlecht angezogen, er ist grauenhaft angezogen. Karl setzt die Sonnenbrille auf, denkt, dass er sie jetzt wirklich gebrauchen könne, wenn er nur auf das Hemd blicke: »Lassen Sie uns gehen«, sagt er.
Helger nimmt die Tasche mit den Messwerkzeugen, Karl den Metallkoffer mit den Plänen.
*
Sie fahren aus der Stadt, wechseln zweimal das Fahrzeug, wie man es vorgeschrieben hat.
Als Karl die beiden Männer mit einer Helmbrille auf sich zukommen sieht, sagt er: »Nicht schon wieder! Wisst ihr denn nicht, das wir auf eurer Seite sind?«
Einer der Männer antwortet in gebrochenem Englisch: »Ja, aber die Folterknechte, die euch vielleicht mal zu fassen kriegen, sind nicht auf unserer Seite. Also setzt die Nullsichtbrillen auf. Immer noch besser als die Säcke, die man ihnen früher über den Kopf gezogen hatte bei der Bullenhitze!«
Helger schluckt so laut, dass es alle gehört haben müssen: »Wie beruhigend, das mit den Folterknechten!«
Karl schmunzelt: »Wir haben doch alle ein Berufsrisiko, oder?«
Darüber kann Helger nicht lachen, nicht einmal schmunzeln; sowieso ist sein Humor auch mehr der »Schenkelklatsch-Humor« von jemandem, der über die Torte im Gesicht eines anderen lachen kann. Karl beneidet ihn auch manchmal darum, mit den ganz kleinen Dingen des Lebens zufrieden zu sein. Seine geliebten Bratkartoffeln, die er jeden Abend haben musste, seine Dick und Doof-Videos, die Freude, wieder einmal etwas gespart zu haben, weil er eingeladen wurde. Karl nimmt die Brille, fühlt den Luftzug der angedeuteten Schläge, die auf sein Gesicht zu rasen, obwohl er nichts sehen kann.
»Zwei«, sagt Karl.
»Was meinen Sie mit zwei?«, fragt einer der Männer.
»Es waren zwei Schläge. Sie kamen von vorne. Wahrscheinlich eine rechte Gerade, weil Sie ja Rechtshänder sind«, sagt Karl.
»Wer hat Sie ausgebildet?«, fragt der Mann mit dem starken Akzent.
»Sie waren es!«, kommentiert er.
Karl hört die Männer lachen, freundlich, aber überrascht. Er hört noch, wie einer sagt, dass man sie nicht über seine Vergangenheit unterrichtet habe. Genau diese Information wollte Karl haben. Jetzt weiß er, dass es nur niedere Ränge des Militärs sein können, die nicht die höheren Weihen der israelischen Dienste hatten. »Frontschweine«, die die Wüste sehr gut kannten. Irgendwie ist Karl beruhigt, denn er hat es mit Praktikern zu tun.
Sie fahren eine Weile. Karl versucht gar nicht erst zu erkunden, wohin es geht. An der Veränderung der Luft allerdings merkt er, dass sie in die Wüste fahren: trocken, heiß, Sandgeruch. Er muss über sich lachen, denn er hat seine Nase gebraucht, um festzustellen, dass es Sand ist, obwohl er ihn schon auf seinen Lippen und Zähnen hat. Säcke über dem Kopf wären wohl doch effektiver gewesen. Die Geräusche der Stadt lassen mit jeder Minute nach, was seinen Verdacht bestätigt, dass es raus geht in die Wüste.
Ein Camp mit einem Hangar. Wahrscheinlich für Kampfjets oder Transportmaschinen. Offiziell natürlich für Passagierflugzeuge, wie meistens. Als sie ankommen, die Brillen abgenommen bekommen, sehen sie den Hangar.
Helger sagt, dass die Öffnung wohl 120 Meter breit und 18 Meter hoch sei, »Transall oder Sonstiges.«
Karl sagt, dass sie das nichts angehe, sie ihre Arbeit machen müssten. Als alles aufgemessen ist, fahren sie weiter in die Wüste, ohne dass man ihnen die Brillen wieder aufgesetzt hätte. Man vermutet wohl, dass sie jetzt ohne jeden Anhaltspunkt so gut wie nichts mehr im Gelände ausmachen könnten. Sie fahren zu einem größeren Außenposten, man wolle Karls Meinung zur Sicherung hören, sagt einer der Männer. Als sie ankommen, begrüßt sie ein Hauptmann: Sarah Izak. Die beiden Begleiter werden sehr herzlich von Sarah begrüßt. Sie fallen sich in die Arme, lachen, scheinen dann einige Witze auf Hebräisch zu reißen. Karl fühlt sich in seiner Annahme über die Ausbildung der beiden bestätigt: Frontschweine. Sarah ist sehr freundlich. Sie diskutiert mit Karl über die Sicherung des Lagers, was man noch tun könnte, vor allen Dingen, wie man es mit wenig Mitteln schnell voranbringen könne. Karl gibt alles, aber er kann kaum verbessern, was er sieht. Vielleicht wollte sie auch nur eine Bestätigung dafür, alles getan zu haben.
Es geht so lange, bis Helger ein leichtes, aber unverkennbares Beben des Bodens wahrnimmt nach einem dumpfen Grollen. Er wird unruhig. Die Begleiter schauen ruhig, fast unmerklich, auf die Uhr nach jeder weiteren Erschütterung des Bodens. Nach circa 20 Minuten folgt dem Beben ein Einschlaggeräusch. Die Begleiter fangen an zu zählen. Dann sagt einer der beiden, dass sie jetzt gehen müssten, weil die Granaten nur noch 15 Minuten entfernt seien. Karl verabschiedet sich von Sarah. Sie sagt »Schalom«. Karl antwortet mit »Schalom alechem«. Dann geht er weg, aber er kann nicht so einfach gehen. Nicht so. Er dreht sich dann wieder zu Sarah um, die ihm nachsieht: »Wir sehen uns nächstes Jahr … in Jerusalem!«, sagt Karl mit einem Lachen. Das hat Reuven ihm beigebracht als das Äquivalent zu »Viel Glück!«.
Sarah lacht, strahlt über das ganze Gesicht: »Ich sehe dich nächstes Jahr in Jerusalem, Deutscher!«
Er denkt noch, dass sie es gebrauchen kann, denn Schalom bedeutet »Friede«.
*
Helger sitzt sichtbar nervös im Wagen, während Karl darüber nachdenkt, was wohl passieren könnte. Wie von seinem Körper ein Stück entfernt, intellektualisiert er die Situation. Das ist es, was Karl immer tut, wenn er in so einer Situation steckt. Es vertreibt damit die Angst, die Zweifel; es spendet die Hoffnung, aus der Lage herauszukommen; es zeigt Alternativen auf; vor allen Dingen lenkt es ab vom möglichen Schlamassel, der jede Sekunde bevorstehen könnte. Es lässt ihn cool erscheinen, was wichtig ist, um nicht das Gesicht zu verlieren, wie er von seiner Ausbildung weiß. Scheint er nervös oder aufgeregt, fällt der Respekt der Frontschweine. Fällt der Respekt, fällt zuerst die Achtung, später das Vertrauen. Er könnte jetzt sterben – und was dann? Er hat keine Frau, keine Kinder … Was hatte er geschaffen? Geld? Wer würde ihn vermissen? Die Eltern sicher, aber sie wären auch aus der Finanzkrise, denn Karls Lebensversicherung ist extrem hoch, und sie sind die Begünstigten. Wofür lebt er? Vielleicht war der Tod auch nur wie ein wunderbarer Schlaf; ein Schlaf, nach dem er sich manchmal sehnte, allerdings wäre es auch seine Aufgabe gegenüber den Banken, den Regierungsangestellten, die ihn haben fallen lassen, noch einmal aufzustehen. Er ist gerade 35 Jahre alt, und auf einmal ist alles egal; auch das Geld.
Karl wird durch den Begleiter aus seinen Gedanken gerissen, als dieser Helger fragt, ob er Angst habe. Erst da bemerkt Karl, dass man die Einschläge jetzt hören kann. Sie hatten nicht ihn gefragt, sondern Helger. Seine Gedanken sind jetzt bei Sarah, er denkt, dass sie sich sicher zu helfen weiß. Sie hat erzählt, dass sie bereits fünf Jahre im Krieg sei, der kein offizieller Krieg ist.
Karl hört erst jetzt Helger die Frage beantworten: »Sicher habe ich Angst!«
»Wovor?«, fragt der Mann mit dem starken Akzent.
»Wovor? Sie haben Nerven! Ich habe Angst, dass uns eine Granate trifft!«
»Also Angst vor dem Tod?«, fragt der Begleiter: »Sie sorgen sich, wie Sie sterben, aber wann, wann haben Sie sich einmal Gedanken darüber gemacht, wie Sie leben? Willkommen in Israel, Herr Helger!«
Karl durchfährt es von Kopf bis Fuß. Das ist die Antwort auf all seine Fragen. Der Kerl ist ein verdammtes Genie. Jetzt weiß er, dass er nicht so weitermachen kann; nicht sein ganzes Leben dem Geld nachrennen kann, die Familie unterstützen kann; er hat auch das Recht auf Leben, auf sein eigenes Leben.
*
Als sie wieder im Hotel sind, steigt Karl auf das Hoteldach. Es ist eine wunderbare Terrasse mit Blick auf das Meer. Es hätte auch Andalusien sein können oder Marokko. Karl zündet sich die Zigarre an, nimmt ein Glas Rotwein vom Tisch. Er sieht aufs Meer, bemerkt sehr schnell, was anders ist: Hier gehen manche Familien mit Schlauchboot, Strandtüchern und einer Maschinenpistole an den Strand. Niemand scheint es noch zu bemerken. Der Wahnsinn ist gelebte Normalität. Karl lächelt. Er will das 360-Grad-Panorama des Hoteldachs genießen, das diese wunderbare Terrasse bietet. Langsam dreht er sich um die eigene Achse. Sein Blick schweift über den ganzen Strand, genussvoll zieht er an der Zigarre, trinkt einen Schluck Rotwein. Schon der erste Schluck dämpft ihn ein wenig, denn er hat heute wenig gegessen. Seine Zunge fühlt sich ein wenig taub an. Er denkt, dass man den Wein wirklich trinken könne; den Wein aus Israel. Kein Vergleich mit seinem Lieblingsbordeaux, aber sehr trinkbar.
Als er sich weiterdreht, sieht er über die Häuserschluchten, die typisch mediterran sind bis auf die wenigen Ausnahmen derjenigen Häuser, die zerbombt wurden. Hastig, ohne große Geldmittel, wurden sie neu aufgebaut. Karl fühlt sich so gut wie schon lange nicht mehr. Er hat den Auftrag abgeschlossen, dessen ist er gewiss, denn er hat die Lösung gedanklich schon ausgearbeitet. Er steht auf dem Dach eines tollen Hotels, es ist warm, sehr warm, aber die sanfte Brise, die vom Meer weht, relativiert die Hitze zu einem wunderbaren Klima. Er genießt den Tag, er fühlt, wie zufrieden er mit dem Ausgang des Geschäfts ist, hofft, dass Sarah es geschafft habe, als er sich weiterdreht, langsam und voller Genuss. Einen halben Meter dreht er sich zu weit. Es ist nur der halbe Meter, der alles aus den Fugen bringt, der alles Positive an der Situation zerstört. Als Karl die Häuser vor sich sieht, bemerkt er, wie die Westbank brennt. Ihm wird übel. Warum passiert das? Die Israelis hatten nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur das Recht auf eine eigene Identität, sie war für sie vielmehr überlebenswichtig. Wie aber musste sich ein Palästinenser fühlen, der in einem Flüchtlingscamp aufgewachsen ist, als Bürger zweiter Klasse behandelt wird in seinem Land? Es ist unglaublich, was die Juden und Palästinenser in Israel an Wertvollem geschaffen hatten; aber Menschen zu unterdrücken, sie als Problem in deren Land zu behandeln, ist nicht gerecht. Karl versteht beide Seiten. Jetzt denkt er an das allsehende, allwissende Auge, über das er so oft mit seinen Freimaurerfreunden gesprochen hat. Der dritte übergeordnete Standpunkt wäre also die Lösung? Der göttliche Standpunkt? Das entfacht dann meistens den Diskussionswillen aller, mit denen er darüber spricht, denn Karl vertritt den Standpunkt, dass alle Menschen göttlich seien; dass Gott also in uns sei.
Diese Wahrheit beschreibt die Philosophie seines Kampfsystems aus Hawaii, das Kenpo. Die Wahrheit entstünde, so Karl, immer aus allen drei Betrachtungsweisen, von denen mindestens zwei menschlich und eine allmächtig, also göttlich, sei. Die menschliche Ansicht sei aber immer auch göttlich und menschlich, da wir Gestalter unseres Schicksals seien, gleichzeitig auch die Leidtragenden. Die Wahrheit entsteht demnach, indem man jede Situation von seinem eigenen Standpunkt, von dem des Gegenübers und als unbeteiligter Dritter sieht. Der Wechsel der Perspektive ist das Entscheidende. Will denn jemand eine Lösung für Konflikte? Wenn ja, wer? Die Waffenhändler, die Regierungen, deren Interessen immer gewahrt werden? Wer mit Macht in einem Staat hat Interesse daran, Konflikte zu lösen, die ihn überflüssig mach(t)en? Alles sehr theoretisch, denkt Karl jetzt, da er sieht, was er sieht. Jetzt hat er auf einmal Sehnsucht. Das kalte, nasse Mönchengladbach fehlt ihm. Die Ordnung, die ihn manchmal so anekelt, wenn er mit Beamten um lächerliche Verwaltungsvorschriften ringt, bekommt eine andere Dimension, eine neue Qualität. Karl lächelt, als er denkt, dass er gerade die Standpunkte gewechselt hat, um die Dinge wirklich wahrzunehmen. Es ist eben nicht nur theoretisch. Krieg ist schmutzig. Er stinkt. Er ist laut und hässlich. Die Kriegstheorie ist gleichsam für ihn aber immer auch die Theorie des klinisch sauberen Krieges. Wie lächerlich angesichts des Bildes, das er gerade sieht! Karl macht die Zigarre aus, stellt den Wein ab und geht auf sein Zimmer. Er will schlafen, bevor Raquel ihn abholt. Wenn er an sie denkt, fällt ihm das Wort ein, an das er am Flughafen dauernd denken musste: unvermeidlich.
2. Unvermeidlich
Es ist dumm, das zu befürchten, was unvermeidlich ist.
Publius Syrus
30 Minuten später klingelt Karls Handy. Raquel sagt, dass er sich nett machen solle, sie sei bald da. Nett machen, hat sie gesagt, wie man zu einer Frau sagen würde, die man gut kennt. Raquel ist ein Lichtblick, gerade wegen dieser offenen Art. Als sie ihn abholt, strahlt sie, was sofort auf Karl übergeht. Er verschwendet keinen Gedanken mehr an das, was er noch vor einer Stunde gesehen hat, als er sie sieht. Raquel trägt ein sehr körperbetontes Kleid. Das hat Karl erwartet oder, besser noch, erhofft.
Nicht erwartet hat er diesen Körper. Sie ist sehr trainiert, trotzdem weiblich, aber wichtiger noch ist die Art, wie sie sich bewegt, als sie auf ihn zukommt. Viele Männer stehen auf irgendetwas bei einer Frau, die Haarfarbe, die Brüste, die Beine oder den Po. Karl liebt die Bewegung, besser gesagt, wie eine Frau ES gestalten kann. Sie kann dieses gewisse ES gestalten, ganz sicher. Man könnte meinen, dass ihre Füße kaum den Boden berühren. Sie scheint zu schweben, aber es sieht auch ein bisschen so aus, als wollte sie keine Fußabdrücke hinterlassen, wenn sie auf Sand liefe. Karl denkt, dass er wohl wieder mal seine Berufskrankheit vor sich habe, die alles in militärische Kategorien lenkt. Sie trägt keine Pumps, die die Beine einer Frau immer strecken, wie man es in Europa erwartet hätte. Ballerinas sind alles, was sie braucht bei ihren kaum ein Meter 70. Es ist perfekt. Sie ist perfekt. Karl stammelt so etwas wie: »Du siehst unglaublich aus.«
Sie sagt fast nüchtern in dieser Situation, aber mit leicht ironisch-witzigem Unterton: »Ja, ich weiß, ich habe ja auch lange genug dafür gebraucht. Aufdonnern, das geht schnell, aber natürlich gut aussehen, das dauert sehr lange!« Sie lacht sehr laut, so sympathisch, über sich und ihren eigenen Witz, der möglicherweise kein Witz ist. Karl zweifelt, aber ihr Lachen ist ansteckend. Es gibt keine Option, außer gute Laune zu haben.
Sie fragt wie selbstverständlich: »Hast du Hunger?«, und Karl antwortet ebenso selbstverständlich: »Ja, sicher!«
Raquel führt ihn in das Restaurant, das die Touristen nur durch Zufall sehen, aber es ist auch so gestaltet, einen Touristen zu beeindrucken, wenn man ihm das »wahre Israel« zeigen will: das Meer, die offene Terrasse, die Gerichte aus dem, was das Meer dort hergibt, und die so »vollkommen israelisch« sind. Karl lächelt in sich hinein. Weiß sie wirklich nicht, dass er hier gelebt hat, das meiste davon kennt? Unwahrscheinlich, dass sie es nicht weiß, denn sie gehört dem Mossad an. Sie essen, aber sie essen nicht, sie trinken Wein, aber sie trinken nicht. Alles ist nur das, was das Unausweichliche vorbereitet.
Als sie beim Nachtisch sind, fragt sie Karl, wie es nun weitergehen solle. Karl weiß nicht, was er erwidern soll, obwohl alles so klar ist. Er will diese Frau, weiß nicht einmal, warum. Es ist ihm auch egal. Er ist ungebunden. Sie ist unglaublich: witzig, intellektuell, unterhaltend. Sie hat die ganze Zeit keinen Hehl daraus gemacht, was sie will. Karl fühlt sich manchmal wie die verfolgte Jungfrau, denn Komplimente der Art, wie sie sie macht, ist er nicht gewohnt. Sie sind ebenso aggressiv wie wunderbar. Frech spricht sie über seinen schönen Oberkörper, seine Lippen, seine starken Hände; bald über seine grünen Augen, die wohl vom Teufel abstammen müssten. Karl kommt nicht einmal dazu, Gegenkomplimente zu machen, die sowieso nur als ein plumpes Entgegnen ausgefallen wären. Unehrlich wären sie erschienen, eher als eine Formalität. Sie sagt wieder etwas über seine Arme, wie schön sein Körper sei. Karl kann sein Erröten nur durch seine Atemtechnik verhindern und durch ein paar Witze überspielen. Das war zweifellos die aggressivste Frau, die er je kennengelernt hatte. Er genießt sie, sie genießt es, ihn in Verlegenheit zu bringen, was nicht zu übersehen ist durch ihre Posen. Wie sie das Haar gekonnt zurückwirft, ihren Busen wie zufällig präsentiert durch das Zusammenschieben ihrer Unterarme auf dem Tisch.
»Also«, weckt sie Karl aus seinen Gedanken, der Sorge um seine Familie, der Firma und so vielen anderen Fragen, die in seinem Hinterkopf herumschwirren: »Wie geht es weiter?«
Karl weiß nicht, was er sagen soll, außer: »Mach doch einen Vorschlag. Das ist dein Land, deine Kultur!« Wenn sie schon so rangeht, dann soll sie auch die Entscheidung treffen, die lange gefällt ist! Raquel tut etwas, was Karl so nicht erwartet hat.
*
Sie sagt: »Du gefällst mir. Ich möchte, dass du heute Nacht zu mir kommst, oder ich komme zu dir ins Hotel oder was auch immer. Ganz sicher will ich mit dir zusammen sein.«
Karl verschlägt es den Atem. Es fällt ihm nichts Besseres ein als: »Wie bitte?«
Raquel ist entsetzt: »Willst du mich demütigen? Soll ich es wiederholen?«
»Nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Ich bin es nur nicht gewohnt … dann auch noch von einer Frau, die sich die Männer sicher mit einem Stock vom Leib halten muss, so schön, wie du bist!«
Raquel schüttelt den Kopf: »Gott, seid ihr Deutschen kompliziert!«
Karl verlangt die Rechnung, muss dann erfahren, dass sie bereits bezahlt ist. Jetzt fühlt er sich wirklich als das schwächere Geschlecht, wenn es denn so etwas überhaupt geben sollte. Sie bestellen ein Taxi, denn sie sind in Eile. Die Fahrt ist unendlich lang, obwohl sie vom Hotel aus zu Fuß zum Restaurant gegangen sind. Karl sieht den alten Taxifahrer im Rückspiegel lächeln, der das sicher jeden Tag sieht. Sie küssen sich, wissen nicht mehr, wann das Taxi anhält. Karl erinnert sich nicht mehr, dass er es zu seinem Hotel beordert hat. Er zahlt hastig, beide laufen förmlich durch die Halle, versuchen, im Aufzug durchzuatmen, kommen endlich im Zimmer an. Karl ist nicht naiv, er weiß, dass sie eine Agentin sein könnte, die nur ihren Job macht, aber er will es nicht glauben, will es nicht wissen, er fühlt sich einsam, und was könnte schon passieren? Er würde den Israelis sowieso die Pläne über die Anlagen zur Verfügung stellen müssen. Nach dem Abschluss gibt es keine Geheimnisse mehr. Betriebsgeheimnisse, das wusste Karl, waren nur durch Neuentwicklungen zu schützen. Genau das war die Stärke seines Unternehmens: Kreativität!
Als sie im Zimmer sind, vergeht die Zeit wie im Rausch. Es ist nicht genug davon da. Die Zeit sollte stillstehen, sich dehnen, das Zimmer soll das Universum sein. Morgens um 6 Uhr sind sie immer noch wach. Sie reden, lieben sich, blödeln herum, sprechen über Philosophie, Politik … Da der nächste Tag frei ist, haben sie Zeit, aber auf keinen Fall genug davon.
Um 10 Uhr wacht Karl wieder auf. Raquel schläft noch. Das Fenster steht auf, das Meer bläst eine kühle Brise durch das Terrassenfenster ins Zimmer. Er steht auf und geht zum Fenster.
Karl muss sie ansehen, wie sie daliegt. Er sieht etwas, was er malen würde, wenn er könnte. Einen Moment denkt er an den Fotoapparat, verwirft den Gedanken, weil kein Fotoapparat das festhalten könnte, was er empfindet. Das Bild würde er ewig im Gedächtnis behalten, auch ohne eine technische Einrichtung, die in diesem Moment so profan wäre, des Augenblicks nicht würdig. Zu schnell wacht sie auf, entdeckt ihn, sieht seine Blicke, deckt sich nahezu mädchenhaft mit dem weißen Laken zu.
*
Ausgerechnet diese Frau erwischt Karl in einem Augenblick der Scham, als sie die Beine zur Brust zieht, damit er nicht zu viel von ihrem Körper sehen kann. Sie fühlt sich beobachtet und deswegen unsicher. Er kann es nicht fassen, genießt es für den Bruchteil einer Sekunde, in der er weiß, dass nicht alles nur Theater und Professionalität gewesen sein kann, gerade wegen dieser Unsicherheit, die so gar nicht zu ihrem Auftreten passt. Um die Stille zu brechen, sagt sie: »Guten Morgen«, wieder zu verlegen, zu schnell. »Hast du auf meine Narben gesehen?«
Karl sagt leise, als er sich zu ihr auf das Bett setzt: »Jedenfalls hast du noch mehr Narben als ich!«
»Ja«, bestätigt Raquel, »deine sind von der Ausbildung, vom Sport, meine sind aus dem Krieg.«
Karl fühlt sich wieder unterlegen.
»Stören sie dich?«, fragt sie fast selbstbewusst, obwohl sie sich das Bettlaken als Gegenbeweis weiter hochzieht.
Karl zieht das Laken sanft herunter: »Hattest du die letzten Stunden den Eindruck, dass mich etwas an dir stört?«
Sie lacht, küsst ihn, zieht ihn an sich, als ob sie in ihn reinkriechen wollte.
Irgendwann bestellt Karl ein Frühstück, sie duschen; er erinnert sich nicht mehr. Als sie erwachen, ist es Abend. Karl denkt an eine alte chinesische Geschichte, in der ein Edelmann erwacht und sich fragt, ob er geträumt habe, ein Schmetterling zu sein, oder ob er ein Schmetterling sei, der gerade träumte, ein Edelmann zu sein.
*
Raquel sagt irgendwann sehr spontan, perfekt getimed, um jegliche Romantik zu unterbinden: »Gehen wir etwas essen!« Was sie sagen wollte, war: »Es war schön, aber jetzt ist es aus!«
Karl hat das erwartet, aber nicht so schnell; nicht so brutal.
»Ja, gerne, in unser Lokal?«, schlägt er gespielt höflich vor.
»Nein, in irgendein Lokal, wo es Fleisch gibt!«, sagt sie.
»Okay! Gehen wir!«
Sie ziehen sich an, sitzen bald an einem Tisch.
»Karl«, sagt sie, »das war unglaublich für mich, aber das führt zu nichts!«
Karl kennt diese Art der Diskussion, aber nicht nach so einem Erlebnis: »Was meinst du?«
»Ich gehöre in dieses Land und du in deines!«
»Bitte sag mir nicht, dass ich ein Auftrag für dich war!«
»Ich kenne deine Akte, ich weiß, dass du ein Experte im Nahkampf bist, aber ich habe große Lust, dir eine reinzuhauen!«
Karl ist verlegen: »Sorry, ich wollte dich nicht verletzen, aber ich bin auch nicht naiv!«
Raquels Augen scheinen etwas wässrig zu sein. Zum ersten Mal sieht Karl sie betrübt: »Besser kann es nicht werden als jetzt …«, sagt sie.
Karl unterbricht: »Das habe ich einige Male so oder so gehört und trotzdem …«
Raquel sieht ihn wütend an: »Würdest du jetzt bitte schweigen?«
»Jawohl, Frau Major!«
Raquel hat einen sehr ernsten Gesichtsausdruck, als sie fragt: »Bereust du es?«
Karl sieht ihr fest, direkt in die schwarzen Augen, sagt: »Den Teufel tu ich!« Auch das alles war wohl unvermeidlich.
*
Den Rest des Tages verbringt er mit Helger. Sie reden über den Auftrag, die Lieferzeit, wie man Kosten spart. Karls Gedanken sind bei Raquel. Am nächsten Tag steht er am Flughafen und fragt sich, wie er das, was unweigerlich kommen wird, lösen soll. Es sind immer die gleichen Fragen der Israelis bei der Ausreise, die sehr lange dauern: »Was haben Sie gemacht?«, »Mit wem waren Sie zusammen? Beruf?«, »Wer waren Ihre Geschäftspartner?«, »Was sind das für Zeichnungen?« und wie immer: »Hatten Sie Sex?« Auf die Frage wartet Karl ganz besonders. Er weiß, dass Raquel das Prozedere kennt. Zu Karls Überraschung ist Raquel die Fragende und stellt tatsächlich diese Frage: »Hatten Sie Sex in Israel?« Als sie es herausbringt, bedeutet sie dem Psychologen, der immer anwesend ist, mit einer Handbewegung, den Raum zu verlassen, um Helger zu befragen.
»Wie meinen Sie das? Außer mit Ihnen, Frau Major?«
Karl fühlt sich wieder als Mann, nicht überlegen, denn so fühlt er sich Frauen gegenüber nie wirklich, aber zumindest wieder so etwas wie gleichberechtigt. Eine Art Augenhöhe ist wiederhergestellt. Der schmale Grat dessen oder einer subtilen Rache an der Grenze zu einem bösen, interessanten Spiel?
Raquel blickt ihn zornig an: »Du kannst ein solches Arschloch sein!«
Karl wird ironisch: »Ts, ts, so ein böses Wort in unserer so jungen Beziehung! Ist das eine Art Scheidung?«
Raquel ist wirklich sauer, sieht ihn mit ihren schwarzen Augen an, die zu glühen scheinen: »Ernsthaft. Ich lasse dich festnehmen!«
Karl lacht: »Also, wie war die Frage noch mal?«
Raquel holt lange aus für das, was sie sagen will. Sie atmet tief ein, ringt nach den richtigen Worten, um dann doch nur das herauszubringen: »Oh, du verdammter Idiot!«
Karl kann es sich nicht verkneifen: »Also, Frau Major, ich muss doch sehr bitten. Sie hatten doch nicht Sex mit einem Arschloch und Idioten. Da muss ich aber eine Lanze für ihn brechen …«
Sie kann nicht anders und muss lachen, laut, schallend. Sie ist wieder Raquel, trotz der Uniform.
»Also«, spult Karl ab, scheinbar unüberlegt, »sie wissen es doch sowieso, deine Sicherheitsorgane, und wenn die es noch mal hören wollen, dann sage ich es, ja, mit dir … es war so unglaublich, dass ich mich mein Leben lang daran erinnern werde. Ich würde dich außerdem gerne wiedersehen, auch wenn du ein paar Narben mehr hast; und ja, ich könnte mich in dich verlieben. Wenn ich nicht …«
»Du hast dich doch schon in mich verliebt, und wir werden uns wiedersehen. Aber eine Beziehung wird das sicher nicht!«, unterbricht sie ihn.
Karl wird wieder ironisch: »Na, dann endet es ja doch glücklich … nicht etwa in so was Doofem wie der Ehe!«
»Jetzt geh in deine Maschine. Du bist echt der …«
Karl nimmt den Satz auf: »… komplette Idiot … Arschloch …«
»Nein … Du bist wunderbar … seit Langem konnte ich vieles vergessen, nur nicht, wer ich bin und wohin ich gehöre!«
»Was ist, wenn du zu Raquel gehörst, mehr als zu Israel!? Was ist, wenn du zu mir gehörst?«
Raquel sieht zu Boden. Sie kann ihn jetzt nicht ansehen: »Da bin ich noch nicht angekommen!«
Karl überlegt einen Moment, denkt über sich nach und fühlt sich egoistisch dabei: »Raquel, du bist ich und ich bin du. Wir leben unser Leben für andere! Wir sind seelenverwandt.«
*
Karl steht auf, dreht sich um, dann geht er durch die weiteren Kontrollen. So sehr hätte er sich mehr gewünscht. Er trifft Helger, sie begrüßen sich, schlendern zur Maschine. Als er an der Treppe zum Flieger steht, traut er seinen Augen nicht. Da steht sie. Sie wartet auf ihn.
»Hast du geglaubt ich lasse dich so gehen? Ohne Kuss, ohne Umarmung?«
Karl sieht sich um, obwohl er weiß, wie sinnlos das ist: »Das kann dich deine Karriere kosten!«
»In Deutschland, aber nicht in Israel!« Sie umarmt ihn, sie küsst ihn. Karl steigt in die Maschine. Er sieht Israel lange nach. Raquel sieht er länger nach.
Helger lächelt ihn süffisant an: »Respekt, Chef, Respekt!«
Als er in Deutschland ankommt, regnet es. Düsseldorf ist wolkenverhangen, grau. Er steigt aus, genießt den Nieselregen auf seiner Haut, muss über die deutsche Bürokratie bei der Passkontrolle lächeln. Deutschland erscheint ihm so viel freundlicher als vor seiner Abreise. Er fühlt sich nicht schuldig dessentwegen, was in Israel passiert ist. Zum ersten Mal versucht eine Frau nicht, ihm so etwas wie Schuld einzureden, wenn er sich von ihr trennt. Mehr noch hatte sie sich von ihm getrennt. Es war ganz allein ihre Entscheidung.
3. Entscheidung
Entscheidung ist Beschränkung.
Peter Hille
Das Erste, was Karl am Morgen erwartet, ist der Anruf einer seiner Banker. Er hört schon gar nicht mehr hin, weil er weiß, worum es geht, weil er die Zahlen kennt, weil er es x-mal von den anderen Bankern gehört hat. Sie treiben ihn in die Enge wie immer. Mehr Sicherheiten, auch und gerade aus dem Privatvermögen, das es kaum noch gibt, bessere Umsätze und so weiter. Wäre die Lage nicht so dramatisch, könnte man das gebetsmühlenartige Wiederholen der immer gleichen Floskeln und Zahlen langweilig nennen. Er sieht aus dem Fenster und kann sich trotz des Mannes, der gerade aus dem Telefon ruft, an den ersten Schneeflocken erfreuen. Sie sind es, die seinen nächsten Gedanken bestimmen: Norwegen, Bernd Einar Jacobsen. Dieser Mann kann die Lösung sein.
Am nächsten Morgen ruft Karl seinen Freund Bernd in Norwegen an, einen der wenigen Milliardäre, die er kennt. Der Einzige, den Karl kennt, der eine Leberkrebserkrankung im Endstadium überstanden hat. Bernd lädt ihn sofort ein. Karl hasst es, in die Kälte zu fliegen, aber er freut sich auf den sicherlich warmherzigen Empfang seines Freundes. Beide gehen nicht davon aus, dass es ein Höflichkeitsbesuch wird, zumindest nicht nur; aber es würde Karl sehr schwerfallen, seinen Freund zu bitten, ihm finanziell unter die Arme zu greifen. Aber Bernd hätte vielleicht eine Idee. Vielleicht würde auch seine Tochter Lina da sein. Karl hofft, dass sie ihm nicht böse sein würde wegen der Liaison, die einmal zwischen ihnen passiert ist.
Als Karl in Oslo landet, hat er fast so etwas wie Heimatgefühle. Er mag die Art der Norweger: Sie sind unkompliziert, herzlich, haben Humor. Bald sitzen Bernd und Karl an einem kalten Januarmorgen in Oslo in einem Café zusammen. Karl erschrickt, als er Bernd sieht, denn der hat sicher mehr als 20 Kilo abgenommen, ist trotzdem lebenslustiger denn je, energiegeladener, als er ihn je gesehen hat. Mit seinem norwegischen Akzent sagt er in breitem Englisch, dass Karl ihn nicht so anstarren solle, denn was er sähe, sei der Preis für sein Leben gewesen. Heute würde er Karl zu Ehren das erste Mal wieder einen Fisch essen, nach sechs Monaten ohne jedes tierische Protein. Karl muss lachen, noch während er Bernd umarmt; aus Rührung, vor Freude oder weil Bernd eine Situation immer perfekt entkrampfen kann. Bernd legt sofort los: »Weißt du noch, als wir das letzte Mal hier saßen? Du hattest die Hose immer noch gestrichen voll!«
Karl kann heute darüber lachen, damals war ihm gar nicht danach zumute: »Jaja, und das aus gutem Grund. Man muss nicht oft mit einem Helikopter im Schneesturm notlanden, der von einem ehemaligen Offshore-Taucher geflogen wird, der erst sechs Wochen seine Fluglizenz hat!«
Beide lachen, aber Karl erinnert sich wieder an die Strommasten, die sie knapp verfehlt hatten. Das Lachen erstickt in seinem Hals. Karl fragt, wie es Lina, Bernds Tochter, gehe.
Bernd murmelt lächelnd, dass sie ihn gefahren habe, gerade jetzt suche sie einen Parkplatz. Das hätte sie sich nicht nehmen lassen, den Deutschen wiederzutreffen.
Karl erschrickt etwas, aber mit einem wohligen Schauer, der ihn durchrieselt. Als er Lina sieht, verschlägt es ihm einen Moment lang den Atem. Sie ist genauso wunderbar wie in der Nacht, als sie zusammen waren. Es ist nicht ihre Schönheit, obwohl sie zweifellos schön ist, sehr schön. Es ist die Art, wie Lina ist. Die Art, wie sie die Dinge tut. Lina lacht nicht. Sie ist das Lachen. Sie geht nicht. Sie ist das Gehen. Niemals hat Karl vor ihr eine solche menschliche Präsenz gesehen. Jetzt steht er kurz vor einer Umarmung. Er weiß jetzt schon, dass er es am Ende der Umarmung bereuen würde, nicht um sie gekämpft zu haben.
Lina begrüßt Karl mit einem zärtlichen Kuss auf den Mund wie unter Liebenden, lässt ihn beinahe nicht mehr aus der Umarmung. Als Bernd das sieht, guckt er Karl mit großen Augen an. Scheinbar den verärgerten Vater spielend, fragt er, ob er etwas wissen müsse.
Karl schmunzelt: »Besser nicht, alter Freund, besser nicht!«
Lina lacht laut los. Immer wenn sie das tut, müssen alle mitlachen. Sie weiß auch, dass das ihre stärkste Waffe ist. Niemand kann ihr dann widerstehen oder gar böse sein. Schon gar nicht ihr Vater. Sie ist eine Skandinavierin im besten Sinne des Wortes: blond, strahlend blaue Augen, Sommersprossen und sehr sportlich. In jener Nacht damals in Trondheim führte sie Karl zu einem Fotoladen, in dem ein Riesenposter stand mit eben jener Frau, die man nicht erkennen konnte. Nackt, Goldbronze am Körper, wunderbar. Karl war es damals ein wenig peinlich, mit einer Frau den Körper einer anderen Frau zu beurteilen, als sie fragte, ob Karl die Frau gefalle. Damals druckste er herum, weil er sie nicht in Verlegenheit bringen wollte.
Sie fragte: »Sag nicht, die Brüste gefielen dir nicht … Sieh dir mal den Po an … Das gefällt dir nicht? Ist doch echt klasse, oder?«
Natürlich gefiel Karl das. Die Frau auf dem Foto war toll, perfekt, erotisch, ohne billig oder gar pornografisch zu wirken.
Lina lachte damals wie heute unwiderstehlich: »Das würde mir sehr leidtun, wenn dir das nicht gefallen würde. Das bin ich!«
Man hatte Fotos zur Olympiade von ihr gemacht, die ihren nackten Körper in Bronze übermalt zeigten. So ist eben Lina.
*
Seine Aufmerksamkeit ist jetzt wieder im Café bei Bernd und ihr. Sie will helfen – ebenso wie Bernd. Bernd meint, dass das kein wirklich großes Problem sei, was Karl habe, solang er alles zurückzahlen könnte. Falls allerdings nicht, wären seine Financiers wesentlich weniger nachsichtig als die Banker, die er kenne. Dann reden sie nicht weiter über die Probleme, sondern sie haben sich fest entschlossen, Karl rauszuholen aus dem Chaos, und sei es nur für ein paar Stunden. Der Abend ist wunderbar, weil Karl wenig genug Menschen trifft, die nichts von ihm wollen außer Freundschaft. Er schämt sich fast, dass er der Einzige am Tisch ist, der aus egoistischen Motiven gekommen ist. Zumindest ist das die eine Seite der Motivation.
Bernd und Karl hatten sich durch Doktor Beck kennengelernt. Karl weiß noch nicht einmal genau, was Bernd macht. Auch auf die Frage nach seinem Geschäftsfeld antwortet dieser immer nur, dass er Probleme löse. Es schwante Karl schon damals, dass es sich um Geld und Waffen handeln könnte. Auf der anderen Seite hat er 120 Kinder adoptiert, die er unterstützt mit Geld, aber viel wichtiger: mit Wissen um das Leben. Vielleicht ist er einer von den schlechten Jungs, denkt Karl an diesem Abend, aber hier und heute tut er das Richtige. Niemand ist nur schlecht; niemand ist nur gut. Manchmal ist es die Situation, die die Moral bestimmt. Man kann aus guten Motiven auch Schlechtes tun. Karl dämmert der Abgrund seiner Seele. Er verwirft den Gedanken. Für heute war es einfach genug Grübelei.
Als Bernd gegangen ist, nachdem er sich ein Taxi bestellt hat, bleibt nur Lina. Sie verliert keine Zeit: »Weißt du noch?«
Karl sieht auf den Boden: »Jedes Detail!«
Lina lächelt nicht, als sie sagt: »Du bist wirklich ein Deutscher. Ein Ja hätte genügt …«
Karl unterbricht mit einem Lachen: »Ja, und in unserer Nacht musste ich auch einige Klischees über mich ergehen lassen. Ich hatte ja keine Ahnung, was du mit ›German Style‹ meintest!« Beide lachen, als Lina meint, dass das glücklicherweise nicht zugetroffen habe.
»Weißt du noch«, fragt Lina, »warum wir miteinander geschlafen haben?«
Karl weiß nicht, was er sagen soll, aber er muss etwas sagen, um die Situation nicht zu zerstören: »Ich habe da so eine Vermutung … Vielleicht magst du mich?«
Lina tut so, als wäre sie sauer: »Du bist noch der gleiche Idiot wie vor fünf Jahren. Wenn es etwas ernster wird, machst du einen Witz. Niemand soll an dich herankommen … Wie haben das andere Frauen geschafft?«
»Komm, Lina, lass …«
Lina fasst ihn an beiden Händen, drückt sie fest, intensiv, als wollte sie mit den Händen sagen, was sie mit Worten nicht vermag, die dann trotzdem aus ihr heraussprudeln: »Karl, sie haben es nicht geschafft. Keine hat es geschafft, denn du führst das Leben anderer Menschen, zusammengesetzt aus Pflicht, Ordnung, der Firma und ich weiß nicht, was. Das alles hat es geschafft, dass du niemals liebst. Das ist nicht richtig. Ich denke, dass du es bereuen wirst.«
Karl sieht sie fragend an: »Warum hilfst du mir dann?«
Lina ist direkt wie immer, aber selten war sie so durchdringend: »Um dessentwillen, was du in der Nacht gesagt hast. Weißt du es noch?«
Karl unterbricht: »Du sagtest auf meinem Hotelzimmer, dass du in Schwierigkeiten wärst, wenn du jetzt nicht mit mir schlafen würdest. Allein und halb nackt in meinem Zimmer. Mir ausgeliefert. Darauf habe ich gesagt, dass du niemals in Schwierigkeiten seist, solang du bei mir seist!«
Lina lächelt. Sie sieht ihn an: »Du weißt es noch, du hast es genauso gesagt wie damals. Gerade ist damals.«
»Lina, ich bereue es, dass es nicht weiterging …«
Lina will es nicht hören. Sie ist zufrieden mit dem Moment: »Nicht! Es ist schön, wie es ist. Besser als in diesem Moment kann es niemals zwischen uns werden!«
Karl kennt den Satz nur zu genau. Die Lektion hat er auch verstanden: Das Leben anderer zu leben, war so zu seinem Charakter geworden, dass er sein Ich nicht mehr davon trennen konnte.
Sie gibt ihm einen Kuss, steht auf, geht, ohne sich umzudrehen. Karl bleibt noch eine Stunde sitzen, sieht in den dunkelblauen Himmel mit all seinen Schneeflocken. Er bemerkt erst, wie spät es ist, als er auf die Uhr sieht, und bestellt bald ein Taxi ins Hotel. Auf dem Weg denkt er nach über Bernds Worte und darüber, was sich hinter diesem ganz speziellen Kredit verbirgt. Sicher wusste er es; was er nicht weiß, ist, welchen anderen Weg es geben könnte. Eines ist sicher: Es brechen sehr schlechte Zeiten für ihn an. Für seine ganze Familie, wenn er sich nicht auf den Deal einlässt.
4. Schlechte Zeiten
Auch die guten alten Zeiten waren einmal schlechte neue Zeiten.
Unbekannt





























