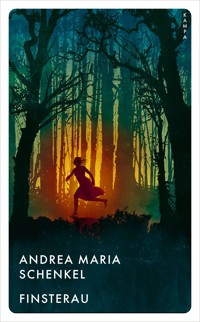Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: True Crime
- Sprache: Deutsch
Milliardärssohn Harry Kendall Thaw, der Harvard University verwiesen, nachdem er einen Taxifahrer mit einer Schrotflinte durch die Stadt gejagt hatte, war besessen von dem New Yorker Stararchitekten Stanford White. Seine Obsession führte so weit, dass er White 1906 auf der Dachterrasse des von ihm entworfenen Madison Square Garden aus nächster Nähe erschoss. Hans Schmidt, zeit seines Lebens Sonderling und Einzelgänger, ermordete im Herbst 1913 das Hausmädchen seiner Pfarrei in Harlem, zerstückelte ihre Leiche und versenkte sie im Hudson River. Später gab er an, von Gott den Befehl erhalten zu haben, Anna zu opfern. Schmidt ging in die Geschichte ein als einziger Pfarrer, der in den USA hingerichtet wurde. Carl Panzram ermordete nach eigenen Angaben über zwanzig Menschen, suchte immer nach den Schwachen, den Harmlosen, den Ahnungslosen, und wurde doch nur für ein Tötungsdelikt verurteilt. Bestsellerautorin und Kriminalreporterin Andrea Maria Schenkel hat historische Kriminalfälle gesammelt, recherchiert und aufgeschrieben. Schon 2006, lange vor dem True-Crime-Hype, wurde sie mit ihrem Debütroman Tannöd, der auf einem wahren, bis heute ungelösten Mordfall beruht, schlagartig berühmt. Heute lehrt sie im Rahmen ihres Promotionsstudiums am CUNY John Jay College of Criminal Justice der City University of New York. Was Schenkel am Verbrechen fasziniert, ist das Wesen des Bösen. Ist der Mensch per se böse – oder wird er dazu gemacht?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Maria Schenkel
Richtet sie hin!
Historische Fälle
Kampa
Die Schwarze Hand
Am Dienstag, den 9. August 1904, betritt gegen 21 Uhr ein sichtlich aufgeregter Mann die Polizeistation in der Amity Street in Brooklyn. Sein Name ist Vincenzo Mannino. Mannino ist Bauunternehmer und lebt mit seiner Familie nur einen Steinwurf vom Revier entfernt. Er berichtet den Beamten, sein achtjähriger Sohn Antonio, genannt Toni, sei verschwunden. Wie alle Kinder des Viertels habe er draußen gespielt, am Abend sei er jedoch nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause gekommen. Stattdessen sei kurz darauf ein Zettel mit einer Lösegeldforderung gefunden worden. 500 Dollar werden für die unversehrte Rückkehr des Kindes verlangt. Die Summe ist beachtlich, mehr als das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Büroangestellten zu dieser Zeit. Für die Manninos ist das Geld das geringere Problem. Was sie in Aufregung versetzt, ist der Umstand, dass die Lösegeldforderung von der Schwarzen Hand unterschrieben wurde.
Bereits seit dem 18. Jahrhundert treibt die Schwarze Hand im südlichen Italien ihr Unwesen. Fast immer wurde die Entführung wohlhabender Bürger in einem Erpresserbrief angekündigt, die Forderung mit einem bluttropfenden Dolch, einem von einem Messer durchstoßenen Herzen, einem Totenkopf oder einer schwarzen Hand unterschrieben. Manchmal genügten auch drei schwarze Kreuze, und der Adressat wusste, was er zu tun hatte: Wurde bezahlt, war der Fall erledigt, es gab keine Entführung und niemand kam zu Schaden. Viele arme Süditaliener sahen diese Zahlungen als ausgleichende Gerechtigkeit: Eine reiche Elite unterstützte mit diesem Obolus die Mittellosen und in Not Geratenen der Gemeinde. Beide Seiten wussten, wo die Grenze lag, und respektierten sie weitestgehend.
Im Jahr 1880 begann die große Auswanderungswelle. Insgesamt 13 Millionen Menschen verließen Italien bis 1914 und verstreuten sich über den ganzen Globus. Am Höhepunkt der Welle, zwischen 1900 und 1914, wanderten allein drei Millionen Italiener auf der Suche nach Arbeit und einem besseren Leben in die USA aus. Fast alle stammten sie aus dem verarmten Süden.
Auch die Urgroßeltern meines Partners waren unter ihnen. Sie verließen San Sosti, ein kleines Dorf in Kalabrien. Anfang zwanzig und verheiratet, waren sie bereit, in den USA ein neues Leben zu beginnen. Bis zu ihrem Tod sprach die Urgroßmutter meines Partners nur Italienisch, es war, als hätte sie die alte Heimat nie verlassen. Auch sein Großvater, der 1905 in den USA geboren wurde, sprach die ersten sechs Jahre seines Lebens kein Wort Englisch. Er lernte es in der Schule, fand sich immer mehr zurecht und heiratete später Octavia, ein Mädchen mit irisch-schottischen Vorfahren – ein Skandal für die Familie. Durch die Audiokassetten, die er seinen Enkeln hinterließ, hörte ich von dem Leben der italienischen Auswanderer zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Auch wenn der Großvater meines Partners in San Francisco und nicht in New York aufwuchs, sind die Bedingungen vergleichbar. In seinen Aufzeichnungen erzählte er auch von der Schwarzen Hand, die mit den Auswanderern in die neue Welt gelangte. Wie in der alten Heimat waren ihre Opfer zunächst ausschließlich italienischstämmige Immigranten, die es geschafft hatten, Fuß zu fassen und einen gewissen Wohlstand zu erlangen. Doch was in Italien funktioniert hatte, veränderte sich in den USA. Es genügte nicht mehr, eine Entführung anzukündigen, um die Opfer zur Zahlung zu bewegen. In den USA musste weit mehr Druck ausgeübt werden. Aus einer stillschweigenden gesellschaftlichen Übereinkunft wurde eine gewalttätige kriminelle Machenschaft.
Anders als die sizilianische Mafia, die Cosa Nostra, hatte die Schwarze Hand keine hierarchischen Strukturen. Es waren meist Einzeltäter oder kleinere Gruppen, die geschickt die Angst der Opfer ausnutzten. Ab 1904 wurden immer mehr und immer gewalttätigere Vergehen mit ihr in Verbindung gebracht. Die Schwarze Hand schien allgegenwärtig zu sein, und die Presse stürzte sich darauf. Es entstand der Mythos der Mano Nera. Auch die Cosa Nostra erkannte das Potenzial und begann nun ihrerseits, sich den Ruf der Schwarzen Hand zunutze zu machen. Irgendwann vermischten sich die Grenzen so sehr, dass am Ende jeder italienische Einwanderer unter Generalverdacht stand.
Wie die Urgroßeltern meines Partners sprachen die meisten italienischen Einwanderer den Dialekt ihrer Heimat, nur eine Minderheit konnte sich auf Englisch verständigen. Viele von ihnen wollten nur so lange in den USA bleiben, bis sie genügend Geld beisammenhatten. Die Rate der Rückkehrer lag bei 25 %. Die Neuankömmlinge lebten in italienischen Vierteln, kauften in italienischen Geschäften ein, arbeiteten für italienische Arbeitgeber. Bei der Polizei gab es lange Zeit keinen einzigen Beamten mit italienischen Wurzeln, keinen, der sich in den italienischen Nachbarschaften auskannte oder dort verständigen konnte, keinen, an den sich die Bürger dieser Viertel wenden konnten. Es entstand eine Gesellschaft in der Gesellschaft.
Giuseppe »Joe« Petrosino war der erste italienischstämmige Beamte des New York Police Departement. Auch er war aus Italien eingewandert, und anders als die meisten seiner Landsleute sprach er sowohl Englisch als auch Italienisch akzentfrei. Zudem beherrschte er über zwanzig verschiedene italienische Dialekte. Petrosino war am 30. August 1860 in dem kleinen Ort Padula zur Welt gekommen. Als Zwölfjähriger hatte er Italien verlassen, um mit seinem Vater in Le Havre an Bord der Denmark nach Amerika auszuwandern. Nach einer dreiwöchigen Überfahrt erreichten sie am 8. November 1872 New York. Über Castle Garden an der Südspitze Manhattans reisten sie in die USA ein. Das Immigrationszentrum auf Ellis Island existierte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, es wurde erst 1890 errichtet. In New York lebte Petrosino mit seinem Cousin bei seinem Großvater. Sein Vater arbeitete den ganzen Tag und konnte sich nicht um den Sohn kümmern. Als der Großvater bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, sollten die beiden Kinder in einem Waisenhaus untergebracht werden. Dem irischstämmigen Richter taten die Jungen jedoch leid, und er nahm sie vorübergehend bei sich auf, bis 1874 auch der Rest ihrer Familie nach New York auswanderte. Nach Beendigung seiner Schulzeit brachte sich Petrosino zunächst als Schuhputzer durch. Am 19. Oktober 1883 trat er in den Polizeidienst ein. Für den nur 1,60 Meter großen und untersetzten Petrosino wurde eine Ausnahme bei den strengen Größenanforderungen gemacht, so dringend brauchte die New Yorker Polizei Beamte, die sich mit dem wachsenden Heer der Einwanderer verständigen konnten.
Der junge und ehrgeizige Petrosino fiel Theodore Roosevelt, dem damaligen Leiter der New Yorker Polizeibehörde und späteren Präsidenten, auf. Roosevelt beförderte ihn zum Detective Sergeant und zum Leiter der Mordkommission. Der Höhepunkt seiner Karriere sollte jedoch die Leitung des 1908 in Leben gerufenen Italian Squad zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität sein. Petrosino war bekannt für seine Verkleidungen, er trat als Geschäftsmann, als Priester, als Arbeiter auf. Seine Sprachgewandtheit half ihm dabei. Für seine Erfolge wurde er von der Presse gefeiert. Bald kannte jedes Kind den kleinen, ernst blickenden Mann mit der Melone aus den Zeitungen. Als der italienische Opernsänger Enrico Caruso einen Erpresserbrief der Schwarzen Hand erhielt, in dem ihm mit dem Tod gedroht wurde, war es der Opernliebhaber Petrosino, der den berühmten Sänger überzeugte, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Bei der geplanten Geldübergabe wurden die Hintermänner gefasst. Auch an der Untersuchung zum Entführungsfall des achtjährigen Toni, der am Abend des 9. August 1904 nicht nach Hause gekommen war, war Petrosino beteiligt.
Auf der Polizeistation in der Amity Street berichtet Tonis Vater Vincenzo Mannino den Polizisten zunächst von einem Vorfall, der sich am Vortag ereignet hatte. Seine Schwiegermutter Maria Pincello war am Montagnachmittag mit der Fähre von Manhattan nach Brooklyn zurückgekommen. An der Anlegestelle traf sie auf ihren Enkel Toni. Der war in Begleitung des mehr als doppelt so alten Angelo Cucozza, ein ehemaliger Arbeiter in Manninos Bauunternehmen. Ihr kam das ungleiche Paar seltsam vor, und sie sprach die beiden an. Toni und Cucozza konnten keine zufriedenstellende Erklärung für ihre Anwesenheit an der Fährstation geben. Ganz fürsorgliche Nonna, nahm Pincello daraufhin ihren Enkel bei der Hand und lieferte ihn zu Hause ab.
Auf Nachfrage seiner Eltern berichtete der Junge, Cucozza habe ihm 50 Cent angeboten, wenn er mit nach Manhattan fahren würde. Der 18-Jährige habe Toni gesagt, er müsse dort einen Behördengang erledigen und bräuchte dringend einen Übersetzer. Da er Cucozza kannte und dieser ihm versprach, ihn rechtzeitig wieder nach Hause zurückbringen, willigte Toni ein. Mit dieser Erklärung war die Angelegenheit erledigt, und niemand schenkte dem Ganzen mehr Beachtung.
Als Toni am darauffolgenden Tag auch nach Einbruch der Dunkelheit nicht vom Spielen nach Hause kommt, aber dafür ein Brief mit einer Lösegeldforderung auftaucht, bekommen die Manninos Angst. Sofort wird von den Beamten die Suche nach dem Kind eingeleitet. Die Nachricht seines Verschwindens verbreitet sich wie ein Lauffeuer.
Wenig später meldet sich der Inhaber eines Süßwarenladens: Toni war am Dienstagnachmittag in seinem Geschäft in unmittelbarer Nähe des Elternhauses an der Ecke Amity und Emmett Street, Brooklyn. Er habe eine Limonade und Süßigkeiten gekauft. Nach Aussage des Ladenbesitzers habe ihm das Kind erzählt, die Sachen seien für ihn und seinen Freund. Den Einkauf bezahlte der Junge mit einer silbern glänzenden 50-Cent-Münze. Dem Inhaber war ein junger Mann aufgefallen, der vor dem Geschäft auf Toni wartete. Der Beschreibung nach hätte es Cucozza sein können. Der Zeuge habe noch gehört, wie der Unbekannte zu dem Kind sagte: »Komm schon, Toni. Es wird Zeit für uns zu gehen.« Danach liefen beide die Straße hinunter Richtung Fähre. Seither hatte sie keiner gesehen.
Tonis Vater begibt sich in Begleitung zweier Polizisten zum Anleger, in der vagen Hoffnung, Cucozza habe tatsächlich die Fähre über den East River genommen und würde früher oder später dort wieder auftauchen. Gegen ein Uhr morgens ist der Gesuchte tatsächlich unter den Passagieren. Noch an Ort und Stelle wird er verhaftet und mit aufs Revier genommen. Zunächst schweigt er beharrlich. Er wisse von nichts, und Toni kenne er nur vom Sehen aus der Zeit, als er für dessen Vater gearbeitet habe. Erst als er mit der Aussage des Ladeninhabers konfrontiert wird und ihm keine andere Möglichkeit bleibt, gibt Cucozza zu, mit dem Kind nach Manhattan gefahren zu sein. Nun tischt er den Beamten eine neue Geschichte auf: Er sei vor ein paar Tagen von zwei ihm unbekannten Männern in Brooklyn angesprochen worden. Diese sahen vertrauenswürdig aus, und er unterhielt sich eine Weile mit ihnen. Es sei eine entspannte Atmosphäre gewesen, sie machten Scherze, und alle lachten und verstanden sich gut. »Wie es halt so ist.« Die Männer stellten ihm zwei Dollar in Aussicht, wenn er Manninos Sohn nach Manhattan bringen würde. Zunächst hielt er die Sache für einen Scherz, die Unbekannten ließen jedoch nicht locker: Alles sei ganz harmlos, er habe nichts zu befürchten. Als Cucozza versichert wurde, dass Toni nichts passiere, willigte er ein. Ein Mann würde am Montag in der Nähe von Tonis Elternhaus auf ihn und den Jungen warten. Ihm wurde eingeschärft, er sollte den Fremden nicht ansprechen und auch sonst keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Alles, was er zu tun habe, sei, diesem Unbekannten zu folgen. Cucozza habe sich nichts dabei gedacht und nur das leicht verdiente Geld gesehen. Der Deal platzte, als die Großmutter des Jungen die beiden an der Anlegestelle sah. Er gab zu, enttäuscht gewesen zu sein, da ihm nun das Geld durch die Lappen ging. Gleichzeitig war er aber auch erleichtert, da er glaubte, die Angelegenheit hätte sich nun erledigt. Den Polizisten gegenüber ließ er durchblicken, dass ihm das Ganze doch etwas seltsam vorgekommen war.
Am Tag darauf tauchte jedoch einer der beiden Männer erneut bei ihm auf. Dieses Mal verlief die Begegnung nicht so freundschaftlich. Der Mann drohte, wenn es ihm nicht gelingen sollte, Toni noch am selben Abend nach Manhattan zu bringen, würde es böse für ihn enden. Die Drohung erschien Cucozza durchaus real, und aus Angst ließ er sich erneut darauf ein. Wieder habe er das Kind angesprochen. Er ist mit ihm zum Süßwarenladen gegangen. Von dort habe er den Jungen zur Fähre gebracht. In Manhattan lieferte er ihn in einer Wohnung in der obersten Etage eines Mietshauses ab. Nach Cucozzas Aussagen war es in der 39th Street zwischen der Second und Third Avenue. Danach hielt er sich noch eine Weile in Manhattan auf und ist dann gegen Mitternacht mit der Fähre zurück nach Brooklyn. Dort angekommen, sei er den Beamten in die Arme gelaufen. Seinen Lohn, die versprochenen zwei Dollar, habe er nicht bekommen.
Die Polizisten fahren mit Cucozza nach Manhattan. Er soll ihnen das Haus zeigen. Hier ist der sich plötzlich nicht mehr sicher. Alles sehe so gleich aus. In der ersten durchsuchten Wohnung lebt ein irischer Einwanderer mit seiner Familie. Schnell stellt sich heraus, dass er mit der Angelegenheit nichts zu tun haben kann. Auch die Suche in den benachbarten Gebäuden bleibt erfolglos. Von Toni keine Spur. Wieder in Brooklyn und erneut von den Polizisten befragt, verstrickt sich Cucozza in Widersprüche. Er sagt, er sei nicht oft in Manhattan und habe sich womöglich in der Gegend geirrt.
Die Beamten kommen nicht weiter, Cucozza wird dem Untersuchungsrichter am Butler Street Court vorgestellt. Dort bekennt er sich der Entführung schuldig, verweigert aber hartnäckig jede weitere Aussage. Als er aus dem Gerichtssaal ins Untersuchungsgefängnis abgeführt werden soll, stellt sich Giuseppe Sigretti, Manninos Geschäftspartner, dem Verdächtigen in den Weg. Die Beamten schreiten nicht ein und lassen Sigretti gewähren. Der spricht mit gedämpfter Stimme, redet unablässig auf Italienisch auf Cucozza ein.
Sigretti verspricht hundert Dollar, wenn Cucozza verrät, wo er den Jungen abgeliefert habe. Dieser blockt zunächst ab. Sigretti lässt nicht locker, bis der Verdächtige gesteht, dass alles bisher Erzählte nicht ganz der Wahrheit entspräche. Er habe Angst, darüber zu sprechen, da die anderen an der Entführung Beteiligten ihn dann töten würden. Er sei nicht alleine gewesen, den ganzen Weg bis zu dem Haus, in das er Toni gebracht habe, sei ihnen ein kleiner, kräftiger Italiener gefolgt. Dieser habe ihm zugerufen, wann er nach rechts oder links abbiegen oder in eine Straßenbahn einsteigen solle. Cucozza habe sich an diese Anweisungen gehalten. Sie seien eine halbe Ewigkeit im Zickzack durch die Stadt gelaufen. Schließlich habe ihm der geheimnisvolle Führer zu verstehen gegeben, dass er an einer Straßenecke stehen bleiben und warten solle. Er habe getan, was von ihm verlangt wurde. Kurz darauf kam ein weiterer Mann hinzu, und gemeinsam sind sie in die oberste Etage eines nahe gelegenen Mietshauses gebracht worden. In der Wohnung hätten sie eine Frau vorgefunden. Es machte auf ihn den Eindruck, als hätte sie sie bereits erwartet. Cucozza wurde aufgefordert, den Jungen zurückzulassen, und die beiden Männer hätten ihn dann wieder durch das Treppenhaus auf die Straße gebracht. Unten angekommen, habe ihm der Kleinere der beiden ins Ohr gezischt, er solle so schnell er kann verschwinden. »Fahr direkt nach Brooklyn zurück. Wenn du jemals hierher zurückkommst oder der Polizei auch nur ein Wort darüber sagst, wohin du den Jungen gebracht hast, kannst du dir sicher sein, dass wir dich töten werden.« Der 18-Jährige zweifelte keinen Augenblick daran, dass die Unbekannten diese Drohung in die Tat umsetzen würden.
Nach dieser Aussage wird Cucozza erneut nach Manhattan gebracht. Dieses Mal führt er die Beamten zu einem ausschließlich von Italienern bewohnten Haus in der 317 E 39th Street. Die Wohnung mit der Nummer 16 in der obersten Etage gehört einem Mann namens Francisco Corneglio. Der arbeitet für die Long Island Railroad. Neben ihm leben dort noch seine Frau und ein Untermieter. Sowohl Corneglio als auch seine Frau versichern, mit der Sache nichts zu tun zu haben. Cucozza besteht darauf, es sei die Wohnung und es seien auch die Personen, bei denen er den Jungen abgeliefert habe. Der kleine Italiener, der ihm den Weg gezeigt habe, sei allerdings nicht unter ihnen. Alle in der Wohnung Anwesenden inklusive des Untermieters werden verhaftet und nach Brooklyn gebracht. Von Toni fehlt weiterhin jede Spur.
Zwischenzeitlich trifft ein weiteres Schreiben der Entführer bei den Manninos ein: Dem Jungen gehe es gut. Wenn die Eltern wollen, dass dies auch so bleibe, sollen sie sich von der Polizei fernhalten und auf neue Anweisungen warten. Wie die erste Nachricht ist auch diese von der Schwarzen Hand unterschrieben.
Die nächsten Tage bringen keine weiterführenden Erkenntnisse: Die vier Verdächtigen bleiben in Haft, die Polizei sucht nach Hinweisen, in der Presse wird ausführlich über den Fall berichtet. In Brooklyn weichen Sigretti und seine Frau nicht von der Seite der Manninos. Der Geschäftspartner wird mehr und mehr zum Sprecher der Familie. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen: Er informiert die Journalisten, schirmt die Eltern vor Neugierigen ab, begleitet Tonis Vater zur Polizei, ist bei allen Ortsbegehungen zur Stelle.
Je länger das Kind verschwunden ist, umso verzweifelter werden die Eltern. Dennoch gibt Mannino die Hoffnung nicht auf, seinen Sohn lebend wiederzusehen. Seine Frau hingegen verfällt zusehends in Trauer und Depressionen. Sie glaubt, die Männer haben Toni längst getötet.
Weitere Schreiben der Kidnapper tauchen auf. Am Ende sind es vier. Zwei wurden in Manhattan aufgegeben, zwei kommen aus der Gegend um Boston in Massa- chusetts. Die Polizei erhält schließlich mehrere anonyme Hinweise zu einem Mann namens Vito Laduca. Er soll der Drahtzieher der Entführung sein. Doch keiner der Zeugen will gegen ihn aussagen. Laduca ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt, schon mehrfach ist er in Verdacht geraten, in kriminelle Machenschaften verstrickt zu sein. Als sein Name mit dieser Entführung in Zusammenhang gebracht wird, läuten bei Petrosino und seinen Männern sofort die Alarmglocken.
Laduca hält sich seit 1902 in den USA auf. Bereits im Jahr darauf war er einer der Hauptverdächtigen im Barrel-Murder-Case. Der Fall hatte 1903 die ganze Stadt in Aufruhr gehalten. In einem Fass war die schrecklich zugerichtete Leiche eines Kriminellen gefunden worden. Laduca stand im Verdacht, an dem Mord beteiligt gewesen zu sein, ihm konnte aber nichts nachgewiesen werden. Ein Zigarettenstummel bei der Leiche führte Petrosino und sein Team schließlich zu Giuseppe Morello, dem Kopf der berüchtigten Morello-Bande. Morello wurde vor Gericht gestellt, und Laduca hat seinen Hals in letzter Sekunde aus der Schlinge gezogen. Seit einiger Zeit betreibt Laduca gemeinsam mit seiner Frau einen Fleischerladen in Brooklyn. Als die Beamten dort nach ihm suchen, ist er bereits untergetaucht.
Mittlerweile ist mehr als eine Woche vergangen, und die Ermittlungen scheinen sich im Kreis zu drehen. Das Verhältnis der Manninos zur Polizei verändert sich. Waren sie anfangs fast begierig darauf, mit den Beamten zusammenzuarbeiten, verhalten sie sich plötzlich abweisend. Besonders Tonis Vater distanziert sich. Auch die Allianz zwischen Mannino und seinem Geschäftspartner Sigretti scheint sich aufzulösen. Die ermittelnden Beamten hören von Streitigkeiten. Mannino ist bereit, auf jede Forderung der Entführer einzugehen. Sigretti hingegen soll eine Lösegeldzahlung grundsätzlich ablehnen. Gegenüber einem Zeugen sagt er, ihm sei es lieber, das Lösegeld in Blei statt in Gold zu bezahlen.
Und dann kommt das Unerwartete: Am Samstag, den 20. August 1904, gegen 3 Uhr morgens läuft Toni zufällig dem Cousin seines Vaters über den Weg. Salvatore Mannino sagt aus, er habe das Haus nachts noch einmal verlassen, da er nicht schlafen konnte, und da sei das Kind die Straße entlanggegangen.
Hatte sich die Polizei vom Auftauchen des Kindes Klarheit erhofft, wird ab diesem Tag alles nur noch undurchsichtiger. Toni berichtet, er sei, nachdem Cucozza ihn zurückgelassen hatte, in eine andere Wohnung verbracht worden. Diese habe sich in der obersten Etage in einem Haus in der Gegend der 106th Street befunden. Laut seinen Aussagen waren zwei Männer und eine große, dunkel gekleidete Frau bei ihm. Sie haben ihm Essen gegeben und ihn meist gut behandelt. Am Freitagabend ließen sie ihn dann plötzlich frei. Er ist in die Straßenbahn in der 106th Street gestiegen und danach mit der Fähre nach Brooklyn gefahren. Allein und ohne Begleitung. Keiner der ermittelnden Polizisten glaubt Toni. Einer der leitenden Beamten sagt gegenüber der Presse: »Ich kann nicht glauben, dass der Junge ausgerechnet dem Cousin seines Vaters zufällig begegnet ist, und ich habe weitere Informationen darüber, dass der Junge nicht allein auf der Fähre war.« Ein Informant habe das Kind mit mindestens fünf Männern bei der Überfahrt gesehen, und er sei nicht der Einzige gewesen, der dies der Polizei gegenüber bestätigt habe.
Die Familie mauert, und die Beamten bekommen fast keine Chance, mit dem Kind zu sprechen. Tonis Vater lässt den Jungen nicht aus den Augen. Bei jeder Befragung ist er anwesend. Toni soll die Verdächtigen identifizieren. Ihm soll eine Fotografie des untergetauchten Vito Laduca vorgelegt werden, um zu klären, ob dieser in die Sache verwickelt sei. Die Polizei will auch wissen, ob es sich bei Francisco Corneglio, dessen Frau oder deren Untermieter um jene Personen handelt, bei denen Angelo Cucozza das Kind zurückgelassen hat. Doch ehe Toni bei einer anberaumten Gegenüberstellung einen Blick auf die Verdächtigen werfen kann, stellt sich sein Vater dazwischen. Mit strenger Miene ermahnt er seinen Sohn: »Du kennst diese Personen nicht, oder?« Ein sichtlich eingeschüchterter Toni sagt daraufhin, er habe die Leute noch nie gesehen. Einzig an Cucozza erinnert er sich.
Auch eine Ortsbegehung wird zur Farce. Als alle gemeinsam mit den Polizeibeamten nach Manhattan aufbrechen, werden sie von Passanten erkannt. Eine immer größer werdende Menschenmenge folgt ihnen von der South Ferry über die Houston Street zur 39th Street und dann weiter bis hinauf nach Harlem zur 106th Street. Den Polizisten bleibt am Ende nur der Weg über die Dächer, um die Neugierigen abzuschütteln. Als sich die Lage zu beruhigen scheint, sieht es so aus, als würde auch die Untersuchung endlich Fortschritte machen. Toni erwähnt gegenüber den Beamten, dass er die Gegend wiedererkenne. Seinem Vater gefällt diese Aussage überhaupt nicht, und wie aus dem Nichts zieht Mannino plötzlich einen Onkel aus dem Hut. Es sei völlig klar, dass der Junge die Gegend kenne, besagter Onkel wohne in der 238 E 108th Street in der obersten Etage. Daher, und nur daher, käme seinem Sohn der Ort bekannt vor. Er selbst habe seinen Sohn zu einem Besuch mitgenommen. Die Frage der Beamten, warum er diesen Umstand erst jetzt erwähne, lässt Mannino unbeantwortet. Dafür nennt er den Namen des »Onkels«: Calogero Constantino. Constantino ist ein kleiner, untersetzter dunkelhaariger Mann mit Kotteletten. Die optische Übereinstimmung Constantinos mit der Beschreibung des Mannes, der Cucozza bei der Entführung den Weg gewiesen haben soll, ist verblüffend. Als die Beamten Toni zur Situation eingehender befragen möchten, wird dies von seinem Vater verweigert. Toni sei erschöpft und verwirrt, er müsse sich erst erholen.
Auch in den nächsten Tagen wird jeder Kontakt mit dem Kind unterbunden. Die ermittelnden Beamten sind frustriert, sie befürchten, der Junge könnte mit der verstreichenden Zeit entscheidende Einzelheiten vergessen. Einem Reporter gegenüber sagt einer der Ermittler: »Ich bin davon überzeugt, dass Mannino ein falsches Spiel spielt. Der Junge ist zweifellos vorbereitet worden. Er weiß genau, was er sagen darf und was nicht.«
Als der Vater endlich einer weiteren Befragung zustimmt, ist es Petrosino, der Leiter der Abteilung, der mit dem Jungen spricht. Mannino ist auch dieses Mal im Raum und lässt das Kind nicht aus den Augen.
Petrosino fragt Toni: »Wer hat dir gesagt, dass du nichts erzählen sollst, mein Junge?«
Das Kind ist verunsichert. Er blickt zu seinem Vater und fragt nach: »Was meinen Sie damit?«
Petrosino antwortet: »Ich meine nicht deinen Vater. Haben die Kidnapper gesagt, du sollst nichts sagen?«
Toni ist überrascht. Mannino nickt als Zeichen der Zustimmung. Erst danach antwortet das Kind: »Oh … die Kidnapper … ja. Die Frau hat mir gesagt, ich darf niemandem davon erzählen oder sie würden mich töten.«
Auf Petrosinos Nachfrage, wie die Frau denn ausgesehen habe, sagt er wie schon zuvor: »Es war eine große, schwarz gekleidete Frau.« Dabei macht er mit den Armen eine Geste, als würde die Frau bis hinauf zur Zimmerdecke reichen. Sofort beendet der Vater die Befragung.