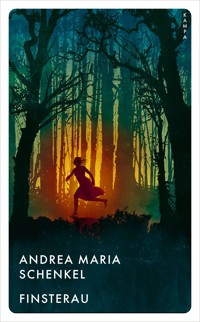9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Verfolgung, Existenzangst und Neuanfänge in der Fremde - das sind die Erfahrungen des jungen Juden Carl Schwarz, als er 1950 in Brooklyn Emmi kennenlernt, die wie er aus Bayern stammt. Sie hat Deutschland nach dem Krieg verlassen, und wie er will auch sie ein neues Leben beginnen. Carl findet bei Emmi die Heimat, die er elfjährig verlassen musste, und lebenslange Liebe und Geborgenheit. Über die Vergangenheit reden beide nicht - zu schmerzhaft sind die Erinnerungen an das, was war. Jahrzehnte später wird Carl von einer Freundin gebeten, den schriftlichen Nachlass ihres verstorbenen Ehemannes durchzusehen, eines Holocaust-Überlebenden. Nur widerwillig macht sich Carl an die Arbeit - und stößt in den Briefen und Unterlagen aus dem KZ Dachau auf Hinweise aus Emmis Vergangenheit. Das Fundament aus Verschweigen und Halbwahrheiten, auf dem ihr gemeinsames Leben basierte, beginnt zu zerbrechen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Andrea Maria Schenkel
Als die Liebe endlich war
Roman
Hoffmann und Campe
In Erinnerung an Trixi Wachsner
Weihnachten 1943 stand die junge Frau vor der Tür.
Wie das Kätzchen, das Jahre vorher nicht von der Schwelle gewichen war. Zuerst hatte er es nicht beachtet, hatte geglaubt, es würde wieder verschwinden. Doch es blieb, selbst der Schnee konnte es nicht vertreiben, der zuerst in wenigen Flocken, dann immer dichter aus dem milchweißen Winterhimmel fiel. Das Kätzchen zwängte sich in die Nische des Türstocks, bis schließlich fast nichts mehr von ihm zu sehen war; als kleine weiße Kugel lag es zusammengekauert im Eck.
Es hatte ihn gereut, er brachte es nicht übers Herz, es fortzujagen. Er öffnete die Tür, ließ es herein, gab ihm zu fressen und zu trinken, einen Platz zum Bleiben.
Anders als das Kätzchen hatte er die junge Frau schon von weitem kommen sehen, er wollte gerade den Hund ins Haus holen. Zunächst glaubte er, sie wäre eine jener Hamsterer aus der Stadt, die es im fünften Winter des Krieges von der Not getrieben aufs Land zog.
Im Gegensatz zu ihr waren diese Menschen schwerbeladen, hatten alle Habseligkeiten, auf die sie nur irgendwie verzichten konnten, im Rucksack verstaut. Goldene Uhren der Großväter, Broschen der Großmütter, Gemälde aus Familienbesitz im Tausch für drei kleine Eier, eine Ecke Butter, ein Stück Schinken oder ein wenig Milch. So mancher seiner Nachbarn tauschte in jenen Tagen gern. Ihm jedoch tat es in der Seele weh, wenn er sie sah. Manchmal legte er dann noch ein Ei oder einen Apfel dazu. Er hatte genug, der Krieg war noch nicht zu ihm gekommen in jenen Tagen, und in seinem Alter brauchte es nicht mehr so viel, um satt zu werden.
Die junge Frau hatte nur ein Bündel auf dem Rücken und einen kleinen Koffer in der Hand.
Sie war gerade am Haus angelangt, als er hinüberging in den Schuppen. Sie fragte ihn, ob sie sich auf der Bank vor dem Haus ein wenig ausruhen könne. Ihm war es recht. Wenig später, es begann dunkel zu werden, holte er noch ein paar Scheite Holz ins Haus, und da saß sie immer noch da. Er konnte sehen, dass sie fror.
»Kalt ist’s. Willst mit rein?«
»Wenn ich darf?«
Er nickte.
Er stellte ihr den Stuhl ganz nah an den Küchenofen, so konnte sie sich wärmen. Sie stellte ihr Bündel und den Koffer neben sich, kauerte sich auf den Stuhl und rieb sich die klammen Hände. Er beachtete sie nicht weiter, bereitete wortlos die Abendsuppe zu, stellte den Topf auf den Tisch und gab ihr mit einem Wink zu verstehen, dass sie herüberrücken solle. Er schob ihr einen Löffel und einen Kanten Brot hin.
»Iss.«
Gemeinsam aßen sie aus dem Topf in der Mitte des Tisches. Sie schlang hastig die Suppe hinunter.
»Was willst hier heraußen?«
»Eine Stellung suche ich.«
»Wennst willst, kannst bleiben, bist was gefunden hast. Zahlen kann ich nicht viel, aber Essen und eine warme Stube kann ich dir geben.«
Sie blieb. Er gab ihr die leere Kammer des alten Knechts.
In den ersten Tagen knurrte der Hund und verkroch sich unter dem Tisch, wenn sie an ihm vorbeiging. Mit der Zeit gewöhnte er sich an sie, wie er sich an die Katze gewöhnt hatte. Ihre Papiere waren in Ordnung, das Arbeitsbuch, alles war da. Nicht dass es ihn interessiert hätte. Den neugierigen Nachbarn erzählte er, sie sei eine Verwandte seiner verstorbenen Frau, und sie wäre ausgebombt worden. In München. Darum sei sie hier. Er hatte einen guten Leumund, alle glaubten ihm, und langsam gewöhnten auch sie sich an sie, wie der Hund sich an sie gewöhnt hatte. Sie blieb, bis der Krieg zu Ende war und darüber hinaus.
Im Sommer 1946 packte sie ihr Hab und Gut zusammen.
»Gehst?«, fragte er sie.
»Ja.«
Als sie schon ein ganzes Stück vom Haus entfernt war, blickte sie sich noch einmal um, winkte ihm kurz zu und rief ein »Vergelt’s Gott für alles«. Es war das Letzte, was er von ihr sah.
Sie ging, wie sie in sein Leben gekommen war. Und so wie der letzte Sommer schon vergessen ist, wenn sich die ersten Blätter an den Bäumen verfärben und die Spinnen sich an langen Fäden durch die Lüfte tragen lassen, hatte auch er sie schon vergessen, als die ersten Stürme die Blätter der Bäume durch die Luft tanzen ließen.
Regensburg–Shanghai
(März–Mai 1938)
1 Der Mann im Fluss
Im Schutz der Dunkelheit war der Mann in den Fluss gewatet. Seine Kleider sogen sich voll, zogen ihn nach unten, ohne Gegenwehr ließ er es geschehen, und der Tod kam lautlos und schnell. Die Donau war gnädig mit ihm, umarmte ihn zärtlich und trug ihn mit sich fort, auf die Stadt zu. Wenig später, zu beiden Seiten von Kaimauern eingefasst, nahmen die Wasser Fahrt auf. Schoben und drängten auf die Pfeiler der Brücke zu. Diese zerschnitten den Strom, zwängten die Wassermassen und den Toten mit ihnen unter der Brücke hindurch. Immer schneller von der Strömung getragen, ging es weiter, bis der Körper sich verfing und die Reise ein jähes Ende nahm.
Als Erna Gradl am nächsten Morgen das Schlafzimmerfenster öffnete, bemerkte sie zunächst nichts. Von ihrer Wohnung aus konnte sie über den Fluss hin zur Altstadt sehen. Die Türme des Doms und der mittelalterlichen Patrizierhäuser erstrahlten im Licht der aufgehenden Sonne. Erst als sie das Oberbett zum Lüften über den Fenstersims hängte, sah sie den Arm, der aus dem Wasser ragte und von der Strömung hin und her geschwenkt wurde, als wollte der Tote ihr und den Menschen am Ufer ein letztes Lebewohl zuwinken. Erna Gradl schlüpfte in Jacke und Schuhe und rannte die Treppen hinunter aus dem Haus, hinüber zur Donau. Als sie dort ankam, hatte sich bereits eine Menschentraube gebildet. Schaulustige wie sie standen auf der Brücke und blickten hinunter in den Fluss.
Auch Carl und Ida waren zur Brücke gelaufen, und fast wäre es ihnen gelungen, sich durch die Reihen der Erwachsenen hindurchzuquetschen und einen Blick auf den Toten im Strom zu erhaschen, aber Grete Schwarz erwischte ihre Kinder gerade noch und zog beide unsanft zurück.
Carl dachte den ganzen weiteren Tag an den Toten. Er stellte sich vor, wie es wohl war, zu ertrinken, und noch mehr, wie es unten am Grund aussah. Dort im schlammig-sandigen Segment der Donau, in dem Welse hausten mit Mäulern so groß, dass ein Hund oder ein Ferkel leicht darin Platz fänden. Zweihundert Jahre, hatte er gehört, sollten Waller alt werden können. Einer der Fischer am oberen Ende der Wöhrdstraße hatte das gesagt, im letzten Herbst, als Carl dabei zusah, wie der Mann ein solches Ungetüm aus einer Zille heraus an Land schaffte. Fast hätte der den Fang nicht allein tragen können, ein weiterer Fischer eilte herbei, um ihm zu helfen, so groß war der Wels gewesen. Als der schließlich auf der Kaimauer lag, schaute Carl sich den Fisch genauer an. Der Körper war unförmig blauschwarz, der Kopf riesig. Mit wulstigen breiten Lippen, fleischigen Barteln zu beiden Seiten des Mauls, schnappte der Wels gierig nach Luft.
»Glaubst du, der ist ins Wasser gegangen oder hineingefallen?«
»Wer?« Carl wusste nicht, worüber seine Schwester sprach, zu jäh hatte Ida ihn aus seinen Tagträumen gerissen.
»Na, der Tote. Die Wasserleiche, der, der sich unten am Pfeiler der Brücke verfangen hat.«
»Keine Ahnung.« Es war besser, wenig Interesse zu zeigen. Sonst würde Ida zu plappern anfangen und ewig nicht aufhören, und er wollte lieber in Ruhe seinen eigenen Gedanken nachhängen.
Beide saßen sie mit baumelnden Beinen auf der Befestigungsmauer, unter ihnen die schlammig braunen Wasser der schnell dahinfließenden Donau. Sie sollten hier vor dem Haus An der Hundsumkehr auf ihre Mutter warten. Carl blickte über den Fluss hinweg zum anderen Ufer. Wenn er die Augen zu einem kleinen Schlitz zusammenkniff, kam es ihm vor, als würde die Donau in zwei Richtungen zur gleichen Zeit fließen. Ein Stück weiter flussabwärts zwängten sich die Fluten durch die Pfeiler der Steinernen Brücke hindurch. Er fragte sich, ob dem Mann die Kräfte ausgegangen waren, weil er sich zu sehr gegen den Sog des Strudels gestemmt hatte. Wenn man auf der Steinernen Brücke stand und hinuntersah, konnte man die Wirbel des Wassers und die darauf tanzende weißliche Gischt sehen. Carl glaubte, das Wasser wollte ihn und einen jeden, der darauf hinuntersah, anlocken. Er stellte sich vor, von der Brücke zu springen und unterzutauchen. Er glaubte, den Sog zu spüren, der ihn hinunterziehen würde. Sein Vater hatte ihm erklärt, wenn er in einen Strudel gerate, müsse er sich still verhalten, dürfe nicht dagegen ankämpfen. »Du musst dich bis auf den Grund ziehen lassen. Nur dann hast du eine Chance, aus dem Strudel wieder aufzutauchen. Wer sich dagegen wehrt, ist verloren. Das Wasser ist stärker, es nimmt dir die Kraft«, hatte der Vater gesagt.
»Erika behauptet, Wasserleichen schauen gruselig aus. Aufgedunsen, mit runzeliger Haut, wie wenn man zu lange in der Badewanne gesessen hat.« Carl hatte es gewusst: Ida würde nicht aufhören zu plappern.
»Die muss es wissen. Die wohnt ja praktisch auf dem Friedhof.« Erika war Idas Freundin. Ihr Vater hatte eine Sargschreinerei in Reinhausen, gleich neben dem Haus der Großeltern. Wann immer die Kinder dort zu Besuch waren, waren die beiden Mädchen unzertrennlich.
Carl konnte Erika nicht ausstehen, seit sie ihm im letzten Sommer ihren Ziegenbock, der in einem kleinen Verschlag im Garten untergebracht war, auf den Hals gehetzt hatte.
»Hast du gewusst, dass den Toten im Leichenschauhaus eine Schnur um die Zehen gebunden wird? Wenn einer wieder aufwacht, dann läutet im Haus des Friedhofvorstehers eine Glocke.«
»Ist er nur scheintot und wacht auf, reicht die kleinste Bewegung mit den Zehen.« Sie wackelte mit den Fingerspitzen leicht hin und her. »Es muss schrecklich sein, lebendig in einem Sarg zu liegen, und keiner hört dich«, sinnierte Ida. »Erika hat gesagt, früher hat man sich deshalb auch gegen Aufpreis einen Herzstich machen lassen können, damit man auch wirklich tot ist.«
»Das ist doch alles ein Blödsinn.« Carl hob einen kleinen Stein auf und warf ihn ins Wasser.
»Ist es nicht«, sagte Ida energisch. »Ich habe mit Erika ausgemacht, dass wir, wenn ich das nächste Mal bei den Großeltern bin, im Dunkeln über den Friedhof gehen. Am besten um Mitternacht, da sollen die Geister der Scheintoten wie Irrlichter zwischen den Gräbern herumlaufen. Kommst mit?«
Carl malte mit einem kleinen Holzstöckchen Kreise in den Sand, der sich auf dem Kai abgelagert hatte.
»Du traust dich nicht, stimmt’s?«
Ida beugte sich nach vorn, die Beine baumelten weiter in der Luft, und die wollenen Strümpfe schoben sich über ihren Knöcheln zusammen.
»So ein Blödsinn. Pass du lieber auf, dass du nicht das Gleichgewicht verlierst und von der Mauer fällst, wenn du dich so weit vorbeugst.«
»Ich falle nicht.« Ida drehte ihren Kopf zur Seite und blickte von unten zu Carl hoch. »Du traust dich nicht, weil du Angst hast. Vor den Geistern der Toten.«
Carl nahm einen weiteren Stein und sah auf die vorbeifließende Donau. »Die Erika, die sagt viel, wenn der Tag lang ist.« Er versuchte möglichst gleichgültig zu klingen; er wusste, je mehr Missmut er zeigte, desto weniger würde seine Schwester mit dem Sticheln aufhören. Er hielt den Kiesel in seiner Hand. »Deine Freundin ist eine ganz Gschnappige, sie weiß immer alles ganz genau.« Carl holte aus und warf den Stein so weit er konnte ins Wasser. »Als ob die schon jemals in der Nacht auf dem Friedhof war.«
»War sie eben doch, sie hat es mir erzählt.«
»Du glaubst auch alles, was man dir sagt, Ida. Die redet doch bloß saublöd daher.«
»Macht sie nicht, sie hat gesagt, wenn ich will, kann sie mir die Geister auf dem Friedhof zeigen.«
Carl sah sich nach einem größeren Stein um. Als er keinen fand, stand er auf und lief ein kleines Stück die Kaimauer entlang. Der Boden war hier noch von der schlammigen Schicht des letzten Hochwassers bedeckt. Seine Schwester hörte nicht auf zu reden, über ihre Freundin und über Untote, die angeblich auf dem Friedhof ihr Unwesen trieben. Carl versuchte ihr nicht zuzuhören und konzentrierte sich ganz auf seine Suche. »Erika hat gesagt, wenn ich mich in der Nacht aus dem Haus schleichen könnte, würde sie mit mir auf den Friedhof gehen. Wenn du willst, kannst mitkommen.«
Im Schmutz zwischen Sand und Kiesel glaubte er, eine Münze gefunden zu haben.
»Als wenn Oma es nicht merken würde, dass du dich in der Nacht aus dem Haus schleichst.«
Carl bückte sich und hob die Münze auf.
»Was hast da?«
Schnell ließ er das Geldstück in die Jackentasche gleiten. »Nix.«
»Du lügst doch, du hast was aufgehoben und in deine Tasche gesteckt.« Ida sprang auf und lief zu Carl hinüber.
»Komm, zeig mir, was du gefunden hast. Bitte.«
Zögernd holte Carl die Münze aus der Tasche.
»Ein Geldstück, das musst du sauber machen, es ist ja ganz voller Dreck. Warte.« Sie zog ihr Taschentuch aus der Jackentasche. »Gib her.« Carl hielt ihr die Münze hin. Ida nahm sie, spuckte sie an und rieb sie mit dem Tuch trocken. »Ein Zehnerl! Wenn wir davon Bonbons kaufen, gebe ich es dir wieder zurück.« Ida versteckte die Münze in der Faust hinter ihrem Rücken.
»Gib’s wieder her.« Carl packte ihr Handgelenk mit der einen Hand und versuchte mit der anderen, seiner Schwester das Geldstück aus der Faust zu winden.
»Aua, das tut weh! Wenn wir teilen, bekommst du es wieder, sonst sage ich es der Mutter.« Carl ließ los, seine Schwester streckte ihm die flache Hand entgegen. Er nahm das Zehnpfennigstück und steckte es schnell ein, ehe Ida es sich anders überlegen konnte.
»Aber du musst mit mir teilen! Denn was dir nicht gehört, bleibt dir nicht.«
Wenig später kam die Mutter aus dem Haus und holte die Kinder ab. Sie sah müde und erschöpft aus. »Es ist Zeit, kommt, wir gehen heim.«
Den ganzen Weg spielte Carl mit der Münze in seiner Jackentasche. Er rieb sie zwischen seinen Fingern. Es fühlte sich gut an. Er hatte die Münze gefunden. Zehn Pfennig. Ein Schatz, ein Vermögen! Eine ganze Tüte Süßigkeiten. Warum sollte er mit seiner Schwester teilen? Kurz vor der Hengstenbergbrücke holte er die Münze schließlich aus der Tasche heraus. Er warf sie leicht in die Höhe, Ida sollte es sehen. Aber nicht zu hoch, er wollte sicher sein, sie immer wieder vor Ida zu fangen. Seine Schwester lief neben ihm her und beobachtete ihn misstrauisch. Ihre Mutter ging ein ganzes Stück vor ihnen, drehte sich nur hin und wieder zu den Kindern um. Warf ihnen dabei einen mahnenden Blick zu, um sie so zur Eile anzutreiben. Carl nahm das Zehnerl zwischen Zeigefinger und Daumen. Er hielt es locker, dass es leicht zwischen seinen Fingern über das Geländer rollte, und doch fest genug, um nicht davonzuspringen. Die Münze drehte sich, er ging schneller. Das Geldstück rollte weiter und weiter, über die Unebenheiten des Geländers hinweg und sicher geführt von Zeigefinger und Daumen. Das Zehnerl tanzte zwischen seinen Fingern. Er blickte triumphierend zu Ida. Er wurde immer übermütiger, ging schneller und schneller, lief beinahe und das Zehnerl mit ihm. Dann geriet er ins Stolpern, das Geldstück rutschte aus seiner Hand, rollte weiter über das Geländer; ganz langsam, wie in Zeitlupe sah er der schlingernden Münze noch eine Weile zu, bis sie gegen einen auf der Brücke befestigten Beleuchtungsmast stieß. Sie prallte ab, sprang über das Geländer hinaus und hinab in den Fluss. Carl versuchte sie noch zu packen, griff aber zweimal nur ins Leere und fiel schließlich selbst der Länge nach hin.
»Ich habe dir gesagt, was dir nicht gehört, bleibt dir nicht.« Ida stand da und grinste ihn an. »Jetzt hat es der Tote, als Fährgeld in die Ewigkeit.«
»Du mit deinem Blödsinn.« Carl stand auf und wischte sich ärgerlich den Staub von der Hose. Eigentlich wollte er Ida einen Schubs geben, ließ es jedoch bleiben, da sich die Mutter in diesem Moment zu ihnen umwandte und sie mit strengem Blick ermahnte, schneller zu laufen.
Zu Hause erwartete Frau Gradl, die Nachbarin, sie schon im Treppenhaus. »Frau Schwarz, gut, dass ich Sie sehe. Haben Sie einen Augenblick Zeit? Kommen S’ doch rein.« Geschäftig winkte sie die drei zu sich in die Wohnung. »Ich habe was für die Kinder.« Auf dem Tisch in der Wohnküche stand ein kleines Osterlamm, dick und weiß von Zucker.
»Für den Carl und die Ida. Ich habe es extra gebacken«, sagte die Nachbarin nicht ohne Stolz. »Bitte nehmen S’ doch Platz.« Ohne auf eine Antwort zu warten, rückte sie die Stühle zurecht und holte das Geschirr von der Anrichte. »Einen Kaffee trinken S’ schon mit? Das Wasser ist schon aufgesetzt.«
»Mama, schau, das Lamm hat richtige Locken und eine Fahne mit einem goldenen Kreuz auf grünem Grund.« Ida deutete mit dem Finger auf den Kuchen.
»Ich hab es mit Eischwerteig gebacken. Der ist so leicht, er zergeht fast auf der Zunge.« Während die alte Frau sprach, schnitt sie das Lamm in Stücke. »Nehmen S’ doch Platz, Frau Schwarz.«
Zögerlich und unsicher setzte sich Grete. »Das ist aber nett von Ihnen, Frau Gradl, und es wäre gar nicht nötig gewesen.«
»Ist schon gut«, winkte die Angesprochene ab und legte ein Stück auf einen Teller, den sie Ida reichte. »Da, greif zu.« Ida hob das Kuchenstück auf und biss hinein. Brösel verteilten sich über Teller, Tisch und Jacke.
»Aufpassen, Ida. Iss schön über dem Teller.« Grete schob den Kuchenteller etwas näher an ihre Tochter heran.
»Ach, das macht doch nichts, das kann man später alles wegwischen. Warten S’, ich gieß nur schnell den Kaffee auf, trinken S’ schon einen mit? Ich bin gleich wieder da.« Frau Gradl eilte hinüber zum Herd.
»Haben Sie es schon gehört? Der Tote, das ist der Friesinger«, rief die Nachbarin von Herd herüber, während sie das Kaffeemehl mit dem heißen Wasser aus der Schöpfkelle überbrühte. »Der von der Eisenwarenhandlung. Er ist ins Wasser gegangen. Schrecklich, nicht?«
Mit gedämpfter Stimme fuhr sie fort. »Die Leute erzählen, dass er sich umgebracht hat, weil er sein Geschäft hat aufgeben müssen. Der neue Inhaber hätte ihn ja weiter arbeiten lassen, aber das wollte er nicht. War halt scheinbar zu stolz dafür, kann man ja verstehen, dass es nicht einfach ist, aber da muss man einmal über seinen Schatten springen und den Stolz hinunterschlucken, sag ich immer. Das ist halt so mit den neuen Gesetzen und der Verdeutschung.«
Grete Schwarz kniff die Lippen zusammen und stand abrupt vom Stuhl auf. »Ich glaube, es ist schon Zeit. Danke für den Kuchen, Frau Gradl, aber wir müssen gehen. Kommt, Kinder.«
»Wollen Sie nicht doch eine Tasse Kaffee? Der wäre jetzt gleich fertig!«
»Nein, es ist wirklich sehr nett, aber ich muss heim. Komm, Ida, komm.« Grete nahm die Kinder bei der Hand und zog sie aus der Wohnung. Die alte Frau folgte ihnen und redete unentwegt weiter. »Haben Sie wirklich keine Zeit mehr? Na, dann vielleicht ein andermal, aber warten S’, das Osterlamm, das gebe ich den Kindern schon mit, es hat ihnen ja so geschmeckt.«
Ehe Grete ablehnen konnte, war Frau Gradl schon wieder in ihrer Wohnung verschwunden. Ida und Carl blieben vor der offenen Tür stehen, während Grete die Schlüssel zur eigenen Wohnung in der Tasche suchte. Mit dem Teller in der Hand kam Erna Gradl zurück.
»Schau, Ida, kannst den Teller halten? Oder noch besser, dein Bruder hält ihn, dann kannst du in Ruhe weiteressen. Schau, die Fahne, das ist das Zeichen zur Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, den haben die Juden damals ans Kreuz genagelt.« Frau Gradl sah Grete an. »Oder hätte ich das jetzt nicht sagen sollen? Ihr Mann ist ja auch ein Jude«, sagte die alte Frau.
Grete schob Carl zur Seite und nahm ihm den Teller weg. »Ich weiß, wer Jesus Christus war, denn ich stamme aus einer katholischen Familie, Frau Gradl. Und mein Mann ist katholisch getauft.« Sie drückte der Nachbarin den Teller in die Hand. »Ich weiß, dass Sie es gut gemeint haben. Danke.«
Dann sperrte sie die Tür auf und schob die Kinder in die Wohnung. »Kommt, Kinder.«
Die alte Frau stand verdutzt im Treppenhaus. »Dann ist Ihr Mann aber trotzdem nur ein Judenchrist, und auch die haben unseren Herrn ans Kreuz genagelt, sagt der Herr Pfarrer.«
Das Licht der Nachttischlampe war schon längst gelöscht, doch Ida lag immer noch wach im Bett. Durch das Fenster fiel das Mondlicht herein. »Carl, schläfst du schon?«
»Nein, aber fast.«
Sie setzte sich im Bett auf und sah zu ihm hinüber. »Schade, dass du das Osterlamm nicht probiert hast. Es war richtig gut. Die Eischneelocken sind im Mund geschmolzen. Ich hätte jetzt gerne noch ein Stück.«
»Ich mag die Gradl nicht. Sie ist eine alte Hexe. Die steht immer hinter dem Vorhang und schaut den ganzen Tag, was die Leute machen«, antwortete Carl leise.
»Ich mag sie auch nicht, aber backen kann sie.« Nach einer kurzen Pause flüsterte Ida: »Kann ich zu dir rüberkommen? Ich kann nicht einschlafen.«
»Ja, komm, aber wenn du mir die Decke wegziehst, musst du wieder in dein Bett.«
»Darf die Berta auch mit?«
»Ja.«
Ida nahm ihre Puppe unter den Arm und zwängte sich zu ihrem Bruder ins Bett. »Kannst noch ein bisschen rutschen?«
Carl schnaufte, rückte aber dennoch ein kleines Stück.
»Gute Nacht, Ida.« Dann drehte er sich mit dem Gesicht zur Wand. Es dauerte nicht lange, und beide waren eingeschlafen.
Georg Schlattner hatte den Wagen außerhalb des Lichtkegels der Straßenbeleuchtung geparkt, man konnte nur an der hin und wieder aufglimmenden Zigarette erkennen, dass jemand im Auto saß. Er wartete lange, ehe er ausstieg. Den Kragen hochgestellt und den Hut tief ins Gesicht gezogen, querte er die Straße und ging auf das Haus zu. Die Haustür war unverschlossen. Er blickte sich noch einmal zu beiden Seiten um. Im Dunkeln stieg er die Treppen hinauf zum ersten Stock. Vor der Wohnung blieb er stehen, wartete kurz, zögerte, dann erst drehte er den Klingelknopf an der Tür.
Grete Schwarz öffnete. »Schorsch, was machst du hier? So spät? Ist was passiert?«
Schlattner grüßte kurz und schlüpfte dann an der überraschten Grete vorbei in die Wohnung. »Mach schnell zu, braucht keiner sehen, dass ich hier bin. Ich muss mit euch reden.«
»Wir wollten gerade ins Bett gehen, ich gebe dem Erwin Bescheid, dass er sich noch schnell was Richtiges anziehen kann.«
»Das braucht er nicht, Gretel, ich bleib nicht lang.«
Grete klopfte an der Schlafzimmertür »Erwin, komm schnell raus, der Schorsch ist da.«
Erwin Schwarz sah erstaunt aus, als er Georg Schlattner neben seiner Frau im Flur stehen sah.
»Grüß dich, Erwin. Ich hab was mit euch zu bereden, aber nicht hier auf dem Gang.«
Erwin nickte »Komm, gehen wir in die Küche.« Er wies dem Besucher mit der Hand den Weg. »Was bringt dich jetzt so spät noch zu uns her?«
Die Männer kannten sich seit ihrer Kindheit. Sie waren in die Volksschule und später auch gemeinsam auf das Neue Gymnasium gegangen. Während Erwin in Erlangen Medizin studiert hatte, ging Georg Schlattner nach ein paar Semestern Jura zur Polizei. Und auch da hatten sich ihre Wege wieder gekreuzt, Schlattner hatte bis zur Pensionierung des alten Haubner, Gretes Vater, als dessen Assistent gearbeitet. Fünf Jahre war es jetzt her, dass Kriminaloberkommissar Gustav Haubner, mit allerlei Auszeichnungen und Belobigungen dekoriert, höflich, aber sehr eindringlich aufgefordert worden war, um seine Pension einzugeben. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten waren Leute wie er nicht mehr gefragt. Genau wie Otto Hipp, der ehemalige Bürgermeister, hatte er sich mehrfach öffentlich gegen die NSDAP ausgesprochen. Und als Hipp sein Amt hatte aufgeben müssen und durch den überzeugten Parteigänger Dr. Otto Schottenheim ersetzt wurde, blieb auch Haubner nichts übrig, als um seine Pensionierung zu bitten. Sein Assistent blieb, passte sich wie so viele der neuen Zeit an.
»Magst dich nicht setzen, Schorsch?« Grete rückte den Stuhl ein wenig zurecht, »oder wollen wir vielleicht doch lieber rüber ins Wohnzimmer gehen?«
»Nein, nein, hier, das passt schon.« Georg Schlattner nahm den Hut vom Kopf, und ohne den Mantel auszuziehen, setzte er sich. »Ich … bleib nicht … lang.«
Schlattner sprach langsam und stockend, als wäge er jedes Wort genau ab. »Wir haben heute den Friesinger aus der Donau geholt … In der Wohnung haben wir Frau und Tochter gefunden. Selbstmord. Sie sind in den Betten gelegen, als ob sie schlafen würden.«
»Um Gottes willen!« Grete setzte sich erschrocken neben ihren Mann an den Tisch.
»Ich dürfte euch das gar nicht sagen.« Die ganze Zeit blickte Schlattner auf den Hut, den er langsam in seinen Händen drehte. »Ein Abschiedsbrief, und das hier hat auf dem Tisch gelegen.« Er griff in die Innentasche seines Mantels und legte einen Briefumschlag auf den Küchentisch.
»Der Friesinger ist arisiert worden. Firma und Grundstück sind jetzt in deutscher Hand. Der Hermann Hans, dein alter Parteifreund von der Bayerischen Volkspartei, ist dafür zuständig, als rechte Hand von unserem Bürgermeister. Der Hermann war schon immer ein zäher Hund, das weiß ich noch vom Studium. Jetzt ist er ein abgebrühter Grundstückshändler.« Georg Schlattner lächelte bitter. »Selbstmord von ein paar Juden interessiert keinen. Erwin, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll … ich habe lange überlegt … ich will, dass ihr den Umschlag nehmt und geht.«
»Ich versteh dich nicht, was ist da drin? Wo sollen wir hingehen?«
Schlattner blickte Erwin zum ersten Mal direkt an, seit er am Tisch saß. »Schiffspassagen nach Shanghai. Der Friesinger braucht sie nicht mehr, aber ihr braucht sie.«
»Ich versteh dich nicht, Schorsch.«
»Erwin, ich kenne dich schon lang, ich weiß, wie du fühlst, aber für die meisten Leute bleibst ein Jud, und mit diesen Schmarotzern will keiner was zu tun haben. Niemand kann aus seiner Haut. Allein schon, dass ich hier bei euch sitz, kann mich meine Karriere kosten.«
»Ich glaub, dann solltest du gehen.« Erwin wollte von seinem Stuhl aufstehen, doch seine Frau legte eine Hand auf seinen Arm. »Lass den Schorsch ausreden.«
Erwin schüttelte den Kopf, »Ich will es gar nicht hören. Meine Familie lebt seit fast vierhundert Jahren hier. Immer hier.« Um seine Worte zu unterstreichen, schlug er zweimal mit der flachen Hand auf den Tisch »Es hat immer wieder schlechte Zeiten gegeben. Wir sind nicht gegangen, Gretel, manchmal ist es schlimmer, manchmal besser.«
»Und jetzt kommt es ganz schlimm, du wirst noch an mich denken, aber dann ist es zu spät«, fiel Schlattner ihm ins Wort. »Schau dich doch an, Erwin, du darfst nur noch als Krankenbehandler für andere Juden arbeiten, und dein ehemaliger Kommilitone und Burschenschaftskamerad, der Herr Dr. med. Otto Schottenheim, wo ist der? Hilft dir der? Ich sehe nichts!« Georg Schlattner war von seinem Stuhl aufgestanden und beugte sich weit über den Tisch, beide Hände auf der Tischplatte aufgestützt »Den großen Menschenfreund gibt er, aber nur für rassisch einwandfreie Bürger. Draußen am Harthof lässt er eine Siedlung bauen. Sogar nach ihm benannt worden ist’s. Da lässt sich einer schon bei Lebzeiten ein gewaltiges Denkmal setzen. In der Stadt stolziert er rum mit seiner SS-Uniform, wie der Gockel auf dem Mist, und wer nur verkehrt schnauft, wird von seinen Schergen in Schutzhaft genommen. Erwin, wach auf, wie soll das weitergehen?« Schlattner setzte sich wieder und rückte mit dem Stuhl näher an den Tisch heran.
»Es ist immer weitergegangen«, erwiderte Erwin trotzig. »Und so wird es auch diesmal sein. Selbst wenn wir gehen wollten, wo sollten wir hin? Ohne Visa und ohne Bürgen? Es ist nicht so, ich mach mir auch meine Gedanken, das kannst mir glauben.«
»Hör auf mich, sei kein Tor.« Schlattner schob den Umschlag über den Tisch. »Dahin braucht ihr keine Visa.«
Erwin Schwarz schüttelte den Kopf »Ich geh nicht zu den Chinesen. Was will ich bei den Schlitzaugen? Ich gehöre hierhin und nirgends sonst. Ich bin getauft. Ich bin genauso katholisch wie ihr zwei. Das Judentum ist mir fremd. Mein Vater hat sich nur wegen seiner und der Familie meiner Mutter nicht taufen lassen. Ich bin den Schritt gegangen und habe jede Verbindung dazu aufgegeben. Ich bin katholisch und so deutsch wie ihr beide auch. Shanghai – weißt du, wie weit das von hier weg ist? Das Klima, das Essen, die Menschen – alles ist anders.«
»Erwin, bitte sei leiser.« Grete versuchte ihren Mann zu beruhigen.
»Ich bin nicht leiser, Gretel. In der Zeitung kannst lesen, dass Shanghai ein Sumpf ist. Es hat die höchste Verbrecherrate auf der ganzen Welt, und da soll ich mit unseren Kindern hin? So schlimm kann es hier nicht werden, wie es da unten jetzt schon ist. Drogen, Prostitution – willst du, dass die Kinder so aufwachsen? Unter einem Haufen Räuber, Banditen und Schmarotzer? Willst du das? Gretel, sag! Und von was willst du leben?«
»Ich will, dass unsere Kinder ein vernünftiges Leben haben, Erwin. Was glaubst, wie oft ich in der Stadt schon angespuckt worden bin? Die Kinder werden größer, die kriegen immer mehr mit. Ich will nicht, dass sie aufwachsen und von den anderen gemieden werden, weil sie Mischlinge sind, Bastarde! Im Augenblick mag es noch nicht so schlimm sein, aber es ist schlimm genug, und es wird noch schlimmer werden. Ärzte braucht man überall auf der Welt. Erwin, ich bitte dich, der Schorsch hat recht.«
»Und ob ich recht habe. Denen, die jetzt das Sagen haben, ist es egal, ob du dich als Deutscher fühlst und in der Burschenschaft warst. Oder haben sich die Kameraden von der Bubenruthia noch einmal bei dir gemeldet? Genauso wenig wie unser Herr Bürgermeister. Und die Bayerische Volkspartei, wo sind’s die Herren? Der Hipp hat gehen müssen, und der Hermann ist jetzt in der NSDAP. Aus ist es mit dem konservativen politischen Katholizismus. Ein jeder schaut, wie er durchkommt; für die Leute bist du ein Jude, da kannst dich zehnmal taufen lassen, und die Gretel ist deine Schickse.«
»Was der Schorsch sagt, stimmt, Erwin. Keiner hat uns bisher geholfen, weder deine alten Parteifreunde wie der Hermann noch der Otto. Weg schauen alle, wenn ich sie auf der Straße sehe, als ob ich Luft wäre.«
»Hör auf deine Frau. Die Zeiten haben sich geändert. Was glaubst du, heutzutage genügt es schon fast nimmer, nur in der Partei zu sein, damit du vorwärtskommst. In der SS sollte man sein, auch das macht uns unser Herr Bürgermeister ja schön vor.
Die Burschen von NSKK kann man schon fast nicht mehr zurückhalten. Die warten jeden Tag drauf, dass sie einen erwischen, den sie aufmischen können. Und bei uns im Präsidium? Ein jeder ist sich selbst der Nächste. Keiner schaut mehr so genau hin, dann ist der eine oder andere halt so lange gegen die Tür gerannt, bis er liegen geblieben ist, und anschließend geht er, damit die Gesellschaft vor einem solchen Element geschützt ist, nach Dachau.«
»Schorsch, ich kann nicht – an den Fahrkarten, da klebt das Blut vom Friesinger. Wie soll ich da gehen?« Erwin Schwarz schob den Umschlag weiter von sich fort.
»Skrupel kannst du dir nicht mehr leisten, Erwin. Die Herren von der Arisierung hatten auch keine gehabt, wie sie den Friesinger um Hab und Gut gebracht haben. Euch läuft die Zeit davon – wenn ihr noch weiter wartet, dann kann ich nichts mehr für euch tun. Ich muss auch schauen, wo ich bleib; wenn ich deinem Schwiegervater nicht so viel zu verdanken hätte, glaubst du, ich würde dann hierherkommen?«
Georg Schlattner stand von seinem Stuhl auf. »Ich sag es dir noch einmal: Ihr müsst gehen! Der Friesinger war am Ende, mit fast siebzig und einer kranken Tochter. Der hatte keine Wahl mehr. Aber du hast eine, ergreif sie!«
Erwin schüttelte wortlos den Kopf.
»Was bist du nur für ein Tor?« Georg Schlattner wandte sich um und ging. Grete lief hinter ihm her. An der Haustür drehte er sich zu ihr um. »Gretel, du weißt, ich mag dich gern, und wenn du damals den Erwin nicht genommen hättest … ich hätte dich gleich genommen. Gescheiter wäre es gewesen. Aber es ist, wie es ist. Rede mit ihm. Ihr müsst weg. Der Friesinger und die Seinen, die brauchen die Passagen nicht mehr. Der hat sich nicht nur wegen der Arisierung umgebracht: Sein Sohn … der kommt nicht mehr, den haben die in Dachau in der Schutzhaft erschlagen, weil er ein Jude war. Keiner traut sich, das zu sagen, und ich halte auch meinen Mund. Du musst zum Lloyd, alles umschreiben lassen, und dann noch auf die Stadt. Das kostet natürlich was, umsonst ist der Tod, aber du darfst nicht warten, das Schiff wartet auch nicht.«
»Ich weiß nicht, Schorsch … der Erwin ist doch beim Paulusbund, glaubst du nicht, dass die uns helfen können?«
»Sag mal, Gretel, verstehst du mich auch nicht? Hat dich dein Mann auch schon ganz närrisch gemacht? Den Bund gibt es nicht mehr! Und wenn sie morgen einen neuen aufmachen unter anderem Namen, dann gibt es den auch bald nicht mehr! Egal, ob katholisch oder protestantisch getauft, alle Assimilierten können noch so oft beteuern, mit dem Judentum nichts am Hut zu haben. Helfen tut es am Ende nichts. Ich bitte dich, Gretel, nimm die Kinder und geh!«
Mit diesen Worten setzte er seinen Hut auf, zog ihn tief ins Gesicht und ging hinaus in die Nacht.
Als Grete in die Küche zurückkam, saß ihr Mann immer noch am Tisch und starrte ins Leere. Sie setzte sich ihm gegenüber, nahm seine Hände in ihre und hielt sie fest.
»Erwin, ich weiß, du willst es nicht hören, aber wir müssen gehen. Schau dich doch um – die ganze Stadt erstickt fast in Hakenkreuzfahnen. Seit der Otto Bürgermeister ist, schikaniert er die jüdischen Familien der Stadt. Vor jedem jüdischen Geschäft haben seine Schergen und Spitzel Stellung bezogen. Ganz gleich, wie groß und alteingesessen sie sein mögen. Vorm Schocken auf dem Neupfarrplatz stehen sie genauso wie in der Maxstraße oder vorm Manes in der Goliathstraße. Selbst wenn keiner von der Bande zu sehen ist, traut sich die Kundschaft nicht mehr hinein – es könnte an der Ecke einer lauern und es bei erster Gelegenheit weitererzählten. Es ist ein abgekartetes Spiel, und wir haben keine Chance. Du hast es doch gehört, der Hermann zieht den Geschäftsleuten, die es trotz aller Widerstände bis jetzt geschafft haben, den Boden unter den Füßen weg, indem er ihnen ihr Hab und Gut für Pfennigbeträge abluchst.«
»Gretel, ich habe mit dem Judentum nichts zu tun, ich bin getauft. Und mehr noch, ich will damit nichts zu tun haben, weder als Konfession noch als Volkstum oder ich weiß nicht, was. Ich bin Deutscher. Ich bin für mein Land in den Krieg gezogen und habe für mein Land gekämpft. Ich gehöre hierher, nirgendwohin sonst.«
»Mir musst du es nicht erzählen, aber glaubst du wirklich, dass sich noch einer darum kümmert, dass du das Eiserne Kreuz für deine Tapferkeit und Verdienste im Krieg bekommen hast? Diesen Leuten ist das einerlei. Der Schorsch hat recht, für die bin ich eine Hure, die sich eingelassen hat mit einem Juden. Für diese deutschen Volksgenossen lebe ich in Rassenschande, und unsere Kinder sind minderwertige Mischlinge.«
Erwin zog seine Hände zurück. »Unser Land ist mehr als diese Leute. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Es geht nicht um uns, es geht um die Juden aus Polen und weiß Gott woher sonst noch. Orthodoxe und Sektierer, diese Leute haben nichts mit uns gemein. Sie überfluten unser Land und wollen sich nicht anpassen. Oder jene, die kein Gewissen haben und nur ans Geld denken. Spekulanten, die wie Leichenfledderer über uns herfallen, uns ausbluten lassen wollen. Es geht nicht um uns national Gesinnte, wir haben uns angepasst. Wir müssen einfach aushalten, und alles wird wieder gut.«
»Was redest du da? Erwin! Es geht um Menschen wie du und ich.« Grete sah ihren Mann an. »Wieder gut? Was soll wieder gut werden? Im Augenblick wird nur alles schlechter. Der arme Herr Friesinger und die Seinen sind der Beweis! Anständige Leute. Auf was willst warten? Darauf, dass wir am Ende auch in den Strudel springen, weil uns nichts anderes übrig bleibt?«
»Gretel, du versündigst dich!«
»Ich gehe morgen zum Lloyd und anschließend auf die Stadt. Ich lasse die Passagen umschreiben, und es ist mir egal, was ich dafür zahlen muss. Ich bekomme das Geld schon zusammen, lieber gehe ich zu Fuß bis ans Ende der Welt. Ich bleibe nicht mehr.«
»Gretel …«
»Ich war heute bei meiner alten Klavierlehrerin, und im Treppenhaus bin ich dem Hofstetter begegnet, ihrem Nachbarn. Er ist wieder zurück. Er ist kein Jude, aber er hat den Mund aufmacht, hat sich aufgeregt darüber, wie sie mit den jüdischen Bürgern dieser Stadt verfahren und mit den demokratischen, den sozialistischen, kurz jedem, von dem die braune Brut glaubt, dass er anders ist. Keine zehn Wochen ist es her, da haben sie ihn fortgebracht, in Schutzhaft, nach Dachau. Hast du jemals in die Augen von einem gesehen, der zurückkam? Ich habe es. Heute. Die Augen waren leer. Ich will nicht in solche Augen blicken.«
»Du bringst da Dinge durcheinander. Der Hofstetter war schon immer ein Querulant.«
»Es ist mir ganz einerlei, ich will meine Kinder nicht in so einem Land aufwachsen sehen. In einem Staat, für den sie minderwertig sind. Und du solltest das auch nicht wollen.«
Mit diesen Worten stand sie auf und ging hinüber ins Schlafzimmer.
Für Carl waren die nächsten Tage angefüllt mit endlosem Warten. Geduldig sitzen in langen weißgetünchten Fluren, auf hölzernen Bänken vor verschlossenen Türen, die sich nie zu öffnen schienen. Hoffen, dass die Mutter endlich eingelassen wurde, um dann wiederum ihre Rückkehr zu ersehnen. Unterbrochen von stetigem Treppauf und Treppab von einem der Stockwerke ins andere. Nur um dort angelangt von neuem stoisch auszuharren, bis sie an der Reihe waren. An manchen Tagen durften die Kinder nach der Schule zu Hause bleiben, mussten die Mutter nicht begleiten, aber auch diese Tage waren angefüllt mit zähem, unendlichem Warten auf ihre Rückkehr.
Zu Hause war nichts wie vorher. Die Eltern gingen sich aus dem Weg, sprachen nur das Nötigste. Selbst Ida mit ihrem immerwährenden Geplapper war seltsam einsilbig, als läge ein grauer Schleier über allem. Carl konnte sich nicht erklären, was geschehen war, und keiner antwortete auf seine Fragen, wenn er es wagte, sie zu stellen.
Zu allem Übel wurde auch noch Großvater ins Krankenhaus eingewiesen. Obwohl seine Mutter ihm versicherte, dass es ihm gut ging und sie ihn bald besuchen würden, wusste Carl nicht recht, ob er ihr glauben konnte.
Als Grete Schwarz am Sonntag hinaus ins Neue Krankenhaus ging und die Kinder mitnahm, war Carl erleichtert.
Ida quengelte den ganzen Weg, ihr täten die Beine weh. Dann wieder wollte sie sich ausruhen oder jammerte, die Schuhe würden drücken. Unzählige Male hatten sie stehen bleiben müssen. Carl konnte sie noch so sehr zur Eile antreiben, sie ließ sich Zeit beim Schnürsenkel-neu-Binden und auch beim Hochziehen der wollenen Strümpfe. Weitaus schlimmer jedoch fand er, dass sie sich fast den ganzen Weg von ihm ziehen ließ.
Grete Schwarz ging zügig voran, änderte ihr Tempo kaum. Von Zeit zu Zeit, wenn der Abstand zwischen ihr und den Kindern gar zu groß zu werden schien, blieb sie kurz stehen, drehte sich um und rief ihnen zu, sie sollten sich beeilen. Carl und Ida rannten dann ein Stück, bis sie wieder bei ihr waren. Ida beschwerte sich mehr als einmal wortreich darüber, warum sie nicht die Straßenbahn nehmen könnten, die regelmäßig an ihnen vorbeifuhr. Die Antworten ihrer Mutter waren so vielfältig wie die Klagen der Tochter: »Die Straßenbahn ist zu teuer«, »Das Wetter ist schön«, »Bewegung schadet nichts, wir können laufen«, oder der Satz, der Ida am meisten missfiel: »Sei froh, dass du gesunde Beine hast.« Ida fragte nach, warum sie darüber froh sein sollte. Sie würde sich daran sowieso nicht mehr lange erfreuen können, durch einen Marsch wie diesen wäre es mit der Gesundheit ihrer Beine bald vorüber.
Als all das Jammern nichts nützte, verfiel Ida darauf, sich theatralisch mit den Armen auf den Knien abzustützen, begleitet von Klagen über Seitenstechen. Ihre Mutter durchschaute das Spiel, ging weiter, und Carl zog aufs Neue seine maulende Schwester hinter sich her.
Mehr als eine halbe Ewigkeit schien vergangen zu sein, als sie endlich am Krankenhaus ankamen.
Mit Gustav Haubner lagen noch andere Patienten im Zimmer. Sein Bett stand im hinteren Teil des Raumes. Carl, der sich auf den Besuch gefreut hatte, ging eingeschüchtert durch den Raum vorbei an all den anderen Kranken in ihren Betten und deren Besuchern. Ihn beklemmte das Zimmer, wie ihn das Warten der letzten Tage bedrückt hatte. Es roch nach Krankheit und Tod, zumindest stellte Carl sich vor, beides würde so riechen. Gustav Haubner hatte die Arme über der Bettdecke verschränkt. Müde und blass sah er aus. Carl fühlte sich unwohl, mit jedem weiteren Schritt ins Zimmer hinein verstärkte sich dieses Gefühl.
Ganz anders Ida. Sie, die den ganzen Weg hierher nur geklagt und gejammert hatte, lief auf das Bett zu, und noch ehe die Mutter sie davon abhalten konnte, setzte sie sich darauf.
»Ida, da ist kein Platz, das darf man nicht.«
»Lass sie, Grete.« Großvaters Stimme klang schwächer, als Carl sie in Erinnerung hatte.
»Na gut, aber dann rück wenigstens hinunter zum Fußende, sonst hat Opa keinen Platz.« Ida rutschte ein wenig.
Carl stand da, der Anblick des Großvaters, die Luft im Zimmer, er merkte, wie ihm schwindelig wurde.
»Grete, schau den Buben an. Ist dir nicht gut, Bub?« Carl wollte antworten, konnte aber nicht, er versuchte zu nicken, im gleichen Moment gaben seine Beine nach.
Als er wieder zu sich kam, lag er auf einer Bank im Flur vor den Krankenzimmern. Seine Mutter saß neben ihm und hielt seine Hand.
»Geht es dir wieder besser?«
»Ja.«
»Du hast uns einen Schrecken eingejagt.« Grete Schwarz lächelte ihren Sohn an. »Kann ich noch einmal zu Opa ins Zimmer? Ida bleibt hier bei dir, und ich bin gleich wieder da.« Carl nickte.
Er blieb auf der Bank liegen, seine Schwester saß daneben. Und wieder warteten sie. Ida schaukelte mit ihren Beinen hin und her, beugte sich nach vorn und zurück. Carl blickte hinauf zur Decke und hoffte, der Besuch im Krankenhaus möge bald beendet sein. Besucher liefen an ihnen vorbei, Klosterschwestern in langen weißen Trachten huschten den Flur entlang. Misstrauisch beäugten sie die beiden Kinder. Während Carl auf der Bank lag, begann Ida im Korridor auf und ab zu gehen. Sie versuchte nur auf die schwarzen Kacheln des Bodens zu treten. Hatte sie eine Reihe abgeschritten, hüpfte sie weiter zur nächsten, bis sie alle schwarzen Fliesen einmal betreten hatte. Dann ging sie hinüber zum Fenster und sah durch die Scheiben hindurch hinaus. »Carl, schau mal, von hier aus kann man in den Garten sehen.«
»Ich habe keine Lust, Ida. Mama hat gesagt, wir sollen hier auf sie warten.«
»Du bist der langweiligste Bruder, den es gibt.« Ida drehte ihm den Rücken zu und drückte sich noch eine Weile die Nase an der Scheibe platt, bis sie auch daran jedes Interesse verlor und sich wieder zu ihm auf die Bank setzte. Gegen Ende der Besuchszeit kam Grete zurück. Mit ihr der Großvater.
Er hatte sich seinen gestreiften Morgenmantel angezogen und begleitete sie ein Stück. »Ein wenig Bewegung tut mir gut, ich gehe mit euch noch bis zum Stiegenhaus. Die Besuchszeit ist gleich zu Ende.«
Ida hüpfte und hopste den Flur entlang, während Carl sich noch immer schwach auf den Beinen fühlte. An der Treppe angelangt, drückte Gustav Haubner seine Enkel fest an sich. »Gib gut auf deine Schwester acht. Versprichst du das?« Carl wusste nicht, warum, aber es kam ihm vor wie ein Abschied für immer. Als Letztes umarmte der Großvater seine Tochter, leise, kaum hörbar sagte er: »Geh, Grete, geh, solange es noch Zeit ist. Schon wegen der Kinder. Mutter und ich sind alt, wir kommen alleine zurecht. Um uns musst dir keine Sorgen machen, mir geht es bald wieder besser.«
Grete wollte etwas sagen, doch ihr Vater schüttelte den Kopf. »Glaub mir, Kind, diese Menschen haben keine Ahnung von Demut und Nächstenliebe. Wer demütig ist, ist schwach, glauben sie. Und auf den Schwachen treten sie herum. Mit Religion und Volkstum hat das nichts zu tun, die machen sich ihren Glauben selber. Deren Herrgott ist der Herrenmensch. Aber auch diese tausend Jahre werden schnell vergehen.«
Als sie die Treppe hinunterstiegen, drehte sich Grete noch einmal um und blickte hoch zu ihrem Vater, der sich nicht von der Stelle gerührt hatte. Er winkte ihnen zu und lächelte.
Nach dem Abendessen legte Grete einen Stapel Bücher auf den Küchentisch. Sie erzählte den Kindern, sie alle würden schon sehr bald auf eine lange Reise gehen. Dann fing sie an, die Bücher und Atlanten vor ihren Augen auszubreiten.
»Zuerst geht die Reise nach München und von dort mit dem Nachtzug quer durch die Alpen nach Verona. Weiter über Mailand nach Genua.« Im Hafen von Genua würde ein Schiff auf sie warten, die Conte Biancamano, und das würde sie um die halbe Welt mitnehmen an einen Ort, der Shanghai hieß und im fernen China lag. Grete fuhr mit dem Zeigefinger hin und her über den Atlas, querte die Alpen, das Mittelmeer, zog vorbei am Suezkanal und hinaus in den Persischen Golf, durchzog das Chinesische Meer, bis ihr Finger in Shanghai landete. Während sie ihren Kindern alles auf der Karte zeigte, erzählte sie über die Länder, an denen sie vorüberfahren würden. Konnte sie eine Frage nicht beantworten, durfte Carl aus dem Lexikon vorlesen, was es noch zu wissen gab. Erwin saß eine Weile still daneben, dann stand er wortlos auf und ging zu Bett.
Am Morgen wurden Carl und Ida nicht wie gewöhnlich von der Mutter geweckt. Großmutter war zu Besuch gekommen, und ihre Mutter sagte, sie dürften heute von der Schule zu Hause bleiben, da es wegen der langen Reise noch so viele Dinge zu erledigen gab. Maria Haubner blieb den ganzen Tag, sie half ihrer Tochter, die wenigen Sachen, die mitgenommen werden konnten, einzupacken, und spielte mit ihren Enkeln. Auch am Abend ging sie nicht wie sonst nach Hause, sie brachte Carl und Ida zu Bett und erzählte ihnen wunderschöne lange Geschichten vom Kaiser von China, von mechanischen Nachtigallen und von vielen anderen wunderlichen Dingen, die es dort zu sehen gäbe.
Als Carl in der Nacht wach wurde, glaubte er die Stimmen seiner Eltern zu hören. Obwohl sie laut miteinander sprachen, konnte er nichts verstehen, sosehr er sich auch bemühte. Mehr noch, das angestrengte Lauschen machte ihn dösig, und seine Gedanken begannen sich erneut um die lange Reise zu drehen, sie trugen ihn fort zu all den wunderbaren Seltsamkeiten, von denen Großmutter erzählt hatte.
Ohne es zu merken, schlief er ein. Viel später als sonst ließen die gedämpft aus dem Nebenzimmer zu hörenden Geräusche ihn langsam munter werden. Großmutter und Eltern waren dabei, die letzten Dinge zu packen und dafür Sorge zu tragen, was mit den Gegenständen, die sie zurücklassen mussten, geschehen sollte. Ida und er standen dabei meist im Weg. Es wurde Nachmittag, bis sie endlich im Zug saßen.
Ida lamentierte, sie hätte sich von Erika und all den Freundinnen gar nicht und selbst von Großmutter nicht richtig verabschieden können. Carl beachtete sie kaum, in sich versunken lauschte er dem Stampfen der Räder und blickte hinaus auf die vorüberziehende Landschaft. Häuser mit beleuchteten Fenstern reihten sich wie Perlen einer Kette aneinander. Er träumte vor sich hin, stellte sich vor, was in all den Zimmern vor sich ging, nahm in Gedanken an fremden Tischen Platz und hörte imaginären Gesprächen zu, war Teil dieser fiktiven Leben. Je weiter sie von zu Hause wegfuhren, desto dunkler wurde es: Kamen sie anfangs noch an vielen erleuchteten Häusern vorüber, waren es im Laufe der Nacht immer weniger geworden, und schließlich war draußen alles nur noch tiefschwarz.
Manchmal blickte Carl hinüber zu seinem Vater, der stumm und steif dasaß und aus dem Fenster starrte. Zu Beginn der Reise hatte Erwin Carls Blick noch gelegentlich erwidert, ab und an sogar gelächelt, aber mit jeder Stunde, die sie weiter von zu Hause forttrug, nahm er immer weniger von den Dingen um ihn herum wahr. Die Finsternis kroch in ihn hinein, und die Kälte, die sie mit sich brachte, ließ ihn frieren. Die Fahrt ging schrecklich langsam vonstatten. Der Zug hielt in jedem noch so kleinen Bahnhof an der Strecke. Zu Beginn der Reise klangen die Namen der Stationen noch vertraut. Köfering, Hagelstadt, Pfakofen. Erwin dachte an glückliche Tage, Radausflüge mit Grete, damals, als sie jung und noch ohne Kinder waren. Helle unbeschwerte Bilder, voller Lachen und im festen Glauben, das Leben würde immer so weitergehen und für sie nur Glück bereithalten. Die Erinnerungen spendeten ihm keinen Trost, sie schmerzten und zogen ihn nur tiefer hinab.
2 Brenner
Mitten in der Nacht blieb der Zug mit einem Ruck stehen. Überall gingen die Lichter an. Von einer Sekunde zur nächsten war Hektik und Lärm in den monotonen Gleichklang der Zugfahrt gekommen. Laute Stimmen waren zu hören, dazwischen auf- und zuschlagende Abteiltüren.
Carl schob neugierig den Vorhang ein wenig zur Seite und lugte hinaus. Auf dem taghell erleuchteten Bahnsteig patrouillierten Menschen in Uniformen.
»Carl, lass das!« Seine Mutter zog ihn vom Fenster fort und schloss den Vorhang. Wenig später wurde auch ihre Tür aufgerissen: »Controllo dei passaporti! Ihre Papiere bitte!« Drei Beamte des italienischen Zolls standen ungeduldig im Abteil. Grete suchte aufgeregt und umständlich in der Tasche nach den Papieren. »Subito! Subito! Signora! Passaporti! Reisepässe!« Der ältere Beamte, ein kleiner Mann mit akkurat gestutztem Bart und einer Vielzahl glänzender Knöpfe an der Uniform, schnauzte sie an. Schließlich hielt sie ihm mit zitternder Hand die Ausweise entgegen. Er ergriff die Papiere, prüfte sie mit strengem Blick. Dann wandte er sich um und raunte seinen Kollegen etwas zu. Die drei verließen das Abteil, blieben jedoch vor der Tür stehen. Grete sah Erwin fragend an. Der zuckte nur mit der Achsel. Stille. Einer der Beamten öffnete die Tür erneut und sagte zu Grete: »Scusi, Signora! Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick.« Seine Stimme klang sanft und freundlich. Er schloss die Tür, blieb aber weiter vor dem Abteil stehen und unterhielt sich wieder mit seinen Kollegen. Der ältere ging schließlich mit den Papieren fort. Die anderen blieben und warteten. Wenig später kam der Beamte zurück, stieß die Tür zum Abteil wieder auf.
»Dottor Schwarz, ich muss Sie und Ihre Familie bitten, mit meinem Kollegen den Zug zu verlassen.«
»Warum? Ist etwas nicht in Ordnung?«, fragte Grete und zwang sich, so ruhig wie nur irgend möglich zu klingen. Der Mann wandte sich erneut an Erwin. Dieses Mal fordernder. »Dottore, wenn ich Sie bitten darf?«
»Aber …« Grete hatte vor Aufregung rote Flecken im Gesicht. Erwin sprach beruhigend auf sie ein, »Grete, lass uns tun, was der Herr von uns möchte.«
»Aber warum? Wir werden den Anschlusszug in Mailand verpassen!« Sie wühlte in ihrer Tasche und hielt dem Zöllner die Fahrscheine hin »Wir haben Passagen für ein Schiff nach Shanghai.« Ohne einen Blick darauf zu werfen, drehte sich der Beamte um und ging. Der Zöllner mit der sanften Stimme beugte sich zu Grete hinab. »Signora, es tut mir leid, aber wir können da nichts machen, uns sind auch die Hände gebunden. Kommen Sie bitte kurz mit ins Büro, es wird sich bestimmt alles klären lassen. Der Zug hat ohnehin einen längeren Aufenthalt durch die Passkontrolle!«
»Aber …«
»Grete, es bringt doch nichts.« Erwin stand auf und holte die Koffer aus dem Gepäcknetz. Der Zöllner trat einen Schritt zur Seite und wartete neben der offenen Tür.
»Bitte, wir werden den Zug in Mailand verpassen, bitte …« Gretes Stimme klang verzweifelt.
Erwin legte eine Hand auf ihre Schulter. »Grete! Wir müssen mit dem Herrn mitgehen.«
»Hören Sie auf Ihren Mann, Signora.« Der Beamte lächelte sie aufmunternd an.
Erwin nahm beide Koffer, »Carl, hilf deiner Mutter und trag die Reisetasche und den Rucksack.« Die immer noch schlaftrunkene Ida im Arm, stieg Grete widerwillig aus dem Zug. Auf dem Bahnsteig hatten sich außer ihnen noch weitere Passagiere mit ihren Habseligkeiten versammelt. Beamte mit Hunden schritten die Reihe ab. Alles unter den prüfenden Blicken einer etwas abseitsstehenden Gruppe mit braunen Uniformen und Hakenkreuzbinden um den Arm.
Einer nach dem anderen wurde aufgefordert, zur eingehenden Kontrolle der Reisedokumente und des Gepäcks in das Büro der Zollbehörde zu gehen.
Die Überprüfung ging nur schleppend voran. Taschen und Koffer mussten geöffnet und der Inhalt zur Begutachtung auf einen Tisch gelegt werden. Scheinbar wahllos wurden Personen aus der Schlange gepickt, ausgesondert und in den anderen Raum gebracht. Der Zug blieb unterdessen weiter am Bahnsteig stehen. Grete sah sich immer wieder ungeduldig um, vergewisserte sich, ob er auch wirklich noch nicht von ihr unbemerkt weitergefahren war. Endlich kamen auch sie an die Reihe, ohne die beiden Kinder wurden sie aufgefordert, in das Büro des Dienststellenleiters einzutreten.
»Si accomodi!« Mit einer flüchtigen Bewegung der Hand zeigte der auf die beiden Stühle vor seinem Schreibtisch und forderte sie auf, sich zu setzen. Hinter dem Schreibtisch an der Wand hing ein kleineres Bild König Viktor Emanuels III. und ein um vieles größeres Porträt Mussolinis. Grete starrte zuerst auf die Bilder, dann auf den Offizier und die Reisedokumente, die vor ihm auf dem Tisch lagen.
»Dottor Schwarz, es tut mir leid, aber ich kann Sie leider nicht weiterreisen lassen.« Der Mann sprach fast akzentfrei, dennoch dauerte es eine Weile, ehe sie verstanden.
»Warum?« Grete blickte ihn ungläubig an »Unsere Papiere sind doch in Ordnung.«
»Signora, nicht die Dokumente sind das Problem. Ihr Mann ist es. Der Capo, Il Duce, ist in Milano, und der Zug endet dort.«
»Aber was hat das mit meinem Mann zu tun?«
»Es tut mir wirklich sehr leid, Signora, aber wir sind angewiesen, alle jüdischen Reisenden an der Grenze aufzufordern, umzukehren.« Er faltete die Reisedokumente wieder zusammen.
»Aber mein Mann ist katholisch getauft.«
»Signora, das kann ich nicht beurteilen, und es steht auch nicht zur Debatte. Ich muss mich auf das verlassen, was ich sehe, und auf die Order, die ich bekomme. Ich habe hier den Pass, und laut dieses Dokuments ist Ihr Mann Jude.«
Grete ließ nicht locker: »Entschuldigen Sie bitte, Herr …«
»Maresciallo Panucci, Signora.« Der Offizier lächelte angestrengt.
»Maresciallo Panucci, wir versichern Ihnen, wir werden den Mailänder Bahnhof nicht verlassen. Wir wollen nur umsteigen in den Zug nach Genua.« Grete suchte in ihrer Tasche nach den Schiffspassagen und hielt sie ihm entgegen »Hier, sehen Sie, wir haben Fahrscheine ab Genua. Wir sind nur auf der Durchreise.«