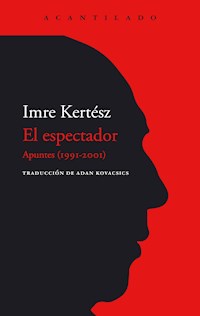9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Ein literarisches Meisterwerk.» (Der Spiegel) Imre Kertész ist etwas Skandalöses gelungen: die Entmystifizierung von Auschwitz. Es gibt kein literarisches Werk, das in dieser Konsequenz, ohne zu deuten, ohne zu werten, der Perspektive eines staunenden Kindes treu geblieben ist. Wohl nie zuvor hat ein Autor seine Figur Schritt für Schritt bis an jene Grenze hinab begleitet, wo das nackte Leben zur hemmungslosen, glücksüchtigen, obszönen Angelegenheit wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Imre Kertész
Roman eines Schicksallosen
Roman
Aus dem Ungarischen von Christina Viragh
Informationen zum Buch
«Ein literarisches Meisterwerk.». (Der Spiegel)
Imre Kertész ist etwas Skandalöses gelungen: die Entmystifizierung von Auschwitz. Es gibt kein literarisches Werk, das in dieser Konsequenz, ohne zu deuten, ohne zu werten, der Perspektive eines staunenden Kindes treu geblieben ist. Wohl nie zuvor hat ein Autor seine Figur Schritt für Schritt bis an jene Grenze hinab begleitet, wo das nackte Leben zur hemmungslosen, glücksüchtigen, obszönen Angelegenheit wird.
Informationen zum Autor
Am 9.November 1929 in Budapest geboren, wurde Imre Kertész 1944 nach Auschwitz deportiert und 1945 in Buchenwald befreit. Nach Kriegsende folgte die journalistische Tätigkeit bei der Tageszeitung «Világosság», die bald umbenannt und zum Parteiorgan der Kommunisten wurde. Nach seiner Entlassung bestritt Kertész seit 1953 seinen Lebensunterhalt als freier Schriftsteller und schrieb Musicals und Unterhaltungsstücke für das Theater. Im Jahre 2002 wurde er mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.
Das bekannteste Werk des Autors, «Roman eines Schicksallosen», erschien auf Ungarisch 1975.Seitdem ist es in mehr als 40Sprachen übersetzt worden. Die Verfilmung des Romans durch Lajos Koltai wurde einem internationalen Publikum im Wettbewerb der Berlinale 2005 präsentiert.
Weitere Veröffentlichungen:
Kaddisch für ein nicht geborenes Kind. 1992
Galeerentagebuch. 1993
Ich – ein anderer. 1998
Eine Gedankenlänge Stille, während das Erschießungskommando neu lädt. 1999
Fiasko. 1999
Die englische Flagge. 2002
Detektivgeschichte. 2004
Liquidation. 2005
Roman eines Schicksallosen. Das Buch zum Film. 2005
Dossier K. 2006
Briefe an Eva Haldimann. 2009
1
Heute war ich nicht in der Schule. Das heißt, doch, ich war da, aber nur, um mir vom Klassenlehrer freigeben zu lassen. Ich habe ihm das Schreiben meines Vaters überbracht, in dem er wegen «familiärer Gründe» um meine Freistellung nachsucht. Der Lehrer hat gefragt, was das für familiäre Gründe seien. Ich habe gesagt, mein Vater sei zum Arbeitsdienst einberufen worden; da hat er weiter keine Schwierigkeiten gemacht.
Ich bin losgeeilt, aber nicht nach Hause, sondern gleich zu unserem Geschäft. Mein Vater hatte gesagt, sie würden mich dort erwarten. Er hatte noch hinzugefügt, ich solle mich beeilen, vielleicht würden sie mich brauchen. Eigentlich hat er mir gerade darum freigeben lassen. Oder vielleicht, um mich «an diesem letzten Tag an seiner Seite zu wissen», bevor er «seinem Zuhause entrissen wird»: denn auch das hat er gesagt, allerdings, ja, zu einem anderen Zeitpunkt. Er hat es, wenn ich mich recht erinnere, zu meiner Mutter gesagt, als er am Morgen mit ihr telefonierte. Es ist nämlich Donnerstag, und an diesem Tag und sonntags hat strenggenommen meine Mutter Anrecht auf meinen Nachmittag. Doch mein Vater hat ihr mitgeteilt: «Es ist mir heute nicht möglich, Gyurka zu dir hinüberzulassen», und hat das dann so begründet. Oder vielleicht doch nicht. Ich war heute Morgen ziemlich müde, wegen des Fliegeralarms in der Nacht, und erinnere mich vielleicht nicht richtig. Aber dass er es gesagt hat, da bin ich sicher. Wenn nicht zu meiner Mutter, dann zu jemand anderem.
Ich habe dann mit meiner Mutter ebenfalls ein paar Worte gewechselt, worüber, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, sie war mir dann auch ein wenig böse, denn wegen der Anwesenheit meines Vaters blieb mir nichts anderes übrig, als mit ihr etwas kurz angebunden zu sein: Schließlich muss ich mich heute nach ihm richten. Als ich schon im Begriff war aufzubrechen, hat auch meine Stiefmutter noch ein paar vertrauliche Worte an mich gerichtet, im Flur, unter vier Augen. Sie hat gesagt, sie hoffe, an diesem für uns so traurigen Tag bei mir «mit einem angemessenen Verhalten rechnen zu können». Ich wusste nicht, was ich da hätte sagen sollen, und so habe ich nichts gesagt. Aber vielleicht legte sie mein Schweigen falsch aus, denn sie hat gleich etwas hinzugefügt, in dem Sinn, dass sie mir keineswegs zu nahe treten wollte mit dieser Ermahnung, die – das wisse sie – sowieso unnötig sei. Denn sie zweifle ja nicht daran, dass ich als fast fünfzehnjähriger großer Junge selbst fähig sei, die Schwere des uns ereilenden Schicksalsschlages zu ermessen, so hat sie sich ausgedrückt. Ich habe genickt. Mehr brauchte es auch nicht, wie ich gemerkt habe. Sie hat noch eine Bewegung mit den Händen in meine Richtung gemacht, sodass ich schon Angst hatte, sie wollte mich vielleicht umarmen. Das hat sie dann doch nicht getan und nur tief geseufzt, mit einem langen, bebenden Atemzug. Ich habe gesehen, dass ihr auch die Augen feucht wurden. Es war unangenehm. Dann durfte ich gehen.
Von der Schule bis zu unserem Geschäft bin ich marschiert. Es war ein klarer, lauer Morgen – dafür, dass der Frühling erst anfängt. Ich hätte mir gern den Mantel aufgeknöpft, habe es mir aber dann anders überlegt: Im leichten Gegenwind könnte das Revers zurückklappen und den gelben Stern verdecken, was gegen die Vorschrift wäre. In einigen Dingen muss ich jetzt doch schon umsichtiger verfahren. Unser Holzkeller befindet sich hier in der Nähe, in einer Nebenstraße. Eine steile Treppe führt hinunter in dämmeriges Licht. Ich habe meinen Vater und meine Stiefmutter im Büro angetroffen: einem engen, wie ein Aquarium beleuchteten Glaskäfig direkt unterhalb der Treppe. Auch Herr Sütő war da, den ich noch aus der Zeit kenne, als er bei uns in einem Anstellungsverhältnis war, als Buchhalter und Verwalter unseres anderen, unter freiem Himmel gelegenen Lagers, das er uns inzwischen abgekauft hat. So sagen wir es wenigstens. Herr Sütő trägt nämlich, da bei ihm in rassischer Hinsicht alles in bester Ordnung ist, keinen gelben Stern, und das Ganze ist eigentlich, soviel ich weiß, nur ein Geschäftstrick, damit er auf unseren Besitz dort achtgibt und auch, nun ja, damit wir unterdessen nicht ganz auf unsere Einnahmen verzichten müssen.
Ich habe ihn irgendwie schon ein bisschen anders gegrüßt als früher, denn er ist ja in gewisser Hinsicht jetzt höhergestellt als wir; auch mein Vater und meine Stiefmutter sind aufmerksamer zu ihm. Er hingegen legt umso größeren Wert darauf, meinen Vater weiterhin «Herr Direktor» und meine Stiefmutter «verehrte gnädige Frau» zu nennen, als wäre nichts geschehen, und auch den Handkuss lässt er bei ihr nie aus. Auch mich hat er in dem gewohnten scherzenden Ton begrüßt. Meinen gelben Stern schien er gar nicht zu bemerken. Dann bin ich stehen geblieben, wo ich gerade stand, nämlich bei der Tür, während sie fortfuhren, wo sie bei meinem Eintreffen aufgehört hatten. Wie mir schien, hatte ich sie irgendwie bei einer Besprechung unterbrochen. Zuerst verstand ich gar nicht, wovon sie sprachen. Einen Moment hielt ich sogar die Augen geschlossen, denn sie flimmerten mir noch ein wenig vom Sonnenschein oben. Unterdessen sagte mein Vater etwas, und als ich die Augen wieder aufmachte, sprach Herr Sütő. Auf seinem bräunlichen runden Gesicht – mit dem dünnen Schnurrbärtchen und der kleinen Lücke zwischen den breiten weißen Schneidezähnen – hüpften orangerote Sonnenflecken, wie Geschwüre, die aufbrechen. Den folgenden Satz hat wieder mein Vater gesagt, es war darin von irgendeiner «Ware» die Rede und dass «es am besten wäre», wenn Herr Sütő «sie gleich mitnähme». Herr Sütő hatte nichts dagegen einzuwenden; daraufhin hat mein Vater ein in Seidenpapier gewickeltes und mit einer Schnur zusammengebundenes Päckchen aus der Schreibtischschublade genommen. Da erst habe ich gesehen, um was für eine Ware es sich handelte, denn ich habe das Paket gleich an seiner flachen Form erkannt: Die Schatulle war darin. In der Schatulle aber sind unsere wichtigeren Schmuckstücke und andere solche Sachen. Ja, ich glaube sogar, dass sie extra meinetwegen von «Ware» sprachen, damit ich die Schatulle nicht erkenne. Herr Sütő hat sie sogleich in seiner Aktentasche verschwinden lassen. Dann aber ist eine kleine Diskussion zwischen ihnen entstanden: Herr Sütő hatte nämlich seinen Füllfederhalter hervorgeholt und wollte meinem Vater für die «Ware» unbedingt eine «Bescheinigung» geben. Er hat lange nicht lockergelassen, obwohl ihm mein Vater sagte, das seien «Kindereien» und «zwischen uns ist so etwas doch nicht nötig». Mir schien, Herr Sütő hörte das gern. Er hat dann auch gesagt: «Ich weiß, dass Sie mir vertrauen, Herr Direktor; aber im praktischen Leben hat alles so seine Ordnung.» Er zog sogar meine Stiefmutter zu Hilfe: «Nicht wahr, gnädige Frau?» Sie hat aber bloß ein müdes Lächeln auf den Lippen gehabt und etwas gesagt wie: Sie möchte die ordnungsgemäße Erledigung dieser Angelegenheit völlig den Männern überlassen.
Mir war das Ganze schon etwas verleidet, als er dann endlich seinen Füllfederhalter doch weggesteckt hat; dann aber fingen sie an, in der Angelegenheit dieses Lagers hin und her zu reden: nämlich was sie mit den vielen hier befindlichen Brettern machen sollten. Wie ich hörte, war mein Vater der Meinung, man müsse sich beeilen, bevor die Behörden «eventuell die Hand auf das Geschäft legen», und er hat Herrn Sütő ersucht, meiner Stiefmutter in dieser Angelegenheit mit seiner Erfahrung und seiner Sachkenntnis beizustehen. Herr Sütő hat sich sofort zu meiner Stiefmutter gewandt und erklärt: «Das ist doch selbstverständlich, gnädige Frau. Wir bleiben ja wegen der Abrechnungen sowieso in ständigem Kontakt.» Ich glaube, er meinte unser Lager, das jetzt bei ihm ist. Irgendwann fing er endlich an, sich zu verabschieden. Er schüttelte meinem Vater lange die Hand, mit betrübter Miene. Doch er war der Meinung, dass «in einem solchen Augenblick viele Worte fehl am Platz» seien, und er wollte deshalb nur ein einziges Abschiedswort an meinen Vater richten, nämlich: «Auf ein baldiges Wiedersehen, Herr Direktor.» Mein Vater hat mit einem kleinen, schiefen Lächeln geantwortet: «Hoffen wir, dass es so sein wird, Herr Sütő.» Gleichzeitig hat meine Stiefmutter ihre Handtasche geöffnet, ein Taschentuch herausgenommen und es sich geradewegs an die Augen gehalten. In ihrer Kehle gurgelten seltsame Töne. Es wurde still, und die Situation war sehr peinlich, weil ich auf einmal so ein Gefühl hatte, auch ich müsste etwas tun. Aber der Vorfall hatte sich ganz plötzlich ereignet, und mir ist nichts Gescheites eingefallen. Wie ich sah, war es auch Herrn Sütő unbehaglich. «Aber gnädige Frau», ließ er sich vernehmen, «das sollten Sie nicht. Wirklich nicht.» Er schien ein bisschen erschrocken. Er hat sich vorgebeugt und meiner Stiefmutter den Mund geradezu auf die Hand fallen lassen, um bei ihr den gewohnten Handkuss zu verrichten. Dann ist er gleich zur Tür geeilt: Ich hatte kaum Zeit, beiseitezuspringen. Er hat sogar vergessen, sich von mir zu verabschieden. Nachdem er draußen war, hörten wir noch lange seine schweren Schritte auf den hölzernen Stufen.
Nach einigem Schweigen hat mein Vater gesagt: «Na schön, um so viel wären wir jetzt leichter.» Worauf meine Stiefmutter, noch mit leicht verschleierter Stimme, meinen Vater gefragt hat, ob er den fraglichen Beleg nicht doch hätte von Herrn Sütő annehmen sollen. Doch mein Vater hat erwidert, solche Belege hätten keinerlei «praktischen Wert», abgesehen davon, dass es noch gefährlicher wäre, so etwas versteckt zu halten als die Schatulle selbst. Und er hat ihr erklärt, wir müssten jetzt «alles auf eine Karte setzen», auf die nämlich, dass wir Herrn Sütő voll und ganz vertrauen, in Anbetracht dessen, dass es für uns im Augenblick sowieso keine andere Lösung gibt. Darauf hat meine Stiefmutter nichts mehr gesagt, dann aber bemerkt, mein Vater möge wohl recht haben, sie aber würde sich trotzdem sicherer fühlen «mit einem Beleg in der Hand». Sie war allerdings nicht imstande, das entsprechend zu begründen. Mein Vater hat daraufhin zur Eile gemahnt: Die Arbeit warte, sie sollten endlich anfangen, da, wie er sagte, die Zeit drängt. Er wollte ihr nämlich die Geschäftsbücher übergeben, damit sie sich da auch ohne ihn zurechtfinden kann und das Geschäft nicht lahmliegen muss, wenn er im Arbeitslager ist. Zwischendurch hat er auch mit mir ein paar flüchtige Worte gewechselt. Er fragte, ob man mir ohne Schwierigkeiten freigegeben habe und so weiter. Schließlich sagte er, ich solle mich setzen und mich ruhig verhalten, bis er und meine Stiefmutter alles erledigt hätten mit den Büchern.
Bloß hat das sehr lange gedauert. Eine Zeit lang versuchte ich, geduldig auszuharren, und bemühte mich, an meinen Vater zu denken, genauer daran, dass er morgen weggeht und ich ihn wahrscheinlich dann lange nicht mehr sehen werde; aber nach einer Weile war ich von diesem Gedanken müde, und da ich für meinen Vater sonst nichts tun konnte, ist es mir langweilig geworden. Auch das Herumsitzen machte sehr müde, und so bin ich, einfach um eine Abwechslung zu haben, aufgestanden und habe Wasser vom Wasserhahn getrunken. Sie haben nichts gesagt. Später bin ich auch einmal nach hinten gegangen, zwischen die Bretter, um ein kleines Geschäft zu erledigen. Als ich zurückkam, habe ich mir die Hände über dem angeschlagenen rostigen Waschbecken gewaschen, dann habe ich mein Pausenbrot aus der Schultasche gepackt und gegessen, und zum Schluss habe ich wieder vom Hahn Wasser getrunken. Sie haben nichts gesagt. Ich habe mich an meinen Platz zurückgesetzt. Dann habe ich mich noch sehr lange fürchterlich gelangweilt.
Es war schon Mittag, als wir zur Straße hochgestiegen sind. Wieder hat es mir vor den Augen geflimmert, diesmal wegen der Helligkeit. Mein Vater hat sich lange, ich hatte fast schon das Gefühl, absichtlich, mit den beiden grauen Eisenschlössern abgemüht. Dann hat er die Schlüssel meiner Stiefmutter übergeben, da er sie ja nie mehr brauchen wird. Das weiß ich, weil er es gesagt hat. Meine Stiefmutter hat ihre Handtasche geöffnet, ich fürchtete schon, es sei wieder wegen des Taschentuchs: Aber sie hat bloß die Schlüssel versorgt. Wir haben uns in großer Eile auf den Weg gemacht. Nach Hause, wie ich anfangs dachte; doch nein, wir sind zuerst noch einkaufen gegangen. Meine Stiefmutter hatte eine ganz ausführliche Liste von all den Dingen, die mein Vater im Arbeitslager brauchen würde. Um einen Teil hatte sie sich schon gestern gekümmert. Den anderen hingegen mussten wir jetzt besorgen. Es war irgendwie ein bisschen unbehaglich, mit ihnen zu gehen, so zu dritt und alle drei mit dem gelben Stern. Wenn ich allein bin, amüsiert mich die Sache eher. Mit ihnen zusammen hatte es beinahe etwas Unangenehmes. Ich könnte nicht erklären, warum. Später habe ich dann nicht mehr darauf geachtet. In den Geschäften waren überall viele Leute, außer in dem, wo wir den Rucksack kauften: Da waren wir die einzigen Kunden. Die Luft war ganz durchtränkt mit dem scharfen Geruch von präpariertem Leinen. Der Ladenbesitzer, ein vergilbtes altes Männchen, mit einem blitzenden künstlichen Gebiss und Ärmelschonern über den Ellbogen, und seine dicke Frau waren sehr freundlich zu uns. Sie häuften die verschiedensten Artikel vor uns auf den Ladentisch. Ich machte die Beobachtung, dass der Ladenbesitzer die alte Frau «mein Kleines» nannte und dass immer sie nach den Waren laufen musste. Übrigens kenne ich das Geschäft, es liegt nicht weit von unserer Wohnung, aber drinnen war ich noch nie. Eigentlich ist es eine Art Sportgeschäft, wobei sie auch anderes anbieten. Neuerdings gibt es bei ihnen auch gelbe Sterne aus eigener Herstellung zu kaufen, denn an gelbem Stoff herrscht jetzt natürlich großer Mangel. (Was wir brauchten, hat meine Stiefmutter noch rechtzeitig besorgt.) Wenn ich es richtig sehe, besteht ihre Erfindung darin, dass der Stoff irgendwie auf ein Stück Karton gespannt ist, und das ist natürlich hübscher, ja, und dann sind auch die Zacken der Sterne nicht so lächerlich verschnitten wie bei mancher Heimanfertigung. Ich habe bemerkt, dass ihnen das eigene Produkt selbst auf der Brust prangte. Und das war, als würden sie es nur tragen, um die Käufer zu animieren.
Aber da ist schon die alte Frau mit den Waren gekommen. Noch davor hatte der Ladenbesitzer gebeten, ihm die Frage zu gestatten, ob wir den Einkauf vielleicht im Hinblick auf den Arbeitsdienst tätigten. Das Ja hat meine Stiefmutter gesagt. Der Alte hat traurig genickt. Er hat sogar seine vergreisten, leberfleckigen Hände hochgehoben und dann mit einer Geste des Bedauerns wieder auf den Ladentisch zurücksinken lassen. Dann hat meine Stiefmutter erwähnt, dass wir einen Rucksack brauchten, und sich erkundigt, ob sie welche hätten. Der Alte hat gezögert und dann gesagt: «Für die Herrschaften ja.» Und seine Frau hat er angewiesen: «Mein Kleines, für den Herrn holst du einen aus dem Lager!» Der Rucksack war gleich der richtige. Aber der Ladenbesitzer hat seine Frau noch nach ein paar anderen Sachen geschickt, die – so meinte er – meinem Vater «dort, wo er hingeht, nicht fehlen dürfen». Im Allgemeinen sprach er sehr taktvoll und mitfühlend zu uns, und er vermied es nach Möglichkeit immer, den Ausdruck «Arbeitsdienst» zu gebrauchen. Er zeigte uns allerhand nützliche Dinge, einen luftdicht verschließbaren Blechnapf, ein Taschenmesser mit vielerlei Instrumenten, eine Umhängetasche und sonst noch Dinge, nach denen, wie er erwähnte, «unter ähnlichen Umständen» bei ihm oft gefragt werde. Meine Stiefmutter hat dann für meinen Vater das Taschenmesser gekauft. Mir gefiel es auch. Als alle Einkäufe beisammen waren, hat der Ladenbesitzer seine Frau angewiesen: «Kasse!» Darauf zwängte die alte Frau ihren weichen, in ein schwarzes Kleid gehüllten Körper unter etlichen Schwierigkeiten zwischen die Registrierkasse und einen mit Kissen gepolsterten Lehnstuhl. Der Ladenbesitzer hat uns noch bis zur Tür begleitet. Dort hat er gesagt, er hoffe, «ein andermal wieder die Ehre zu haben», dann hat er sich vertraulich zu meinem Vater gebeugt und leise hinzugefügt: «So, wie wir das meinen, der gnädige Herr und ich.»
Jetzt endlich haben wir uns dann doch auf den Nachhauseweg gemacht. Wir wohnen in einem großen Mietshaus, in der Nähe des Platzes, wo auch die Straßenbahnhaltestelle ist. Wir waren schon auf unserem Stockwerk, als meiner Stiefmutter einfiel, dass sie vergessen hatte, die Brotmarken einzulösen. In die Bäckerei habe ich dann zurückmüssen. Den Laden konnte ich erst nach ein bisschen Schlangestehen betreten. Zuerst musste ich mich vor die blonde, großbusige Bäckersfrau hinstellen: Sie schnitt das entsprechende Quadrat von der Brotmarke ab, dann weiter, vor den Bäcker, der das Brot abwog. Er hat meinen Gruß gar nicht erwidert; es ist ja in der Gegend allgemein bekannt, dass er die Juden nicht mag. Deshalb hat er mir auch um etliche Gramm zu wenig Brot hingeworfen. Ich habe aber auch schon sagen gehört, dass auf diese Weise pro Ration etwas für ihn übrig bleibt. Und irgendwie, wegen seines wütenden Blicks und seiner geschickten Handbewegung, habe ich auf einmal die Richtigkeit seines Gedankengangs verstanden, nämlich warum er die Juden in der Tat nicht mögen kann: Sonst müsste er ja das unangenehme Gefühl haben, er betrüge sie. So hingegen verfährt er seiner Überzeugung gemäß, und sein Handeln wird von der Richtigkeit einer Idee gelenkt, was nun aber – das sah ich ein – etwas ganz anderes sein mag, natürlich.
Ich beeilte mich, von der Bäckerei nach Hause zu kommen, da ich schon recht hungrig war, und so bin ich gerade nur auf ein Wort mit Annamaria stehen geblieben: Als ich eben die Treppe hinaufwollte, kam sie heruntergehüpft. Sie wohnt auf unserem Stock, bei den Steiners, mit denen wir uns jeweils bei den alten Fleischmanns treffen, neuerdings jeden Abend. Früher haben wir von der Nachbarschaft nicht sonderlich Kenntnis genommen: Aber jetzt hat sich eben herausgestellt, dass wir von der gleichen Sorte sind, und das verlangt nach einem kleinen abendlichen Gedankenaustausch, die gemeinsamen Aussichten betreffend. Annamaria und ich reden währenddessen über andere Dinge, und so habe ich erfahren, dass die Steiners eigentlich bloß ihr Onkel und ihre Tante sind: Ihre Eltern leben nämlich in Scheidung, und da sie sich bis dahin ihretwegen nicht einigen konnten, haben sie beschlossen, dass sie dann lieber hier sein soll, wo sie bei keinem von beiden ist. Zuvor war sie in einem Internat, aus demselben Grund, so wie übrigens früher auch ich. Auch sie ist vierzehn, so ungefähr. Sie hat einen langen Hals. Unter ihrem gelben Stern beginnt sich schon ihr Busen zu runden. Sie musste auch gerade zur Bäckerei. Sie wollte noch wissen, ob ich am Nachmittag nicht Lust hätte auf ein bisschen Rommé, zu viert, mit ihr und den beiden Schwestern. Diese wohnen einen Stock über uns. Annamaria ist mit ihnen befreundet, ich hingegen kenne sie nur flüchtig, vom Gang und vom Luftschutzkeller. Die Kleinere sieht erst so nach elf oder zwölf aus. Die Größere ist, wie ich von Annamaria weiß, genauso alt wie sie. Manchmal, wenn ich gerade in unserem Zimmer auf der Hofseite bin, sehe ich sie auf dem gegenüberliegenden Gang, wie sie gerade forteilt oder nach Hause zurückkehrt. Ein paarmal bin ich ihr auch schon unter dem Tor begegnet. Ich dachte bei mir, dann könnte ich sie jetzt ein bisschen näher kennenlernen: Lust dazu hatte ich. Doch im selben Augenblick fiel mir mein Vater ein, und ich sagte dem Mädchen, heute nicht, da mein Vater einberufen worden ist. Da hat sie sich auch sofort erinnert, dass sie die Sache mit meinem Vater schon daheim von ihrem Onkel erfahren hatte. Und sie machte die Bemerkung: «Natürlich.» Wir schwiegen ein Weilchen. Dann hat sie gefragt: «Und morgen?» Aber ich habe ihr gesagt: «Lieber übermorgen.» Und auch da habe ich gleich noch hinzugefügt: «Vielleicht.»
Als ich nach Hause kam, fand ich meinen Vater und meine Stiefmutter schon bei Tisch vor. Während sie sich mit meinem Teller beschäftigte, fragte meine Stiefmutter, ob ich hungrig sei. Ich sagte: «Entsetzlich», ohne, so plötzlich, etwas dabei zu denken und weil es nun einmal in der Tat so war. Sie hat dann meinen Teller auch richtig beladen, auf den ihren jedoch hat sie kaum etwas genommen. Aber gar nicht ich, sondern mein Vater war es, der es bemerkte und sie fragte, warum. Sie hat irgendetwas geantwortet wie: Im Augenblick sei ihr Magen nicht fähig, etwas aufzunehmen, und da sah ich meinen Fehler sofort ein. Gut, mein Vater missbilligte ihr Verhalten. Er führte an, dass sie sich nicht gehenlassen dürfe, gerade jetzt, wo es auf ihre Kraft und Ausdauer am meisten ankomme. Meine Stiefmutter hat nicht geantwortet, aber es war etwas zu hören, und als ich aufblickte, habe ich auch gesehen, was: Sie weinte. Es war wieder ziemlich peinlich, ich gab mir Mühe, nur auf meinen Teller zu schauen. Trotzdem habe ich die Bewegung bemerkt, mit der mein Vater nach ihrer Hand gegriffen hat. Nach einer kleinen Weile nahm ich wahr, dass sie ganz still waren, und als ich vorsichtig aufblickte, saßen sie Hand in Hand und sahen sich sehr innig an, eben so wie ein Mann und eine Frau. Das habe ich nie gemocht, und auch jetzt hat es mich geniert. Obwohl es im Grunde genommen ja ganz natürlich ist, glaube ich. Ich mag es trotzdem nicht. Ich weiß nicht, warum. Mir ist gleich leichter geworden, als sie wieder zu sprechen anfingen. Auch von Herrn Sütő war wieder kurz die Rede und natürlich von der Schatulle und von unserem anderen Holzlager: Ich hörte, dass es meinem Vater eine Beruhigung war, wenigstens diese Dinge, wie er sagte, «in guten Händen zu wissen». Meine Stiefmutter teilte diese Beruhigung, auch wenn sie flüchtig doch wieder auf die Sache mit den «Garantien» zu sprechen kam, in dem Sinn, dass diese nur auf dem gegebenen Wort beruhten und dass es sehr fraglich sei, ob so etwas genüge. Mein Vater hat die Achseln gezuckt und geantwortet, dass es nicht nur im Geschäftsleben, sondern auch «in den übrigen Bereichen des Lebens» für nichts mehr eine Garantie gebe. Meine Stiefmutter hat ihm mit einem Aufseufzen sogleich beigepflichtet: Sie bedauerte schon, die Angelegenheit erwähnt zu haben, und sie bat meinen Vater, nicht so zu sprechen, nicht so etwas zu denken. Da aber hat er daran gedacht, wie meine Stiefmutter mit den großen Sorgen fertig werden soll, die ihr aufgebürdet sind, in so schweren Zeiten, ohne ihn, allein: Doch meine Stiefmutter hat geantwortet, sie sei nicht allein, da ich ihr ja zur Seite stehe. Wir zwei – so fuhr sie fort – würden aufeinander aufpassen, solange mein Vater nicht wieder in unsere Mitte zurückgekehrt sei. Sie wandte sich mir zu, den Kopf etwas zur Seite geneigt, und fragte: So ist es doch, oder? Sie lächelte, aber gleichzeitig zitterten ihre Lippen. Ich habe ja gesagt. Auch mein Vater schaute mich an, mit einem milden Blick. Das hat mich irgendwie ergriffen, und um etwas für ihn zu tun, habe ich den Teller weggeschoben. Er hat es bemerkt und mich gefragt, warum ich das tue. Ich habe gesagt: «Ich habe keinen Appetit.» Wie ich sah, tat ihm das gut: Er hat mir über das Haar gestrichen. Und wegen dieser Berührung würgte mich zum ersten Mal an diesem Tag auch etwas in der Kehle; aber nicht Weinen, sondern eine Art Übelkeit. Ich hätte mir gewünscht, mein Vater wäre nicht mehr da. Es war ein schlechtes Gefühl, aber es war so stark, dass ich nur das über Vater denken konnte, und ich war in diesem Augenblick ganz durcheinander. Gleich danach hätte ich dann auch weinen können, aber ich hatte keine Zeit, weil die Gäste kamen.
Meine Stiefmutter hatte sie schon zuvor erwähnt: Nur die engste Familie kommt – so hatte sie gesagt. Und als mein Vater irgendwie eine Geste machte, hat sie hinzugefügt: «Aber sie wollen sich doch von dir verabschieden. Das ist doch nur natürlich!» Und da hat es schon geklingelt: Die Schwester meiner Stiefmutter und ihre Mama trafen ein. Bald darauf sind auch die Eltern meines Vaters, mein Großvater und meine Großmutter, gekommen. Meine Großmutter haben wir schnellstens auf das Kanapee gesetzt, denn mit ihr verhält es sich so, dass sie selbst durch ihre dicke Vergrößerungsglas-Brille kaum etwas sieht, und in mindestens gleichem Maß ist sie schwerhörig. Aber sie will trotzdem am Geschehen teilnehmen und dazu beitragen. In solchen Augenblicken hat man alle Hände voll mit ihr zu tun, weil man ihr einerseits fortwährend ins Ohr schreien muss, wie die Dinge stehen, andererseits geschickt verhindern muss, dass sie sich auch noch einmischt, weil das bloß Verwirrung stiften würde.
Die Mama meiner Stiefmutter erschien in einem kegelförmigen, kriegerischen Hut mit Krempe: vorn sogar mit einer Feder darauf, quer. Sie hat ihn dann aber bald abgenommen, und da ist ihr schönes, etwas schütteres, schneeweißes Haar zum Vorschein gekommen, mit dem dünngeflochtenen schmächtigen Knoten. Sie hat ein hageres gelbes Gesicht, dunkle große Augen, und von ihrem Hals hängen zwei welke Hautlappen herunter: In gewisser Weise ähnelt sie einem sehr klugen edlen Jagdhund. Der Kopf zittert ihr fortwährend ein bisschen. Ihr ist die Aufgabe zugefallen, den Rucksack für meinen Vater zu packen, weil sie sich auf solcherlei Arbeiten besonders versteht. Sie hat sich dann auch sofort darangemacht, anhand der Liste, die ihr meine Stiefmutter übergab.
Die Schwester meiner Stiefmutter haben wir allerdings nun gar nicht gebrauchen können. Sie ist viel älter als meine Stiefmutter und auch ihrem Äußeren nach ganz anders, so als wären sie gar keine Geschwister: Sie ist klein, dicklich und hat ein Gesicht wie eine staunende Puppe. Sie schwatzte furchtbar viel und weinte auch und hat alle umarmt. Auch ich konnte mich nur mit Mühe von ihrem sich weich anfühlenden, nach Puder riechenden Busen befreien. Als sie sich hinsetzte, stürzte das ganze Fleisch ihres Körpers über die kurzen Oberschenkel. Und um auch von meinem Großvater zu sprechen: Er seinerseits ist stehen geblieben, da, neben dem Kanapee mit meiner Großmutter, und hat sich geduldig, mit unbewegtem Gesicht ihre Klagen angehört. Zuerst hat sie wegen meines Vaters gejammert; doch mit der Zeit ließen sie ihre eigenen Leiden diesen Kummer vergessen. Sie klagte über Kopfschmerzen, dann beklagte sie sich über das Rauschen und Dröhnen, das der Blutdruck in ihren Ohren hervorruft. Mein Großvater ist das schon gewöhnt: Er antwortete ihr auch gar nicht. Er hat sich aber auch die ganze Zeit nicht von ihrer Seite gerührt. Nicht ein einziges Mal habe ich ihn etwas sagen hören, aber sooft mein Blick in die Richtung wanderte, habe ich ihn immer dort gesehen, in derselben Ecke, in der es allmählich dunkler wurde, in dem Maß, wie der Nachmittag fortschritt: Jetzt waren nur noch seine kahle Stirn und die Biegung seiner Nase irgendwie von einem stumpfen gelblichen Licht beleuchtet, während seine Augenhöhlen und der untere Teil seines Gesichts im Schatten versanken. Und nur am Blitzen seiner kleinen Augen war zu erkennen, dass er jede Bewegung im Zimmer verfolgte, ganz unmerklich.
Überdies ist auch noch eine Kusine meiner Stiefmutter gekommen, mit ihrem Mann. Ich rede ihn «Onkel Vili» an, denn so heißt er. Mit seinem Gang ist etwas nicht ganz in Ordnung, und deshalb trägt er an einem Fuß einen Schuh mit dickerer Sohle, andererseits verdankt er diesem Umstand auch das Privileg, dass er nicht zum Arbeitsdienst muss. Er hat einen birnenförmigen Kopf, oben breit, rund und kahl, an den Wangen jedoch und zum Kinn hin schmaler. Man hält in der Familie große Stücke auf seine Meinung, denn bevor er ein Wettbüro für Pferderennen aufmachte, war er im Journalismus tätig. Auch jetzt wollte er sofort von interessanten Neuigkeiten berichten, die er «aus sicherer Quelle» hatte und als «absolut glaubwürdig» bezeichnete. Er setzte sich in einen Lehnstuhl, das schlimme Bein steif weggestreckt, rieb sich mit einem trockenen Rascheln die Hände aneinander und teilte uns mit, dass «in unserer Situation demnächst eine grundlegende Wende zu erwarten» sei, weil «geheime Verhandlungen» unseretwegen begonnen hätten, und zwar «zwischen den Deutschen und den alliierten Mächten, mit neutraler Vermittlung». Die Deutschen hätten nämlich, nach Onkel Vilis Erklärungen, ihre hoffnungslose Lage an allen Fronten «nun bereits selbst erkannt». Er war der Ansicht, wir, «das Judentum Budapests», kämen ihnen geradezu «wie gerufen», um «auf unserem Rücken Vorteile bei den Alliierten herauszuschinden», die dann natürlich für uns alles tun würden, was getan werden könnte; und hier erwähnte er einen nach seiner Meinung «wichtigen Faktor», den er noch von seiner journalistischen Tätigkeit her kannte und den er «die Weltöffentlichkeit» nannte; er sagte, diese Letztere sei «erschüttert» von den Geschehnissen, die uns beträfen. Es gehe natürlich hart auf hart – so meinte er weiter–, und gerade das erkläre die augenblickliche Schärfe der Maßnahmen, die gegen uns ergriffen würden; doch das seien lediglich die natürlichen Folgen «des großen Spiels, in dem wir im Grunde nur das Werkzeug für ein riesiges internationales Erpressungsmanöver sind»; er sagte jedoch, dass er, der durchaus wisse, was unterdessen «hinter den Kulissen geschieht», das alles in erster Linie für «spektakulären Bluff» halte, des höheren Preises wegen, und er bat uns nur um ein wenig Geduld, bis «die Dinge ihren Lauf nehmen». Worauf mein Vater ihn gefragt hat, ob das noch für morgen zu erwarten sei oder ob er seine Einberufung auch als bloßen «Bluff» betrachten und morgen vielleicht gar nicht erst ins Arbeitslager einrücken solle. Da ist Onkel Vili ein bisschen verlegen geworden. Er sagte: «Nun ja, das nicht, natürlich nicht.» Doch er sagte auch, er sei da ganz ruhig, mein Vater würde bald wieder zu Hause sein. «Es ist fünf vor zwölf», hat er gesagt und sich dabei in einem fort die Hände gerieben. Und er hat auch noch hinzugefügt: «Wäre ich doch bloß bei einem einzigen meiner Renntipps so sicher gewesen wie bei dieser Sache, dann wäre ich jetzt nicht ein so armer Schlucker!» Er wollte noch fortfahren, aber meine Stiefmutter und ihre Mama waren gerade fertig mit dem Rucksack, und mein Vater erhob sich von seinem Platz, um das Gewicht auszuprobieren.
Als Letzter kam der älteste Bruder meiner Stiefmutter, Onkel Lajos. Er nimmt in unserer Familie irgendwie eine wichtige Stellung ein, obwohl ich nicht ganz genau angeben könnte, welche. Er wünschte sogleich, mit meinem Vater unter vier Augen zu sprechen. Ich konnte sehen, dass dies meinem Vater auf die Nerven ging und dass er, wenn auch sehr taktvoll, versuchte, es schnell hinter sich zu bringen. Danach hat Onkel Lajos überraschend mich in die Zange genommen. Er sagte, er möchte mit mir «ein bisschen plaudern». Er hat mich in eine verlassene Ecke des Zimmers geschleppt und, Auge in Auge mit ihm, gegen einen Schrank gestellt. Er fing damit an, ich wisse ja, dass mein Vater «uns morgen verlässt». Ich sagte, ich wisse es. Dann wollte er hören, ob er mir hier fehlen werde. Ich antwortete, wobei seine Frage mir doch etwas auf die Nerven ging: «Selbstverständlich.» Und weil mir das irgendwie zu wenig schien, habe ich gleich noch hinzugefügt: «Sehr.» Worauf er eine Zeit lang bloß genickt hat, mit klagender Miene.
Daraufhin habe ich aber ein paar interessante und überraschende Dinge von ihm erfahren. Zum Beispiel, dass ein bestimmter Abschnitt meines Lebens, den er «die sorglosen, glücklichen Kinderjahre» nannte, mit dem heutigen traurigen Tag nunmehr für mich zu Ende sei. Gewiss, so sagte er, hätte ich in dieser Form noch gar nicht darüber nachgedacht. Ich musste zugeben: nein. Doch sicher – fuhr er fort – würden seine Worte mich trotzdem nicht ganz überraschen. Ich sagte wieder nein. Darauf hat er mich wissen lassen, dass meine Stiefmutter nach dem Weggang meines Vaters ohne Stütze sei, und auch wenn die Familie «ein Auge auf uns haben wird», so bliebe doch ich von nun an ihre Hauptstütze. Bestimmt – sagte er – würde ich vor der Zeit erfahren, «was Sorge und Verzicht ist». Denn es sei ganz klar, dass ich es von nun an nicht mehr so gut haben könnte wie bisher – und das wolle er mir auch nicht verheimlichen, da wir ja nun «unter Erwachsenen» sprächen. «Jetzt», so sagte er, «hast auch du Anteil am gemeinsamen jüdischen Schicksal», und dann ist er noch weiter darauf eingegangen, wobei er etwa erwähnte, dass dieses Schicksal «seit Jahrtausenden aus unablässiger Verfolgung besteht», was die Juden jedoch «mit Ergebenheit und opferwilliger Geduld auf sich zu nehmen haben», da Gott ihnen dieses Schicksal um ihrer einstigen Sünden willen zuteilwerden lasse, und gerade deswegen könnten sie auch nur von Ihm Barmherzigkeit erwarten; Er hingegen würde von uns erwarten, dass wir in dieser schweren Zeit an unserem Platz bleiben, an dem Platz, den Er uns zugeteilt hat, «je nach unseren Kräften und Fähigkeiten». Ich zum Beispiel – so habe ich von ihm erfahren – müsse künftig in der Rolle des Familienoberhaupts an meinem Platz bleiben. Und er wollte wissen, ob ich die Kraft und die Bereitschaft dazu in mir fühlte. Ich hatte zwar seinem Gedankengang bis dahin nicht ganz folgen können, vor allem da nicht, als er das von den Juden, ihren Sünden und ihrem Gott gesagt hatte, aber irgendwie war ich von seinen Worten doch ergriffen. So habe ich eben gesagt: Ja. Er schien zufrieden. Gut, sagte er. Er habe schon immer gewusst, dass ich ein verständiger Junge sei, der «über tiefe Gefühle und ein ernstes Verantwortungsbewusstsein» verfüge; und das sei bei den vielen Schicksalsschlägen ein gewisser Trost für ihn – so war seinen Worten zu entnehmen. Und dann hat er mir mit seinen Fingern, die außen mit Haarbüscheln bedeckt und innen leicht feucht waren, unters Kinn gegriffen, hat mein Gesicht angehoben und mit leiser, leicht zitternder Stimme gesagt: «Dein Vater steht vor einer großen Reise. Hast du schon für ihn gebetet?» In seinem Blick war etwas Strenges, und vielleicht hat das in mir das peinliche Gefühl geweckt, ich hätte meinem Vater gegenüber etwas versäumt, weil ich, nun ja, von mir aus tatsächlich nicht daran gedacht hätte. Doch nun, da er dieses Gefühl in mir geweckt hatte, fing ich an, es als Belastung zu empfinden, als eine Art Schuld, und um mich davon zu befreien, habe ich ihm gestanden: «Nein.» – «Komm mit», sagte er.
Ich musste ihm in unser Zimmer auf der Hofseite folgen. Hier, umgeben von ein paar verschlissenen, nicht mehr benutzten Möbeln, beteten wir. Onkel Lajos hat zunächst ein kleines, rundes, seidig glänzendes schwarzes Käppchen genau da auf seinen Kopf gesetzt, wo sein spärliches graues Haar eine kleine Lichtung bildet. Auch ich hatte meine Mütze aus dem Flur mitnehmen müssen. Dann hat er aus der Innentasche seiner Jacke ein Büchlein mit schwarzem Einband und rotem Rand und aus der Brusttasche seine Brille hervorgeholt. Danach begann er mit dem Vorlesen des Gebets, und ich musste ihm immer so viel Text nachsprechen, wie er mir jeweils vorsprach. Am Anfang ging es gut, aber bald fand ich diese Anstrengung ermüdend, und mich störte auch einigermaßen, dass ich kein Wort von dem verstand, was wir zu Gott sagten, da wir Ihn ja auf Hebräisch anrufen müssen und ich diese Sprache gar nicht kenne. Daher musste ich, um trotzdem folgen zu können, unablässig auf die Mundbewegungen von Onkel Lajos achtgeben, sodass mir von dem Ganzen eigentlich nur der Anblick der feucht zuckenden, fleischigen Lippen geblieben ist und das unverständliche Geräusch der fremden, von uns selbst gemurmelten Sprache. Ja, und dann noch der Anblick, den ich über die Schultern von Onkel Lajos hinweg durch das Fenster hatte: Gegenüber eilte gerade die größere der Schwestern über den Gang im Stockwerk über uns zu ihrer Wohnung. Ich glaube, ich verhedderte mich im Text ein bisschen. Doch am Schluss des Gebets schien Onkel Lajos zufrieden, und auf seinem Gesicht war ein Ausdruck, dass auch ich schon beinahe das Gefühl hatte: Tatsächlich, wir haben etwas für meinen Vater getan. Und das war am Ende wirklich besser als zuvor, mit diesem belastenden und fordernden Gefühl.
Wir kehrten in das Zimmer auf der Straßenseite zurück. Es dämmerte. Wir haben die mit Verdunklungspapier verklebten Fensterflügel vor dem bläulichen, dunstigen Frühlingsabend draußen geschlossen. Damit waren wir ganz im Zimmer eingesperrt. Der viele Lärm ermüdete mich. Und auch der Zigarettenrauch biss mir schon in die Augen. Ich musste viel gähnen. Die Mama meiner Stiefmutter hat den Tisch gedeckt. Sie selbst hatte das Abendessen mitgebracht, in ihrer großen Handtasche. Sie hatte sogar Fleisch dazu besorgt, auf dem Schwarzmarkt. Das hatte sie erzählt, als sie ankam. Mein Vater hat ihr das Geld dafür bezahlt, aus seiner ledernen Brieftasche. Wir saßen schon alle beim Abendessen, als auf einmal auch noch Herr Steiner und Herr Fleischmann gekommen sind. Auch sie wollten sich von meinem Vater verabschieden. Herr Steiner fing gleich damit an, «dass sich keiner stören lassen» solle. Er sagte: «Gestatten, Steiner. Bitte sitzen zu bleiben.» An den Füßen hatte er auch jetzt die zerschlissenen Pantoffeln, unter der offenen Weste wölbte sich sein Bauch, und auch den ewigen, übelriechenden Zigarrenstummel hatte er im Mund. Er hat einen großen roten Kopf, auf dem die kindlich gescheitelte Frisur seltsam wirkt. Herr Fleischmann verschwand fast daneben, denn er seinerseits ist winzig, von sehr gepflegtem Äußeren, und er hat weißes Haar, eine gräuliche Haut, eine eulenartige Brille und einen immer etwas besorgten Ausdruck im Gesicht. Er machte an Herrn Steiners Seite wortlos Verbeugungen und rang die Hände, als wolle er sich entschuldigen, für Herrn Steiner, so schien es. Da bin ich allerdings nicht sicher. Die beiden Alten sind unzertrennlich, auch wenn sie sich fortwährend in den Haaren liegen, denn es gibt keine Frage, in der sie sich einig wären. Sie haben nacheinander meinem Vater die Hand gedrückt. Herr Steiner hat ihm auch noch auf die Schulter geklopft. Er nannte ihn «alter Junge», und dann hat er seinen alten Kalauer losgelassen: «Nur immer den Kopf runter und nie die Verzagtheit verlieren.» Und er sagte – worauf auch Herr Fleischmann heftig nickte–, dass sie sich weiterhin um mich und die «junge Frau». (wie er meine Stiefmutter nannte) kümmern würden. Er zwinkerte mit seinen winzigen Äuglein. Dann hat er sich meinen Vater an den Bauch gedrückt und ihn umarmt. Als sie weg waren, ist alles im Geklapper der Bestecke, im Gemurmel der Stimmen, im Dunst der Speisen und dichten Tabakrauch erstickt. Jetzt drangen nur noch hin und wieder zusammenhanglose Bruchstücke von Gesichtern und Gebärden zu mir, die sich sozusagen aus dem Nebel um mich herauslösten, insbesondere der zittrige, knochige gelbe Kopf der Mama meiner Stiefmutter, wie sie auf jeden Teller aufpasst; dann die abwehrend erhobenen Hände von Onkel Lajos, der kein Fleisch will, weil es vom Schwein ist und die Religion das verbietet; die Pausbacken der Schwester meiner Stiefmutter, ihre mahlenden Kiefer und tränenden Augen; dann taucht unerwartet der kahle, rosige Schädel von Onkel Vili in den Lichtkreis der Lampe, und ich höre Fetzen von neuen zuversichtlichen Erklärungen; des weiteren erinnere ich mich an die feierlichen, in völliger Stille aufgenommenen Worte von Onkel Lajos, mit denen er Gottes Hilfe in der Angelegenheit erbittet, dass «wir in Bälde alle wieder gemeinsam am Familientisch sitzen dürfen, in Frieden, Liebe und Gesundheit». Meinen Vater sah ich kaum einmal, und auch von meiner Stiefmutter drang nur eben so viel zu mir durch, dass man sich sehr viel und aufmerksam um sie kümmerte, fast schon mehr als um meinen Vater, und dass ihr einmal der Kopf wehtat und mehrere sie fragten, ob sie vielleicht eine Tablette möchte oder eine Kompresse: Sie wollte aber weder das eine noch das andere. Hingegen wurde ich in unregelmäßigen Abständen wegen meiner Großmutter aufmerksam: wie sie den anderen die ganze Zeit in die Quere kam, wie man sie dauernd zu ihrem Kanapee zurückführen musste und wegen ihrer vielen Klagen und ihrer nichts mehr sehenden Augen hinter den dicken, von Tränen beschlagenen Vergrößerungsgläsern – wie zwei seltsame, Schweiß absondernde Insekten. Irgendwann sind dann alle vom Tisch aufgestanden. Da begann das letzte Abschiednehmen. Meine Großmutter und mein Großvater sind allein, etwas früher als die Familie meiner Stiefmutter gegangen. Und vielleicht das merkwürdigste Erlebnis dieses ganzen Abends war für mich die einzige Regung, mit der mein Großvater sich bemerkbar gemacht hat: Er presste seinen scharfen kleinen Vogelkopf für einen einzigen Augenblick, aber auf eine ganz wilde, fast schon verrückte Art an die Jacke meines Vaters, an seine Brust. Sein ganzer Körper zuckte wie im Krampf. Dann ist er schnell hinausgeeilt, meine Großmutter am Ellbogen führend. Alle haben ihnen Platz gemacht. Dann haben einige auch mich umarmt, und ich habe auf meinem Gesicht die klebrige Spur ihrer Lippen gespürt. Dann war es mit einemmal endlich still, alle waren gegangen.
Und da habe auch ich von meinem Vater Abschied genommen. Oder eher er von mir. Ich weiß gar nicht recht. Ich erinnere mich auch nicht genau an die Umstände: mein Vater war wohl mit den Gästen hinausgegangen, denn eine Weile blieb ich allein am Tisch mit den Trümmern des Abendessens, und ich bin erst aufgeschreckt, als mein Vater zurückkam. Er war allein. Er wollte sich von mir verabschieden. Morgen früh ist dafür keine Zeit mehr – so hat er gesagt. Im Großen und Ganzen hat auch er über meine Verantwortung und mein Erwachsenwerden etwa das Gleiche aufgezählt, was ich am Nachmittag schon einmal von Onkel Lajos gehört hatte, bloß ohne Gott, nicht mit so schönen Worten und viel kürzer. Er hat auch meine Mutter erwähnt: Er war der Ansicht, sie könnte jetzt vielleicht versuchen, «mich von zu Hause wegzulocken». Wie ich sah, bereitete ihm dieser Gedanke ziemliche Sorgen. Die beiden hatten nämlich lange um den Besitz meiner Person gestritten, bis dann schließlich das Gerichtsurteil meinen Vater begünstigte: Und nun wollte er nicht, das fand ich auch verständlich, nur wegen seiner nachteiligen Lage sein Anrecht auf mich verlieren. Doch er hat sich nicht auf das Gesetz, sondern auf meine Einsicht berufen und auf den Unterschied zwischen meiner Stiefmutter, die für mich «ein warmes, familiäres Zuhause geschaffen hat», und meiner Mutter, die ihrerseits mich «verlassen» habe. Ich horchte auf, da ich von meiner Mutter über diesen Punkt anders unterrichtet worden war: Ihrer Meinung nach war mein Vater der Schuldige. Deshalb war sie auch gezwungen gewesen, einen anderen Mann zu finden, einen gewissen Onkel Dini (eigentlich: Dénes), der übrigens gerade letzte Woche abgereist ist, ebenfalls ins Arbeitslager. Genaueres aber hatte ich eigentlich nie erfahren, und auch jetzt kam mein Vater gleich wieder auf meine Stiefmutter zurück und erwähnte, dass ich es ihr verdanke, nicht mehr im Internat sein zu müssen, und dass mein Platz «hier zu Hause, an ihrer Seite» sei. Er sprach noch lange von ihr, und jetzt dämmerte mir schon, warum meine Stiefmutter nicht dabei war: Es wäre ihr bestimmt peinlich gewesen, das zu hören. Mich hingegen begann es einigermaßen zu ermüden. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich meinem Vater alles versprochen habe, als er es dann von mir verlangt hat. Im nächsten Augenblick jedoch habe ich mich plötzlich in seinen Armen wiedergefunden, und es hat mich irgendwie unerwartet und unvorbereitet getroffen, von ihm so gedrückt zu werden nach diesen Worten. Ich weiß nicht, ob mir die Tränen deshalb gekommen sind oder einfach aus Erschöpfung oder vielleicht, weil ich mich seit dem ersten morgendlichen Hinweis durch meine Stiefmutter irgendwie darauf vorbereitet hatte, dass sie mir in diesem bestimmten Augenblick unbedingt kommen müssten: Aber warum auch immer, es ist ja recht, dass es so geschehen ist, und ich hatte das Gefühl, es hat meinem Vater auch gutgetan, das zu sehen. Dann hat er mich zu Bett geschickt. Ich war ja auch sehr müde. Aber wenigstens – so dachte ich – konnten wir den Armen mit der Erinnerung an einen schönen Tag ins Arbeitslager ziehen lassen.