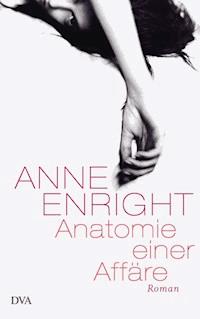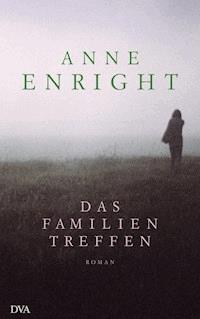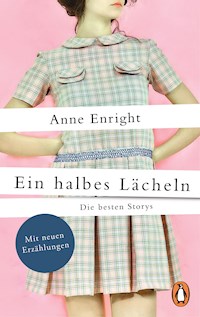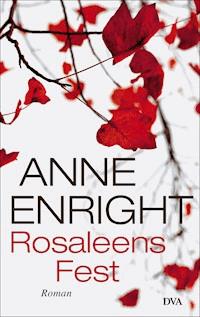
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rosaleen ist eine Frau, die nichts tut und von den anderen alles erwartet. Sie ist Mitte siebzig, die vier Kinder sind schon lange aus dem Haus. Die Brüder Dan und Emmett sind vor der Enge der irischen Heimat in die Ferne geflohen; das Nesthäkchen Hanna wollte auf den Theaterbühnen der Welt reüssieren, spricht aber nun dem Alkohol zu, und Constance, die Älteste, hat sich selbst verloren. Doch abgenabelt hat sich keines der Kinder. Noch immer versucht jedes auf seine Weise, es dieser besten aller Mütter recht zu machen. Und scheitert.
Da kommt die Einladung zu einem letzten Weihnachtsfest in Ardeevin. Rosaleen möchte das Haus, in dem die Kinder groß geworden sind, das voller Erinnerungen an glückliche Momente und Verletzungen steckt, verkaufen. Die Geschwister reisen mit diffuser Hoffnung auf Versöhnung an – und doch endet es, wie noch jedes Weihnachten geendet hat.
Booker-Preisträgerin Anne Enright wagt sich auf den dunklen Grund unserer Gefühle, studiert menschliches Verhalten dort, wo es am störanfälligsten ist, wo Liebe und Hass nahe beieinander liegen und es kein oder zumindest kein einfaches Entrinnen gibt: in der Familie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Rosaleen ist eine Frau, die nichts tut und von den anderen alles erwartet. Sie ist Mitte siebzig, die vier Kinder sind schon lange aus dem Haus. Die Brüder Dan und Emmett sind vor der Enge der irischen Heimat in die Ferne geflohen; das Nesthäkchen Hanna wollte auf den Theaterbühnen der Welt reüssieren, spricht aber nun dem Alkohol zu, und Constance, die Älteste, hat sich selbst verloren. Doch abgenabelt hat sich keines der Kinder. Noch immer versucht jedes auf seine Weise, es dieser besten aller Mütter recht zu machen. Und scheitert.
Da kommt die Einladung zu einem letzten Weihnachtsfest in Ardeevin. Rosaleen möchte das Haus, in dem die Kinder groß geworden sind, das voller Erinnerungen an glückliche Momente und Verletzungen steckt, verkaufen. Die Geschwister reisen mit diffuser Hoffnung auf Versöhnung an – und doch endet es, wie noch jedes Weihnachten geendet hat.
Anne Enright wagt sich auf den dunklen Grund unserer Gefühle, studiert menschliches Verhalten dort, wo es am störanfälligsten ist, wo Liebe und Hass nahe beieinander liegen und es kein oder zumindest kein einfaches Entrinnen gibt: in der Familie.
»Rosaleens Fest erinnert uns – mit großer emotionaler Wucht – an das, was das Leben im Grunde ausmacht, in aller Rohheit, Kostbarkeit, Unverzichtbarkeit. Herzzerreißend. Anne Enright ist eine Meisterin.« The Sunday Times
»Ein großartiger, radikaler Roman.« The Guardian
Anne Enright wurde 1962 in Dublin geboren und lebt heute im irischen Bray, County Wicklow. Die vielfach ausgezeichnete Autorin zählt zu den bedeutendsten englischsprachigen Schriftstellern der Gegenwart und wurde jüngst zur ersten Laureate for Irish Fiction ernannt. Ihr Roman Das Familientreffen wurde unter anderem 2007 mit dem renommierten Booker-Preis belohnt, ist in gut dreißig Sprachen übersetzt und weltweit ein Bestseller. Anatomie einer Affäre (2011), ihr fünfter Roman, wurde mit der Andrew Carnegie Medal for Excellence in Fiction ausgezeichnet. Mit ihrem neuesten Roman, Rosaleens Fest, ist Anne Enright wieder für den Booker-Preis nominiert.
ANNE ENRIGHT
Rosaleens Fest
Roman
Aus dem Englischen von Hans-Christian Oeser
Deutsche Verlags-Anstalt
Für Nicky Grene
ERSTER TEIL
Abschied
HANNA
Ardeevin, County Clare
1980
Später, nachdem Hanna Käsetoasts gemacht hatte, kam ihre Mutter in die Küche und füllte eine Wärmflasche mit Wasser aus dem großen Kessel auf dem Herd.
»Geh doch mal zu deinem Onkel für mich, ja?«, sagte sie. »Besorg mir etwas Solpadeine.«
»Meinst du?«
»In meinem Kopf herrscht Nebel«, sagte ihre Mutter. »Und bitte deinen Onkel um Amoxicillin, soll ich dir das buchstabieren? Ich glaub, ich hab was mit der Brust.«
»In Ordnung«, sagte Hanna.
»Versuch’s jedenfalls«, sagte ihre Mutter einschmeichelnd und presste die Wärmflasche an ihre Brust. »Das machst du schon.«
Die Madigans wohnten in einem Haus, durch dessen Garten ein kleiner Bach floss, und am Tor stand der Name des Hauses: »Ardeevin«. Hanna brauchte nicht weit zu gehen: über die Buckelbrücke und an der Tankstelle vorbei ins Städtchen.
Sie kam an den beiden Zapfsäulen vorüber, die auf dem Vorplatz Wache hielten, die breite Tür war geöffnet, und irgendwo dort drinnen hielt sich Pat Doran auf und blätterte in seinem Kalender oder lag in der Werkstatt unter einem Auto. Neben dem schwingenden Castrol-Schild stand eine Öltonne, aus der eine kahle Astgabel ragte. Pat Doran hatte ihr eine alte Hose übergezogen und an den Astenden zwei Schuhe befestigt, sodass es aussah, als wäre ein Mann in die Tonne gefallen und strampelte panisch mit den Beinen. Es wirkte sehr echt. Ihre Mutter sagte, die Tonne stehe zu nah an der Brücke, der Mann werde noch mal einen Unfall verursachen, aber Hanna liebte ihn. Und sie mochte Pat Doran, von dem es hieß, sie sollten ihm aus dem Weg gehen. Er nahm sie auf Spritztouren in schnellen Autos mit, über die Brücke und zack!, auf der anderen Seite aufgesetzt.
Hinter Doran’s kam eine Zeile mit kleinen Reihenhäusern, jedes der Fenster hatte seine ganz eigenen Vorhänge oder Rollos und seinen ganz eigenen Schmuck: ein Segelboot aus poliertem Horn, eine cremefarbene Terrine mit Plastikblumen darin, eine mit rosa Filz besetzte Plastikkatze. Hanna mochte sie alle, wenn sie daran vorbeikam, und sie mochte es, wie sich ein Haus ans andere reihte, immer in derselben Folge. An der Ecke der Main Street befand sich die Arztpraxis; in der kleinen Diele hing ein aus Nägeln und metallisch schimmerndem Garn gefertigtes Bild. Die Fäden schienen sich erst zu ver-, dann zu entwirren, und Hanna gefiel es, dass das Bild stillstand und doch dauernd in Bewegung schien, das machte einen höchst wissenschaftlichen Eindruck. Danach kamen die Läden: das Textilgeschäft mit seinem großen, von gelbem Zellophan gesäumten Schaufenster, die Metzgerei, auf deren Auslageblechen das Fleisch von blutbeflecktem Plastikgras eingefasst war, und hinter der Metzgerei der Laden ihres Onkels – früher der ihres Großvaters –: Considine’s Medical Hall.
Auf einem Plastikstreifen, der am oberen Rand des Schaufensters klebte, stand »Kodachrome Farbfilme«, in der Mitte in fetten Großbuchstaben »Kodak Filme« und am unteren Rand ein weiteres Mal »Kodachrome Farbfilme«. Die Schaufensterauslage bestand aus einer cremefarbenen Stecktafel mit kleinen Fächern, die von der Sonne gebleichte Pappschachteln enthielten. »Genau das Richtige für Ihr verstopftes Kind«, besagte ein Schild in starken roten Lettern, »SENOKOT, die natürliche Wahl bei Verstopfung«.
Hanna drückte die Tür auf, und die Ladenglocke schrillte. Sie blickte zu ihr empor. Die Metallspirale war mit Staub überzogen, während die Glocke selbst sich jede Stunde mehrmals sauber schüttelte.
»Komm rein«, sagte ihr Onkel Bart. »Rein oder raus.«
Und Hanna trat ein. Bart hielt sich allein im vorderen Teil der Apotheke auf; im Offizin, zu dem Hanna der Zutritt nicht erlaubt wurde, bewegte sich eine Frau in weißem Kittel. Früher hatte Hannas Schwester Constance hinter dem Tresen gestanden, inzwischen aber arbeitete sie in Dublin, sodass eine Bedienung fehlte, und der prüfende Blick, den der Onkel Hanna zuwarf, verriet Gereiztheit.
»Was will sie diesmal?«, fragte er.
»Hm. Hab’s vergessen«, sagte Hanna. »Ihre Brust. Und Solpadeine.«
Bart zwinkerte. Dieses Zwinkern schien außerhalb seines Gesichts vor sich zu gehen. Schwer nachzuweisen, dass es überhaupt stattgefunden hatte.
»Nimm dir ’ne Atempastille.«
»Hätte nichts dage-he-gen«, sagte Hanna. Aus der kleinen Dose vor der Registrierkasse fischte sie ein Veilchenbonbon und setzte sich in den Sessel, in dem man auf verschreibungspflichtige Medikamente wartete.
»Solpadeine«, sagte ihr Onkel.
Onkel Bart war gut aussehend, genau wie ihre Mutter; beide hatten die langen Knochen der Considines. Hannas ganze Kindheit hindurch war er Junggeselle geblieben, ein Herzensbrecher, jetzt aber hatte er eine Frau, allerdings eine, die nie einen Fuß in den Laden setzte. Darauf sei er stolz, sagte Constance. Da war er nun und musste Verkäuferinnen und Apothekergehilfinnen entlohnen, und seine Frau war aus dem Geschäft verbannt für den Fall, dass sie über den impaktierten Stuhl des Gemeindepfarrers lachte. Bart hatte eine vollkommen unnütze Frau. Sie hatte keine Kinder, dafür aber wunderschöne Schuhe in allen möglichen Farben, jedes Paar in einem passenden Beutel. Hanna dachte, dass Bart seine Frau womöglich hasste, so wie er sie anblickte, doch ihre Schwester Constance sagte, seine Frau nehme die Pille, denn die beiden könnten an die Pille herankommen. Sie sagte, sie trieben es jede Nacht zwei Mal.
»Wie geht’s denn allen so?« Bart öffnete eine Schachtel Solpadeine und nahm den Inhalt heraus.
»Gut«, antwortete Hanna.
Auf der Suche nach etwas tastete er auf dem Tresen umher und fragte: »Hast du die Schere, Mary?«
In der Mitte der Apotheke stand ein neues Drehregal mit Parfüms, Shampoos und Conditionern. In den unteren Fächern waren weitere Artikel aufgereiht, und erst als ihr Onkel mit der Schere aus dem Offizin kam, fiel Hanna auf, dass sie sie eingehend betrachtet hatte. Aber er tat so, als hätte er nichts bemerkt; er zwinkerte nicht einmal.
Er schnitt den Durchdrückstreifen in der Mitte entzwei.
»Gib ihr das«, sagte er und reichte ihr eine Hälfte des Blisters mit vier Tabletten. »Und wegen der Brust sag ihr: Was du morgen kannst besorgen, das verschiebe nicht auf heute.«
Das sollte eine Art Scherz sein.
»Mach ich.«
Hanna wusste, dass sie jetzt eigentlich gehen musste, doch die neuen Fächer schlugen sie in Bann. Da standen Fläschchen 4711 sowie cremefarbene und dunkelrote Pappschachteln mit Imperial-Leather-Badezusatz. Es gab zwei Flakons Tweed und eine Reihe anderer Parfüms, die ihr unbekannt waren. Auf einem Flakon stand »Tramp« mit einem verwegenen Pinselstrich als Querbalken des T. Im mittleren Regalfach standen Shampoos, die nichts mit Schuppen zu tun hatten, sondern mit Sonnenschein und mit Frauen, die ihre Haare ausschüttelten – Silvikrin, Sunsilk, Clairol Herbal Essences. Im untersten Fach lagen bauschige Plastikpackungen, und Hanna kam nicht dahinter, was sie enthalten mochten, vielleicht Watte. Sie hob eine verdrehte, längliche Flasche Cachet von Prince Matchabelli heraus und atmete an der Stelle ein, wo die Kappe auf das kalte Glas traf.
Sie spürte den Blick ihres Onkels auf sich ruhen, in dem ein Ausdruck wie Mitleid lag. Oder wie Freude.
»Bart«, sagte sie. »Glaubst du, Mammy ist in Ordnung?«
»Herrgott noch mal«, sagte Bart. »Was?«
Hannas Mutter hatte sich ins Bett gelegt. Fast zwei Wochen lag sie da nun schon. Seit jenem Sonntag vor Ostern, als Dan ihnen allen mitteilte, er wolle Priester werden, hatte sie sich weder angekleidet noch frisiert.
Dan war in seinem ersten Jahr im College in Galway. Man werde ihm erlauben, sein Studium abzuschließen, sagte er, aber er wolle es vom Priesterseminar aus tun. In zwei Jahren werde er also einen gewöhnlichen Hochschulabschluss in der Tasche haben und in sieben Jahren Priester sein, und danach werde er in der Mission tätig werden. Sein Entschluss stehe fest. Das alles verkündete er, als er in den Osterferien nach Hause kam, und ihre Mutter ging nach oben und kam nicht mehr herunter. Sie behauptete, Schmerzen im Ellbogen zu haben. Dan sagte, er brauche nicht viel zu packen, und dann sei er fort.
»Geh zu den Geschäften«, sagte Hannas Vater zu ihr. Aber er gab ihr kein Geld, und sie wusste auch nicht, was sie kaufen sollte. Außerdem hatte sie Angst, es könnte etwas passieren, wenn sie aus dem Haus ginge, sie würden einander anschreien. Dan wäre nicht mehr da, wenn sie zurückkäme. Nie wieder würde jemand seinen Namen erwähnen.
Doch Dan verließ das Haus nicht, nicht einmal, um einen Spaziergang zu machen. Er lungerte herum, setzte sich erst in einen Sessel, dann in einen anderen, mied die Küche, nahm das Angebot einer Tasse Tee an oder schlug es aus. Hanna brachte ihm die Tasse aufs Zimmer. Auf der Untertasse lag etwas zu essen, ein Schinkensandwich oder ein Stück Kuchen. Manchmal nahm er nur einen Bissen, und wenn Hanna die Sachen zurück in die Küche brachte, aß sie die Reste auf, und die alten Brotkrusten bewirkten, dass ihr Bruder in seinem Eingesperrtsein ihr nur noch mehr ans Herz wuchs.
Dan war so unglücklich. Hanna war erst zwölf und fand es schrecklich, mit ansehen zu müssen, was sich alles in ihrem Bruder anstaute – all sein Glaube und die Anstrengung, diesem einen Sinn abzugewinnen. Als Dan noch zur Schule ging, hatte er sie immer genötigt, sich Gedichte aus seinem Englischunterricht anzuhören, und hinterher unterhielten sie sich darüber und über alle möglichen anderen Sachen. Später sagte ihre Mutter, auch sie habe sich oft mit Dan unterhalten. Sie sagte: »Ich habe ihm von Dingen erzählt, von denen ich sonst niemandem erzählt habe.« Und diese Aussage kränkte Hanna sehr, denn was sie selbst betraf, plauderte ihre Mutter fast alles aus. Sie »schonte« ihre Kinder weiß Gott nicht.
Hanna schob die Schuld auf den Papst. Dieser war kurz nach Dans Aufbruch ans College in Irland eingetroffen, und es hatte den Anschein, als sei er eigens deshalb eingeflogen worden, denn die große Messe für die Jugend Irlands wurde in Galway abgehalten, draußen auf der Pferderennbahn in Ballybrit. Hanna nahm an der Messe in Limerick teil – es war, als stünde man mit seinen Eltern einfach nur sechs Stunden lang auf einem Feld –, doch ihr Bruder Emmet durfte ebenfalls nach Galway, obwohl er erst vierzehn war und man für die Jugendmesse sechzehn sein musste. Von der Dorfkirche aus fuhr er in einem Minibus ab. Der Priester hatte ein Banjo mitgebracht, und als Emmet zurückkehrte, hatte er gelernt zu rauchen. In der Menschenmenge hatte er Dan nicht ausmachen können. Er hatte zwei Leute gesehen, die Sex in einem Schlafsack hatten, aber das war in der Nacht davor gewesen, als alle auf irgendeinem Feld kampierten.
»Und wo lag dieses Feld?«, fragte ihr Vater.
»Ich weiß es nicht«, sagte Emmet. Den Sex hatte er den Eltern gegenüber natürlich nicht erwähnt.
»Gab’s da eine Schule?«, fragte ihre Mutter.
»Ich glaube, ja«, sagte Emmet.
»War das hinter Oranmore?«
Sie hatten in Zelten geschlafen, oder es zumindest versucht, denn um vier Uhr morgens mussten sie alle packen und zu Fuß durch die stockdunkle Nacht zur Rennbahn gehen. Jeder sei schweigend marschiert, es sei wie am Ende eines Krieges gewesen, sagte Emmet, schwer zu erklären – nur das Getrappel von Füßen, der Anblick einer glühenden Zigarette, bevor sie dem Raucher aus dem Mund gerissen wurde. »Wir gehen in die Geschichte ein«, hatte der Priester gesagt, und als der Morgen dämmerte, standen Männer in guten Anzügen und mit gelben Armbändern unter den Bäumen. Was Emmet betraf, war das aber auch schon alles. Sie sangen By the Rivers of Babylon, und als er zurückkam, hatte er seine Stimme verloren und trug die schmutzigste Kleidung, die seine Mutter je gesehen hatte; sie musste sie zwei Mal durchwaschen.
»Lag’s an der Straße nach Athenry?«, fragte ihr Vater. »Das Feld?«
In der Familie Madigan blieb die Lage des Feldes bei Galway ein dauerhaftes Rätsel, ein weiteres war, was genau Dan erlebt hatte, nachdem er mit dem College begonnen hatte. Weihnachten kehrte er zurück und stritt mit seiner Granny über Vorsichtsmaßnahmen, und seine Granny sei ganz dafür gewesen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, das sei der Witz, sagte Hannas Schwester Constance, denn »Vorsichtsmaßnahmen« waren in Wahrheit Kondome. Später, nachdem der Weihnachtspudding flambiert worden war, kam Dan in der Diele an Hanna vorbei, er nahm sie mit auf sein Zimmer und sagte: »Schütze mich, Hanna. Schütze mich vor diesen grässlichen Menschen.« Er schloss sie in die Arme.
Am Neujahrstag sprach ein Priester im Haus vor, und Hanna sah ihn zusammen mit ihren Eltern im Wohnzimmer sitzen. In den Haaren des Priesters zeigten sich die Spuren des Kamms, so als wären sie noch nass, und sein Mantel, der unter der Treppe hing, war ganz schwarz und weich.
Danach fuhr Dan wieder nach Galway, und bis zu den Osterferien, als er auch uns anderen bekannt gab, Priester werden zu wollen, geschah nichts weiter. Er machte die große Ankündigung beim sonntäglichen Mittagessen, das bei den Madigans stets mit Tischtuch und Stoffservietten aufgetragen wurde, ganz gleich, was geschah. An jenem Sonntag, Palmsonntag, gab es Schinkensteak und Grünkohl mit weißer Sauce und Karotten – grün, weiß und orange, wie die irische Flagge. Auf dem Tuch stand ein kleines Glas mit Petersilie, und der Schatten des Wassers zitterte im Sonnenlicht. Ihr Vater faltete seine großen Hände und sprach das Tischgebet, danach herrschte Schweigen. Bis auf die allgemeinen Kaugeräusche und das Räuspern ihres Vaters, eine Gewohnheit, der er fast minütlich nachgab.
»Hchm-hchmm.«
Die Eltern saßen an den Tischenden, die Kinder an den Seiten. Mädchen dem Fenster, Jungen dem Zimmer zugewandt: Constance-und-Hanna, Emmet-und-Dan.
Im Kamin brannte ein Feuer, hin und wieder schien auch die Sonne, sodass sie es jeweils fünf Minuten lang so warm wie im Winter und so warm wie im Sommer hatten. Sie hatten es doppelt so warm.
Dan sagte: »Ich hab noch mal mit Father Fawl geredet.«
Es war fast April. Eine Art gesprenkelter Tag. Das reinliche Licht erfasste die Tropfen auf der Fensterscheibe in all ihrer Vielfalt, während sich an den regenschwarzen Zweigen draußen tausend Babyblätter entfalteten.
Drinnen zerknüllte ihre Mutter das Papiertaschentuch, das sie in der Hand hielt. Sie hob es an die Stirn.
»O nein«, sagte sie und wandte sich ab, und ihr Mund klaffte so weit auf, dass man die Karotten sehen konnte.
»Er sagt, ich soll euch bitten, es noch einmal zu überdenken. Es sei schwer für einen Mann, wenn seine Familie nicht hinter ihm steht. Es ist eine große Entscheidung, die ich treffe, und er sagt, ich soll euch bitten – soll euch eindringlich bitten –, die Sache nicht mit euren eigenen Gefühlen und Sorgen schlechtzumachen.«
Dan sprach, als wären sie im stillen Kämmerlein. Oder als wären sie in einem großen Saal. Dabei handelte es sich weder um das eine noch um das andere, sondern um eine Familienmahlzeit im Esszimmer. Hanna sah, dass ihre Mutter den Impuls hatte, vom Tisch aufzuspringen, es sich aber nicht gestatten würde, der Situation zu entfliehen.
»Er sagt, ich soll euch um Verzeihung bitten, wegen des Lebens, das ihr euch von mir erhofft habt, und wegen der Enkelkinder, die ihr nicht haben werdet.«
Emmet prustete in sein Mittagessen. Dan presste die Hände auf die Tischplatte, bevor er zu einem schnellen, festen Schlag gegen seinen kleinen Bruder ausholte. Ihre Mutter scheute zurück wie ein Pferd, das über einen Graben setzen soll, doch Emmet duckte sich, und nach einer langen Sekunde landete sie endlich auf der anderen Seite des Grabens. Daraufhin senkte sie den Kopf, als wollte sie eine schnellere Gangart einlegen. Ein kleines, unartikuliertes Stöhnen entrang sich ihr. Das Geräusch schien sie nicht nur zu überraschen, sondern auch zu erfreuen, und so versuchte sie es gleich noch einmal. Das nächste Stöhnen begann verhalten und dauerte an, und als es ein letztes Mal anschwoll und abklang, hörte es sich fast wie Sprechen an.
»O Gott«, sagte sie.
Sie warf den Kopf zurück und blinzelte ein, zwei Mal zur Decke empor.
»O du lieber Gott.«
Tränen begannen zu fließen, eine nach der anderen, bis zum Haaransatz; eine, zwei-drei, vier. So verharrte sie einen Augenblick lang, während die Kinder zusahen, aber so taten, als sähen sie nicht zu, und ihr Mann sich in die Stille hinein räusperte: »Hchm-hchmm.«
Ihre Mutter hob die Hände und schüttelte ihre Ärmel nach hinten. Mit den Handballen wischte sie sich über die feuchten Schläfen und benutzte ihre feingliedrigen, gekrümmten Finger, um sich die Haare zu richten, die sie hinten stets in einem Knoten trug. Dann setzte sie sich wieder auf und blickte sorgfältig ins Leere. Sie hob die Gabel, spießte ein Stück Schinkensteak auf und führte es zum Mund, doch die Berührung der Zunge mit dem Fleisch wurde ihr zum Verhängnis; die Gabel schwang zurück auf den Teller, und das Stück Schinken fiel herab. Ihre Lippen formten sich zu einem Klagelaut, indem sie sich in der Mitte berührten und an den Seiten öffneten – Dan nannte es ihr »Breitmaulfrosch-Maul« –, dann atmete sie scharf ein und machte: »Aggh-aahh. Aggh-aahh.«
Hanna fand, ihre Mutter sollte aufhören zu essen oder, falls sie doch noch Hunger hatte, ihren Teller nehmen und in ein anderes Zimmer gehen, um sich dort auszuweinen; doch offensichtlich kam ihrer Mutter der Gedanke nicht, vielmehr blieb sie sitzen und aß und weinte zur selben Zeit.
Viel Weinen, wenig Essen. Wieder knüllte sie das längst zerfetzte Papiertaschentuch zusammen. Es war entsetzlich. Der Schmerz war entsetzlich. Ihre Mutter prustete und prustete, und in kleinen Klümpchen und Bröckchen fielen ihr die Karotten aus dem Mund.
Mit leiser Stimme kommandierte Constance, die Älteste, die anderen herum, und sie trugen ihre Teller und Tassen an ihrer Mutter vorüber, aus der es, auf die eine oder andere Weise, ins Essen tropfte.
»Ach, Mammy«, sagte Constance, beugte sich zu ihr und griff geschickt an ihr vorbei nach dem Teller, um ihn wegzuräumen.
Dan war der älteste Junge, und so fiel es ihm zu, den Apfelkuchen anzuschneiden. Dazu musste er aufstehen, das silberne Dreieck des Tortenhebers in der Hand – eine dunkle Gestalt vor dem Licht, das durchs Fenster fiel.
»Mich kannst du auslassen«, sagte ihr Vater, der behutsam mit dem Henkel seiner Teetasse gespielt hatte. Er erhob sich und verließ das Zimmer, und Dan sagte: »Also fünf. Wie soll ich denn fünf Stücke schneiden?«
Es gab sechs Madigans. Fünf – so hatte er sie noch nie betrachtet, und er führte den Tortenheber durch das auf dem Kuchen angedeutete Kreuz und schwenkte ihn dann zweiundsiebzig Grad zur Seite. Es war ein Zerschneiden der Beziehungen zwischen ihnen. Eine vollkommen andere Aufteilung. Als gäbe es jede Menge Madigans und in der weiten Welt dort draußen jede Menge Apfelkuchen.
Als ihre Mutter mit einem kleinen Löffel die Nachspeise in sich hineinschaufelte, wurde ihr Weinen zu einem komisch hechelnden Einatmen: »Phwhh phwwhh phwhh«, und von dem Teig und der holzigen Süße der alten Äpfel ließen die Kinder sich trösten. Dennoch, Eiscreme wurde an jenem Sonntag nicht angeboten, und keiner von ihnen erkundigte sich danach, obwohl alle wussten, dass es welche gab; sie war in der oberen rechten Ecke des Kühlschranks ins Gefrierfach gezwängt worden.
Danach zog sich ihre Mutter ins Bett zurück. Statt den Bus nach Dublin zu nehmen, musste Constance dableiben; ihre Wut auf Dan war groß. Beim Abwaschen machte sie ordentlich Lärm, während er auf sein Zimmer ging, um in seinen Büchern zu lesen, und die Mutter hinter ihrer geschlossenen Tür lag. Am Montag fuhr ihr Vater hinaus nach Boolavaun und kam erst abends wieder heim, und niemand konnte erraten, was er sich dabei gedacht hatte.
Es war nicht das erste Mal, dass ihre Mutter die, wie Dan es nannte, horizontale Lösung bevorzugte, aber das längste Mal, an das Hanna sich erinnern konnte. Von Zeit zu Zeit knarrte das Bett. Dann ging die Toilettenspülung, und die Tür zum Zimmer ihrer Mutter schloss sich wieder. Am Krummen Mittwoch kamen die Kinder früher aus der Schule, und ihre Mutter lag noch immer im Bett. Hanna und Emmet schlichen im Haus umher, das ohne ihre Mutter so groß und still war. Alles wirkte sonderbar unverbunden: die Biegung der Geländer am oberen Treppenabsatz, das kleine Arbeitszimmer mit der defekten Glühbirne, der feuchte Streifen auf der Esszimmertapete, der sich langsam durch einen Bambushain vorarbeitete.
Dann kam Constance hoch und verhaute die beiden, und es wurde klar – zu spät –, dass sie laut und rücksichtslos gewesen waren, wo sie doch nur fröhlich und vergnügt sein wollten. Eine Tasse landete auf dem Fußboden, eine Lache kalten Tees auf dem Küchentisch lief auf das dort liegende Bibliotheksbuch zu, und als Emmet seiner Schwester Zaumzeug anlegte und auf ihr zur Haustür hinausritt, stellte sich heraus, dass der weiße Patentledergürtel nur aus Plastik war. Nach jeder Katastrophe stoben die Kinder auseinander und verhielten sich, als wäre nichts geschehen. Und es war ja auch nichts geschehen. Sie war dort oben am Schlafen, sie war tot. Dann wurde die Stille immer drängender und leichenhafter, geradezu tragisch, bis irgendwann der Türgriff gegen die Wand knallte und ihre Mutter herausgestürzt kam. Mit wirrem Haar, offenem Mund und erhobener Hand flog sie die Treppe herab auf sie zu, und unter dem Baumwollstoff ihres Nachthemds zeichneten sich ihre schwappenden Brüste ab.
Vielleicht schleuderte sie dann noch eine Tasse zu Boden, stieß die Teekanne abermals um oder warf den zerrissenen Gürtel durch die offene Tür aufs Blumenbeet.
»So«, sagte sie dann etwa.
»Zufrieden?«
»Was ihr könnt, kann ich schon lange«, sagte sie.
»Wie findet ihr das?«
Sie starrte sie einen Moment lang an, als überlege sie, wer wohl diese fremden Kinder seien. Nach kurzer Verwirrung machte sie auf dem Absatz kehrt und stapfte hinauf ins Bett. Und zehn, zwanzig oder dreißig Minuten später öffnete sich knarrend die Tür, und es ertönte ihre kleine Stimme: »Constance?«
Diese Auftritte hatten etwas Komisches. Dan verzog das Gesicht und widmete sich wieder seinem Buch, Constance machte vielleicht Tee, und Emmet tat etwas sehr Hochherziges und Selbstloses – eine einzelne Blume aus dem Garten, ein aufrichtig gemeinter Kuss. Hanna wusste nicht, was sie tun sollte, außer vielleicht hineinzugehen und sich lieb haben zu lassen.
»Mein Baby. Wie geht’s meinem kleinen Mädchen?«
Viel später, als all das längst vergessen war, als der Fernseher lief und zum Abendbrot Käsetoasts gemacht wurden, kehrte ihr Vater von den Feldern in Boolavaun zurück. Zwei Stufen auf einmal nehmend, eilte er die Treppe hinauf und verschwand, nachdem er zwei Mal angeklopft hatte, in ihrem Zimmer.
»Und nun?«, sagte er, bevor sich die Tür zu einem Gespräch schloss.
Nach langer Zeit kam er zurück nach unten in die Küche und verlangte sein Abendbrot. Eine Stunde oder so döste er schweigend vor sich hin und schrak erst bei den Neun-Uhr-Nachrichten auf. Dann schaltete er den Fernseher aus und fragte: »Wer von euch hat den Gürtel eurer Mutter zerrissen? Heraus mit der Sprache!« Und Emmet antwortete: »Es war meine Schuld, Daddy.«
Er stand vornübergebeugt, mit gesenktem Kopf und herabhängenden Händen da. Emmet konnte einen verrückt machen mit seiner Art, den Braven zu mimen.
Ihr Vater zog das Lineal unter dem Fernsehapparat hervor, Emmet hob die Hand, und ihr Vater hielt seine Fingerspitzen bis zur letzten Millisekunde fest, bevor er ihm den Schlag verabreichte. Dann wandte er sich seufzend ab und schob das Lineal wieder unter den Fenseher.
»Marsch ins Bett«, sagte er.
Mit hochroten Wangen verließ Emmet das Zimmer, und Hanna bekam ihren Gutenachtschrapper – eine kratzende Berührung der Wangenbartstoppeln ihres Vaters, wenn er sich ihrem Kuss zum Scherz entzog. Ihr Vater roch nach seinem Tagwerk: nach frischer Luft, Diesel und Heu, irgendwo dazwischen eine Erinnerung an Kühe, darunter die Erinnerung an Milch. Sein Mittagessen hatte er in Boolavaun zu sich genommen, wo seine Mutter wohnte.
»Deine Granny wünscht dir gute Nacht«, sagte er, was wieder so eine Art Scherz war. Und er legte den Kopf schief.
»Wirst du morgen mit mir hinausfahren? Also ja.«
Am nächsten Tag, Gründonnerstag, nahm er Hanna in seinem orangefarbenen Cortina mit, dessen Tür laut knackte, wenn man sie öffnete. Nach ein paar Kilometern begann er zu summen, und als sie aufs Meer zuhielten, sah man den Himmel immer weißer werden.
Hanna liebte das kleine Haus in Boolavaun: vier Zimmer, ein Vorbau voller Geranien, dahinter ein Berg und davor ein Himmel voller Wolken. Wenn man die lang gestreckte Wiese durchquerte, gelangte man zu einer schmalen Landstraße, die über eine kleine Anhöhe führte. Von dieser sah man die Aran-Inseln in der Bucht von Galway und die ebenso berühmten Klippen von Moher weit im Süden. Die Straße verengte sich zur Green Road durch den Burren, hoch über dem Strand von Fanore, und das sei die schönste Wegstrecke der Welt, ohne Ausnahme, sagte ihre Granny, gefeiert in Liedern und Geschichten. Hin und wieder fügten die Steine sich zu Mauern, um dahinter wieder ein Feld zu bilden, jene kleinen steinigen Weiden, deren Blumen süß und selten waren.
Und wenn man die Augen von dem beschwerlichen Weg hob, war alles anders: Draußen in der Bucht schlummerten die Inseln vor sich hin, die Wolken ließen ihre Schatten übers Wasser gleiten, und in tranceartigen stummen Gischtwolken brandete der Atlantik gegen die fernen Klippen.
Tief unten lagen die Flaggy Shore genannten Kalksteinplatten – graue Felsen unter einem grauem Himmel –, und es gab Tage, an denen das Meer ein einziges glitzerndes Grau war und das Auge nicht unterscheiden konnte, ob Abend- oder Morgendämmerung herrschte, immerzu musste es sich anpassen. Es war, als würden die Felsen das Licht aufsaugen und verstecken. Und das war das Besondere an Boolavaun: Es war ein Ort, der sich dem Blick entzog.
Und Hanna liebte ihre Granny Madigan, eine Frau, die aussah, als hätte sie eine Menge zu sagen und gäbe nichts davon preis.
Setzte dort draußen jedoch der Regen ein, dann zog der Tag sich in die Länge: Ihre Granny bewegte sich unablässig hierhin und dorthin, räumte Sachen weg und wischte sie ab, vieles davon überflüssiges Getue; sie fütterte Katzen, die sich nicht herbeirufen ließen, oder verlor etwas, das sie eben erst aus der Hand gelegt hatte. Zu bereden gab es da nicht viel.
»Wie läuft es in der Schule?«
»Gut.«
Und vieles durfte Hanna nicht berühren. Eine Vitrine in der guten Stube beherbergte eine Auswahl an Porzellan. Andere Flächen waren mit Geranien in verschiedenen Stadien der Blüte und des Verfalls vollgestellt. Auf einer hinteren Fensterbank stand ein ganzer Kasten mit amputierten Blumen, deren zurückgeschnittene Stängel buschiges Wachstum bis zu den Spitzen verhieß. Die Wände waren kahl bis auf ein Gemälde der Seen von Killarney in der guten Stube und ein schlichtes schwarzes Kruzifix über dem Bett ihrer Granny. Ein Herz Jesu gab es nicht, auch kein Weihwasser und keine Statuette der Jungfrau. Granny Madigan ging mit einer Nachbarin zur Messe, falls sie überhaupt zur Messe ging, und die acht Kilometer zum nächsten Geschäft legte sie bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zurück. Wenn sie erkrankte – und sie erkrankte nie –, war sie in Schwierigkeiten, denn Considine’s Medical Hall betrat sie grundsätzlich nicht.
Hatte sie noch nie getan und würde sie nie tun.
Für die Gründe interessiert sich Hanna sehr, denn sobald ihr Vater das Vieh auf die Weide getrieben hatte, nahm ihre Granny sie verstohlen beiseite – als würden Mengen von Menschen sie beobachten – und drückte ihr eine Pfundnote in die Hand.
»Geh für mich zu deinem Onkel«, sagte sie, »und bitte ihn um dieselbe Creme wie beim letzten Mal.«
Die Creme war für etwas Abscheuliches, das nur alte Damen hatten.
»Was soll ich sagen?«, fragte Hanna.
»Ach, nicht nötig, nicht nötig«, antwortete ihre Granny. »Er wird schon Bescheid wissen.«
Früher war zweifellos Constance für diese Besorgungen zuständig gewesen, aber jetzt war Hanna an der Reihe.
»Na schön«, sagte sie.
Die Pfundnote, die Granny ihr in die Hand drückte, war einmal gefaltet und dann zusammengerollt. Hanna wusste nicht, wohin damit, also steckte sie sie zur sicheren Verwahrung in ihren Socken und schob sie bis zum Fußknöchel hinab. Aus dem einen Fenster blickte sie auf das harte Meereslicht, aus dem anderen auf die Straße, die zur Stadt führte.
Sie vertrugen sich nicht, die Considines und die Madigans.
Als Hannas Vater das Zimmer betrat, um seine Tasse Tee zu trinken, füllte er den ganzen Türrahmen aus, sodass er sich bücken musste, und Hanna wünschte, ihre Granny würde ihren Sohn um die Creme bitten, was immer für eine Creme das war, obwohl sie ahnte, dass sie etwas mit dem hellen Blut zu tun hatte, das sie auf dem Leibstuhl ihrer Granny gesehen hatte. Das war ein Stuhl, in dessen Sitzfläche sich eine Öffnung befand, unter die man den Nachttopf schob.
In dem Haus in Boolavaun gab es, wie gesagt, vier Zimmer. Hanna betrat jedes von ihnen und lauschte auf die unterschiedlichen Geräusche des Regens. Jetzt stand sie im hinteren Schlafzimmer, das ihr Vater sich früher mit seinen beiden jüngeren Brüdern geteilt hatte. Inzwischen lebten diese in Amerika. Sie betrachtete die drei Betten, in denen sie einst geschlafen hatten.
Draußen in der Küche saß ihr Vater bei seinem Tee, und ihre Granny las in der Zeitung, die er ihr jeden Tag aus der Stadt mitbrachte. Bertie, der Hauskater, rieb sich an den betagten Füßen ihrer Granny, und das Radio empfing den Sender nicht mehr. Auf dem Herd kochte episch langsam ein großer Topf mit Wasser auf.
Nachdem der Regen aufgehört hatte, gingen sie ins Freie, um Eier zu suchen. Ihre Granny trug eine weiße Emailleschüssel mit schmalem blauem Rand, der hier und da angeschlagen war, sodass der schwarze Untergrund zum Vorschein kam. In gebückter Haltung ging sie rasch zu der Hecke hinter dem Hühnerstall, die den eigentlichen Hof vom Dreschhof trennte. Sie tastete unter den Sträuchern herum und spähte durch die Zweige.
»Oho«, sagte sie. »Jetzt hab ich dich.«
Neben den entzündeten Fußballen ihrer Granny kroch Hanna ins Gebüsch, um das Ei aufzulesen, das in der Hecke gelegt worden war. Das Ei war braun und mit Hühnerkot beschmiert. Granny hielt es in die Höhe, um es zu bewundern, bevor sie es in die leere Schüssel legte, wo es mit einem hohl und gefährlich klingenden Geräusch umherrollte.
»Geh«, sagte sie zu Hanna, »und schau in den Mauerlöchern nach.«
Hanna ging in die Hocke. Die Mauern, von denen das Land durchzogen war, waren ihr und Emmet verboten; Granny hatte Angst, die Steine könnten sich lockern und ihnen auf den Kopf fallen. Die Mauern seien älter als das Haus, sagte ihre Granny; Tausende von Jahren alt, die ältesten Mauern Irlands. Aus der Nähe betrachtet, waren die Steine mit Weiß getupft und mit gelben Flechten übersät, die wie Geldmünzen im Sonnenlicht glänzten. Und tatsächlich, in einer Spalte, aus der Jakobskraut wuchs, lag ein weißes Ei versteckt und war nicht einmal verschmutzt.
»Aha«, sagte ihre Granny.
Hanna legte das Ei in die Schüssel, und ihre Granny fasste mit den Fingern hinein, damit die beiden Eier nicht gegeneinanderprallten. Hanna schlüpfte in den hölzernen Hühnerstall mit seinem widerlichen Gestank nach altem Stroh und Federn, um die restlichen Eier einzusammeln, während ihre Granny in der Tür stand und für jedes neue Ei, das Hanna fand, die Schüssel senkte. Als sie sich wieder dem Haus zuwandten, griff die alte Frau nach unten und hob einen der scharrenden Vögel auf – so mühelos, dass sie die Schüssel mit Eiern nicht einmal abstellen musste. Wenn Hanna versuchte, eins der Hühner einzufangen, stoben diese so flink auseinander, dass sie Angst hatte, ihnen einen Herzanfall zu verursachen; ihre Granny dagegen hob ihn einfach vom Boden auf, und da war er nun, in ihre Armbeuge geklemmt. Das rotbraune Gefieder glänzte in der Sonne. Ein junger Hahn, den kurzen schwarzen Schwanzfedern nach zu urteilen, die, wenn er ausgewachsen wäre, einen stolzen, grünlich schimmernden Schmuck abgeben würden.
Als sie den Hof durchquerten, kam Hannas Vater aus dem Wagenschuppen, einem zur Seite hin offenen Nebengebäude zwischen dem Kuhstall und der kleinen Nische für Torf. Ihre Granny stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihm den Vogel zu reichen, und als ihr Vater sich umwandte, baumelte das Tier von seiner Hand. Er hatte den Vogel an den Füßen gepackt, und in der anderen Hand hielt er ein Beil, und zwar dicht an der Klinge. Als er zu einer zerbrochenen Bank im Schutz des Wagenschuppendachs ging, die Hanna noch nie aufgefallen war, schwang er probeweise einige Male das Beil. Er schleuderte den Kopf des Tieres auf das Holz, sodass es den Schnabel vorreckte, und schlug ihn ab.
Das tat er ebenso mühelos, wie ihre Granny den Vogel vom Boden aufgehoben hatte. Im Nu war alles vorbei. Ihr Vater hielt das gemetzelte Ding von sich weg, solange das pumpende Blut aufs Kopfsteinpflaster tropfte.
»Oh.« Ihre Granny stieß einen leisen Schrei aus, als sei etwas Wertvolles verloren gegangen, und plötzlich fanden sich die Katzen ein und stellten sich auf die Hinterpfoten, unter den offenen Hals des Vogels.
»Fort mit euch«, sagte ihr Vater und stieß eine der Katzen mit dem Stiefel zur Seite, dann übergab er den noch flatternden Vogel Hanna, die ihn halten sollte.
Hanna war überrascht, wie warm sich die Krallen des Hähnchens anfühlten; sie waren so geschuppt und knochig, dass sie sich eigentlich nicht hätten warm anfühlen dürfen. Sie hatte den Eindruck, dass ihr Vater sich über sie lustig machte, als er ihr den Vogel überließ und ins Haus ging. Hanna hielt das Hähnchen mit beiden Händen von sich und versuchte, es nicht fallen zu lassen. Es flatterte und zappelte. Eine der Katzen hatte bereits den fleischigen Hahnenkamm zwischen den schmalen Zähnen und lief mit dem Kopf davon, der unter ihrem kleinen weißen Kinn wippte. Eigentlich hätte Hanna bei alledem – dem herabbaumelnden zerfetzten Hals und dem empörten Auge des Hahns – aufkreischen müssen, aber sie war viel zu sehr damit beschäftigt zu verhindern, dass der Leichnam ihr aus den Händen zuckte. Die Flügel waren abgespreizt und das rostbraune Gefieder zurückgesträubt, sodass sich die gelben Flaumfedern zeigten, und unter den schwarzen Schwanzfedern schied der Rumpf Kot aus, in Spritzern, die das spritzende Blut nachahmten.
Ihr Vater kam mit dem großen Topf Wasser aus der Küche und stellte ihn auf dem Kopfsteinpflaster ab.
»Immer noch am Leben?«, fragte er.
»Da, da!«, rief Hanna.
»Das sind nur die Reflexe«, sagte er. Jetzt war sich Hanna sicher, dass er sich über sie lustig machte, denn obwohl eigentlich alles vorbei war, zuckte das Ding erneut, und ihre Granny stieß einen Laut aus, wie Hanna ihn noch nie gehört hatte, ein entzücktes Krähen, das Hanna auf der Haut ihres Halses verspürte. Die alte Frau ging wieder in die Küche und legte die Eier auf die Anrichte. Als sie herauskam, fischte sie ein Stück Zwirn aus der Schürzentasche, und endlich nahm Hannas Vater ihr das Hähnchen ab und tauchte das Ding in den Topf mit dampfendem Wasser.
Selbst dann noch zuckte der Körper, und die Flügel schlugen zwei Mal kräftig gegen die Topfwände.
Rein und raus. Und dann war der Hähnchenkadaver still.
»Jetzt bist du dran«, sagte Hannas Vater zu seiner Mutter und hielt ihr ein Bein hin, damit sie das Stück Zwirn darumband.
Danach sah Hanna zu, wie ihre Granny das Hähnchen an einem Bein an einem Haken im Wagenschuppen aufhängte und dem Vogel mit einem laut reißenden Geräusch die Federn herausrupfte. Die nassen Federn klebten in Klumpen an ihren Fingern; sie musste immer wieder in die Hände klatschen und sie an der Schürze abwischen.
»Komm her, und ich zeig dir, wie’s geht«, sagte sie.
»Nein«, sagte Hanna und blieb in der Küchentür stehen.
»Na, komm schon«, sagte ihre Granny.
»Ich will aber nicht«, sagte Hanna und fing an zu weinen.
»Ach, Liebling.«
Und Hanna wandte beschämt das Gesicht ab.
Hanna musste immer weinen – so stand es nun einmal um sie. Sie musste immer »schnoddern«, wie Emmet es ausdrückte. Ach, deine Blase sitzt zu dicht an deinen Augen, sagte ihre Mutter immer, Constance nannte es das Wasserwerk, und es gab noch einen Ausdruck, den alle verwendeten: Hier kommt das Wasserwerk; dabei waren es ihre Brüder und ihre Schwester, die sie zum Weinen brachten. Besonders Emmet, der ihr Tränen entlockte, sie ihr heiß und schmerzend aus dem Gesicht riss und triumphierend mit ihnen davonrannte.
»Hanna flennt schon wieder!«
Aber Emmet war ja nicht einmal hier. Und Hanna weinte wegen eines Hähnchens. Denn das war es, was sich jetzt unter den schmutzigen Federn zeigte. Es hatte eine weiße Hühnerhaut bekommen und schrie förmlich nach Röstkartoffeln.
Ein Sonntagshähnchen.
Und ihre Granny umarmte sie jetzt von der Seite. Sie drückte Hannas Arm.
»Ist ja gut«, sagte sie.
Derweil kam Hannas Vater mit einer Kanne Milch aus dem Kuhstall, die er mit nach Hause nehmen wollte.
»Wirst du’s überleben?«, fragte er.
Als sie ins Auto stieg, stellte der Vater die Kanne zwischen Hannas Füße, damit die Milch nicht verschüttet wurde. Das Hähnchen lag auf dem Rücksitz, eingewickelt in Zeitungspapier, das mit einer Kordel zugebunden war. Sein Inneres war leer, und das Gekröse lag in einer Plastiktüte daneben. Ihr Vater schloss die Wagentür, und während er um den Wagen auf die Fahrerseite ging, saß Hanna stumm da.
Hanna schwärmte für die Hände ihres Vaters, sie waren riesig, ihr Anblick am Lenkrad ließ das Auto wie ein Spielzeugauto erscheinen und ihre eigenen Gefühle wie die eines Babys, denen sie eines Tages entwachsen würde. Die Milch, die in der Kanne schwappte, war noch warm. Auch die Pfundnote spürte sie dort unten, an ihrem Fußknöchel geborgen.
»Ich muss für Granny zur Apotheke«, sagte sie.
Doch ihr Vater gab darauf keine Antwort. Hanna überlegte kurz, ob er die Worte überhaupt gehört hatte, ja, ob sie sie überhaupt ausgesprochen hatte.
Ihr Großvater John Considine hatte einmal eine Frau angebrüllt, weil sie die Medical Hall betreten und um etwas gebeten hatte, das man nicht erwähnen durfte. Hanna erfuhr nie, worum es sich handelte – man könnte ja vor Scham sterben –, es hieß, er habe die Frau unsanft vor die Tür gesetzt. Obwohl andere Leute behaupteten, er sei ein Heiliger – ein Heiliger, sagten sie –, jedenfalls in den Augen der Stadtbewohner, die ihn zu jeder Stunde wegen eines Kindes mit Keuchhusten weckten oder wegen einer alten Dame, die die Schmerzen ihrer Nierensteine rasend machten. Von Gort bis Lahinch gab es Männer, die, wenn ihre Hühner Luftröhrenwürmer oder ihre Schafe Durchfall hatten, mit keinem anderen reden wollten. Sie brachten ihre Hunde an einem Stück Erntegarn zu ihm – wilde Männer aus dem hinterletzten Winkel –, und dann ging er ins Offizin, um summend etwas zurechtzumischen: Kampfer und Pfefferminzöl, Opiumtinktur und Wurmfarnextrakt. Soweit Hanna es beurteilen konnte, war der alte John Considine in den Augen aller ein Heiliger, mit Ausnahme der Leute, die ihn nicht leiden konnten, und das war die halbe Stadt – die gingen stattdessen zu Moore, dem Apotheker auf der anderen Seite des Flusses.
ENDE DER LESEPROBE
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Originaltitel: The Green RoadOriginalverlag: Jonathan Cape, ein Imprint von Vintage, Penguin Random House, London
Die Deutsche Verlags-Anstalt dankt dem Ireland Literature Exchange (Übersetzungsfond), Dublin, Irland, für die finanzielle Unterstützung dieser Ü[email protected]
1. AuflageCopyright © 2015 by Anne EnrightCopyright © 2015 by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHAlle Rechte vorbehaltenSchutzumschlaggestaltung: LNT-Design, KölnTypografie und Satz: DVA/Brigitte MüllerGesetzt aus der BerlingISBN 978-3-641-17353-1www.dva.de