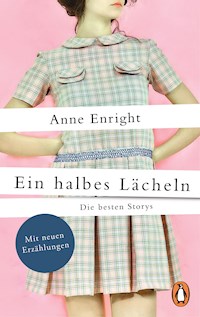18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anne Enrights »bislang bester Roman« (The Irish Times) über zwei Frauen und ihre Reise zu sich selbst
Die junge Irin Nell verdient ihr Geld mit dem Schreiben von Reiseberichten über Orte, an denen sie nie war. Denn Nell hat Fantasie, und das Schreiben ist ihr Leben. Ihren Großvater, den berühmten Dichter Phil McDaragh, hat sie nie kennengelernt, aber seine Verse sprechen intensiv zu ihr. Auch Nells Mutter Carmel kennt diese Verse gut. Lange hat sie sich vergeblich bemüht, das Image des Dichters und seine Lyrik mit ihren Erinnerungen an den Vater zusammenzubringen. Nun ist es an Nell, um die Versöhnung zu kämpfen, die ihrer Mutter versagt blieb.
So zärtlich wie wahrhaftig erzählt Anne Enright in ihrem berührenden Familienroman von vererbten Wunden und der tröstlichen Kraft der Poesie.
»Ein großartiger Roman.« Sally Rooney
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anne Enrights »bislang bester Roman« (The Irish Times) über zwei Frauen und ihre Reise zu sich selbst
Die junge Irin Nell verdient ihr Geld mit dem Schreiben von Reiseberichten über Orte, an denen sie nie war. Denn Nell hat Fantasie, und das Schreiben ist ihr Leben. Ihren Großvater, den berühmten Dichter Phil McDaragh, hat sie nie kennengelernt, aber seine Verse sprechen intensiv zu ihr. Auch Nells Mutter Carmel kennt diese Verse gut. Lange hat sie sich vergeblich bemüht, das Image des Dichters und seine Lyrik mit ihren Erinnerungen an den Vater zusammenzubringen. Nun ist es an Nell, um die Versöhnung zu kämpfen, die ihrer Mutter versagt blieb.
So zärtlich wie wahrhaftig erzählt Anne Enright in ihrem berührenden Familienroman von vererbten Wunden und der tröstlichen Kraft der Poesie.
»Ein großartiger Roman.« Sally Rooney
www.penguin-verlag.de
ANNE ENRIGHT
VOGELKIND
Roman
Aus dem Englischen von Eva Bonné
Die Originalausgabe erschien 2023
unter dem Titel The Wren, The Wren
bei Vintage Publishing, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2023 by Anne Enright
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Kristine Kress
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagabbildung: © duncan1890 / DigitalVision
Vectors / Getty Images
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-31395-1V003
www.penguin-verlag.de
Für Claire Bracken
NELL
IN NEVADA GIBT es einen Psychologen namens Russell T. Hurlburt, der auf dem Gebiet des menschlichen Bewusstseins forscht. Im Jahr 2009 stattete er Melanie, eine junge Probandin, mit einem Pieper aus, der im Laufe des Tages zu willkürlichen Zeiten losging. Auf das Signal hin sollte Melanie alles notieren, was sie in dem Moment bewusst wahrnahm. Später schilderte sie diese gedanklichen Ereignisse in einem Interview.
Am dritten Tag des Experiments stellte ihr Freund ihr eine Frage zum Thema Versicherungen, außerdem versuchte sie, sich an das Wort »Parodontologe« zu erinnern. Am vierten Tag empfand sie den starken Wunsch, tauchen zu gehen. Am sechsten Tag wischte sie Blütenblätter aus der Spüle und hatte dabei den Ausdruck »ganz schön lange« im Ohr.
Dr. Hurlburt sagt, dass es für die Ausgestaltung unseres Innenlebens, wie es sich in unserem Kopf abspielt, viele Variationen gibt. »Aus meinen Forschungen geht hervor, dass viele Menschen niemals von sich aus Gedankenbilder entwerfen, andere wiederum erzeugen detailreiche, lebensechte Bewegtbilder in Technicolor.« Das Innenleben einiger Leute wird von Sprache, körperlichen Empfindungen und Gefühlen dominiert, während andere auf »unsymbolisches Denken« in Form von wortlosen Fragen zurückgreifen, beispielsweise in der Situation »Soll ich das Schinkensandwich nehmen oder das mit Roastbeef?«.
Ich finde dieses Experiment hilfreich und sehr interessant. Erklärungen sind weder gefragt, noch werden sie gegeben. Melanie denkt so, weil Melanie so denkt. Vielleicht gibt es keinen Grund dafür, dass sie, wenn sie an einer Spüle voller Blütenblätter steht, zur Dichterin wird und ihr inneres Gehör sich an drei schlichten Wörtern erfreut, »ganz schön lange«, während andere hier nur alte Teebeutel sehen würden und das Gefühl bekämen, dass ihr Leben den Bach runtergeht.
Ich frage mich, was Melanies Freund in dem Moment gedacht hat.
Wir sollten eine Versicherung abschließen!,
oder:
Warum ignoriert sie mich?,
oder:
O mein Gott, diese Brüste,
oder:
Ich sollte eine Lebensversicherung auf das Miststück abschließen und es ermorden, verdammt,
oder:
Wenn wir den Anbieter wechseln, würden wir sehr viel Geld sparen. Ich könnte eine Aufstellung machen und ihr die möglichen Risiken und die Kostenersparnis zeigen.
oder:
Wenn ich jetzt über Versicherungen rede, muss ich nicht an meine Erektion denken.
Wenn ich jetzt über Versicherungen rede, muss ich nicht über mein finanzielles Versagen in einem System nachdenken, das die Leute bis zum Letzten ausquetscht.
Wenn ich jetzt über Versicherungen rede, muss ich nicht über den Tod nachdenken, außer auf eine praktische Weise.
Ich bin praktisch verliebt, und ich liebe es, mich praktisch zu betätigen.
Ich will keinen Stress, ich will ein Ja.
Ich will sterben, auf der Stelle, in ihren Armen.
Seien wir nicht albern. Melanies Freund denkt natürlich an Fußball. Denn das antworten Männer, wenn man sie fragt, woran sie gerade denken, und selbstverständlich sagen diese Männer die Wahrheit. Obwohl … unter den Gedanken an Fußball rührt sich etwas, eine riesige, alte Echse mit flatternder Zunge. Irgendwo da unten. Die Schmerzen in der rechten Daumenwurzel, der leichte Juckreiz oben auf dem Schädel. Unter dem Juckreiz, oder dahinter: eine Öffnung. Eine Lücke. Eine Stelle. Ein strahlend blauer Himmel über einem fernen Planeten, an dem drei Monde aufgehen (er ist ein Junge, nicht vergessen).
Eins zu null. Zwei zu null. Vielleicht sogar fünf zu null. Ja! Und hinter dem Fußball denkt er: Sieg! Tausende Männer springen von den Kunststoffsitzschalen des Stadions auf wie ein Mann. Ja! Fußball!
Melanie saugt derweil an ihrem Zahnimplantat, das sich ein bisschen locker anfühlt. Ihr Freund findet das leise Geräusch einfach nur schrecklich. Auf Körpergeräusche reagiert er sehr empfindlich, besonders auf fremde, besonders auf jene aus fremden Mündern. Melanies Freund ist sich der Zungen und des Speichels in den Mündern anderer Leute überdeutlich bewusst, es stört ihn sogar, wenn der Hund sich nachts leckt. Am schlimmsten sind Äpfel. Dann ist es, als würde mitten in seinem Kopf geschmatzt und gekaut und als gäbe es zwischen innen und außen keine Grenze aus Schädelknochen. Es ist die totale Invasion, fast wie Folter, und währenddessen versucht er, die Post zu sortieren. Oder die verdammte Versicherungsfrage zu klären.
Aber was soll man machen.
Melanie und ihr Freund. Ich wünsche ihnen alles Gute. Ich glaube, sie ist eine Träumerin, und er ist wirklich ein Schatz und macht sich Gedanken um ihre Sicherheit. Mit der Zeit – mit viel Zeit – werden beide lernen, was der andere gerade denkt.
Er denkt:
weich
dieser Duft
Sie denkt:
ganz schön lange
Wir gehen nicht durch die gleiche Straße wie der Mensch an unserer Seite. Wir können nicht mehr tun, als ihm zu sagen, was wir sehen. Wir können auf Dinge zeigen und versuchen, sie zu benennen. Wenn wir es geschickt anstellen, erlebt unsere Begleitung die Welt auf eine neue Weise, und dann kommt es zu einer echten Begegnung.
Als ich mir diese Gedanken zum ersten Mal gemacht habe, war ich der Ansicht, Empathie wäre eine Lösung für fast alles (ist sie! wirklich!). Ich habe damals viel über Gender und Empathie nachgedacht, über Religion und Empathie, über ihre evolutionären Vorteile. Ich trug einen großen, schönen Kuchen namens »den Schmerz der anderen fühlen« im Herzen, stocherte pausenlos darin herum und bildete mir ein, dass Gefühle eine Brücke zwischen Menschen bilden und Stimmungen einen Raum durchqueren können, und Zuneigung war gasförmig und wurde vom einen ausgeatmet und vom anderen wieder ein. Empathie! Das große Verschmelzen.
Denn verschmelzen können wir. Wir können uns miteinander verbinden. Du und ich, wir weinen beim selben Film.
Aber manchen Leuten gelingt dieses – zugegebenermaßen recht komplizierte – Manöver nicht. Da bleibt immer eine Lücke.
Heute glaube ich, dass zwischen mir und den anderen eine Lücke klaffen muss, denn alle Menschen sind von Raum umgeben. Doch das ist kein Grund zur Sorge. Die Luft zwischen den Leuten kann von Gefühlen durchkreuzt werden – muss sie aber nicht. Man braucht noch etwas anderes, zumindest am Anfang. Das meinte Russell T. Hurlburt, als er über die unterschiedlichen Arten des gedanklichen Erlebens sprach. Menschen sind unterschiedlich und denken auf unterschiedliche Weise. Ich glaube, der gesuchte Begriff lautet »Übersetzung«.
In diese Haltung der glücklichen Getrenntheit zu finden, hat mich viel Zeit gekostet. Als Kind glaubte ich, wir alle wären gleich. Ich hatte telepathische Kräfte, du hattest telepathische Kräfte, und das war wirklich schön. Zu erkennen, dass es sich hier um einen Irrtum handelt, traf mich folglich sehr hart.
Aber:
Die junge Frau, die auf der Toilette ein Kind zur Welt bringt und nicht einmal wusste, dass sie schwanger war. Wie konnte das passieren?, fragen wir. Natürlich hat sie es verdrängt. Sie war arm.
Eine junge Frau.
Eine andere junge Frau empfindet Schmerzen, nicht bloß vor und während der Geburt oder vor und während ihrer Periode, sondern beim Eisprung. Sie kann tatsächlich fühlen, wie das Ei in den Eileiter plumpst. »Mittelschmerz« ist ein deutsches Wort, also muss es wahr sein. Ich bin mit einem Mädchen zur Schule gegangen, das alles gefühlt hat. In der Woche vor ihrer Periode lenkten ihre empfindlichen Brüste sie vom Unterricht ab, vier, drei oder zwei Tage vorher kamen Krämpfe hinzu, und dann ging es richtig los. Ein zehntägiges Spektakel, jeden Monat. Ein Drittel ihres Lebens. Tampons passten nicht. Binden reichten nicht aus. Sie fiel in Ohnmacht. Da waren Flecken an ihrer Kleidung. Sie musste Eisentabletten nehmen. Sie legte sich ins Bett, und ihre Mutter sagte: O je. Eigentlich, erzählte sie, träume sie davon, sich die Hose auszuziehen und sich nackt auf die Erde zu setzen, denn in dem Fall wüsste sie, dass alles sicher aufgefangen würde. Das Mädchen hieß Maya, sie war meine Freundin und hatte ständig irgendwelche Schmerzen, doch sie wurde abgespeist und ignoriert und bekam zu hören, sie fühle das Falsche. Das macht der Schmerz mit einem Menschen. Der Schmerz legt den Vorwurf nahe, man bilde sich den Schmerz nur ein.
Selbst, wenn man nur den Mund aufmacht und sagt: Es tut weh.
Du sagst: Es ist in mir. Das Gefühl. Kannst du es dir vorstellen? Ich selbst stelle es mir natürlich nicht nur vor. Das ist der Unterschied zwischen uns.
Was ich damit sagen wollte: Maya hätte eine Schwangerschaft auf jeden Fall bemerkt. Ich glaube nicht, dass sie schockiert und überrascht gewesen wäre, ein Baby aus sich herauskommen zu sehen, nachdem es ihr neun Monate lang in den Darm getreten und auf der Blase gesessen hat. Ichdachte,ichhätteVerstopfung! ist kein Satz, den Maya gesagt hätte. Ich glaube, sie hätte eher so etwas gesagt wie Aaaauaaaa!, neun Monate lang.
Aaaauaaaa!
Manche Körper sind ein bisschen dumm. Andere sind laut, mitteilsam oder leicht verrückt. Einige Körper müssen sich ständig bemerkbar machen und haben immer etwas Neues. Oh nein, Juckreiz!
Aaaauaaaa!
Mein Körper war immer in Ordnung. Ich konnte immer ganz gut darin leben und mich bewegen. Na ja, manchmal sehe ich in den Spiegel und denke: Waaaas? Aber abgesehen davon: Sex, Essen und so weiter? Da ging es mir immer gut. Ich esse. Ich laufe. Ich liebe es, zu laufen, für mich fühlt laufen sich an wie fliegen.
Damit will ich auf eine umständliche Weise ausdrücken, dass ich mich mit 22 zum ersten Mal verknallt habe, und es war eine totale Überraschung. Anscheinend hatte das scheue Tier die ganze Zeit in mir gelauert; es hatte gestrampelt und gezappelt, aber ich hatte nichts von seiner Existenz geahnt.
Aaaauaaaa!
Ich spreche von »verknallen«, weil es den Vorgang technisch gut beschreibt. Da war keine Lücke, ich brauchte keine Übersetzung. Ich fühlte mich verstanden, verschmolzen. Ich war euphorisch.
Ich war 22, kam gerade vom College und wusste zu leben. Das möchte ich nicht vergessen. Mein Körper war nicht stumm gestellt. Ich wusste, wie man Sex genießt, isst, sich betrinkt und wieder davon erholt. Wie man sich selbst und andere berührt. Ich konnte tanzen, es ein bisschen übertreiben und tiefgründige, sinnlose Diskussionen führen. Süße nächtliche Sessions mit einem Mädchen, das ich mochte, oder mit einem Typen, den ich meistens nicht besonders mochte. Ehrlich gesagt erkenne ich da einen gewissen Widerspruch. Sex mit einem Mann fühlte sich immer ein bisschen wie kämpfen an; ich konnte mich verletzlich fühlen oder merken, dass ich in der Tat verletzt worden war, später, wenn der Kater einsetzte. Was ich im Moment fühlte, war schwer einzuschätzen. (Bin ich eine Masochistin? Ach, ich kann mich nicht erinnern.) In emotionaler Hinsicht waren es immer nur die Frauen, die mir zusetzten, besonders die mit der unterkühlten, verächtlichen Art, die sie überhaupt erst so anziehend für mich machte. Aber bitte.
Im Trinity College hatte ich eine tolle Clique. Wir fanden schon am fünften Tag zueinander. Ein Typ radelte über den gepflegten Rasen, den er eigentlich nicht einmal hätte betreten dürfen. Er trug einen langen Mantel und hatte Haare wie Lord Byron (sagte er). Lily, Shona und ich beobachteten ihn. Er hieß Malachy, unverkennbar schwul, unverkennbar lustig. Er setzte sich in unsere Nähe, und wir wussten, was zu tun war.
Weil sein Vater in der Immobilienbranche arbeitete, hatte Malachy eine eigene kleine Wohnung im Stadtzentrum, die wir im Laufe des ersten Studienjahres wie in Zeitlupe verwüsteten. Was aber nicht am Trinken oder an den von mir so heiß geliebten durchgemachten Nächten lag, sondern an den langen, leeren Tagen danach, wenn wir nach dem Frühstück bei ihm rumhingen und dünne, kleine Joints drehten. Und dann, kurz bevor wir die Kontrolle verloren, ergab plötzlich alles einen Sinn. Entweder wussten wir genau, was zu tun war – die Planetenficker vergangener Generationen hatten uns um unsere Zukunft gebracht –, oder wir fühlten uns am Ende, noch bevor unser Leben richtig angefangen hatte. Zwischen diesen beiden Polen schwankten wir. Der Traum, dass die dumme Menschheit sich überwinden und irgendwie vorankommen könnte, beziehungsweise dass wir unser Zuspätgekommensein überwinden könnten, schweißte uns zusammen.
Tschiddip, tschiddip.
Wenn ich sehr bekifft war, verbrachte ich viel Zeit damit, in das Vogelgezwitscher aus den immergrünen Bäumen vor Mals Fenster einzutauchen. Sechs riesige Kiefern mit rotem Stamm und ausladenden Ästen – die Wohnanlage hatten sie drum herumbauen müssen. Eine einzige dieser Kiefern kostete so viel wie drei Apartments. Die Natur als Museum. Wenn wir in der Betonbox hockten wie in einer verglasten Wabe und die wilden Vögel auf den windgeschüttelten Ästen beobachteten, erschienen uns die Bäume wie ein Vorwurf.
Irgendwann bildete ich mir ein, ich könnte die Vögel verstehen.
Fink, fink.
Pink, pink.
Quer-rer.
Skro.
Wenn ich traurig war, machte mir das bevorstehende Ende der Welt weniger Sorgen als mein Alltag, was aber vielleicht nur an meinem ganz persönlichen Angststil lag. Beispielsweise verfiel ich im College regelmäßig in Panik, sobald ich an den Ziegenmelker dachte, einen Vogel, der in Irland früher sehr verbreitet war und inzwischen fast ausgestorben ist. Der Ziegenmelker ist ein kleines, unscheinbares Tier und sieht aus wie ein Kiefernzapfen mit riesigen Nachtsichtaugen. Sein gesprenkeltes Gefieder ist perfekt an die Borke eines bestimmten Baums angepasst, einer der Gründe dafür, dass man den Ziegenmelker praktisch nie sieht. Der andere Grund ist, dass es, wenn man ihn theoretisch sehen könnte, meistens schon dämmert. Der dritte Grund für die Unsichtbarkeit des Ziegenmelkers: Er ist nicht da, beziehungsweise nicht mehr. Es sind fast keine Exemplare mehr übrig. Die letzte Sichtung ereignete sich auf der Inchy Bridge in Timoleague, einem arttypischen Lebensraum, wo »ein Männchen an drei Abenden zwischen dem 1. und dem 8. Juni 2012 bei der Insektenjagd beobachtet wurde«. Jedenfalls ernährte sich der kleine Zugvogel von in der Dämmerung erbeuteten Insekten, aber nun sind die Insekten und damit auch sein Lebensraum verschwunden. Sein Gesang klingt wie eine ferne Nähmaschine, die mal langsamer und mal schneller rattert.
Tschurr. Tschirr.
Dicker Stoff, dünner Stoff.
Dicker Stoff. Dünndünn.
Weil ich, statt im Hügelvorland der Knockmealdown Mountains unter einer Tarnplane zu frieren, nur im Internet recherchiere, schlägt meine Traurigkeit über das Schicksal des Ziegenmelkers schnell in Interesse an Rabenkrächzen um, welches angeblich ein Territorium markiert. Wenn es heiser klingt, signalisiert es Ärger. Ich würde gern ein Lexikon der Vogellaute schreiben. Ich könnte beim Wort »Syrinx« anfangen, das den unteren Kehlkopf der Vögel bezeichnet, jenes Organ, das winzigen Wesen einen Höllenlärm entlockt.
Der Ziegenmelker ist übrigens eine Art Bauchredner. Er kann es so klingen lassen, als käme sein Gesang von einem anderen Baum. Sich mit einem Ziegenmelker zu paaren, wäre sicher sehr verwirrend. Man würde ziemlich viele falsche Bäume ansteuern.
So viel zu mir. Ich sehe mir einen Videoclip über sprechende Raben an, obwohl meine Freundin Lily sich um das Wiedererstarken des Faschismus sorgt, und während meine Freundinnen am Sturz des Patriarchats arbeiten, beweine ich das traurige Schicksal der Bienen. Später, wenn ich bekifft bin, spiele ich Videos von Schnecken beim Sex ab und drehe den Ton extra laut. Ich sage meinen Freundinnen, sie wären auf den Mann fixiert, ganz im Gegensatz zu mir, die nicht auf den Mann fixiert ist. Ihnen geht es um Herrschaft, mir um Wurzeln und Fühler. Sie verfolgen die Überwachungskultur, ich verfolge das Wetter.
Ich war in Sorge um den Ziegenmelker, diesen winzig kleinen Herzensbrechervogel, und für sehr lange Zeit war das alles, was ich an Angst ertragen konnte.
Also.
Sein Name ist Felim. Er lebt in Dublin, aber aufgewachsen ist er auf dem Land. Seine Mutter betet jeden Abend einen Rosenkranz, was ich verwunderlich fand und auch sehr lustig, bis er mir sagte, es sei kein bisschen lustig.
Aber das kam erst später. (Übrigens waren Felims Vorwürfe ausnahmslos berechtigt. Das muss ich vorausschicken.)
Felims Mutter ist also gläubig, sein Vater bewirtschaftet den Hof. Felim wurde mit Sodabrot und Speck groß, auf Socken misst er knapp über eins neunzig, er ist durchtrainiert vom Futtersackschleppen und führt auf Partys seinen besonderen Trick vor: Er hebt die Leute am Kopf hoch. Tatsächlich haben wir uns so kennengelernt. Ich war mit meiner Freundin Lily in einem Club, wo er sie am Kopf in die Höhe hob und wieder absetzte, und ich tippte ihm auf die Schulter und wollte die Nächste sein. Er musterte mich, drehte mich um und legte mir, während er hinter mir stand, seine Hände ans Kinn. Seine Daumen umklammerten meinen Nacken, und dann spürte ich, wie meine Wirbelsäule auseinandergezogen wurde und meine Füße den Bodenkontakt verloren. Es fühlte sich an wie ein Ritual, wie eine Initiation. Es war berauschend. Nach der Landung kicherte ich so schüchtern wie ein verklemmtes Schulmädchen.
Ich rief über die Musik hinweg: Willst du mich hochnehmen, oder was?
Was?
Willst du mich hochnehmen, oder was?
Ich versuchte, draußen in der großen weiten Welt zurechtzukommen, was aus irgendeinem Grund erforderlich machte, dass ich viel zu Hause blieb. Vormittags lag ich im Bett, tippte auf dem Laptop herum, surfte im Internet und hielt mich an die Deadlines der Agentur. Eine von Lilys Londoner Freundinnen hatte mir den Job besorgt. Ich produzierte Content am laufenden Band und versuchte nebenher, mir eine Twitter-Followerschaft aufzubauen, obwohl fast alle meine Bekannten zu Instagram umgezogen waren. Die Bezahlung war furchtbar schlecht. Hauptsächlich verfasste ich Reiseberichte von Orten, an denen ich nie gewesen war. Während ich in den grauen Himmel über Dublin blickte, strömte es nur so aus mir heraus: Das zwischen dem touristischen Bali und dem Hipsterparadies Gili Trawangan gelegene Nusa Lembongan ist ein echter Geheimtipp. Die Agentur ködert mich immer wieder, so bin ich auch zu den Storys über Yoga-Retreats und Wellness gekommen, die ich für eine Schauspielerin/Eco-Influencerin namens Meg schreibe. Mein Ton hat ihr so gut gefallen, dass sie mehr wollte: Texte über Sonnenschutzmittel und den Planeten, den Unterschied zwischen Panamahüten aus Sisal und aus Papier, Palmöl in Feuchtigkeitscreme, Silikone in Augenpflege. Für ihre Maltipoos habe ich einen laufenden Dialog entworfen – eine echte Mini-Hunde-Soap. Es klingt spaßig, fiel mir aber überraschend schwer.
– Schnauze voll.
– Aber echt.
Außerdem habe ich versucht, eigene Sachen zu schreiben und allein zu wohnen, was ganz gut klappte, weil ich immer wieder an den riesigen, stets gefüllten Kühlschrank meiner guten alten Ma zurückkehren konnte. Ich liebe sie wirklich sehr, aber leider mussten wir feststellen, dass eine junge Frau wie ich irgendwann ein eigenes Zuhause braucht.
Meine Mutter Carmel ist sehr pragmatisch veranlagt. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber für sie gibt es das Problem entweder, oder es gibt das Problem nicht. In allen anderen Fällen heißt es: Das bildest du dir nur ein.
Für meine Freundin Maya hatte sie zum Beispiel nie Verständnis. Nicht, als wir klein waren. Ja, sie war nett, sie war immer höflich, sie bot uns Eiscreme an (die Maya ablehnte), aber sobald Maya von ihrer Mutter abgeholt worden war und die Tür hinter ihnen ins Schloss fiel, verdrehte meine Mutter demonstrativ die Augen.
Dieses Kind, sagte sie.
Ich fragte: Was?
Sie mag kein Eis?
Sie bekommt davon Zahnschmerzen.
Wie bitte?!
Meine Mutter ist der Überzeugung, dass einem alle Probleme erspart bleiben, solange man nicht zu viel über sich nachdenkt. Wer Schmerzen hat, kreist zu sehr um sich selbst; der Schmerz ist nur ein nachgeordnetes Symptom beziehungsweise eine Allergie, eine Unverträglichkeit oder gar eine Einbildung. Eine Allergie würde sie einem Menschen erst dann zugestehen, wenn er einen anaphylaktischen Schock erleidet und zum Epi-Pen greifen muss. Genauso wenig glaubt sie an Lebensmittelunverträglichkeiten, fast so, als wäre Glaube in dieser Frage der alles entscheidende Faktor. Wer solche Probleme hat, verdient es ihrer Meinung nach nicht besser. Die meisten Leiden sind nur erfunden, denn die Leute haben »zu viel Fantasie«.
Manchmal treibt sie mich wirklich zur Weißglut.
Sie anzuschreien, ist ausgeschlossen. Maya schrie ihre Mutter Bronagh ständig an. Für mich war das, als würde man mitten auf den Wohnzimmerteppich kacken (nicht richtig, aber irgendwie verlockend).
Nein. Wenn Carmel angeschrien wird, gehen die Lichter aus, eins nach dem anderen. Es ist wie ein Stromausfall in Manhattan.
Trotzdem habe ich damals natürlich alles in Schutt und Asche gelegt.
Ich habe geschrien, sie hat zurückgeschrien, und dann sind wir durch die dunkle Großstadt geirrt wie eine alte Dame, die ihren kleinen Hund sucht, und in der Ferne heulen die Sirenen, tatü, tata.
Nein.
So sehr ich meine Mutter und ihren fantastischen Kühlschrank, die Heizung, die Kaffeemühle mit ganzen Bio-Bohnen auch liebe; so sehr ich es auch liebe, dort auf dem Sofa zu liegen und zu lesen, während sie sich grunzend über ihr Sudoku beugt – ich musste da raus.
Der sentimentale Teil von mir wusste natürlich, was ich ihr antat, als ich meine Sachen in den Kofferraum lud und damit ihr Herz brach. Als ich sie nötigte, mich zu einem feuchten Zimmer in einer heruntergekommenen Straße am anderen Ende der Stadt zu fahren, dessen einziger Pluspunkt darin bestand, dass sie dort nicht war. Ich würde unter die Räder kommen. Ich war immer so brav gewesen, hatte alles getan. Und jetzt wollte ich unter einer Hecke schlafen und im Regen aufwachen?
Eigentlich wollte ich diese blöde, überteuerte Stadt verlassen, ich wusste aber noch nicht, wie, also zog ich in ein Haus in Ballybough, das der toten Oma irgendeiner Freundin gehört hatte. Zuerst wohnte ich dort mit Lily und später, als sie nach London gezogen war, mit ihrem Freund Stuart und einem dritten WG-Mitglied, das im halben Zimmer untergebracht wurde. Im Internet sah ich lichtdurchflutete Wohnzimmer mit Topfpflanzen, die größer waren als unsere Küche. Irgendwann wirkten sogar die Backsteinfassaden unserer Straße kuratiert, und ich bekam das Gefühl, durch ein fremdes Leben zu scrollen. Ich scrollte und scrollte.
Zwischen dem Hochnehmen im Club und unserer zweiten Begegnung verstrichen mehrere Wochen. Ich sah Felim vor einem Kiosk am Flussufer wieder. Ich stand gerade an der Kasse an, er betrachtete die Zeitschriften im Ständer. Dass er darin stöberte, erschien mir ganz normal und dann plötzlich seltsam – wer blättert in Papierausgaben? Bis zu dem Moment hatte ich mir nicht mal klargemacht, dass man so etwas kaufen konnte. Felim schlug die Zeitschrift zu und stellte sie in den Ständer zurück. Die Titelseite zeigte ein rotes Cabrio, die Fingerabdrücke auf dem Hochglanzpapier wirkten irgendwie traurig.
Es war ein Samstag im Sommer. Ich weiß nicht mehr, was ich getan hatte, bevor ich mich mit einer Wasserflasche in die Warteschlange einreihte. Nichts wies darauf hin, dass ich mit ausgebreiteten Armen auf eine Klippenkante zulief. Ich war 22. Ich fühlte mich unattraktiv und einsam, das waren die Katastrophen, unter denen ich litt. Auf keinen Fall stand die Katastrophe dort drüben und blätterte in Classic Car.
Corvette mal oben ohne.
Felim sah ehrlich aus, beziehungsweise sah er aus, als wäre ehrlich zu sein genau sein Ding. Und ehrlich war, was ich wollte. Es war auch mein Ding.
Neulich habe ich mir noch mal durchgelesen, was mir während jener Wochen und Monate durch den Kopf ging. In jenem schrecklichen, verschimmelten Haus verlor ich die Kontrolle über mein Leben, und nebenbei ging ich aus und ließ mich in Clubs am Kopf hochheben. Mal lebte jetzt auf Instagram und postete Foto um Foto. Sein langer Schatten im Gras, sein gekrümmter Schatten an einer Hauswand, sein Schatten auf dem Wasser. Ich versuchte, Gedichte zu schreiben – auf Papier, weil ich glaubte, echtes Papier würde sie zu echten Gedichten machen. Nebenbei sammelte ich für eine Frau, die seit vielen Jahren nicht mehr Bus gefahren war, »Sachen, die man im Bus zu hören kriegt«. Ich ging ihre Maltipoo-Fotos durch und dachte: Wäre doch nur einer davon ein Jack Russell! Unendliche Möglichkeiten.
Um mich inspirieren zu lassen, sah ich mir Videos von Tierbegegnungen an. Ein Kätzchen springt heran und will mit einer friedlich trottenden Henne spielen. Ein riesiges Kaninchen kuschelt mit einem kleinen Hund. Ein Schwan wird aus dem Sack gelassen und schießt über den Teich zu einem anderen Schwan. Sie verrenken ihre Hälse zu einem Herz. Menschen interessierten mich weniger, es sei denn, sie trugen Uniform – Mütter, die aus dem Irak zurückkehren, Väter in Kandahar. Die spirituelle Präzision der aus dem Krieg heimkehrenden Särge ließ mich ergriffen innehalten.
Ich glaube, dass ich in meiner kleinen Kummerblase in Ballybough nach dem Gefühl der aufsteigenden Tränen süchtig wurde. Nach diesem kleinen Schmerz im Augapfel. Es kam nie viel Flüssigkeit heraus. Normalerweise absorbierte ich die Tränen wieder, durch irgendeinen winzigen, innerlichen Abfluss.
Wenn ich richtig und ausgiebig heulen wollte, wenn ich Tränen wollte, die mir über die Wangen liefen, sich unterm Kinn sammelten und erkalteten, sah ich mir Videos von Cochlea-Implantationen an. Ein fantastisches Subgenre. Ein kleiner tauber Junge (es ist fast immer ein Junge) bekommt ein Hörgerät eingesetzt, das durch den Schädelknochen mit dem Gehirn verbunden ist, und dann hört er zum ersten Mal die Stimme seiner Mutter.
So etwas rührte mich zu Tränen. Ich weinte ungehemmt und immer wieder. Jedes Mal, wenn ich mir den Clip ansah, legten meine Tränendrüsen an derselben Stelle los, bis auf die Millisekunde genau.
Der Junge hebt den Kopf
Tränenanfrage
Etwas regt sich in seinem Gesicht
Tränen bestätigt
Er dreht sich um
Flüssigkeitsanstieg
Er zeigt
Zu voller Größe anschwellender Tropfen
Die Mutter reagiert
Ausgiebige Tränenfreigabe
Bevor ihnen das Implantat seitlich in den Schädel geschoben wurde, waren einige dieser Kinder komplett taub. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, erfährt ihr Gehirn zum ersten Mal ein Geräusch, was immer das ist. Mit weit aufgerissenen Augen hören sie die Stille im Raum, ganz anders als die Lautlosigkeit, in der sie ihr Leben zugebracht haben. Diese Stille kann man hören. Dann plötzlich Stimmen. Die Ärztin oder die Mutter spricht: Hallo, oder: Ich habe dich lieb, oder: Hey, Thomas. Hey, kleiner Kerl. Manche Kinder erkennen die Stimme – jetzt schon! – und drehen sich um. Es ist, als hätten sie immer gewusst oder immer gehofft, dass sie da ist.
Und ihre Gesichter verraten eine Offenbarung. Eine vollumfängliche Bestätigung.
Ja!
Mutter!
Was ist das? Warum können sie eine Stimme erkennen, ohne zu wissen, was – oder wer – eine Stimme ist? Schallwellen in einer Tischplatte? Die im Mutterleib gespürten Vibrationen?
Was mich dazu bringt, mit einem echten Stift auf echtes Papier zu schreiben: Offenbarung bedeutet, etwas zu verstehen, für das wir erschaffen wurden; wir waren lediglich noch nicht eingeschaltet.
Das war ich. Ich schrieb in ein apfelgrünes Notizbuch von Moleskine, von dem ich hoffte, es würde sich gut auf Insta machen, und anschließend legte ich mich wieder in einem alten Schlafsack auf das fleckige Sofa in der WG in Ballybough, starrte auf den Bildschirm und wartete auf eine Offenbarung.
Das Gesicht des Jungen, der noch kein Implantat bekommen hat, ist auf friedliche Weise verschlossen. Dieser kleine Mensch hört sich selbst nicht lachen, er weiß auch nichts vom Klopfen seiner Schritte auf dem Fußboden. Es gibt kein Echo. Er lebt in einer Welt ohne klangliche Spiegel und wirkt seltsam perfekt und unnahbar, wie eine Statue. Er ist so absolut unbefangen, dass man ihm fast wünscht, nichts würde sich je ändern.
So fühlte es sich an, als ich Felim zum zweiten Mal sah. Auf einmal eröffnete sich eine neue Dimension der Stille, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Es passierte vor einem Kiosk am Flussufer, wo seine breiten Schulterblätter sich unter dem hellblauen Baumwollshirt bewegten wie Flügel. In der Sekunde, als sein Blick meinen traf, streckte die Zukunft eine Hand nach mir aus, und darin hielt sie ein Messer.
Achtung, jetzt komme ich.
Und auch: Eine Autozeitschrift? Im Ernst?
Ich bezahlte die Plastikwasserflasche, drehte mich um und rammte meinen gesenkten Kopf in sein Brustbein.
Hey, sagte er.
Oh, hey.
Lily ist nach London umgezogen?
Oh, ja, sagte ich, sie postet ständig irgendwelche Sachen.
Am nächsten Tag die Anfrage, unmittelbar gefolgt von einem wenige Monate alten Foto, das Lily und mich bei einer After-Show-Party zeigt.
– Die guten alten Zeiten
Hatte er uns gestalkt? Der Gedanke, dass er vor mir gestanden und ich ihn womöglich nicht einmal bemerkt hatte, macht mich ganz kurz sprachlos. Warum hatte er uns fotografiert? Vielleicht war er wegen Lily dort gewesen.
– Nein!! NEIN!! Er war mit der aus Belfast da.
Ich schreibe ihm schnell zurück. Danke, vermisse sie sehr!
Immer locker bleiben. Er antwortet mit Marlene Dietrichs »Lili Marleen«.
Ich schicke ihm das Meme von Disaster Girl, dem kleinen Mädchen, das in die Kamera lächelt, während im Hintergrund ein Haus abbrennt. Die Bildunterschrift: Schlimme Sachen passieren, wenn du Lily traurig machst.
Er lacht – Ha, ha.
Danach Stille. Für einen Tag, für zwei.
Dann spätabends ein Song von Betty Davis, die er immer nur Miles Davis’ erste Ehefrau nennt. Ich würde darüber lachen, wäre die Musik nicht so atemberaubend. Eine echte Entdeckung, ein Geschenk. Der Song heißt »Nasty Gal«.
– Leicht übertrieben.
– Nasssty.
Das schrieb er mir an einem Dienstagabend um halb elf.
Ich weiß noch, wie ich mich fragte, wo er gerade war und warum er ausgerechnet in dem Moment an mich denken musste. Ich stellte mir ihn vor, wie er sich zu Hause bettfertig macht, oder auf einer langen Zugfahrt. Der Regen klatscht an die Fensterscheiben des Abteils. Oder vielleicht saß er allein in einer Bar.
Ich machte mir Sorgen, ich könnte zu schnell geantwortet haben.
Keine Reaktion.
Eine Woche später: Gehst du zu Alice?
– Wer ist Alice?
– Dachte du kennst sie.
Wir begegnen uns in einer fremden Küche und unterhalten uns hauptsächlich über Musik. Es ist später Nachmittag.
Du bist wirklich intelligent, sagt er. Hörst du das oft?
Und dann gehen wir zu ihm nach Hause, weil er mir seine Plattensammlung (!!) zeigen will. Zwanzig Minuten später liegt Betty Davis auf seinem Plattenspieler und ich in seinem Bett, wo es an diesem ansonsten eher ereignislosen Tag zu einem innigen, ausgelassenen Intermezzo kommt.
Oh, ja. Dies und das, Muskeln unter Haut, seine leicht hässlichen Füße (macht nichts), seine körperliche Fitness, sein Timing und das Licht, oh, dieses Licht. Das erste Mal ist oft holperig, wie durchchoreografiert, und beide geben sich hilfsbereit und höflich.
Danach blieben wir noch eine Weile liegen, und später gab es Toast mit Erdnussbutter und ein paar Dosenbiere. Wir stiegen aus dem Bett, um die Krümel von der Matratze zu wischen. Ich versteckte mich hinter der Tagesdecke, er hielt sich eine Hand vor den Schritt, während die andere energisch über das Laken strich. Wir hatten noch mal Sex, und ich blieb über Nacht. Im Morgengrauen wachte ich neben ihm auf und sah ihm beim Schlafen zu. Seine vollen Lippen waren entspannt, die Luft glitt in seinen Körper hinein und wieder heraus. Von seinen braunen Locken stand ein einzelnes Haar ab und glühte im Gegenlicht.
Plötzlich stockte sein Atem, er öffnete die Augen und bemerkte mich.
Guten Morgen, sagte ich.
Und dann suchte ich meine Sachen zusammen wie ein braves Mädchen, lehnte den angebotenen Kaffee ab und ging.
Worüber haben wir in jener ersten, langen Nacht geredet?
Ich glaube, die meisten Leute hören gar nicht zu; sie warten nur, bis sie endlich wieder an der Reihe sind. Aber ich hörte ihm zu, und er mir.
Ich fragte ihn nach seinem Zuhause, nach seinen Geschwistern, und wie so ein landwirtschaftlicher Betrieb funktioniert. Er hatte einen großen Bruder. Seine Mutter betete jeden Abend einen Rosenkranz. Als er das sagte, lachte er, und ich lachte mit. Ich fragte nach den Kühen. Damals interessierte ich mich für Kühe, ich hatte nämlich irgendwo gelesen, sie seien überzüchtet und deshalb gefährlicher als früher. Ihre Euter, viel zu groß für den Körper, schleifen über den Boden und entzünden sich. Wir haben nur Zuchtvieh, sagte er.
Du meinst, zum Schlachten?
Ja.
Ich erzählte ihm von der Autistin, die Schlachthöfe entwirft. Sie wollte Schlachthöfe weniger grausam gestalten und erfand eine spiralförmige Rampe, auf der die Kühe sich sicherer fühlen; sie können nicht sehen, was sie am Ende erwartet.
Du weißt ja ziemlich viel über Kühe, sagte er.
Hauptsächlich wegen des Methans, sagte ich.
Eigentlich hegte ich romantische Vorstellungen von Heuernte, Kälbern und Sonnenschein, und alles davon passte zum Duft seiner Haut. Felim wirkte so gesund, als könnte ihn zu berühren heilsam sein – diesen irren Gedanken hatte ich. Dabei interessierte ich mich wirklich fürs Landleben. »Der zerteilte Wurm vergibt dem Pflug«, zitierte ich William Blake, woraufhin sein Gesicht sich erhellte – Lyrik war er, das merkte ich sofort, nicht unbedingt gewohnt.
Ich habe schon lange nichts mehr beackert, sagte er. Nichts außer Frauen.
Es war ein Witz über Sex, und ich lachte.
Er erzählte von seinem Job. Er schien mit der Zimmerdecke zu reden, und irgendwann verstummte er. Ich sah seinen Adamsapfel zucken.
Ich dachte immer, fuhr er fort, dass ich irgendwann in Montana oder so landen würde. Nicht in diesem Schuhkarton. Ich bin quasi im Freien aufgewachsen, und mich hier einzupassen, fällt mir schwer. Ich dachte immer, irgendwann baue ich mir was Eigenes auf.
Er drehte sich zu mir um und hatte Tränen in den Augen. Wir rückten wortlos aufeinander zu, und ich dachte: Mein Herz, oh, mein Herz. Das zweite Mal war traurig und ein bisschen hektisch. Zwischendurch eine Leere, als nähme er am falschen Rennen teil. Danach hatte ich das Gefühl, dass wir etwas Schwieriges bewältigt hatten. Ich lag neben ihm und berührte ihn nicht, abgesehen von meinem Fußrist an seinem Schienbein.
Vor dem Einschlafen zeichnete er mit dem Finger eine Spirale auf meine Hüfte. Er erzählte, dass sie auf einem ihrer Äcker einmal einen Stein gefunden hatten, der jetzt im Magazin irgendeines Museums lag. Sein Urgroßvater hatte den Stein auf dem Hausacker aus der Erde gepflügt, er war graviert wie die Gräber von Newgrange, wobei die Steine dort eine Dreifachspirale trugen und ihr Stein eine einfache. Felim hatte den Stein in die Schule mitgenommen und seiner Lehrerin gezeigt, die ihn nach Dublin schickte. Er sah ihn nie wieder.
Auf dem Hausacker?, fragte ich.
Warum fragst du?
So nennt ihr das?
Weil es ein Hausacker ist, sagte er, und ich fand die Antwort ganz wunderbar.
Ganz schön viel los im County Meath.
Eigentlich heißt es Louth.
Ich wiederholte seine Worte lächelnd und streichelte sein Gesicht.
Eigentlich heißt es Louth.
Am nächsten Morgen das übliche Beachte-mich-gar-nicht, es war nur Sex. Ich lehnte den angebotenen Kaffee ab und zog mich im gebotenen Tempo an, während er seinen Tag begann. Als ich aus dem Bad kam, stand er an der Küchenzeile und schlug ein Ei in die Pfanne. Ich strahlte ihn an, Okay, ich muss dann mal los, und er antwortete wie ein Gentleman: Das hat Spaß gemacht, lass uns das wiederholen, ja?
Klar!
Immer dieselbe Qual mit dem Riegel. Der Wunsch, sich an die Tür zu lehnen, sobald das Schloss einrastete und sie wieder fest verschlossen war.
Fest verschlossen.
Drinnen in der Wohnung ging sein Leben weiter. Er nahm den Toast aus dem Toaster, tunkte den Teebeutel in einen Becher mit kochendem Wasser, ließ das Ei auf einen weißen Teller rutschen. Er setzte sich an den kleinen Tisch, warf einen Blick aufs Handy, stach mit der Gabel ins Eigelb. Aß einen Happen.
Als ich durch den Korridor zum hallenden Treppenhaus lief, als ich die Treppe hinunterstieg und die Glastür zur Straße aufschob, war ich noch nicht verliebt.
Es passierte auch nicht unter seinem Fenster, wo mich sein Blick womöglich streifte. Es passierte, sobald ich um die Ecke und außer Sichtweite war. Peng. Ich war verliebt. Ich blieb stehen, starrte zu Boden, ging weiter und wurde von einer selbstgenügsamen, stillen Freude erfüllt. Liebe! Peng. Im Bus noch einmal, Peng!, und auch, als ich aussteigen wollte, mich von meinem Platz erhob und alles abermals freigesetzt wurde, der Knall, das heimliche Entzücken. Plötzlich war die Straße bedeutungsvoll, PENG, es passierte wieder und wieder und steigerte sich noch – das Wissen, die Schönheit, die Hoffnung. Meine Füße berührten den Boden nicht, meine Wangen spürten keinen Wind, die Liebe, das Schwanken und Torkeln, das Blutrauschen in meinen Ohren, das Jeden Moment, das Er wird jeden Moment anrufen, die Schönheit des Tages, die Schönheit des Himmels, der Ruck der verpassten Zeit, hatte ich etwas verpasst? Hatte er geschrieben? Ist der Akku leer? Habe ich aus Versehen ein fremdes Handy eingesteckt? Wenn ich fünf Elstern und drei gelbe Mini Cooper sehe, wenn ich jedes Horoskop lese, wird er mich anschreiben lieben anrufen. Die geschlossenen Vorhänge der ausbleibende Anruf die ausbleibenden Nachrichten das Noch nicht Noch nicht die Liebe die Liebe die Liebe.
Ich verbrachte Stunden damit, in Gedanken seine Wohnung zu rekonstruieren und mir vorzustellen, wie er sich darin bewegte; das weiße Schlafzimmer mit dem weiß furnierten Kleiderschrank und der Lampe mit dem weißen Papierschirm. Ich sah ihn um zwei Uhr morgens, wie er sich auf dem Weg zur Toilette nach den Shorts vom Vortag bückte, um sich zu bedecken. Mich selbst, wie ich dort lag und mich fragte, ob seine muskulöse Statur seinen Schwanz kleiner wirken ließ oder ob er tatsächlich klein war. Denn in mir hatte er sich angefühlt wie aus einer anderen Kategorie. In mir war er ein Ereignis gewesen.
Da draußen eher nicht.
Der Sarkasmus hörte nicht auf. In den darauffolgenden Monaten hörte ich in meinem Kopf eine lästige, zirpende Stimme, die die vielen Unzulänglichkeiten des Mannes kommentierte. Und es gab nichts zwischen diesem furchtbaren Sarkasmus und:
Auaaaaaaaa.
Entkräftung.
Schweigen.
Wir liefen durch die Stadt. Er sagte, ich mag es, wie du den Himmel liest, meine Mutter hat für das Wetter überhaupt kein Gespür, sie muss immer wieder zur Wäscheleine rennen wie eine Irre und ist jedes Mal überrascht. Ich meine, wie lange muss man ihn sich ansehen? Aber Regen … Scheiße, der Regen hält einen vom Denken ab, und das ist doch gut.
Er berührte mein Gesicht und sagte: Du verbringst viel Zeit mit Hinsehen.
Er küsste mich, und dann machten wir dort auf dem Gehweg rum, während sich an der roten Ampel Passanten sammelten, die Straße überquerten, erneut sammelten.
Roter Mann. Grüner Mann. Rot.
Folgende Symptome können auftreten, wenn ein Mensch vom Blitz getroffen wird: Verwirrtheit, Krampfanfälle, Benommenheit, Muskelschmerzen, Taubheit, Kopfschmerzen, Erinnerungsverlust, Unkonzentriertheit, Persönlichkeitsveränderung, chronische Schmerzen.
Manche – meistens Amerikaner, meistens aus dem Mittleren Westen – behaupten, sie hätten durch den Blitzschlag neue Fähigkeiten erlangt. Ein Mann konnte angeblich das Wetter vorhersagen und den kommenden Schnee in den Knochen spüren. Manchmal brannte, wenn er durch einen Flur ging, über seinem Kopf die Glühbirne durch. Ein anderer konnte plötzlich Klavier spielen. Ein dritter erzählte, er könne mit Tieren reden und ihre Antworten verstehen.
So war das nicht, als ich mich verliebte.
Es war ähnlich, aber anders.
Tschiddip, tschiddip.
Quer-rer
Türü
Am Wochenende besuchte ich Carmel zum Sonntagsessen, und er fuhr zum Hof seiner Eltern in Louth. Ich konnte es mir deutlich vorstellen: wie seine fromme Mutter den Kopf senkt, bevor sie zum Besteck greift; die ruhig grasenden Rinder auf der Weide vor dem Haus, während er auf einem Supermarktsteak herumkaut. Ich saß unterdessen in einträchtigem Schweigen mit Carmel zusammen. Es gab Blumenkohlcurry mit Käse und zum Nachtisch Toffeepudding. Essen, von dem meine Mutter glaubt, dass ich es mag. Und sie hat recht, denn wenn ich sie besuche, esse ich diese Sachen tatsächlich. Zu Hause ernähre ich mich von Krautsalat und Chips. Weil ich Vegetarierin bin.
Wie geht es dir?
Ganz gut.
Du siehst ein bisschen blass aus.
Bei mir und meiner Ma geht es meistens still zu. Wir sitzen in einem magischen Kreis – die Duftkerzen beweisen es –, während sich die Welt da draußen selbst zermürbt.
Wirklich?
Geht es dir gut?
Mir geht es super.
(Ich erzähle meiner Mutter nie etwas, ich bin doch nicht dumm.)
Sicher?
Man kann Carmel nicht sagen, dass man ein Problem hat, weil sie dann nämlich losgehen und jemanden zusammenschlagen würde. Meine Mutter ist eine Frau, die, wenn man fünf Jahre alt ist, am Strand zu dem Jetski-Typen rübergeht und brüllt: Was fällt dir ein, mein Kind mit dieser blöden, hässlichen Maschine zu erschrecken? Sie ist die Frau, die bei der Schulbehörde anruft, weil die Irischprüfung zu schwer war (im Ernst). Sie ist, Gott segne sie, eine Kämpferin und Kreuzritterin. Wird man im Bus von einem alten Perversen begrapscht, besorgt sie sich die Aufnahmen aus der Sicherheitskamera und verklagt das Busunternehmen, ruft die Polizei und meldet dich zur Therapie an, und dann geht sie los und steckt das Haus des Täters in Brand.
Also erzähle ich Carmel nichts, auch nicht das von dem Perversen im Bus. Ich stehe einfach auf und suche mir einen anderen Platz.
Das ist köstlich, wirklich, Mama. Was ist das Grüne? Frühlingszwiebel?
Rate mal.
Sag es mir einfach.
Ha!
Ist es Lauch?
Wenn wir sonntags in der Küche sitzen und darauf warten, dass der Ofentimer piept und der Toffeepudding fertig ist, verschweige ich, dass ich in meiner WG in Ballybough an manchen Tagen weder aufräume noch dusche, und die Pflanzen gieße ich so gut wie nie. Ich verschweige, dass mein Job eigentlich kein richtiger Job ist (o mein Gott, wie viele Pflanzen ich schon umgebracht habe) und dass ich im Vollsuff Gedichte schreibe, bis der Kuli das Papier durchsticht.
Schon gar nicht erzähle ich ihr von Felim.
Das ist wirklich hübsch.
Mitten auf dem Tisch steht ein flaches, überbordendes Gesteck aus Wildblumen.
Riech mal!
Oh, wow.
Das sind die Wicken.
Und, was ist bei dir los, Mama? Was macht die Arbeit?