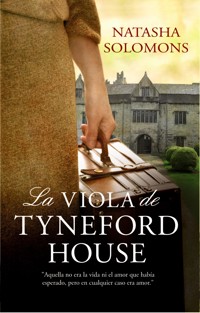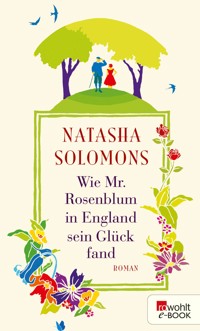10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
»Eine grandiose Neuerzählung der Geschichte von Romeo und Julia« William Boyd Als Romeo Montague die junge Rosaline Capulet zum ersten Mal sieht, ist er sofort verliebt. Die freiheitsliebende Rosaline wiederum ist empfänglich für Romeos Avancen, denn nach dem Tod ihrer Mutter will ihr Vater sie ins Kloster schicken. Romeo bietet ihr die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Doch nach und nach beginnt Rosaline an seinen Versprechungen zu zweifeln. Da richtet sich Romeos Blick auf ihre Cousine, die dreizehnjährige Julia. Allmählich begreift Rosaline, dass nicht nur ihre Zukunft auf dem Spiel steht, sondern Julias Leben. Eine subversive, kraftvolle Nacherzählung von Shakespeares bekanntester Tragödie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Rosaline Capulet ist jung und liebt die Freiheit. Doch nach dem Tod ihrer Mutter sieht sie ihre Chance auf ein selbstbestimmtes Leben dahinschwinden. Der Vater will sie ins Kloster schicken. Umso verlockender erscheinen ihr die Avancen des schönen Romeo Montague, der sie auf Händen trägt. Doch nach und nach beschleichen Rosaline Zweifel an seinen Versprechungen. Als sich Romeos Blick ihrer dreizehnjährigen Cousine Julia zuwendet, wird Rosaline klar: Hier steht sehr viel mehr auf dem Spiel als nur ihr persönliches Glück.
Kann sie Julia vor Romeo retten?
Natasha Solomons
Rosaline
Roman
Für meine Schwester Jo und meine Tochter Lara – möget Ihr vor Romeos bewahrt bleiben.
Mit Rosalinde? … Ich kenn den Namen nicht. Wer soll das sein?
Romeo und Julia, II. Akt, 3. Szene
1. Kapitel
Wo schwer die Pest umgeht
Das Begräbnis fand im Morgengrauen statt, kaum eine Stunde, nachdem Madonna Emelia Capulet diese Welt verlassen hatte. Rosaline folgte der Totenbahre. Sie war untröstlich wegen des erlittenen Verlusts. Mehrfach mussten ihr Vater und ihr Bruder sie ermahnen, mehr Abstand zu wahren, denn auch im Tod war ihre geliebte Mutter noch ansteckend. Die Pest hatte sie dahingerafft.
Die einzigen Träger, die sie gefunden hatten, um die Bahre zu ziehen, waren dreckige, stinkende Gesellen. Sie waren nicht besser als Bettler und hatten mit einer lächerlich hohen Summe bestochen werden müssen. Man hatte Rosaline verboten, den Körper zu waschen. Ein Priester war gekommen, ein Kräutergebinde an den Mund gepresst. Er hatte heiliges Wasser auf das Gesicht der Verstorbenen gespritzt, ehe er wieder fortgeeilt war.
Die Zeit hatte nicht ausgereicht, um ein gold- oder purpurfarbenes Leichentuch für sie aufzutreiben. Niemand stimmte die Totenklage an. Keine Verwandten versammelten sich im Haus oder folgten der Familie zur Grabstelle. Die Gruppe der Trauernden war erbärmlich klein, die anderen Capulets und die Nachbarn versteckten sich hinter verschlossenen Türen, wo sie an Blumensträußchen und Orangen rochen, die mit Gewürznelken gespickt waren, um die Pest abzuhalten, und murmelten krampfhaft Gebete und hastig Bekenntnisse.
Nur Rosaline, ihr Vater, der laut vernehmlich weinte und sich schwer auf Rosalines Arm stützte, und ihr Bruder Valentio waren anwesend.
»Du hast mehr verdient«, murmelte sie ihrer Mutter zu.
Einer der Träger blieb abrupt stehen, um sich die Flohstiche in seinem Schoß zu kratzen. Ungeschickt hantierte er und ließ dabei den Griff der Bahre los.
»Du Trottel! Du Nichtsnutz!«, brüllte Masetto Capulet. Er hätte ihn geschlagen, hätte er nicht gefürchtet, dass der Mann die Bahre mit der Leiche gänzlich fallen ließe.
Rosaline unterdrückte ein Lächeln. Ihre Mutter hätte es lustig gefunden, sie hatte stets Freude an beißendem Witz. Zwei streunende Hunde schlossen sich ihrer armseligen kleinen Truppe an, vielleicht in der Hoffnung, etwas Essbares zu erbeuten. Rosaline würde sie mitzählen. So wäre die Anzahl der Trauernden, die der Bahre folgten, fast respektabel, auch wenn zwei Mitglieder ihrer Gruppe nicht aus der besten Gesellschaft stammten.
Die fehlenden Nachbarn kümmerten sie nicht: Heuchler und Lügner alle miteinander. Mama hatte ihnen Geburtsgeschenke gemacht, ihnen die Tränen und Hinterteile abgewischt, als sie Wickelkinder waren, aber sie hatte sie nicht geliebt. Mich hat sie geliebt. Und ich bin hier. Bei diesem Gedanken biss sich Rosaline fest auf die Lippe, um die Tränen zurückzuhalten. Sie schmeckte Blut.
Der Gottesdienst im Mausoleum der Familie Capulet war kurz. Der Mönch schien verschreckt. Er beäugte unablässig den Sarg, sprach die Gebete zu hastig und stolperte in der Eile über seine eigenen Worte.
Rosaline beobachtete die Wülste seines Nackenfetts, die trotz der Grabeskälte schweißnass glänzten. Die Zeit hatte zu sehr gedrängt, um Wachskerzen zu kaufen, die Madonna Emelia Capulets Status angemessen gewesen wären, und in der Kammer herrschte Dunkelheit. In der Wand war der Zugang zur Gruft aufgestemmt worden, bereit für den Sarg. Der Gestank von Tod und Zersetzung, modrig und faulig, stieg auf und vereinte sich mit dem Geruch verrottender Gebeine, die hier bereits vor langer Zeit versiegelt worden waren. In der Düsternis wartete das gähnende schwarze Loch. Eine Treppe führte tief in die Unterwelt hinunter.
Rosaline wollte schreien, wollte sich an ihrer Mutter festhalten, so wie sie sich als Kind an ihre Röcke geklammert hatte – wie konnte man Emelia Capulet in diese Dunkelheit hinablassen? Sie würde in diesem giftigen Gestank ersticken, in dem schwarzen Schacht nicht sehen können. Sie würde sich fürchten. Sie musste eine Kerze haben, aber was wäre, wenn diese in der Dunkelheit flackerte und erlosch?
In Wahrheit wusste Rosaline, dass Furcht, Schmerz und Liebe jetzt jenseits ihrer Mutter lagen. Sie gehörte hierher, mitten unter die Geister der anderen, längst verschiedenen Capulets.
Rosaline wurde sich ihres Vaters bewusst, der weinend an ihrem Arm zerrte, und fühlte aufsteigenden Groll. Sie streichelte seinen Kopf, um ihn zu trösten, während er sich an ihre Schulter lehnte. Er war weder gütig noch weichherzig, und trotzdem musste sie ihren Kummer dem seinen unterordnen. Für gewöhnlich hatte er keine Verwendung für sie, aber jetzt, während sie sich wünschte, in ihrem Schmerz allein gelassen zu werden, verlangte er nach ihrer Fürsorge.
Ihre Eltern waren wie ein Paar zugleich gekaufter Kerzen gewesen, die man auf zwei Seiten des Kaminsimses aufgestellt hatte. Perfekt in wächserner Symmetrie. Nun war ihr Vater allein zurückgeblieben, und er kam ihr dünn, verloren und verlassen vor. Sie ergriff seine Hand und fühlte die Zerbrechlichkeit der Knochen unter der Haut, die durchscheinend wie Pergament war. Er drückte ihre Finger, küsste ihre Knöchelchen. Als er ansetzte, etwas zu sagen, brachte er nur Schluchzer hervor.
»Schhh«, machte Rosaline. Sie tröstete ihn, wie sie ein Kind getröstet hätte, und war sich bewusst, dass sie ihre Rollen vorübergehend getauscht hatten.
Trotz seiner Fehler – und ausnahmsweise verbot Rosaline sich, sie aufzuzählen – hatte ihr Vater ihre Mutter geliebt. Ihre Ehe war mit Freude gesegnet und sein Schmerz ehrlich und herzbewegend. Dafür bemitleidete sie ihn.
Der Mönch trat von einem Bein aufs andere, als ob er urinieren müsse. Die Familie starrte ihn an, verwirrt und in ihrem Elend gefangen. Schließlich griff Valentio in seinen Geldbeutel und zog mehrere Münzen hervor.
Der Mönch steckte sie ein, hastig einen Segen murmelnd.
»Meine Entschuldigung. Ich muss weitere unglückliche Seelen begraben.«
Keine Seelen, dachte Rosaline. Nur ihre gebrochenen und verrottenden Hüllen. Ihre Seelen sind diesem Beinhaus längst entflohen.
Als die trübselige Gruppe zum Haus zurückkehrte, warteten die Männer der Wache am Eingangstor auf sie. Das rote Pestkreuz war bereits auf die Tür geschmiert worden. Ihr Hauptmann nickte Masetto zu, aber blieb in sicherer Entfernung stehen. Sein Gesicht war verdeckt von einem Blumengebinde, und er erklärte: »Ein Mitglied dieses Haushalts ist infiziert worden, also werdet Ihr alle gemeinsam zwanzig Tage lang eingeschlossen. Wächter wurden hierher abgestellt, um zu verhindern, dass Ihr Euch dieser Anordnung widersetzt. Möge der Herr Euch Barmherzigkeit erweisen.«
Rosaline sah, wie ihr Vater resigniert mit den Schultern zuckte. Es machte keinen Sinn, den Beschluss anzufechten. Sie konnten nur warten und hoffen. Als sie sich in den Flurbereich des Hauses zurückzog, hörte Rosaline, wie hinter ihnen Nägel in die Tür wie in einen Sargdeckel eingeschlagen wurden.
In den folgenden Tagen beobachtete sie von ihrem Fenster aus, wie immer mehr Haustüren entlang der Straße mit dem roten Kreuz versehen wurden. Die Pest breitete sich weiter aus. Nachmittags zogen Prozessionen mit heiligen Relikten durch die Straßen, um die Infektion auszutreiben. Die Mönche skandierten Gebete und schwenkten schwelenden Weihrauch, die Bewohner öffneten ihre Fenster, traten auf die Balkone, fielen in die Gesänge ein und flehten den Himmel an, den Fluch von ihnen zu nehmen.
Rosaline beobachtete auch, dass ihr Vater tagsüber in seinem vergilbten Nachthemd wie ein fahler Geist durchs Haus wanderte, während er Gebete für seine tote Frau murmelte und im Gehen stolperte. In der Nacht sah sie ihn schlaflos durch die Hallen streifen, einen Knüppel fest im Griff. Dennoch konnte sie es nicht über sich bringen, ihm auch nur mit einem einzigen Wort Trost zu spenden. Denn wäre er nicht gewesen, wäre Emelia nicht tot. Rosalines Mitgefühl war durchsetzt mit Ärger über ihn und ihrem eigenen Kummer.
Bald fühlte sie sich, als ob ihr Leben sich nur noch auf ihre Kammer und das endlose Läuten der Basilikaglocken beschränkte. Sieben Mal jeden Tag, zwanzig Tage lang läuteten sie und wiesen sie an zu beten. Was sie nicht tat.
Am zwanzigsten Tag kehrte die Wache zurück und brachte Prüfer mit, die alle Mitglieder des Haushalts auf Anzeichen der Pest untersuchen sollten.
Eine Frau kam in Rosalines Kammer, entkleidete und badete sie.
»Eure Haut ist dunkler als die Eures Bruders und Eures Vaters«, sagte die Frau.
»Ich bin das Kind meiner Mutter«, antwortete Rosaline, die solcher Bemerkungen überdrüssig war.
»Und eine hübsche Blüte seid Ihr auch in dieser Färbung, obwohl das Dunkle, egal wie schön, nicht dem Zeitgeist entspricht.«
Rosaline schnaubte irritiert. Ihre Mutter hätte sich solch Geschwätz nicht angehört. »Genug, schweig! Mag auch in alten Zeiten das Dunkle nicht als vorteilhaft gegolten haben, die Schönheit meiner Mutter hat verändert, was als begehrenswert gilt.«
Rosaline hatte die gleiche goldfarbene Haut wie ihre Mutter, die im Sommer ein tiefes Terrakotta annahm. Ihr Bruder war dem Hautton nach mehr wie ihr Vater: zwei blasse Kälber. Rosaline war froh, dass sie nach Emelia kam – die Ähnlichkeit mit ihrer Mutter konnte ihr niemand nehmen.
Die Frau kauerte sich hin und untersuchte ihre intimsten Körperstellen. »Ich sehe nichts. Nicht auf Eurem Rücken oder Schoß, nicht unter dem Arm oder der Brust. Auch an Eurem Hals nicht. Die Seuche hat Euch nicht befallen.«
»Ist Caterina unversehrt?«
Die Frau scheute zurück. »Ihr fragt nach Eurer Dienstmagd, bevor Ihr Euch nach Eurem Vater erkundigt?«
Rosaline zuckte mit den Schultern.
»Ihr seid sauber«, fügte die Prüferin hinzu. »Der Haushalt kann wieder geöffnet werden.«
Das erste Mal seit zwanzig Tagen lächelte Rosaline.
»Wir werden nicht in Verona bleiben«, sagte Masetto Capulet. »Hier gibt es nichts mehr für uns. Wir werden uns in die Hügel außerhalb der Stadt zurückziehen, bis diese verfluchte Geißel von uns genommen ist.«
Eine Nadel des Ärgers, juwelenklar und schneidend, stach in Rosalines Herz. Emelia hatte ihren Ehemann zuerst zu überreden versucht und ihn schließlich angefleht, die Stadt zu verlassen: Außerhalb sei die Luft besser, und sie würden dem Feind entkommen, den sie weder sehen noch bekämpfen konnten.
Alle anderen Herrenhäuser waren bereits verlassen, nur einige Dienstboten waren zurückgeblieben. Und selbst diese erschienen immer seltener auf ihren Posten, während jeden Tag mehr Leichen aus den Häusern herausgetragen und in den Straßen zurückgelassen wurden.
Nur ihr Zweig der Capulets war in Verona geblieben, denn Masetto wollte seine Geschäfte nicht vernachlässigen. Wären sie vor zwei Monaten abgereist, wie ihre Mutter es erbeten hatte, läge sie jetzt nicht in ihrem Grab.
»Ja«, stimmte Valentio zu. »Ihr solltet gehen. Es ist ein exzellenter Vorschlag.«
Valentios eigene Familie war bereits vor vielen Wochen in den Schutz der Hügel geflohen, fern allen Unglücks und umsorgt in einer Villa inmitten wehender Weizenfelder. Dennoch hatte er nicht die Seite seiner Mutter und seiner Schwester gegen den Vater ergriffen, ganz gleich, wie sehr sie beide ihn darum gebeten hatten. Seine eigenen wertvollen Schätze, die Menschen, die er liebte, waren in Sicherheit.
Die Wut in Rosaline war wie Zunder, und sie senkte den Blick. Sie konnte es nicht ertragen, ihren Vater oder ihren Bruder anzusehen.
Aber Masetto missverstand ihren gesenkten Blick als Bescheidenheit, als ein Zeichen von Gefügigkeit – beides Eigenschaften, die seine Tochter sonst nicht auszeichneten. Seufzend tätschelte er ihre Schulter.
Alles in ihr drängte danach, seine Hand abzuschütteln.
»Ja«, sagte Masetto, der sich für dieses Thema erwärmte. »Das wäre Emelias Wunsch gewesen. Pack nur das Notwendigste. Wir brechen sofort auf.«
Meine Mutter war das Notwendigste, dachte Rosaline verbittert. Sie wusste, dass in ihrem Alter viele bereits verwaist waren. Sie stand kurz vor ihrem sechzehnten Geburtstag, und obwohl ihr Vater lebte, verstand sie sich selbst als Waise.
Die Schultern ihres Vaters waren gebeugt von der Trauer, die er nun wie einen schmerzenden Umhang trug. Er sah sich um, ohne etwas wahrzunehmen. Seine Gedanken waren allein auf seine verstorbene Frau gerichtet. Als er schließlich zu Rosaline blickte, wirkte er erstaunt und verärgert.
Rosaline ballte die Hände zu Fäusten und grub die Fingernägel in das blasse Fleisch ihrer Handteller. Der körperliche Schmerz erinnerte sie daran, dass es sie noch gab, dass sie nicht verschwunden war – selbst wenn ihr Vater nun wünschte, sie wäre es.
Rosaline saß in einer Ecke ihres Schlafgemachs, die Knie unters Kinn gezogen. Sie legte erst eine Ausgabe von Dante, dann Petrarca und Boccaccio und schließlich ihr wertvollstes Buch, Ovids etwas zerfledderte Metamorphosen, in den Koffer. Als sie noch ihre Laute hinzugefügt hatte, erklärte sie, dass sie fertig gepackt habe.
Caterina war nicht überzeugt. »Wo sind deine Strümpfe? Deine Gewänder? Ein Umschlagtuch?«
Rosaline zuckte mit den Schultern. »Es genügt mir, wenn ich mit Büchern und Musik versorgt bin.«
»Musik? Du kannst nicht ernsthaft daran denken zu spielen. Nicht, während du in Trauer bist. Selbst für dich, Mylady, gibt es Grenzen.«
Rosaline ließ noch einen Strang Katzendarm in den Koffer gleiten, falls eine ihrer Lautensaiten reißen sollte. »Ich werde darauf achten, dass mich niemand hört.«
»Pfui, wie bist du verderbt«, fuhr Caterina auf und murmelte ungehalten zu sich selbst, während sie hastig verschiedene Dinge in den Koffer warf.
Rosaline fischte den Dante wieder heraus, setzte sich auf den Boden und las zum wiederholten Mal seine Visionen vom Leben im Jenseits. Sie fragte sich, wo ihre Mutter sei, und fühlte auf ihrer Haut ein prickelndes Unbehagen, als ob sie nach einem sommerlichen Bad im Fluss ans Ufer träte und die Sonne hinter Wolken verschwunden wäre.
Sie fand, dass es Dantes Beschreibungen des Himmels an Brillanz mangelte. Eine Ewigkeit in dieser Gesellschaft versprach drohende Langeweile. Die Alternativen waren die faszinierende Folterpein inmitten der Sünder oder das schaurige Vergessen im Fegefeuer.
»Du sollst nicht lesen. Es weckt in Frauen das Wechselfieber. Jeder weiß das.«
Rosaline küsste ihre Dienstmagd und kniff sie liebevoll in die rundliche Wange.
Sie saßen in einem Fuhrwerk, das die Straße und schließlich den Feldweg entlangholperte. Hinter ihnen verschwand die Stadt. Rosaline beobachtete die sich wiegenden samtigen Hinterteile der beiden Pferde, die den Karren zogen. Die Tiere rochen nach Schweiß und Heu, ihr Zaumzeug klirrte und schepperte. Caterina folgte ihnen zu Fuß, ihr Gesicht glänzte vor Anstrengung.
Hohe Reihen von dunklen Zypressen ragten in das leuchtende Blau des Himmels. Dennoch hatte die Pest auch das Land gezeichnet: Unkraut überwucherte die unbestellten Felder, ein Weinberg neigte sich in der Sonne, an seinen Rebstöcken hingen kleine graue Trauben. Rosaline bemerkte zwei elend wirkende Frauen, die versuchten, umgefallene Pfosten aufzurichten und Zaunwinden zu beseitigen, die drohten, die Weinreben zu erdrosseln. Es gab keine Männer mehr, die ihnen bei der schweren Arbeit halfen.
Die Karrenräder unter ihnen zerquetschten Mädesüß und Rittersporn, ihr Duft stieg zu ihnen auf. Ein jeder dürstet nach einem Heilmittel gegen die Pest, dachte Rosaline. Sogar die Natur selbst.
Valentio lenkte den Karren und schlug mit einem Stock auf die bemuskelten Schultern der Pferde ein, sobald sie trödeln wollten. Ihr Vater saß neben ihr. Seine Schultern zuckten hin und wieder vor unterdrücktem Schluchzen.
Rosaline weinte nicht. Der Feuerstein aus Wut, hart und trocken, verwahrt tief in ihr, hatte all ihre Tränen verbrannt.
Valentino manövrierte das Fuhrwerk um einen dünnen Bullen herum, der eine gelangweilt aussehende wiederkäuende Kuh inmitten eines verwilderten Feldes bestieg.
Interessiert musterte Rosaline die Paarung. Nach vielem Bitten und Betteln hatte ihre Mutter versprochen, mit ihr über den körperlichen Akt eines Mannes und seiner Ehefrau zu sprechen.
Zwei Tage, bevor sie krank geworden war, hatten sie zwei brünstige Hunde auf der Straße beobachtet: das Wimmern und Grunzen der Hündin, das rasende Schieben des Rüden und danach das Ineinanderhängen. Unfähig, sich voneinander zu lösen, waren Hund und Hündin, winselnd und mit den Hinterteilen verbunden, in der Gossenrinne gehoppelt, während die Passanten nach ihnen getreten hatten.
Rosaline hatte wissen wollen, ob sich Mann und Frau nach dem Akt auch in so einem beklagenswerten, entwürdigenden Zustand wiederfänden. Emelia hatte versichert, dass dem nicht so sei, Menschen seien nicht miteinander verhaftet wie Rüde und Hündin, und dass sie ihr schon bald alles erzählen würde, was sie wissen musste.
Rosaline fragte sich, wer sie nun mit den Details vertraut machen würde.
Masetto griff in seine Jacke und überreichte ihr eine Goldkette, erwärmt von seinem Körper. »Deine Mutter wollte, dass du sie bekommst.«
Rosaline nahm sie entgegen. Ihre Mutter hatte diese Kette mit Anhänger jeden Tag getragen. Sie war wie ein Teil von ihr gewesen, wie ihre Finger, ihre braunen Augen oder ihr gesplitterter Schneidezahn. Der Anhänger bestand aus einem großen Smaragd, der wie ein Libellenflügel glänzte. Er kam Rosaline wie ein grün funkelndes Herz vor, das in schimmerndes Gold eingelassen war.
Sie roch an ihm in der Hoffnung, er könnte noch nach ihrer Mutter duften – Hagebutten, getrockneter Salbei –, aber nur der Geruch des Leders von Masettos Jacke und seiner ungewaschenen, sauren Haut stieg ihr in die Nase. Sie legte sich die Kette um den Hals.
»Und sie hat dir einen Brief hinterlassen.« Wieder tastete er in seinem Lederwams umher und zog schließlich einen gefalteten Pergamentbogen hervor.
Einen Moment lang betrachtete Rosaline das Schriftstück. Ihre Mutter war weder des Schreibens noch des Lesens mächtig gewesen. Sie musste den Brief dem Vater diktiert haben. Er wusste bereits, was darinstand. Schlangenhaft leckte er sich mit herausschnellender Zunge über die Lippen.
»Was steht darin?«
»Du solltest ihn lesen.«
Seine Tränen waren getrocknet. Er sah schuldbewusst aus, wie ein Hund, den man beim Hühnerdiebstahl erwischt hatte und der den Blick seines Herrn nicht erwidern konnte.
Sie griff nach dem Brief und las ihn mit wachsendem Entsetzen. »Hier steht, dass ich ins Kloster gehen soll. Das ist eine Lüge! Das wollte sie nicht! Ihr wollt das. Ihr wollt meine Mitgift sparen!« Plötzlich spürte Rosaline einen stechenden Schmerz an ihrem Ohr. Es dauerte einen Moment, bis sie verstand, dass ihr Vater sie geschlagen hatte.
»Du vergisst, dass ich über dich entscheiden kann, wie es mir beliebt. Aber nein. Das war wahrhaftig der Wunsch deiner Mutter.«
Rosaline starrte Masetto an. Sie schmeckte Blut. Er erwiderte ihren Blick, überrascht von seiner eigenen Gewalttätigkeit.
Sie wusste, dass er, selbst wenn es der Wunsch ihrer Mutter gewesen war, nichts gegen Emelias Wahl einzuwenden gehabt hatte. Eine Mitgift war eine hohe Ausgabe. Töchter in Klöster zu verbannen kostete zwar ebenfalls einiges, und noch mehr, wenn man wünschte, dass sie bei ausreichender Kost in angenehm ausgestatteten Zellen lebten. Aber dieser finanzielle Aufwand war verschwindend gering gegenüber einer Mitgift, die ruinös sein konnte.
Rosaline rieb ihr schmerzendes Ohr und starrte auf den Brief. Er war voller Liebesbeteuerungen, die alle von der Hand des Vaters geschrieben worden waren. Was hatte es ihn gekostet, solche Krümel von Zärtlichkeit festzuhalten, die Überbleibsel vom Tisch einer sterbenden Frau? Hungrig verschlang Rosaline sie – mehr würde sie nicht bekommen. Er hat jedes Stück von dir genommen, dachte sie. Sogar deine letzte Botschaft kann nur durch ihn betrachtet werden. Ihr war, als versuche sie, Emelia durch dichten Rauch zu erkennen. Hatte ihr Vater die liebevollen Botschaften nur aufgeschrieben, um den Eindruck zu wahren, dass die Anweisung, sie solle ins Kloster gehen, wirklich dem Wunsch ihrer Mutter entsprach? Ein noch düsterer Gedanke überkam sie, der, gleich einer kalten Springflut, ihre Gefühle zu überspülen drohte.
Was, wenn Masetto Capulet die Wahrheit sagte? Was, wenn ihre geliebte Mutter sie, ihre einzige Tochter, in ein Kloster wegsperren wollte? Tränen brannten in ihren Augen. Sie war verdammt. Wenn nicht zur Höllenglut, so doch zum Fegefeuer.
Als sie die Villa in den Hügeln hinter Verona erreichten, zog sich Rosaline sofort in ihre Schlafkammer zurück. Sie lag auf ihrem niedrigen Holzbett und betrachtete die Balken unterhalb der Decke, die sich im Laufe der Zeit silbergrau verfärbt hatten. Eine Maus huschte einen Balken entlang und blieb direkt über ihrem Kopf wachsam stehen. Im Zimmer roch es genau wie immer, nach der Feuchtigkeit, die sich eingenistet hatte, und nach alten Feuern. Der Wind fuhr über die Traufen, die Dachsparren knarrten wie Schiffe auf dem Wasser.
Draußen im Hof pumpte Caterina Wasser, es zischte und spritzte, als es aus dem Brunnen in den Eimer schoss. Alles war wie immer, und nichts war wie immer.
Rosaline dachte über das Kloster in Mantua nach, das nun zu ihrem Schicksal werden sollte. Das Gebäude hockte auf der Kuppe eines Hügels wie ein schlecht sitzender Hut, unnahbar und fern der Stadt. Seine Mauern waren aus gehauenem lilagrauem Sandstein von einem Steinbruch in den Alpen, drei Fuß waren sie dick. Flüsternd wurde das Gerücht weitergegeben, dass in alten Zeiten die Nonnen des Ordens fliegen konnten und Geister heraufbeschworen hatten – nicht immer nur diejenigen der heiligen Art.
Sie erinnerte sich daran, wie sie als Kind mit ihrer Mutter zu diesem Kloster gekommen war, um deren Schwestern zu besuchen. Rosaline hatte überredet werden müssen, in den parlatorio zu gehen. Ein engmaschiges Eisengitter in der Besucherzelle sollte die Nonnen gegen die fleischlichen Gelüste der Außenwelt abschirmen. Besucher pressten ihre Gesichter gegen das kalte Metall, steckten ihre Finger in dem verzweifelten Versuch hindurch, ihre geliebten Töchter und Schwestern zu berühren, die sich Gott anvertraut hatten.
Während Rosaline vor Elend und Furcht geweint hatte, hatte ihre Mutter sie in eine Decke gehüllt, sie in die fassförmige ruota gesteckt und diese gedreht, sodass die Nonnen sie auf der anderen Seite verstohlen herausholen und mit in den verborgenen Schoß des Klosters nehmen konnten. Ihre Tanten hatten sie hineingeschmuggelt, ihre Tränen weggeküsst und sie mit Umarmungen, Süßigkeiten und Spezereien getröstet. Die ruota war für Waren wie Eier, Kuchen und Gebäck gedacht und nicht für Nichten, aber sie wurde oft für Verbotenes gebraucht.
Nach jenem ersten Besuch war Rosaline häufig auf diesem heimlichen Weg im Kloster gelandet. Sie war verhätschelt worden, ihre Kinderwangen, so zart und weich wie frisch aufgegangener Teig, waren gestreichelt und geküsst worden.
Wenn Rosaline an diese Besuche zurückdachte, konnte sie sich nicht an Gebete oder Bußen erinnern – die hatte man vor ihr verborgen. Stattdessen hatten die Schwestern ihrer Mutter alles aufbewahrt, von dem sie glaubten, dass es sie interessieren oder erfreuen würde: frisch geborene Kätzchen, noch blind und das Fell feucht von der Geburt, ein junger Spatz, der aus dem Nest in einen der Kreuzgänge gefallen war. In eine Schachtel hatten sie ihn gesetzt und mit Würmern gefüttert, bis er fliegen konnte.
Ihre Mutter hatte begierig alles über ihren Aufenthalt bei den Nonnen wissen wollen. Unablässig hatte sie die Details wiederholt, bis Rosaline des ständig gleichen Stroms der Worte überdrüssig geworden war.
Jetzt jedoch wurde ihr klar, dass die beharrlichen Wiederholungen ihre Erinnerungen so fest und anschaulich in ihren Gedanken verankert hatten wie die leuchtenden Farben in Muranoglas.
Mehrere Jahre lang hatten sie und ihre Mutter die Tanten besucht. Rosaline hatte zunächst nicht gewusst, dass die Nonnen dafür, dass sie sie hineinschmuggelten, ihre Seelen und sogar den Ausschluss aus der Kirche riskierten und die unbefleckte Heiligkeit des Klosters schändeten. Dabei war sie überzeugt, dass ihre Tanten auf eine entsprechende Frage ohne zu zögern geantwortet hätten, dass der immense Preis – Seelenpein und mehr – nicht zu hoch für diese pummeligen Ellenbogen mit den Grübchen und die rundlichen, schmuddeligen Kinderknie sei.
Bei ihrem letzten Besuch war Rosaline zu groß gewesen. Sie war in der ruota eingeklemmt und hatte eine halbe Stunde darin festgesteckt, bis man sie endlich hatte befreien können. Nie wieder hatte sie ihre Tanten berührt oder gar umarmt.
Sie verstand, warum ihr Vater für sie ein Leben im Konvent wollte. Er war ein kalter Mann. Bei Zusammenkünften und Festen in Verona wurden die Leute nicht müde, ihr zu erzählen, wie erstaunt sie gewesen waren, als er ihre Mutter aus Liebe geheiratet hatte, eine Frau mit einem unmodernen Äußeren und einer schmalen Mitgift. Ihr Erstaunen über diese Verbindung hatte auch nach zwanzig Jahren nicht nachgelassen.
Zu Rosalines Unglück war Masettos Vorrat an Zuneigung mit seiner Ehefrau erschöpft, für sie blieb nichts mehr. Er war erfreut gewesen, einen Sohn zu bekommen, aber für sie hatte er keine Verwendung. Die Schönheit, die ihn bei Emelia verzauberte, verärgerte ihn bei Rosaline. Er ermahnte sie, nicht zu lange in der Sonne zu sitzen, damit ihre Wangen nicht noch dunkler wurden.
Rosaline beherzigte seinen Rat nicht. Sie wusste, dass er an den Spruch glaubte: Eine Frau gehört zu einem Ehemann oder hinter eine Klostermauer. Aber bis jetzt hatte sie nicht gewusst, dass ihre Mutter dasselbe geglaubt hatte. Warum hatte sie ihr nichts gesagt? War es Feigheit oder Zeitmangel gewesen? Hatte sie vorgehabt, Rosaline ihre Absicht mitzuteilen, aber war dann von der Schnelligkeit ihres Todes betrogen worden? Rosaline war es streng verboten worden, das Krankenzimmer zu betreten. Zu groß war die Furcht vor stinkenden, ansteckenden Ausdünstungen.
Seufzend erkannte Rosaline, dass es egal war, ob sie etwas über die Schrecken oder die Freuden des Ehebetts erfuhr. Sie würde sie sowieso nie erleben. Sie setzte sich auf und sah, dass die Sonne im Begriff war unterzugehen. Tief stand sie über dem Hof, geschwollen und rot wie ein Geschwür, das bereit zum Aufstechen war. Rosalines Kehle war staubtrocken und schmerzte.
Aus einem Glas auf der Kommode nahm sie einen Stängel Lavendel, den sie im letzten Jahr gepflückt hatte. Er roch nach glücklicheren Zeiten. Verbittert zerrieb sie ihn zwischen den Fingern zu Staub. Wut auf die Toten war vergebens und würde niemals Früchte tragen.
Sie griff nach dem Glas und schleuderte es gegen den Kaminrost, wo es in der grauen Asche zersplitterte. Das erste Mal seit Wochen ließ sie die Trauer zu. Laut weinte sie auf. Ihr Gesicht war heiß, und ihre Rippen schmerzten, als ob man sie getreten hätte. Aber das Weinen schenkte ihr weder Erleichterung noch Trost.
Allmählich wurde sie ruhiger. Sie lauschte den Mäusen, die in den Dachsparren tippelten, und einer Schleiereule, die im Mondlicht schrie. Sie durchquerte den Raum und öffnete das Fenster. Inzwischen waren alle Landhäuser in der Dunkelheit versunken. Sie blickte hoch zu dem mit Sternen übersäten Himmelszelt und fühlte den Windhauch auf ihren Wangen. Sie schloss die Augen.
Als sie sie wieder öffnete, bemerkte sie ein Licht am Haus der Montagues auf dem Hügel. Hätte es zu einem anderen Haushalt gehört, hätte ihr das kleine gelbe Licht vielleicht den tröstlichen Gedanken gespendet, dass noch eine andere unglückliche Seele zu dieser pietätlosen, mitternächtlichen Stunde wach war. Während sie es angestrengt betrachtete, verlosch die Lampe. Finsternis übernahm.
Einen Moment lang schien es Rosaline, als ob kein Licht jemals wieder leuchten würde. Sie fühlte, wie sich eine unsichtbare Kette eng um ihre Brust legte, und sie vermutete, dass sich so das Seil angefühlt haben musste, welches die Inquisition bei Ketzern benutzt hatte. Sie fragte sich, ob sie nun sterben würde. Sie wollte nicht hinter einer Mauer versteckt werden. Sie wollte die Welt mit all ihren Herrlichkeiten, Schmerzen und Lastern genießen. Wie konnten sie es wagen, ihr das zu nehmen? Sie würde es nicht zulassen. Bis der Moment kam, in dem man sie wegschloss, würde sie jedes denkbare Vergnügen genießen, schwor sie sich und spuckte zur Bestätigung ihres Eids auf den Boden.
Im Morgengrauen erhob sich die Sonne wieder, und Rosaline tat es ihr nach. Der Morgentau lag frisch auf dem Gras, es war wie gereinigt, glänzend und gänzlich unbeeindruckt von ihrem Unglück. Bienen untersuchten sorgfältig Jasminblüten nach Pollen, ein Specht klopfte suchend nach Frühstück.
Caterina brachte ein Tablett in Rosalines Kammer und überredete sie, ein bisschen Brot zu essen und etwas Milch zu trinken. Sie sagte nichts zu ihrem geschwollenen Gesicht und ihren geröteten Augenlidern. Nachdem Rosaline angekleidet war, band Caterina ihr schwarze Bänder um die Handgelenke und legte ihr einen dunklen Trauerumhang um die Schultern.
Rosaline bedeckte ihre Ohren mit den Händen, um Caterinas klagenden Protest darüber zu dämpfen, dass sie das Haus verließ. Sie eilte über die Felder, um Livia, die Frau ihres Bruders, aufzusuchen. Sie war bereits das siebte Mal in Erwartung. Es würde nicht mehr lange bis zur Geburt dauern.
Als sie ankam, lag Livia in einer der Schlafkammern im oberen Geschoss im Bett. Zusammen mit der Amme und ihren drei Kindern, die überlebt hatten, herrschte in dem Raum betriebsame Enge. Bei Rosalines Anblick breitete sich ein strahlendes Lächeln auf Livias Gesicht aus, das jedoch erlosch und tiefer Trauer Platz machte, als ihr Emelias Tod einfiel.
Sie rappelte sich hoch und griff nach Rosalines Hand. »Oh, meine liebste Rosaline. Möge Emelias Seele im Himmel gemeinsam mit der Jungfrau Maria und allen Heiligen ruhen, geschützt von tausend Gebeten. Sie war zu gut für diese Erde. Und …«, fuhr sie fort, »sie buk den besten Mandelkuchen.«
Rosaline nickte stumm. Sie wollte nicht sprechen. Zu groß war ihre Furcht, wieder in Tränen auszubrechen.
Livia drückte ihre Hand. Ihre Haut war papierdünn, aber ihr Griff war überraschend fest. »Ich habe meine Mutter verloren, alle meine Schwestern und drei meiner Kinder. Der Schmerz wird nicht weniger, aber du wirst dich an die Last gewöhnen.«
Rosaline umarmte sie, küsste ihre blasse Wange und sog tief den schwachen Geruch von ungewaschenen Laken und Rosenöl ein. Die mächtige Rundung des Bauches, in dem das Kind geborgen lag, war unter Livias Hemd zu sehen. Ihr Busen wirkte schmerzhaft geschwollen, die Venen schienen wie eine zarte blaue Flusslandschaft. Ihre Augen lagen in tiefen Höhlen.
»Isst du genug?«, fragte Rosaline. Sie empfand es als Erleichterung, zur Abwechslung über das Leid eines anderen Menschen nachzudenken.
Livia lächelte. »Dein Bruder drängt mir endlos Köstlichkeiten auf.«
»Ja, aber isst du sie auch?«
»Ich versuche es, wirklich.«
Rosaline blickte zu der Amme, die Livias Jüngstes fütterte. Das mollige Kleinkind von knapp einem Jahr nahm gerade die schrumpelige Brustwarze in den Mund. »Sie scheint nützlich und gut zu sein.«
Livia nickte. »Ja, sie kümmert sich um die Kinder, ohne viel Aufhebens davon zu machen.« Verschwörerisch senkte sie ihre Stimme. »Sie war zuvor eine Pestprüferin.«
Die Amme hatte es jedoch gehört. Sie wandte sich ihnen beiden zu. »Das hier ist besser. Leben über Tod.«
Die Tür wurde geöffnet, und Madonna Lauretta Capulet trat ein, das lebhafte Treiben in der Kammer mit besitzergreifenden Blicken messend, als seien alle Anwesenden Seidenballen, die sie zur Herstellung eines Gewandes in Erwägung zog. Nur noch das schmatzende Saugen des stämmigen Kindes am Busen der Amme war zu hören.
Rosaline erstarrte, Livia spielte nervös mit der Decke. Sie beide waren vor Lauretta wie vor einer Natter auf der Hut. Sie war mit Masettos älterem Bruder verheiratet, dem alten Lord Capulet, der dem Haushalt vorstand.
»Wo ist Julia?«, verlangte Madonna Capulet zu wissen. »Ich dachte, sie sei hier und spiele mit den Kindern.«
»Nicht mehr, Tante«, erwiderte Livia. »Sie war über eine Stunde mit ihrer Amme hier, und sie spielten überaus erfreulich. Aber dann verließen sie uns.«
Madonna Capulet ließ den Blick dennoch weiter durch den Raum schweifen, als ob sich Julia hinter den Bettvorhängen oder dem Wandschirm verstecken könnte.
»Es tut mir leid, dass ich meine Cousine Julia verpasst habe«, sagte Rosaline. »Ich hätte sie sehr gern wiedergesehen.«
Ihre Tante runzelte die Stirn. »Sie sollte hier sein. Lästiges Ding.« Dann fiel ihr Rosaline ein, und sie fügte hinzu: »Es dauert mich um deine Mutter. Emelia war eine tugendhafte Frau. Möge sie gemeinsam mit der Jungfrau Maria in Ewigkeit ruhen. Du wirst ihrer Erinnerung huldigen, wenn du ins Kloster gehst.«
Bei ihren Worten fühlte Rosaline einen plötzlichen Schmerz in ihrem Bauch. Sie brachte kein Wort über die Lippen.
Madonna Lauretta betrachtete sie einen Moment lang nachdenklich, dann rief sie nach einem Diener und verlangte nach Wein. »Meine Nichte ist unpässlich. Die Auswirkung der Trauer, nicht etwa die Pest?«, fragte sie und wandte sich an Rosaline. Auf einmal klang sie ängstlich.
»Ihr wusstet, dass man mich fortschicken will?«, fragte Rosaline.
Madonna Capulet setzte sich auf die unbequeme Bettkante. Sie sah verwirrt aus. »Was sonst könnte deine Mutter für dich gewollt haben, teure Nichte? Dein Bruder zeugt unablässig Nachkommen. Deine Eltern brauchen nicht noch mehr. Du kannst nicht den Namen deines Vaters tragen. Er benötigt dich nicht, um den Fortbestand der Familie zu sichern. Für was bist du also von Nutzen?«
Rosaline fuhr mit trockener Zunge über die Lippen, die sich wie Papier anfühlten. »Aber Ihr werdet Julia verheiraten.«
»Gott hat uns nur ein Kind geschenkt. Alle unsere Hoffnungen liegen nun auf ihr. Auf diesem Balg.«
Rosaline sagte nichts. Sie war noch zu jung, um sich an Julias Schwester zu erinnern, die durch ein Fieber gestorben war, oder an die Brüder, die tot geboren worden waren. Sie blickte zu ihrer Schwägerin im Bett, zu ihrem aufgeblähten Bauch. Livia bekam jedes Jahr ein Kind, das stets der Amme übergeben wurde, sodass Valentio sie wieder besteigen und sie zügig erneut schwanger werden konnte.
Kinder waren nützlich, aber für Rosaline hatte man keine Verwendung.
»Was willst du, Rosaline? Du bist erst fünfzehn. Hast du auf einen Ehemann gehofft?«, fragte Madonna Capulet. Interessiert beugte sie sich vor.
Rosalind fühlte sich nicht zu einer Antwort verpflichtet. Stattdessen dachte sie an ihre Eltern. Sie wusste nicht, ob ihre Mutter Masetto wirklich geliebt hatte, nicht einmal, ob sie Liebe überhaupt für notwendig gehalten hatte. Er hatte für sie beide genug geliebt. Manchmal, wenn sie beim Nachtmahl viel Wein getrunken hatten, hatte Emelia ihn geneckt, wie es sonst niemand wagte. Rosaline war sicher, dass ihre Mutter glückliche Augenblicke mit ihm gehabt hatte, wie Tauperlen, die aneinandergereiht in einem Spinnennetz funkelten. Sie waren nicht weniger wertvoll, nur weil sie fragil und von kurzer Dauer waren. Rosaline beschloss, etwas über die Liebe zu erfahren, bevor man sie wegsperrte. Ob mit oder ohne Ehemann.
2. Kapitel
Romeo heißt er
Die Pest floss ab wie die Wasser nach einer Flut, ließ Gräben zurück, die überquollen mit hastig verscharrten Toten. Ernten schimmelten auf den Feldern, und Brücken wurden nicht repariert, weil es keine Männer gab, die die Bäume fällten und daraus Bauholz machten, keine Fuhrleute, die die rohen Bretter zum Fluss transportierten, und keine Zimmerleute, die die morschen Balken ersetzten.
Rosaline sah erstaunt, wie ihr Vater niederkniete, um dem Allmächtigen für die Erlösung zu danken. Alles in ihr weigerte sich, das Gleiche zu tun. Gott hatte ihr das Wichtigste genommen, ihre Welt zerbrochen und sie in einem jämmerlichen Zustand zurückgelassen.
Mehrmals in der Woche wurde Rosaline widerwillig zu einem Kirchgang genötigt. Die kleine Kirche war überfüllt mit Büßern und Sündern, die jedem Heiligen, der ihnen einfiel, dankten, dass sie verschont geblieben waren. Rosaline bemerkte, dass diejenigen, die im Alter ihres Vaters waren, am innigsten beteten. Die jüngeren Gemeindemitglieder unterdrückten ein Gähnen und wirkten abgelenkt. Sie ignorierten sogar, dass der Mönch bei seiner übereifrigen Predigt einen Schauer Spucke auf sie niederregnen ließ. Rosaline beobachtete das dagegen begeistert und wartete gespannt darauf, wen die Spucketröpfchen des inbrünstig Betenden trafen.
Das Singen der Choräle in der Kirche war normalerweise eine freudige Angelegenheit. Aber Rom hatte die harmonische Mehrstimmigkeit verboten, weil sie angeblich Gotteslästerlichkeit und Lust weckte, und der Cantus Planus, der »flache Gesang«, war wieder eingeführt worden. Rosaline fand, der Cantus Planus war genau das: flach und uninteressant. Wieder musste sie an ihre Zukunft im Kloster denken, an ein Leben voller Gebete und langweiliger, flacher Tonfolgen. Wie sollte sie das nur ertragen?
Nach der Kirche suchte sie ihren Vater in seinem Arbeitszimmer auf. Er war damit beschäftigt, seine Konten zu überprüfen. Aber tatsächlich schaute er gar nicht auf die Kontenblätter. Stattdessen starrte er auf eine gemalte Miniatur von Emelia und streichelte mit dem Zeigefinger über ihr gefirnisstes Profil.
Rosaline ergriff die Gelegenheit. »Wenn Ihr mir ein Jahr Aufschub gewährt, werde ich danach ins Kloster gehen. Vielleicht nicht bereitwillig, aber ohne Einwände zu erheben.«
Er runzelte die Stirn. »Warum sollte ich mit dir darüber verhandeln?«
Rosaline zeigte zum Bild ihrer Mutter. »Sie hätte nicht gewollt, dass ich unglücklich bin.«
Erneut schaute er auf das kleine Gemälde in seiner Hand. »Das will ich auch nicht, Tochter. Auch wenn du mir das nicht glaubst.«
»Doch, das tue ich«, sagte sie und versuchte, es überzeugend klingen zu lassen. Sie griff nach seiner Hand, aber die Berührung war zu intim, und sie ließ seine Hand wieder los. »Ein Jahr Kost und Logis kosten nicht viel.«
Aber ihr Vater war durchaus vermögend, und die Ausgaben waren ihm egal. Er strebte einzig und allein danach, sie loszuwerden.
»Deine Mutter wollte, dass du gehst. Selbst wenn du es nicht hören möchtest.«
»Und das werde ich auch. Aber gebt mir ein Jahr mehr von dieser Welt. Erlaubt mir nur, bunte Erinnerungen zu schaffen, bevor mein Leben in grauer Eintönigkeit versinkt.«
»Es ist besser, wenn du so schnell wie möglich gehst. Die Wunde muss mit Feuer versiegelt werden. So wird es leichter für dich sein.«
Sie kniete nieder und bedeckte seine Hand mit Küssen. »Ich bitte Euch.«
Er schwieg einen Moment, überlegte. Unglücklich und unentschlossen sah er aus. »Ich möchte, dass wir beide uns besser kennenlernen, Tochter.«
Sie nickte eifrig.
»Und wenn du im Kloster aufgenommen wirst, gestattest du mir, dass ich dich dort besuche?«, sagte er, und seine Stimme klang traurig. »Ich habe schon meine Ehefrau verloren, ich will nicht auch meine Tochter verlieren.«
»Das werdet Ihr nicht«, antwortete sie.
»Ich gewähre dir zwölf Nächte.«
Entsetzt schaute sie zu ihm hoch. »So wenig! Das ist nicht genug.«
»Das, oder du verlässt uns sofort. Vergiss bei all meiner Freundlichkeit nicht, dass du mir gehörst und es mir freisteht, mit dir zu tun, was mir beliebt.«
Sie stimmte zu, während sie gegen die aufsteigenden Tränen in ihren Augen anblinzelte.
»Von heute gezählt, wirst du in zwölf Tagen ins Kloster gehen. Ohne Widerworte gegen die Familie, ohne dramatische Szenen. Wirst du still dein Schicksal akzeptieren?«
Sie konnte nicht sprechen. Ihre Kehle war verschlossen von Tränen und Panik, sie konnte nicht mehr schlucken. »Ja«, krächzte sie.
»Schwöre es, Rosaline.«
»Ich schwöre.«
Rosaline erwartete, dass alle Glocken der Lombardei ein Klagegeläut anstimmten, dass Schwärme von Saatkrähen laut krächzend ihr Unglück verkündeten. Aber sie konnte nur ein leises Schlagen von Hufeisen auf Stein ausmachen, als die Pferde um den Hof geführt wurden, und das fröhliche Zwitschern eines Buchfinken.
Ihr Vater sah sie nicht länger an, sondern richtete seine Aufmerksamkeit auf seine Kontenblätter und den Abakus. Sie war entlassen.
Sie rannte aus dem Raum.
Nur zwölf Tage blieben ihr noch in diesem Teil der Welt. Zwölf Tage voller Farbe und Licht und Musik. Sie würde danach greifen, sie festhalten.
Auf der Suche nach Caterina eilte sie in die Küche, wie sie es von Kindheit an getan hatte, wenn sie in Schwierigkeiten geraten war und ihre Mutter nicht finden konnte. Aber das hier war kein aufgeschlagenes Knie. Und kein Posset, diese köstlich-tröstende Süßspeise, und kein kandierter Apfel konnten das richten.
Caterina buk eine Aalpastete. Sie bemerkte nicht, dass Rosaline an der Tür stand, und summte leise vor sich hin, während sie den Teig knetete. Stumm beobachtete Rosaline sie, deren Arme, wie unzählige Male zuvor, weiß von Mehl waren, und fühlte sich losgelöst von ihrem bisherigen Leben. Als ob dieser Augenblick ein völlig beliebiger Moment in ihrem fünfzehnjährigen Leben sei. Aber sowie sie ihr erzählen würde, dass sich ihre Wege bald trennten, würde Caterina in Tränen ausbrechen. Das Stundenglas würde sich weiterdrehen, die Zeit weiterlaufen. Sie war dafür noch nicht bereit.
Rosaline gab sich noch einen Augenblick Zeit. Sie betrachtete die sich windenden, ineinander verschlungenen Aale auf der Holzbank, ihre schleimigen Körper, und atmete den modrigen Geruch des Flusswassers ein. Sie sah das kalte Glänzen des Küchenmessers, beschmiert mit Fischblut, das Mehl, das in zarten Wirbeln vom Tisch zu Boden wehte. Sie würde diese Pastete und vielleicht noch die nächste essen. Aber danach würde sie nicht mehr hier sein.
Rosaline räusperte sich, und Caterina hielt inne. Bei Rosalines Blässe und den Tränen in ihren Augen vergaß sie die Pastete. »Was ist geschehen? Was hast du, mein Marienkäferchen?«
Als Rosaline erzählte, was geschehen war, schluchzte Caterina auf und wischte sich über die Stirn, wobei sie dort eine Spur von Flussschlamm und Aalinnereien hinterließ. Die beiden Frauen klammerten sich aneinander. Dann schob Caterina sie fort und presste Rosaline einen Lappen in die Hand, damit sie sich die Augen trocknen könnte. »Hier, setz dich. Livia hat einen gesunden Sohn zur Welt gebracht. Ein Bote kam, um deinem Vater davon zu berichten.«
»Ich bin doppelt froh. Es ist besser, in dieser Welt ein Junge zu sein.«
»Er trinkt unablässig. Sie werden eine zweite Amme brauchen, damit es für ihn und seinen Bruder reicht. Vielleicht könntest du Livia morgen besuchen.« Caterina öffnete die Speisekammer und begann, nach Zuckerwerk zu kramen. Zufrieden schnalzend zog sie ein Päckchen mit kandierten Pflaumen und Kirschen hervor.
»Hier, für dich. Aber verdirb dir nicht den Appetit«, schalt sie freundlich.
Dankbar nahm Rosaline eine Pflaume heraus und schluckte den Klumpen zusammen mit Zucker und Spucke hinunter. Caterina plapperte weiter über den Säugling, um sie abzulenken.
Rosaline stopfte sich mehr gezuckerte Pflaumen in den Mund. Vielleicht würde Livia, wenn ihre Kinder größer waren – aber nicht zu groß –, sie nacheinander zu einem Besuch zu ihr ins Kloster bringen. Sie könnten die Kinder im Fass der ruota hineinschmuggeln, und Rosaline würde sie ein, zwei Stunden im Kloster verstecken. Mehr durfte sie sich nicht erhoffen.
Caterina zwitscherte noch immer wie ein Spatz vor sich hin. »Der Tod deiner armen Mutter verhindert natürlich angemessene Tauffeierlichkeiten. Aber die Nachbarn haben bereits Geschenke gesandt, und dein Bruder hält Hof wie der Fürst von Verona persönlich! Aber natürlich muss die Geburt eines Jungen gefeiert werden. Alle haben was geschickt. Nun, fast alle. Die Montagues natürlich nicht.«
Die Montagues. Schon der Name war wie eine fremde Insel, fern und unbekannt, mächtig und mit Sünde beladen. Der Inbegriff verdorbener Schrecklichkeit. Wann immer Rosaline sich schlecht benahm, wurde ihr mit den Montagues gedroht. Sie würden sie holen. Wie, wurde ihr nie erläutert. Würde man sie der verhassten Familie wie Fleisch vom Schlachter in einem Paket senden? Würden sie Rosaline in ihrer Kammer wie Teufel heimsuchen, die man in einem magischen Kreis heraufbeschwor? Sie bekreuzigte sich.
Aber wie Luzifer waren auch die Montagues nicht immer der Inbegriff des Bösen gewesen, und die Capulets hatten sie nicht immer verabscheut. Früher waren die beiden großen Häuser von Verona zwar nicht befreundet, aber sich einig gewesen, dass eine Allianz zwischen ihnen weise gewesen wäre. Es hatte Eheschließungen zwischen ihren Familien gegeben.
Aber dann wurde, noch in der Jugendzeit ihres Großvaters, eine Ehe versprochen und beschlossen. Doch die Braut, eine Capulet, war sitzen gelassen worden. Es hieß, der Bräutigam habe die Liebe zur Kirche und zu Gott über die Liebe zu seiner Braut gestellt. Schnell war er zum Kardinal aufgestiegen.
Diese Beleidigung ward nicht verziehen, sondern war Jahr für Jahr gewuchert, verformt und gewachsen und schließlich versteinert zu Hass. So wurde es jedenfalls berichtet. Rosaline war sicher, dass noch mehr zu dieser Fehde gehörte, aber hatte niemanden gefunden, der ihr etwas darüber verriet.
Caterina warf einen Schneesturm von Mehl auf den Holztisch. »Die Montagues veranstalten heute einen Maskenball. Ist das zu fassen? Alle anderen gehen in die Kirche, um sich segnen zu lassen und Gott zu danken. Und die veranstalten einen Ball, kaum dass die Pesttoten verscharrt sind. Aber so pflegten es die Montagues immer zu tun. Wenigstens müssen wir weder teilnehmen noch uns dafür entschuldigen lassen. Gott soll sie strafen.«
Rosaline hörte ihr nur mit halbem Ohr zu. Die Feste der Montagues waren nicht nur in Verona, sondern in der ganzen Republik Venedig berühmt: Feuerschlucker, Gaukler, Jongleure, die besten Musiker, die für Geld zu haben waren (und davon hatten die Montagues viel), Köstlichkeiten wie Taubenpasteten, Rehkeulen, bergeweise Austern, langsam schmelzendes Orangen- und Zitroneneis und Tänze bis zum Morgengrauen.
Doch damit nicht genug. Die Feste wurden in den Gärten der Montagues veranstaltet, in labyrinthartigen Grotten mit wunderlichen Ungeheuern, die kein Capulet jemals erblickt hatte.
Die Gärten waren, so hieß es, vor hundert Jahren von einem Montague erschaffen worden, der aus Trauer um seine verstorbene Frau verrückt geworden war. Außer sich vor Angst sei er gewesen, dass sie sich in der Höllenwüste verlaufen könnte, und hatte die sieben Kreise der Hölle auf dem waldigen Gebiet rund um seine Villa entstehen lassen, sodass er seine Frau in seinen Träumen besuchen konnte. In den Karnevalsnächten zechten Männer und Frauen inmitten der Albträume seiner gequälten Seele, in hohen Zedern-, Ahorn- und Pinienwäldern standen düstere Ungeheuer aus Stein und Moos.
All das hatte Rosaline durch Beschreibungen von Nachbarn und Bekannten erfahren. Bevor sie Valentio geheiratet hatte, hatte Livia mit ihrer Familie eine Feier der Montagues besucht. Wieder und wieder hatte Rosaline sie nach jedem Detail in den Gärten befragt. Natürlich war Livia, als sie eine Capulet geworden war, aus dieser Gesellschaft ausgestoßen worden und hatte nicht mehr bei dem verrufenen Vergnügen dabei sein dürfen. Kein Capulet dachte daran, an diesen Festen teilzunehmen.
Der zögerliche Eid, den ihr Vater ihr abgerungen hatte, war wie ein leises Echo in Rosalines Herzen: ein Dutzend Tage und Nächte. Wenn sie die sündige Welt schon verlassen musste, würde sie vorher die köstlichen Vergnügungen genießen, bis Leib, Seele und Herz gesättigt waren.
Der Gedanke an die Montagues war beängstigend, aber ihr blieb nur wenig Zeit. Wenn der Teufel persönlich der Gastgeber war, würde sie mit Bändern im Haar teilnehmen.
Rosaline ging in ihrem Zimmer auf und ab. Eine Maske wäre sinnvoll. Sie würde ihr Gesicht vor Gott verbergen. Aber vor den Menschen, die sie aus Verona kannten und sie vielleicht wiedererkennen würden, müsste sie eine bessere Verkleidung haben. Auf keinen Fall dürfte sie entdeckt werden. Auch wenn ihr Vater ihr einen Aufschub von zwölf Tagen gewährt hatte, würde er niemals dulden, dass sie diese Zeit so verbringen würde. Das wusste sie genau. Auf den leisesten Verdacht hin würde er sie sofort ins Kloster bringen lassen. Nicht nur, weil sie ohne Anstandsdame einen Ball besuchte, sondern weil dieser Ball im Haus der Montagues stattfand, die er von ganzem Herzen hasste.
Doch woher sollte sie spät am Abend noch eine so überzeugende Maskerade nehmen? Ihre eigene Kleidung würde nicht ausreichen.
Sie warf einen Blick auf die Truhe, die am Fußende ihres hölzernen Bettes stand. Dieses Zimmer hatte Valentio vor seiner Heirat bewohnt, als er noch kein Landhaus besessen hatte. Eine Idee überkam Rosaline, und ihr Herz begann rasend schnell zu klopfen. Wie die Flügel eines aufgeregten Vogels schlug es gegen ihren Rippenkäfig. Sie öffnete die Truhe. Ein abgestandener Geruch schlug ihr entgegen, und eine feine Schicht Holzmehl von den Larven des Holzwurms bedeckte das Leinen obenauf.
Die Truhe enthielt wenig. Die Flügel einer toten Motte, ein vergilbtes Blatt Pergament, einige alte Kleidungsstücke, die Valentio als junger Mann getragen hatte. Sie waren nicht wie üblich an einen Diener weitergereicht, sondern in dieser Truhe verstaut worden, vermutlich um sie für weitere Söhne aufzusparen, die niemals das Licht der Welt erblickt hatten. Eine Jacke mit schwarzen Samtärmeln war etwas zerschlissen und hatte einige Mottenlöcher, eine graue Hose war mit Silberbrokat eingefasst. Weich fühlte sich der Stoff unter ihren Fingern an. Ja, sie würde als junger Mann auf den Ball gehen. In Jacke und Hose, ihr Gesicht hinter einer Maske verborgen, würde sie niemand erkennen.
Mit fliegenden Fingern knöpfte sie ihr Nachtkleid auf und ließ es auf den Fußboden fallen, behielt ihr Unterhemd aber an. Sie blickte auf ihre Brust. Das Binden mit einem Tuch konnte sie sich sparen, ihr kleiner Busen würde unter der Jacke verborgen sein. Sie schlüpfte in Jacke und Hose und schloss die polierten Perlmutterknöpfe. Es war bedauerlich, dass kein Hut in der Truhe gelegen hatte. Darunter hätte sie den langen, dunklen und verräterischen Mädchenzopf, der im Nacken zu einem großen Knoten geschlungen war, verbergen können.
Als Caterina das Zimmer betrat, schrie sie leise auf, als hätte sie sich den Zeh gestoßen.
»Hast du mich für Valentio gehalten?«, fragte Rosaline erfreut.
»Nein, dazu bist du viel zu hübsch. Außerdem ist deine Haut dunkler als seine, und dir fehlt der Bart.«
Rosaline ließ den Kopf hängen. Ihr Unterfangen schien hoffnungslos.
»Und warum würdest du deinen Bruder nachäffen wollen?«
Rosaline schüttelte den Kopf und schwieg.
»Sag es mir, Rosaline. Ich bin deine Freundin und in eurem Haushalt, seit du ein Säugling warst.«
Rosaline zögerte. Lieber wollte sie ihren Plan für sich behalten, nicht aus Angst vor Betrug, sondern davor, was mit Caterina passieren würde, wenn man sie, Rosaline, überführen würde. Doch als sie auf die taubengrauen Hosen heruntersah, fielen ihr ihre zierlichen Pantoffeln mit den Rosenknospen ins Auge. Sie griff sich an den Kopf – sie hatte auch vergessen, ihren Jungfrauenschleier abzunehmen, der im Haar befestigt war.
Caterina begriff, was sie vorhatte, und schrie auf. »Bitte, Marienkäferchen, du kannst nicht einmal daran denken, allein dorthin zu gehen! Es wäre für jede Frau gefährlich, aber erst recht für ein Mädchen wie dich, eine Capulet, ohne Begleitung und so unschuldig!« Zu Tode erschrocken von dieser Vorstellung, legte sie eine zitternde Hand an ihre Kehle. »Du bist noch ein Kind.«
»Ich bin kein Kind«, sagte Rosaline. »Ich weiß nicht, was ich bin. Ich werde niemals eine Frau sein. Sie werden mich wegsperren, und ich werde langsam verdorren wie ein ungepflückter Pfirsich, der am Baum verrottet.«
»Die Nonnen im Kloster sind immer noch Frauen.«
»Sind sie das wirklich? Sie sind mit Gott verheiratet und haben ihren eigenen Willen, ihre Wünsche und Gedanken aufgegeben. Ich bin zu temperamentvoll, um Seine Dienerin zu sein. Ich bin weder demütig noch gehorsam. Ich will zu viel.«
Rosaline sah, dass Caterina darauf nichts einwenden konnte. Sie wiederholte nur: »Geh nicht. Es ist gefährlich.«
»Ich werde gehen. Die Frage ist nur, ob du mir hilfst oder ob du mich an meinen Vater verrätst.«
Als sie beide später den unbeleuchteten Pfad durch die Felder zu den Gärten der Montagues gingen, versuchte der junge Signior Rosaline, nicht jedes Mal furchtsam beim Rascheln der Ahornblätter oder beim Bellen eines Fuchses zusammenzuzucken. Der Abend war warm, die Luft stand, Zikaden zirpten, und Ochsenfrösche quakten in den ausgehobenen Gräben am Rand der Felder. Rosaline, die in ihren geborgten Stiefeln stolperte, schlug nach den Mücken, die ihr um die Ohren sirrten. Ihr Vater würde sie wegsperren, aber bevor es so weit war, würde sie leben. Und vielleicht würde sie sogar eine Möglichkeit finden zu fliehen? Sich dem schrecklichen Zugriff ihres Vaters zu entwinden? Diese Hoffnung war so schwach wie ein Glühwürmchen, das man in einer wolkigen Nacht irrtümlich für einen Stern zur Navigation hielt. Sie ließ den Gedanken wieder fallen.
»Dieser Kniff wird nicht funktionieren«, murmelte Caterina. »Du wirst gezüchtigt und sofort weggeschickt werden, und ich …« Sie beendete den Satz nicht. Was man mit ihr machen würde, wenn Rosalines gewagter Plan aufflog, erfüllte sie mit zu viel Furcht.
Rosaline blieb stehen und legte die Hände auf Caterinas Schultern. »Ich schwöre, dass sie niemals herausfinden werden, dass du mir geholfen hast. Trotzdem musst du jetzt zurückgehen. Mir wird nichts passieren.«
Caterina schüttelte den Kopf. »Ich begleite dich bis zum Eingangstor, du kleiner Kobold. Du warst das süßeste Mädchen, das ich je betreut habe, und das ungezogenste.«
»Du meinst wohl, der keckste Junge.«
»Wenn du ein Junge wärst, würdest du nicht über deinen eigenen Degen stolpern.« Caterina lächelte. »Komm, lass mich deinen Gürtel besser binden. Er fällt zu tief. Und steh anders. Die Hüften vorgeschoben, die Beine ein bisschen auseinander. Schau, so.«
Rosaline versuchte es und stellte einen Fuß auf einen weichen Maulwurfshügel, den anderen an den Rand einer Pfütze.
»Schon besser. Aber man würde meinen, du hast noch nie einen Mann beobachtet. Hast du mit deinem Bruder nie mit einem Holzdegen gekämpft?«
»Valentio hat mir einmal auf den Kopf geschlagen und sich dann zum Gewinner erklärt. Das war es auch schon.«
Caterina verbesserte den Winkel des Hutes und betrachtete sie. Rosaline wand sich unbehaglich unter ihrem kritischen Blick.
»Steh still. Männer winden sich nicht so. So, das ist besser. Aber selbst in dieser Dunkelheit sind deine Wangen zu rosig für einen Jungen.«
Caterina bückte sich, steckte ihre Finger in den Maulwurfshügel und verschmierte ein bisschen Erde auf Rosalines Wangen. »Das muss als leichter Bartschatten genügen. Ich hätte daran denken sollen, Kohle mitzunehmen. Du musst auch Wein trinken, sonst wirkt das seltsam. Aber trink nicht zu viel. Und zuck nicht zusammen, wenn sie fluchen.«
»Sapperlot, das werde ich nicht.«
»Und sprich dieses Wort nicht laut aus, du landest sonst im Höllenfeuer!« Caterina seufzte entmutigt. »Warum du unbedingt zu diesem schrecklichen Ort willst, kann ich nicht verstehen.«
Rosaline lächelte. »Weil er ein dunkles Vergnügen verspricht.«
Sie hatten fast das Ende des Feldwegs erreicht. Von dort an waren der Weg, der zu den Gärten führte, und das Haus der Montagues von brennenden Fackeln beleuchtet. Aus den Schatten drang bereits Musik, und es waren Stimmen zu hören. Rosaline fiel es plötzlich schwer zu atmen. Sie griff nach Caterinas Hand und drückte sie mit ihren geliehenen, viel zu großen Handschuhen.
»Wenn du Angst hast, können wir immer noch nach Hause gehen«, sagte Caterina hoffnungsvoll. »Niemand wird herausfinden, dass wir hier waren.«
»Nein«, antwortete Rosaline. »Horch nur, die Musik. Vor ihr brauche ich mich nicht zu fürchten!« Sie ließ Caterinas Hand los und folgte dem Geräusch wie ein Hungernder, der dem Duft eines Fleischstücks am Spieß roch.
»Warte! Ich muss deine Maske befestigen.« Caterina hielt die Maske hoch. Sie war nicht in dem schicklichen Weiß wie die, die Rosaline beim Karneval oder auf Maskenbällen getragen hatte, sondern schwarz und geschwungen, wie es für einen Herrn passend war. Während sie wartete, dass Caterina sie ihr anpasste, bohrte sie den Absatz ungeduldig in die Erde. Die Stiefel waren mit Papier ausgestopft, weil sie ihr viel zu groß waren.
Endlich lag die Maske eng um ihre Augen an. Wangen, Nase und Mund waren unbedeckt.
»Es juckt.«
»Und wenn schon.«
Rosaline hielt still, als Caterina die Bänder verknotete. Dann verabschiedete sie sich von ihrer ängstlichen Begleiterin und eilte weiter in die Richtung, aus der die Musik kam.
Am Rand des Lichtfeldes blieb sie stehen. Sie lauschte. Der Rest des Gartens lag in dunklen Schatten verborgen. Die Zypressen flankierten die Auffahrt, ihre Spitzen reichten wie Tintenfedern in den nachtblauen Himmel.
Sie war später als die meisten anderen Gäste gekommen, und sie ging den Weg allein. Eine große groteske Figur schälte sich aus dem Schatten und versperrte den Weg. Sie rang nach Atem, als sie sah, was es war: ein riesiges Ungeheuer mit aufgerissenem Maul, der Schlund so weit geöffnet, dass ein ausgewachsener Mann darin stehen könnte, und mit zwei lodernden Fackeln in seinen Klauen.
Es starrte sie aus hohlen Totenaugen an, und sie widerstand mit aller Macht dem Drang, sich umzudrehen und wegzurennen. Einen Augenblick später erkannte sie, dass die Musik aus dem schwarzen Loch seiner Kehle drang. Im flackernden Fackelschein las sie die Worte, die auf die Stirn des Ungeheuers geschrieben waren: Lasciate ogni speranza – Lass alle Hoffnung hinter dir.
Wenn sie die festa besuchen wollte, führte der Weg durch diesen Höllenschlund. Rosaline holte tief Luft und trat in das Maul des Ungeheuers.
Sie kam auf eine Lichtung, auf der rasende Götter herumtollten und kämpften. Herkules warf gerade Cacus zu Boden, während eine Sphinx die Furien ins Visier nahm. Gewaltige Drachen rangen mit brüllenden Löwen und versuchten gleichzeitig, die geifernden Mäuler tobender Hunde abzuwehren. Eine Riesenschildkröte, auf deren Rücken eine Nymphe balancierte, lag nahe einem Wasserfall, in dem eine Flussgöttin badete. Aber sie alle waren in Fels gehauen, als hätte einst Medusa sie mit einem Blick versteinert. Ihre Gesichter waren mit schwarzem Moos und silberfarbenen Flechten bewachsen. Mit langen Fingern griff Efeu nach den Säumen ihrer granitenen Gewänder.
Während Rosaline die Lichtung überquerte, betrachtete sie staunend die Statuen. Maskierte Feiernde drängten sich in den Gärten, niemand beachtete sie. Noch mehr Ungeheuer grinsten sie höhnisch vom schattigen Waldesrand an. Einige hatten Steintische als Zungen, auf denen Speis und Trank standen.
Sie war weder hungrig noch durstig, wollte nur endlich zu der Musik, die ebenfalls über die Lichtung schallte. Auf der Suche nach Pan oder Puck sah sie sich um. Denn wer sonst, außer diesen beiden, könnte in so einer fantastischen Welt musizieren? Doch tatsächlich waren die Musiker von menschlicher Gestalt – kräftige, stark schwitzende Gesellen. Auf Flöten, Violen und zwei Lauten spielten sie eine liebliche Motette und begleiteten eine Sängerin mit einer rauen und zugleich honigsüßen Stimme.
Vor Freude verschlug es Rosaline den Atem. Während sie lauschte, füllte sich die Nacht mit Farben. Es war, als ob die Noten in den Himmel schwebten und ihn perforierten, sodass ein leuchtender Schein hindurchschimmerte. Oh, endlich richtige Musik genießen, die so ganz anders als die tristen Tonsequenzen während der Kirchenandacht war!
Wie konnte es sein, dass Gott nicht diese Musik besser gefiel? Die Noten waren ein Geschenk des Himmels, auch wenn sie höllengleich umherwirbelten.
Sie trat näher heran, drängelte sich durch die lauschende Menge nach vorn wie ein Hund, der in einer kalten Winternacht den wärmsten Platz am Herd erschnüffelte.
Die Sängerin hatte bemerkt, wie hingerissen Signior Rosaline war, und gab amüsiert vor, ihr ein Ständchen zu bringen. Irgendwer drückte Rosaline einen Weinkelch in die Hand. Sie nippte daran und hätte den Wein fast ausgespuckt. Er war sauer wie unreife Maulbeeren. Dennoch wurde ihr Kelch sofort wieder gefüllt, und schaudernd leerte sie ihn. Die Fackeln loderten, die Musik spielte weiter, und maskierte Tänzer bewegten sich zwischen den Bäumen und den Statuen, heulend vor Vergnügen.
Der Wein betäubte ihre Nerven. Neugierig blickte Rosaline sich auf der Suche nach bekannten Gesichtern um, aber die meisten trugen Masken – schwarze, weiße, karminrote, Harlekin- und hier und da sogar gehörnte Teufelsmasken. Einige Gäste versteckten ihre Gesichter hinter Schnabelmasken und waren in dunkle Umhänge gewandet, wie die Pestärzte während des Seuchenausbruchs. Rosaline mochte sie nicht. Sie kamen ihr wie Geister der Toten vor, die sie daran erinnerten, wie flüchtig die Freude war.
Während die Nacht voranschritt, wurden die Festlichkeiten immer wilder und die Feiernden betrunkener. Masken lockerten sich oder wurden im Schatten der Bäume abgenommen. In der Menge erkannte sie Signior Martino und Lucio, die auf der anderen Seite des Hügels wohnten. Sie fragte sich, wer unter den Anwesenden die berüchtigten Montagues waren. Waren es die drei Gestalten, die als Tod, Verzweiflung und Seuche maskiert inmitten der Gäste lauerten? Sie wusste es nicht. Ein hochgewachsener Mann mit einer Satansmaske fiel ihr auf. War er ein Montague? Oder der andere dort? Sie beobachtete, wie ein Mann den Hals einer Frau küsste, ihr Schlüsselbein leckte und dabei seine Hand unter ihre Röcke schob, während sie keuchend nach ihm schlug. Sie standen für alle sichtbar neben Poseidons Teich, während der Gott sie ungeniert mit seinem Dreizack in der Hand beobachtete.
Rosaline war nie zuvor Zeugin einer so sinnlichen Zügellosigkeit geworden. Sie konnte den Blick nicht abwenden, war fasziniert und abgestoßen zugleich.
Die Fackeln, von denen das Wachs troff, zogen die Motten an, und schließlich hörten die Musiker auf zu spielen, um mit den Feiernden zu bechern. Es war tiefe Nacht. Rosaline entdeckte eine Laute, die auf einer Bank vergessen worden war. Sie zog ihre Handschuhe aus, nahm sie hoch und zupfte an den Saiten. Sofort spürte sie, wie sie ein tiefer Frieden überkam, und das Drehen in ihrem Kopf, das ihr der Weingenuss beschert hatte, hörte auf.
Das Instrument war exzellent, sein Klang tief und süß. Sie durfte nicht singen, das hätte ihr Geheimnis verraten, also beschränkte sie sich aufs Spiel. Eine kleine Gruppe begann, ihr zuzuhören, während die Musik wie ein kühler, besänftigender Regen in der angespannten Hitze der Nacht von ihren geschickten Fingern rieselte.
Ein Mann trat hinzu. Er trug keine Maske, war weder zu groß noch zu klein, schlank und muskulös. Als er den Kopf schief legte, um ihr besser zuzuhören, bemerkte Rosaline seinen Augenausdruck. Er wirkte, als ob ihr Lied ihn bewegte. Sein Haar, das unter seinem Hut hervorschaute, war fast so dunkel wie ihr eigenes. Bei jedem Stück, das sie beendete, waren seine Beifallsrufe die lautesten und sein Applaus am kräftigsten.
Nach einer halben Stunde war sie erhitzt. Ihr war übel, ihre Maske war zu eng und rund um ihre Augen von Schweiß getränkt. Sie sehnte sich danach, sie abzunehmen, aber wusste, dass sie es nicht durfte.
Als sie von der Laute aufschaute, erblickte sie zu ihrem Schrecken einen Freund von Valentio. Wenn er sie erkannte, würde er sie verraten. Brennende Panik breitete sich in ihr aus. Sie legte die Laute ab und überlegte, wo sie sich verstecken könnte. Aber bevor sie sich abwenden und weggehen konnte, legte der Fremde fest, aber freundlich einen Arm um ihre Schultern. Sie roch Pinien und Leder.
»Kommt mit, lieber Herr. Warum ziehen wir uns nicht etwas zurück? Ich weiß einen passenden Ort«, sagte er. Er schien ihr Unbehagen zu spüren, geleitete sie weg von der Menge und hin zu einem ruhigeren Teil des Gartens. Der Pfad führte an einem Bach und einigen Statuen niederer Götter vorbei. Pan fläzte sich unter dem Blätterdach der Ahornbäume.
Der Fremde ging gelassen neben ihr her, und trotz ihrer Unruhe beobachtete Rosaline ihn verstohlen. Ihr fiel auf, wie schlank er war, dass er einen eleganten Umhang trug und seine Haut heller war als ihre.