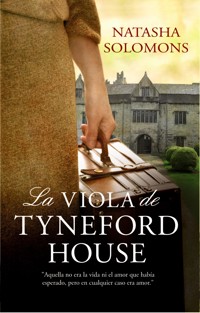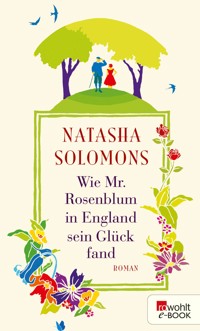4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman in Bildern, die die Lebensstationen einer faszinierenden Frau spiegeln: Juliet hat es schwer, seit ihr Mann sie plötzlich und ohne Abschied verlassen hat. Allein mit ihren beiden Kindern muss sie sich in der stockkonservativen Gemeinde in ihrem Anderssein behaupten und auch noch ihre treuen Eltern trösten, die nachhaltig entsetzt sind über «diese unglückliche Geschichte» mit dem verschwundenen Ehemann. Aber Juliet Montague ist keine Frau, die sich dem Schicksal still fügt. Sie trotzt der Tristesse ihres Alltags mit schöner Unterwäsche (auch wenn sie nie wieder jemand zu Gesicht bekommen sollte), entdeckt ihre Liebe zur Malerei und bricht auf in die großstädtische Kunstszene, um eine Galerie zu eröffnen – inspiriert und begleitet von einer Clique junger, lebensfroher Künstler und dem geheimnisvollen Maler Max, dessen Bilder sie in ihren Bann ziehen. Sie erkämpft sich ihre Freiheit, Schritt für Schritt, Porträt für Porträt, und stellt eines Tages mit Entschiedenheit fest: «Ich bin keine Frau für Wasserfarben, lauter sanfte Rosas und weiche Gelbs. Ich brauche Öl und satte Farben.» Um ihren Frieden zu finden und endgültig frei zu sein, muss Juliet jedoch ihren Ehemann finden und etwas zurückerobern, das George mitnahm, als er sie verließ.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Natasha Solomons
Die Galerie der verschwundenen Ehemänner
Roman
Über dieses Buch
Ein Roman in Bildern, die die Lebensstationen einer faszinierenden Frau spiegeln: Juliet hat es schwer, seit ihr Mann sie plötzlich und ohne Abschied verlassen hat. Allein mit ihren beiden Kindern muss sie sich in der stockkonservativen Gemeinde in ihrem Anderssein behaupten und auch noch ihre treuen Eltern trösten, die nachhaltig entsetzt sind über «diese unglückliche Geschichte» mit dem verschwundenen Ehemann.
Aber Juliet Montague ist keine Frau, die sich dem Schicksal still fügt. Sie trotzt der Tristesse ihres Alltags mit schöner Unterwäsche (auch wenn sie nie wieder jemand zu Gesicht bekommen sollte), entdeckt ihre Liebe zur Malerei und bricht auf in die großstädtische Kunstszene, um eine Galerie zu eröffnen – inspiriert und begleitet von einer Clique junger, lebensfroher Künstler und dem geheimnisvollen Maler Max, dessen Bilder sie in ihren Bann ziehen. Sie erkämpft sich ihre Freiheit, Schritt für Schritt, Porträt für Porträt, und stellt eines Tages mit Entschiedenheit fest: «Ich bin keine Frau für Wasserfarben, lauter sanfte Rosas und weiche Gelbs. Ich brauche Öl und satte Farben.»
Um ihren Frieden zu finden und endgültig frei zu sein, muss Juliet jedoch ihren Ehemann finden und etwas zurückerobern, das George mitnahm, als er sie verließ.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel «The Gallery of vanished husbands» bei Sceptre, Imprint von Hodder & Stoughton/Hachette, UK in London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2014
Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Gallery of vanished husbands» Copyright © by 2013 by Natasha Solomons
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt, nach der Originalausgabe von Hodder & Stoughton Ltd.
Illustration Jim Tierney
ISBN 978-3-644-31171-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Nr. 1 – Frau mit einer Schale Äpfel
Nr. 2 – Badende Frau
Nr. 100 – Juliet «Zappeline» Greene
Nr. 3 – Schau nur, sie fliegt!
Nr. 4 – Juliet in Bewegung
Nr.9 – Sonnenhungrige am Venice Beach
Nr. 31 – An einem trägen Sommernachmittag
Nr. 42 – Das letzte Mal, …
Nr. 75 – Badende Frau
Nr. 101 – Juliet «Zappeline» Montague,meine Mutter
Anmerkung der Autorin
Danksagung
Für meine Eltern Carol und Clive
in Liebe
Und für Luke mit Dank für das Hinauszögern seiner Ankunft, bis das Manuskript (fast) fertig war.
«Die Landkarte eines Gesichtes bringt Dinge zum Ausdruck, von denen die Geographie lernen könnte.»
Patrick Hayman, Aufzeichnungen eines Malers (1959)
Es war Juliet Montagues dreißigster Geburtstag. Das beunruhigte sie nicht über Gebühr, obwohl sie sich eingestand, dass andere Frauen in ihrer Lage durchaus irritiert sein könnten. Als sie um halb sieben aus dem Bett schlüpfte, untersuchte sie ihre Gefühle mit der ihr eigenen Aufrichtigkeit, kam aber zu dem Schluss, dass sie genauso benommen war wie am Tag zuvor, und als sie die Kinder für die Schule fertig machte, verspürte sie auch keinen plötzlichen Drang, nach dem Sherry zu greifen. Dreißig, entschied Juliet, war das Alter, in dem eine Frau am attraktivsten ist. Sie ist vielleicht nicht mehr so in der Blüte wie in den Teens, besitzt auch nicht mehr den Stolz eines Twens, aber mit dreißig hat eine Frau eine Klarheit in ihrem Blick. Jedenfalls galt das für Juliet Montague. Sie wusste genau, was sie wollte.
Und zwar wollte sie einen Kühlschrank kaufen.
An diesem Morgen war es nass und für die Jahreszeit zu kühl, aber Juliet versuchte, das nicht persönlich zu nehmen. Man konnte es unfair finden, wenn es an seinem Geburtstag regnete, und doch musste man ja davon ausgehen, dass jeden Tag irgendjemand Geburtstag hatte, und wenn es an Geburtstagen nie regnen würde, wäre England eine Wüste, und Leonard könnte nirgendwo sein Modellboot fahren lassen. Resigniert knöpfte sie ihren Regenmantel zu, wand sich ihren Schal eng um den Hals und eilte auf dem Weg zur Bahnstation um Pfützen herum, die die Farbe von Tee mit Milch hatten, unsicher wie immer, ob sie ihren Zug überhaupt noch rechtzeitig erwischen würde. Juliet verlor Zeit, Minuten und manchmal sogar eine ganze Stunde, so wie ihrem Vater ständig die Münzen aus der Hosentasche fielen. Der eisige Regen fraß sich in ihre Wangen, und der Wind brauchte keine halbe Minute, um ihren desolaten Regenschirm umzustülpen.
Doch als der Zug in Charing Cross einfuhr, hatte sich der Wintermorgen in einen Frühlingsnachmittag verwandelt. Der rein gewaschene Himmel spannte sich in klarem Blau über Trafalgar Square, und die Tauben hatten sich auf Lord Nelsons ausgestrecktem Arm aufgereiht, um sich von der Sonne trocknen zu lassen wie die Socken auf der Leine. Die weißen Wolkenbäusche sahen genauso aus wie die auf Leonards Bildern, die Juliet in der Küche an der Pinnwand sammelte. Sie warf einen Blick auf die Uhr und überlegte, ob die Zeit reichte, um in die National Gallery zu schlüpfen und ein paar alte Freunde zu besuchen, bevor sie ihre Einkaufstour machte. Bei ihrem letzten Besuch war sie von einer Sonnenblume gepackt worden und hatte den Rest des Nachmittags vertrödelt. Sie hatte das Gemälde betrachtet, bis die gelbe Farbe in Wellen zu vibrieren und zu zittern begann wie flüssiger Sonnenschein, der aus dem Rahmen fiel und sich über den Museumsboden ergoss. Auf dem Weg nach Hause kaufte sie Sonnenblumen und saß beinahe eine Stunde zusammen mit Frieda am Küchentisch und betrachtete die Blumen in ihrer Glasvase, um zu überprüfen, ob Gelb immer zu beben begann, wenn man es nur lange genug ansah.
Sie spürte, wie ihre Entschlossenheit schwand, und sprang in den erstbesten Bus, der vorbeikam – und der, wie sich herausstellte, genau in die falsche Richtung fuhr. Aber da es so ein schöner Nachmittag war, störte Juliet das nicht im Geringsten. Die Aussicht auf einen Spaziergang am Park entlang war genau das Richtige für einen Geburtstag. Sie sah die sauberen Pound-Scheine und die klimpernden Münzen in ihrer Handtasche vor sich und verspürte ein heiteres Kribbeln in ihrer Brust. Einundzwanzig Guineen. Sie hatte noch nie so viel Geld zum Ausgeben gehabt, seit George sie verlassen hatte. Auch das war an ihrem Geburtstag geschehen. Und, dachte sie, während sie dem Schwall Regenwasser auswich, den ein vorbeifahrendes Taxi aufwirbelte, anfangs war er ihr gar nicht mal so schlecht vorgekommen, dieser Geburtstag – da hatte sie aber auch noch nicht gewusst, dass George nicht mehr zurückkehren würde. Sie war bloß irritiert davon gewesen, dass er offenbar ihren Geburtstag vergessen hatte. Keine Karte, nicht mal ein Strauß Blumen aus dem Garten (so einen Strauß hatte er ihr im Jahr zuvor geschenkt, und sie war gerührt gewesen, weil er sich daran erinnert hatte, dass schwarze Tulpen ihre Lieblingsblumen waren, bis sie aus dem Küchenfenster geblickt und gesehen hatte, dass er alle Blumen in ihren Töpfen an der Hintertür abgeschnitten hatte). Ihre Gedanken verloren sich auf vertrauten Bahnen. Wenn er bloß eine Nachricht hinterlassen hätte. Er hätte sie doch auf eine Geburtstagskarte schreiben und gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können: «Liebling, noch viele schöne Geburtstage! Übrigens, ich bin dann mal weg …» Juliet strich das seidene Halstuch glatt, um ihre Gedanken zu beruhigen, und beschloss, an andere Dinge zu denken. Nichts sollte den heutigen Tag verderben. Sie hatte so sorgsam gespart, und endlich würde sie doch noch eine durch und durch moderne Frau werden oder zumindest eine, die nicht so derartig dem Zeitgeist hinterherhinkte. Sich nicht mehr ständig mit dem blöden Eisschrank herumschlagen, die Milchflaschen an Wintertagen zum Kühlen draußen auf dem Fenstersims abstellen müssen oder Fisch oder Fleisch nur an den Nachmittagen einkaufen können, an denen man auch vorhatte, sie zu essen. Sie wusste, wie sehr sich Leonard einen Fernsehapparat wünschte – schon seit einer Weile pflegte er die Freundschaft mit Jungen, die einen besaßen, und wenn er von einem Besuch bei einem von ihnen wieder nach Hause kam, waren seine Wangen gerötet, und er selbst war sehr still und polierte seine kleine runde Brille mit seiner Schulkrawatte sogar noch häufiger als sonst, wobei er stillschweigend all die Wunder noch einmal Revue passieren ließ, die er gesehen hatte. Juliet aber blieb entschlossen; wie aufregend ein Fernsehgerät auch immer sein mochte, es war ein Luxus, und ein Kühlschrank war nun einmal viel wesentlicher. Frieda und Leonard beobachteten mit finsterem Ernst, wie ihre Mutter am Ende jeder Woche wieder eine Handvoll Münzen in die alte Keksdose fallen ließ, die auf dem obersten Regalbrett in der Speisekammer stand. Anfangs waren sie nicht sehr begeistert gewesen: Leonard war verblüfft, dass irgendjemand auf etwas anderes sparen konnte als auf einen schicken Wagen oder einen Fernseher, und Frieda, die ihr ganzes Taschengeld schon am Nachmittag, an dem sie es erhielt, wieder für Süßigkeiten ausgab, dachte an das Geld in der Dose in Form von weißen Schaumgummi-Mäusen, die sich dicht an dicht aneinanderreihten – sie war sich ganz sicher, mit dem Geld so viele Mäuse kaufen zu können, dass man die ganze Strecke bis nach Bognor Regis mit ihnen auslegen könnte (ein Ort, den sie auf der Karte nicht hätte ausfindig machen können, der ihr aber fast unendlich weit von Chislehurst entfernt schien).
Frieda hatte recht: Das Geld in der Keksdose stand für lauter Freuden, die man sich nicht gönnte. Bei «Peter Pan» hatten sie auf den billigsten Plätzen hinter einer Säule gesessen, und Juliet hatte beinahe geweint, als Leonard vor Enttäuschung zusammengesunken war, weil er nicht sehen konnte, wie sich Peter mit dem Buschmesser zwischen den Zähnen über die Bühne schwang. Einen Monat lang hatten sie nur dreimal in der Woche Fleisch zum Abendessen gehabt (zweimal zu Hause und an den Freitagen bei der Großmutter). Juliet hatte versucht, auf der Hauptstraße zu den normalen Metzgern hineinzuschlüpfen, um nicht das teure koschere Fleisch kaufen zu müssen, aber Mrs. Epstein hatte sie beim Herauskommen gesichtet und es Juliets Mutter erzählt, die sich so darüber aufgeregt hatte, dass ihre Tochter ihr Seelenheil wegen eines mageren Stücks Hammel riskierte, dass Juliet ihr versprochen hatte, es nie wieder zu tun. Frieda und Juliet brauchten beide neue Kleidung, allerdings keine Unterwäsche, weil Juliet beschlossen hatte, dass sie alle möglichen Entbehrungen ertragen könnte, solange ihre Höschen hübsch waren, selbst wenn niemand sie je wieder in Unterwäsche zu Gesicht bekäme. Sie weigerte sich, eine von jenen Frauen zu werden, die die Mrs. Epsteins dieser Welt kopfschüttelnd anstarrten, um mit einem Hauch Befriedigung zu murmeln: «Ach, sie war so ein hübsches Ding, aber wie hat sie sich doch gehenlassen nach dieser Geschichte mit ihrem Ehemann!» Nun konnte sie wenigstens, wenn sie sich mit böswilligem Mitleid gemustert fühlte, an ihre Seidenhöschen denken und zurücklächeln.
Ihre Eltern hatten ihr die fehlenden zehn Guineen beim Abendessen am Samstag gegeben. Mr. Greene schob Leonard die Scheine über den Tisch zu («Heb die gut für deine Mutter auf, ja …»), während Mrs. Greene ihre Tochter ein wenig unglücklich anschaute und zwischen einigen Bissen Hühnerfleisch überlegte: «Bist du sicher, dass du dir zu deinem Geburtstag nicht lieber etwas hübschen Schmuck kaufen möchtest?» Juliet schüttelte den Kopf, zur Vernunft entschlossen. Sie wusste, dass ihr frisch geprägter Sinn fürs Praktische ihre Eltern traurig stimmte. Auf der einen Seite waren sie schrecklich stolz darauf, wie gut sie zurechtkam. «Es ist wirklich nicht leicht, was du zu stemmen hast, meine Zappeline», sagte ihr Vater und prostete ihr mit seinem wöchentlichen Schnaps zu. Doch Juliet wusste sehr gut, dass ihre Eltern das entschieden unpraktische Mädchen vermissten, das sich in der einen Woche nach Tennisstunden verzehrte und in der nächsten nach einem Gemüsebeet, in dem es Rhabarber züchten konnte. Sie wollten ihre Tochter mit Goldschmuck überschüttet sehen und nicht wegen eines Kühlschranks knausernd. Eines Freitagabends gestand Mrs. Greene Juliet, dass sie glaubte, selbst verantwortlich zu sein für das, was sie «die unglückliche Geschichte» zu nennen bevorzugte. Nachdem sie, was äußerst untypisch für sie war, einen Sherry getrunken hatte, bekannte sie sich zu der Annahme, dass Juliets Name an allem schuld war. Sie hatten eigentlich vorgehabt, sie Ethel zu nennen, ein guter, vernünftiger Name für die Sorte bodenständiger junger Frauen, die gerne gärtnerten und braune Schuhe trugen und nie vergaßen, ihre Mutter vorm Schabbes anzurufen, aber als sie auf der Woge euphorischer Gefühle nach der Geburt ihres einzigen Kindes davongetragen wurde, erlitt Mrs. Greene einen Anfall von Romantik (der einzige, den sie je in ihrem Leben erdulden musste, um die Wahrheit zu sagen) und nannte ihr Baby plötzlich Juliet. Irgendwie schien ein Mädchen namens Juliet für jene bestimmte Art von Drama vorgesehen, wie nannte man das noch? Jambisch. Ja, Juliets waren für jambische Dramen bestimmt, auf eine Weise, wie Ethels nicht dafür bestimmt waren.
Die Bayswater Road war einer von Juliets Lieblingsorten. Der alte Eisenzaun sorgte für eine entzückende Trennlinie – die Straße auf der einen Seite und der Hyde Park auf der anderen, wo sich grüne Blätter wie Finger zwischen den Stangen hindurchschoben und der Vogelgesang in die Stadt hinausdrang. An den Tagen, an denen es noch einen George gegeben hatte und freie Nachmittage etwas Normales gewesen waren, brachte Juliet gern ihre Kinder in ihrem Kinderwagen hierher zu diesem Rechteck der Stille inmitten des Getrappels der Londoner Straßen. Auch jetzt noch liebte Leonard die Peter-Pan-Statue, die sich mitten in einem Gewirr von Eschen versteckte. Er tat gern so, als hätte er sie vergessen, um dann umso begeisterter wieder auf sie zu stoßen. Männer in Anzügen eilten zurück in ihre Büros und wischten sich die Sandwichkrümel von den Aufschlägen ihrer Nadelstreifen-Anzüge, und Stenotypistinnen in hübschen Wollmänteln schlenderten untergehakt von ihrem Lunch im Park zurück. Die Mädchen waren in einem Alter, in dem man all sein Geld gleich wieder ausgibt, Freundschaften für die Ewigkeit schließt und jede davon überzeugt ist, diejenige zu sein, die einmal Cary Grant heiratet. Nein. Das war wohl nicht mehr aktuell, wie Juliet jetzt einsah. Das war, als sie selbst achtzehn gewesen war. Heutzutage träumten die Mädchen vermutlich eher von Elvis Presley oder James Dean.
Juliets liebste Zeit an der Bayswater Road war der Sonntagnachmittag, wenn der Zaun sich von Trennlinie in Zielort verwandelte und mit Bildern jeglicher Farbe, jeglichen Stils und jeglichen Talents geschmückt war. Es störte sie nicht, dass manche der Bilder schlecht waren und die Landschaften gewöhnlich schlammige Idylle unter trübem Himmel darstellten, die Sterne übergroß und der Mond zu blau waren oder dass die Schönheit auf den Aktbildern in Wahrheit hässlich war. Man konnte jederzeit etwas Gutes zwischen den eher konventionellen Bildern entdecken, und wann immer sie so etwas aufstöberte, hatte Juliet das Gefühl, ein Geheimnis enthüllt zu haben, das nur ihr ganz allein gehörte.
Seit Jahren hatte sie keinen Nachmittag an der Bayswater Road mehr gehabt. Nicht seit der unglücklichen Geschichte mit George. Jetzt schienen die Sonntage ausnahmslos mit den Rückständen ausgefüllt, die von der Woche angespült wurden: Wäscheberge und halb erledigte Grammatikaufgaben, Geschirr, das sich schwermütig wie ein gesunkenes Schiff in der Spüle stapelte. Sie wollte sich gerade ein paar Augenblicke seltenen Selbstmitleids gönnen (schließlich war es ihr Geburtstag), als sie zu ihrer Freude bemerkte, dass etwas weiter entfernt an der Straße jemand begonnen hatte, Leinwände am Zaun aufzuhängen. Dies war eine unerwartete Besonderheit für einen gewöhnlichen Mittwoch, und sie eilte in glücklicher Erwartung den Bürgersteig entlang. Es handelte sich um eine Serie mit Aquarellen von Londoner Straßen, leidenschaftslose Darstellungen für Touristen, aber sie studierte sie trotzdem und genoss das träge Vergnügen des Wiedererkennens. Der Standbesitzer schob ihr eine hingeworfene Skizze vom House of Parliament in die Hände, aber Juliet war bereits abgelenkt. Fünfzig Meter weiter lehnte ein junger Mann Leinwände an den Zaun. Sie kam näher und blieb vor dem Porträt eines jungen Mädchens mit kurz geschnittenem braunen Haar stehen, das einen schlüsselblumengelben Rock trug, auf dem das Sonnenlicht funkelte, das durch ein offenes Dachfenster fiel. Das Mädchen hatte seine Beine unter den Körper gezogen und hockte vorgebeugt wie ein selbstvergessenes Kind, in die Seiten eines Buchs vertieft. Das Bild pulsierte vor Licht. Es wirkte auf Juliet, als hätte der Maler eine Handvoll Morgensonne nach der anderen gepackt und über die Leinwand ausgegossen. Wie war es ihm nur gelungen, sie auf dem Bild festzuhalten, ohne dass sie heruntertropfte? Juliet blickte auf das Trottoir und erwartete beinahe, zu ihren Füßen Pfützen voller Sonnenlicht zu entdecken.
«Ich werde es Das Vorrecht der Ruhe nennen», sagte eine Stimme, und Juliet drehte sich um und bemerkte den Maler zum ersten Mal richtig, registrierte seine blasse Stubenhocker-Haut und den leichten Geruch nach Terpentin. Er verströmte eine Aura gekünstelter Dekadenz, zwischen seinen Lippen hing eine Zigarette, und er trug verblichene Jeans, die am Knie zerrissen und kunstvoll mit Farbe verschmiert waren.
«Nein», sagte Juliet. «Es heißt Studie über das Sonnenlicht.»
Sie spürte, wie er sie forschend betrachtete, wobei sich seine Augen zu Briefschlitzen verengten, und ihre Wangen begannen zu glühen, bis sie fast bedauerte, dass sie überhaupt etwas gesagt hatte. Aber nein, sie hatte absolut recht gehabt. Was auch immer seine Absichten gewesen waren, dies war kein politisch engagiertes Gemälde in der Tradition des Spülbecken-Realismus. Das Bild hatte sich selbst erklärt und ein Eigenleben jenseits des Malerpinsels begonnen. Wenn er das noch nicht begriffen hatte, dann musste es ihm eben jemand erläutern. Plötzlich lächelte er, sein Stirnrunzeln wurde von einem breiten Grinsen abgelöst, und Juliet wurde klar, wie jung er noch war, nicht älter als neunzehn oder zwanzig.
«Ja, in Ordnung. In Ordnung.» Er nickte ihr zu und hob seine Hände, als wäre er beim Äpfelstehlen erwischt worden. «Ich dachte, ich probiere mal was anderes. Hat nicht ganz geklappt, oder?»
Juliet lächelte ebenfalls. «Nein. Tut mir leid. Aber es ist ein wunderbares Gemälde.»
Der junge Mann nickte. Er versuchte, ungezwungen zu wirken, aber seine rosaroten Ohren verrieten ihn. Juliet spähte nach der Signatur auf den Gemälden.
«Charlie Fussell? Sind Sie das?»
Zur Antwort streckte er seine Hand aus, und Juliet schüttelte sie, wobei sie die Schwielen und die Hornhaut auf seiner Handfläche spürte. Die Hand eines Malers.
«Juliet Montague.»
«Es freut mich, Sie kennenzulernen, Miss Montague.» Charlie behielt ihre Finger einen Moment zu lange in der Hand, und Juliet entzog sie ihm entschlossen, brachte ihre Hand wieder an dem Riemen ihrer Handtasche in Sicherheit und vermutete, dass er sich über sie und ihre steifen Mittelschicht-Manieren zutiefst amüsierte.
«Es ist …» Sie wollte ihn schon berichtigen und diesem Jungen erklären, dass sie Mrs. Montague war, als ihr wieder einfiel, dass sie das ja auch nicht mehr so richtig war – nur noch quasi. Und was hatte das hier ohnehin zu bedeuten, und warum sollte es ihn interessieren?
Sie räusperte sich. «Was kostet das Gemälde, bitte?»
«Einundzwanzig Guineen.»
Juliet spürte, wie die Bayswater Road um sie herum in Schweigen versank, als ob jemand die Nadel von einer Grammophon-Platte abgehoben hätte und sie sich ohne Ton weiterdrehte. Ihr Mund war trocken, und ihre Zunge klebte schwer an ihrem Gaumen. Einundzwanzig Guineen. Juliet glaubte nicht an Schicksal. Zufall war etwas, dem man nicht trauen konnte und das einen zu Übermut verleitete, und dann verpfändete George ihren Pelzmantel und die kleinen Saphir-Ohrringe, die sie zu Chanukka geschenkt bekommen hatte, und alle möglichen anderen Unerfreulichkeiten geschahen, und doch, und doch, war dieses Gemälde für sie bestimmt. Es sollte ganz eindeutig ihres sein. Sie hatte versucht, pflichtbewusst und vernünftig und alles zu sein, was sie sein wollte, und sie hatte versucht, nach einem neuen Kühlschrank zu streben und bloß für ihre wohlerzogenen, schlecht frisierten Kinder zu leben, aber das konnte nicht alles sein. Sie wollte dieses Gemälde. Das war ein anständiges Geburtstagsgeschenk, nicht so ein blöder Kühlschrank.
«Ich nehme es.»
Juliets Stimme war nicht mehr als ein Flüstern, und ihre Hand zitterte ein wenig, als sie in ihre Tasche griff und nach der Geldbörse fischte. Sie merkte gar nicht, wie sich Charlies Augen weiteten, als sie den exorbitanten Preis so bereitwillig akzeptierte – da sie noch nie ein Bild gekauft hatte, wusste sie nicht, dass sie eigentlich hätte feilschen sollen.
«Würden Sie es mir bitte einpacken?»
«Ich verkaufe es nicht», sagte Charlie.
Ein Anflug von Wut rann Juliets Rücken hinab.
«Wenn Sie mehr Geld wollen, dann haben Sie unglücklicherweise Pech gehabt. Das ist meine gesamte Ersparnis, und ich sollte sie eigentlich verwenden, um einen Kühlschrank zu kaufen.»
Charlie lachte. «Einen Kühlschrank? Sie glauben, Kunst kann man mit Haushaltswaren gleichsetzen? Jetzt werde ich es erst recht nicht mehr an Sie verkaufen.»
Juliet kniff die Lippen zusammen und runzelte die Stirn. Sie kam zu dem Schluss, dass dies eine Art von Spiel war, das sie nicht ganz verstand.
«Sie wollen dieses Bild doch gar nicht», verkündete Charlie.
Juliet sagte immer noch nichts.
«Sie wollen ein Bild von sich selbst. Ein Porträt. Ich male Sie für denselben Preis. Einundzwanzig Guineen.»
Juliet blickte den jungen Fremden an und fragte sich, ob er sie veräppeln wollte, aber er sah sie unverwandt an, den Kopf zur Seite geneigt, als überlege er bereits, welche Farbe er für ihre Lippen, ihre Augen brauchte. Konnte sie es wagen? Sie dachte an jene leere Wand in dem vollgestopften kleinen Haus in Chislehurst und erwog zum tausendsten Male, dass sie George vielleicht irgendwann vergeben hätte, wenn er nicht das Bild mitgenommen hätte. Auf dem vor ihr war das Mädchen in der Morgensonne in ihr Buch vertieft und ahnte nichts von Juliets Unbehagen.
«Ich möchte Sie malen. Sie haben ein gutes Gesicht. Nicht schön. Interessant.»
Juliet lachte, als ihr bewusst wurde, dass er ihr schmeichelte. Sie schloss die Augen und neigte ihr Gesicht der warmen Nachmittagssonne entgegen, im Bewusstsein, dass er sie mit dieser forschenden Art eines Malers ansah und über ihr Gesicht grübelte, als wäre es ein zu lösendes Rätsel. Sie merkte, wie sehr ihr das gefiel. Nach der Geschichte mit George hatten die Rabbis darauf bestanden, dass Juliet als Witwe weiterleben musste. Er war derjenige, der verschwunden war, aber zu ihrer Bestürzung hatte Juliet bald festgestellt, dass sie es war, die stillschweigend Stück für Stück verschwand. In jenem Augenblick, an ihrem dreißigsten Geburtstag, beschloss sie, dass sie mehr wollte als Kühlschränke, ja sogar mehr als Bilder von Mädchen, die im Sonnenlicht lasen. Juliet Montague wollte gesehen werden.
Am Freitagabend saß Juliet mit ihrer Mutter in der Küche und betrachtete den schwankenden Turm von schmutzigem Geschirr auf der Anrichte. Ihr war klar, dass sie jetzt nicht spülen konnte. Man durfte nichts anrühren, bis der Sabbat vorüber war. Abwaschen war schließlich Arbeit, und jegliche Arbeit war verboten. Rauchen war ebenfalls tabu. Sie sehnte sich wirklich nach einer Zigarette, aber Mrs. Greene bekäme gefährliches Herzrasen, wenn sie es wagte, ein Streichholz anzuzünden.
Aus dem Wohnzimmer konnte Juliet hören, wie ihr Vater Leonard zum x-ten Male geduldig erklärte, warum er nicht mit ihm nach oben ins Gästezimmer gehen und mit seiner Hornby-Bahn spielen konnte. Das war eine Leidenschaft, die sie beide teilten, und durch sie schien Mr. Greene in seinem achtjährigen Enkelsohn den Sohn zu finden, nach dem er sich immer gesehnt hatte. Sie verbrachten Stunden damit, Signale zu ändern, Schienen neu zu verlegen und die Lokomotiven frisch zu bemalen. Die Freitage allerdings waren immer schwierig. Leonard konnte einfach nicht verstehen, warum er bei seinem Großvater sein und doch nicht mit der Eisenbahn spielen durfte. Die geduldigen Erklärungen seines Großvaters über bewegliche Teile, Arbeit und Räder leuchteten Leonard nicht ein, er kam schlicht zu dem Schluss, dass der liebe Gott öffentliche Verkehrsmittel nicht mochte.
Juliet wusste, dass die Verwirrung ihres Sohnes ganz und gar ihre Schuld war. Kurz nach ihrer Heirat hatte sie entdeckt, dass es ihr nicht wichtig war, die Kaschrut-Gesetze in ihrem eigenen Hause einzuhalten. Als sie das erste Mal versehentlich Erdbeeren mit Sahne aus einer Schüssel gegessen hatte, aus der sie sonst Hühnersuppe aß, hatte sie sie, wie man es von ihr erwartete, am Fuße ihres Gartens in der Erde vergraben. Das zweite Mal spülte sie die Schüssel bloß aus und stellte sie wieder in den Geschirrschrank. Nichts geschah, sie verspürte bloß leichte Schuldgefühle. Als sie das dritte Mal die Regeln brach, waren selbst die Schuldgefühle verschwunden, und stillschweigend tauschte Juliet die jüdische Standardausrüstung – ein Satz Geschirr für Milch und einer für Fleisch – gegen die der Mittelschicht ein, ein Satz für den Alltag und einer für festliche Anlässe. Kein Wunder, dass der arme Leonard nicht wusste, wie man sich in einem jüdischen Haushalt zu benehmen hatte.
Juliet sah sich in der Küche ihrer Mutter um: der bescheidene Herd mit der einzigen elektrischen Kochplatte und dem wackeligen Ofen, der beschwatzt werden musste (von Mrs. Greene) oder getreten (von Juliet), um anzuspringen; die verblichenen Vorhänge, die in der Abendluft flatterten und die Juliets Kindheit über grün und gelb gewesen waren, aber nun zu einem undefinierbaren Grau ausgewaschen waren. Der Abend war kühl und wolkenlos, und am Himmel funkelte eine Reihe früher Sterne. Eine Brise raschelte in den Blättern des Apfelbaums, und dennoch saßen sie in der stickigen Küche, deren Hintertür fest verschlossen war, und tranken den viel zu starken Tee ohne Milch, weil sie das immer schon so getan hatten.
«Mama, wir könnten uns doch für einen Moment in den Garten setzen.»
«Besser nicht.» Mrs. Greene schüttelte den Kopf und packte ihre Tasse noch fester, ohne eine Erklärung abzugeben. Juliet runzelte die Stirn und nahm das Haus ihrer Kindheit seit langem zum ersten Mal wieder richtig wahr. Die Küche war muffig und dunkel und roch nach dreckigem Geschirr und abgestandenen Suppen. Sie wollte im Sternenlicht sitzen und kühle, frische Luft atmen.
«Komm schon. Das ist sicher schön.»
«Dein Vater hat die Bank noch nicht repariert.»
«Er wird sie nie reparieren. Wir können auf der Hintertreppe sitzen.»
Mrs. Greene schreckte zurück. «Das können wir nicht. Das ist doch ordinär.»
Juliet schritt zur Spüle, um ihre Verärgerung zu verbergen, und fügte dem Haufen schmutzigen Geschirrs noch ihre Tasse hinzu. Mrs. Greene räusperte sich, wie sie das immer tat, wenn sie nervös war. «Dein Vater denkt, dass er vielleicht nach Amerika gegangen ist. Das tun viele von denen, weißt du.»
Juliet sagte nichts. Sie wollte nicht über George nachdenken. Es war ein viel zu schöner Abend, um ihn mit so etwas zu verderben. Mrs. Greene, die das Schweigen ihrer Tochter als Kummer missdeutete, streckte die Hand aus und umschloss Juliets Rechte. «Mach dir keine Sorgen, Liebling. Dieses Jahr werden wir ihn finden. Wir werden diese unglückliche Geschichte ein für alle Mal klären, und dann kannst du wieder heiraten.»
Juliet blickte hinunter und bemerkte die Gänsehaut, die ihren ganzen Arm hinaufkroch, obwohl ihr gar nicht kalt war.
Einen Monat später saß Juliet auf einem ramponierten Sofa in einer hellen Dachwohnung – nein, keiner Wohnung, sondern einem Studio, wie Charlie sie anhaltend korrigierte.
«Ich will das Kartenspiel auf dem Tisch liegen haben. Das ist symbolträchtig.» Charlies Stimme, die Juliet an Leonards Tonfall erinnerte, wenn er seinen Spinat nicht essen wollte, klang jetzt gereizt.
«Also für mich nicht. Ich spiele nicht.»
Charlie hörte einen Augenblick auf zu schmollen und blickte Juliet leicht überrascht an. «Sie spielen keine Karten? Aber jeder mag doch Karten.»
«Tja, ich nicht. Ich hasse sie. Und ich will sie nicht auf meinem Bild haben.»
Juliet war von ihrer eigenen Schroffheit überrascht. Mit dem peinlichen Gefühl, zu viel von sich verraten zu haben, versuchte sie, ihren Ausbruch durch ein Lächeln zu mildern und so zu tun, als sei es ein Scherz gewesen. «Da ich Ihnen die fürstliche Summe von einundzwanzig Guineen bezahle, darf ich auch entscheiden. Himmel noch mal, was bin ich wieder dominant. Ich vermute, reiche Leute sind immer so.»
Charlie lachte, und Juliet schloss eine Sekunde lang die Augen, wieder einmal schockiert darüber, wie jung er war, und ein wenig erschrocken über ihre eigene Kühnheit. Sie sollte eigentlich bei der Arbeit sein und bei Greene & Son, Spectacle Lens Grinders Anrufe entgegennehmen, Auftragsbücher ausfüllen und Rechnungen für Brillengläser schreiben. Da Juliet das einzige Kind geblieben war, gab es gar keinen Sohn, aber Mr. Greene versicherte ihr stets, dass der Zusatz «& Son» nur den Eindruck eines etablierten Familienunternehmens erwecken sollte. Dennoch gab es ihr jedes Mal einen Stich, wenn sie die Firmenfassade erblickte, eine beharrliche Mahnung daran, dass die Enttäuschung ihres Vaters über seine Tochter schon mit dem bloßen Fakt ihrer Geburt eingesetzt hatte. An diesem Nachmittag hatte sie, anstatt bei den anderen Büromädchen zu sitzen (die man immer noch «Mädchen» nannte, obwohl Juliet die Einzige unter fünfzig war), einen Zahnarzttermin vorgetäuscht. Sie hatte, unsicher darüber, ob es Gewissensbisse oder das Freiheitsgefühl waren, was ihr Herz höher schlagen und die Bluse unter den Achseln kleben ließ, den Zug nach London genommen und Charlies triste Wohnung – nein, sein Studio – in Fitzrovia ausfindig gemacht.
«Also, irgendetwas muss auf dem Tisch stehen, sonst stimmt die Symmetrie nicht. Ich brauche etwas Farbe.» Charlie entfernte sich etwas von der Leinwand, die er neben dem Fenster aufgestellt hatte, und betrachtete die Bildkomposition.
Juliet sah sich in dem kleinen Raum um. Bilder bedeckten jede Fläche – Wände, Türen, Bücherregale, selbst die Dachschräge war mit Kohlezeichnungen von Schwimmerinnen am Meeresufer mit Grübchen in den Schenkeln bedeckt. Drei Wäscheleinen führten im Zickzack zwischen den niedrigen Deckenbalken entlang, an denen Aquarelle und Pastellzeichnungen wie Unterwäsche flatterten. Es war kein einheitlicher Stil auszumachen – dies war der Unterschlupf verschiedener Maler –, und die Bilder befanden sich in allen möglichen Phasen der Fertigstellung, von groben Bleistiftskizzen bis zu vollendeten Ölgemälden, die an den Wänden lehnten. Eine Serie von Gouachen mit Meerlandschaften flatterte an ihren Heftzwecken wie kleben gebliebene Motten. Der Fußboden war nackt, wo er nicht mit Bildern bedeckt war, die Dielen abgeschliffen, sodass das weiche, helle Holz zum Vorschein kam. Die Deckenstreben waren ebenfalls freigelegt worden, das Holz abgeschmirgelt und weiß gestrichen. Obwohl das Zimmer klein war, atmete es Licht, und Juliet hatte das Gefühl, in einem hellen Holzschiff über London zu schweben. Sie atmete den Geruch von Terpentin und Ölen ein und darunter den ausgeprägten Geruch des alten Hauses selbst, den Duft früherer Leben, nach Paraffin und Bienenwachs, Schweiß und Rauch, Staub und Holzwurm. Es war anders als an jedem Ort, an dem sie bislang gewesen war, und die Stille und das Gefühl konzentrierten Fleißes erfüllten sie mit wortloser Zufriedenheit.
«Das ist es! Das ist der Ausdruck, den ich möchte», rief Charlie aus. «Nein. Jetzt ist er wieder weg. Sie haben gelächelt. Macht aber nichts. Ich werde mich daran erinnern.»
Juliet streckte sich auf dem Sofa aus, zog die bestrumpften Zehen hoch und sah zu, wie er Pinsel und eine Palette Wasserfarben hervorholte. Sie runzelte die Stirn, wollte sich aber nicht beschweren, bis ihr wieder die fürstlichen einundzwanzig Guineen einfielen.
«Nein danke. Ich möchte nicht in Wasserfarben gemalt werden. Ich bin keine Frau für Wasserfarben, lauter sanfte Rosas und weiche Gelbs. Ich brauche Öl und satte Farben.»
Charlie blickte sie überrascht an. «Die Wasserfarben sind nur für eine Skizze, aber ich werde sie gar nicht verwenden, wenn Ihnen das so viel ausmacht.» Er schob sich den Pinsel hinters Ohr und musterte sie erneut. «Sie malen auch, nehme ich an?»
Juliet kicherte und schüttelte den Kopf. «Nein, ich bin keine Malerin, bloß ein Betrachterin.»
«Eine was?»
«Es ist eine Gabe, so wie andere Leute ein Kreuzworträtsel in genau zehn Minuten hinkriegen oder den perfekten Apfelstrudel machen können. Ich kann nicht zeichnen oder malen, aber ich kann Bilder sehen. Sie wirklich sehen. Es ist nicht die nützlichste aller Gaben, und sowohl meine Mutter als auch meine Kinder würden es entschieden besser finden, wenn ich Apfelstrudel machen könnte.»
Charlie starrte sie weiter an, die dicken Augenbrauen zusammengekniffen. Juliet seufzte und versuchte, es ihm zu erklären.
«Ich bin immer schon gern in Museen und Ausstellungen gegangen – das war immer schon das, worum ich meine Mutter angebettelt habe, aber ich habe nicht gemerkt, dass ich anders sehe als andere Kinder, bis ich ungefähr zehn Jahre alt war. In der Schule bekamen wir die Aufgabe, unser Lieblingsspielzeug zu zeichnen. Ich vermute, die Lehrerin wollte etwas Fröhliches haben, um das eher trostlose Klassenzimmer zu schmücken. Ich weiß nicht mehr, was ich gezeichnet habe. Ich weiß, dass es nicht sehr gut war. Wir hefteten alle unsere Zeichnungen an die Wand, und sie waren alle ganz gewöhnlich, nicht der Rede wert, bis auf eine. Annas Kaninchen. Es war ein perfektes Porträt. Ich konnte nichts anderes mehr ansehen als diese eine Zeichnung. Ich hörte den anderen Mädchen zu, sah, wie sie an Annas Kaninchen vorbeischauten und seine besondere Schönheit gar nicht bemerkten, und begriff es auf einmal. Anders als Anna konnte ich nicht zeichnen oder malen, aber ich konnte sehen.»
Juliets Magen knurrte, sie war zu aufgeregt gewesen, um zu frühstücken, und es war schon beinahe halb zwei.
«Haben Sie irgendetwas zu essen?»
Charlie deutete mit dem Kopf auf die provisorische Küche, deren Spüle mit Pinseln und einem Wasserkessel gefüllt war. «Da könnten ein paar Äpfel liegen.»
Sie tappte durch das Zimmer, bahnte sich einen Weg um die Papierstapel und die Leinwände herum. Auf einer wackeligen Kommode stand eine Schüssel mit Granny Smith-Äpfeln. Sie zeigten ein kräftiges, helles Grün zwischen dem verblichenen Holz und den dezenten Malerfarben. Juliet griff nach der Schüssel und stellte sie auf den Tisch, wobei sie das Kartenspiel auf den Fußboden warf.
«Hier haben Sie es. Farbe. Und außerdem war es ein Apfel, weswegen meine Familie nach England gekommen ist.»
«Ein Apfel?», fragte Charlie routiniert, in Gedanken bereits bei seinem Gemälde. «Streichen Sie bitte Ihr Haar zurück. Hinter die Ohren. Ja. So ist es gut. Und sprechen Sie ruhig weiter, ich mag das.»
Juliet lehnte sich auf dem Sofa zurück, polierte geistesabwesend den Apfel an ihrem Rock, sah zu, wie Charlie die Leinwand präparierte, Farben mischte und dann mit weiten Schwüngen mit einem Schwamm den Fußboden andeutete, das Lichtdreieck vom Fenster, das gelbliche Weiß der Zimmerdecke. Juliet erzählte, wobei ihr durchaus klar war, dass Charlie nicht richtig zuhörte. Seine zerstreute Aufmerksamkeit fand sie seltsam tröstlich. Sie hätte alles Mögliche sagen können – absolut unverschämt sein, schockierend, sogar obszön, und er würde es nicht einmal merken. Mit einem Seufzen kam sie jedoch zu dem Schluss, dass nichts, was sie zu erzählen hätte, einem jungen Studenten schrecklich sündhaft oder gemein vorkommen würde. Sie wünschte, sie hätte etwas wahrhaft Abscheuliches zu gestehen, eine Begierde oder eine Geschichte, bei der sich seine Augen weiten würden, wie die des Rabbis, als ihre Mutter sie gezwungen hatte, die Geschichte mit George zu erzählen, und der Rabbi da gesessen hatte und seinen Bart um seinen Finger gewickelt hatte, bis Juliet vergaß, was sie da sagte, weil sie so fasziniert davon war, dass sein kleiner Finger lila angelaufen war. Sie stieß ein kleines Lachen aus. Sie könnte Charlie von George erzählen. Würde er das komisch finden oder bloß traurig?
«Erzählen Sie mir diese Sache mit dem Apfel», sagte Charlie.
«Also gut», erwiderte Juliet, dankbar und zugleich enttäuscht darüber, dass ihr das Geständnis erspart geblieben war. «Also. Wir kamen wegen eines Apfels aus Russland hierher. Meine Großmutter Lipschitz machte allen Jungen schöne Augen, aber in Wahrheit hat sie immer nur einen geliebt, einen gewissen Cohen. Ich stelle mir gern vor, dass er sie ebenfalls liebte, aber dieser Teil der Geschichte ist nicht so präzise überliefert. Einmal habe ich meine Mutter gebeten, das klarzustellen, aber sie schien es nie für relevant zu halten, ob die Liebe nun erwidert worden war oder nicht. Meine Mutter ist keine Romantikerin. Wie auch immer, als Großmutter Lipschitz ungefähr zwölf Jahre alt war, döste sie in der Sonne in einem Obstgarten am Dorfrand und neckte ein paar Jungen aus dem Ort, die zwischen den Bäumen Ball spielten. Als der Ball in Großmutter Lipschitz’ Schoß landete, hielt sie ihn fest und weigerte sich, ihn zurückzugeben. Ein Junge flehte sie an, aber – und Sie müssen diese Tatsache im Kopf behalten – der Junge war nicht Cohen. Er sagte so etwas wie: ‹Komm schon, sei ein Schatz, und ich heirate dich vom Fleck weg.› Großmutter Lipschitz ließ nie eine Gelegenheit für einen Flirt ungenutzt und antwortete: ‹Wenn du um meine Hand anhalten willst, dann mach es, wie es sich gehört. Mit einem Geschenk.› Der Junge pflückte einen Apfel von einem Baum und warf ihn ihr zu, wobei er den Heiratsantrag nach hebräischer Sitte aufsagte. Als Großmutter an jenem Abend nach Hause zurückkehrte, erzählte sie diese Geschichte dem Ururgroßvater Lipschitz, einem gelehrten Rabbi. Er wurde sehr ernst und beriet sich mit den anderen Rabbis, die alle der gleichen Meinung waren: Meine zwölf Jahre alte Großmutter und der Junge-der-nicht-Cohen-war, waren verheiratet. Er hatte die heiligen Worte vor Zeugen gesprochen und ihr ein Geschenk dargeboten, das sie nicht nur angenommen, sondern auch noch gegessen hatte. Es gab nur eins, was jetzt zu tun war: Der Junge musste sich von ihr scheiden lassen. Das allerdings wurde zum Haken der Geschichte. Denn der Junge wollte sich nicht von ihr scheiden lassen. Es stellte sich heraus, dass er sich heimlich nach Großmutter Lipschitz verzehrt, aber immer geglaubt hatte, dass sie Cohen heiraten würde. Jetzt wollte er sie nicht mehr hergeben. Sie flehte und wütete und drohte damit, sich zu Tode zu hungern und sich die Haare auszureißen, aber nichts hatte die erhoffte Wirkung. An dieser Stelle weicht die Romantik dem Sinn fürs Praktische. Als sie zum Schluss kam, dass sie sich eigentlich nicht zu Tode hungern wollte, beschloss Großmutter Lipschitz, das Beste aus der ganzen Sache zu machen. Sie willigte ein, sich mit dem Jungen-der-nicht-Cohen-war zusammenzutun, wenn er sie weit fort übers Meer bräche, wo sie nicht jeden Tag ihre wahre Liebe vor Augen hätte. Ihr Ehemann, der begriff, dass er einen guten Handel gemacht hatte, stimmte zu, und sie reisten nach England ab. Ein paar Jahre später erreichten die Pogrome das Dorf. Die gesamte Familie von Großmutter Lipschitz und alle Cohens wurden umgebracht. Großmutter Lipschitz hingegen lebte auf der anderen Seite des Meeres weiter, hatte sieben Kinder und ein Reihenhaus in Chislehurst. Wie Sie sehen, verdanke ich also einem Apfel meine Existenz.»
Und einem Mann, der sich nicht von seiner Frau scheiden lassen wollte, dachte Juliet, obwohl sie es nicht laut sagte, auch wenn sie merkte, dass Charlie ohnehin schon gar nicht mehr zuhörte.
Während er malt, hört Charlie ihre Stimme, als käme sie von unter Wasser. Das Bild zieht ihn ganz in seinen Bann. Dunkles Haar, aber mit rötlichen Flecken von Tagen in der Sonne, Augen, die nicht ganz grün sind, nicht ganz grau. Sie versucht, still zu sitzen, aber sie verrät ihre Ruhelosigkeit, indem sie mit den Zehen wackelt. Sie redet und redet, doch der Klang ihrer Stimme ist ohne Worte, wie ein Wasserfall. Juliet Montague. Charlie kennt keine Mädchen – oder besser gesagt Frauen – wie sie. Sie ist nicht wie die Freundinnen seiner Schwester, die zur Schickeria gehören und laut flüsternd am Telefon reden, weil sie unbedingt wollen, dass man mithört. Sie ist jünger als seine Mutter und ganz und gar nicht wie ihre Tennispartnerinnen in ihren hübschen weißen Kleidchen, die sich pausenlos über ihre Hausangestellten aufregen. Er merkt, dass er versucht, sie zu malen, obwohl er sie überhaupt nicht kennt. Sie ist eine Ansammlung von Teilen, blasse Hände, blaues Kleid, winziger Leberfleck auf der linken Wange, ein ausgeprägter Amorbogen. Er mustert sie und mustert sie und versucht zu sehen. Auf dem Tisch steht eine Schüssel mit grünen Äpfeln, die den ganzen Weg aus Russland gekommen sind.
Jahre später, als Charlie Fussell ein alter Mann ist, sieht er sein Bild in einem Museum hängen. Er geht schnurstracks auf sie zu, möchte unbedingt wieder Bekanntschaft mit ihr machen, aber als er sie erreicht, ist er bestürzt von seiner eigenen Klapprigkeit. Damals war sie älter als er, aber inzwischen haben sie die Plätze getauscht. Ihm ist die Zeit davongelaufen, vor ihr hat sie haltgemacht. Im Alter studiert er die Jugend, ihre und seine, dort oben auf der Leinwand. Er ist von Trauer erfüllt (was er erwartet hat) und Ärger (was er nicht erwartet hat) und begreift, dass er in seiner Maler-Laufbahn, die viele Jahrzehnte umfasst, sein bestes Bild im Frühjahr 1958 gemalt hat, als er noch keine einundzwanzig war. Nichts, was er seither geschaffen hat, ist so gut wie diese dunkelhaarige Frau mit ihrer Schale Äpfel.
Der Sommer neigte sich seinem Ende zu. Der Baum hinter dem Haus hatte seine Früchte schneller auf den braun werdenden Rasen fallen lassen, als Leonard und Frieda sie aufsammeln konnten, sodass der kleine Garten nun süßlich nach faulenden Pflaumen duftete. Es war Freitag, und die Kinder trieben sich Trübsal blasend herum, weil ihnen bewusst war, dass am Montag ein neues Schuljahr begann und dies das letzte, kostbare Ferien-Wochenende war, das eine Atmosphäre beklagenswerter Endlichkeit verströmte, wie die letzte Süßigkeit in einer Papiertüte. Sie erinnerten sich an all die Dinge, die sie in den endlosen Wochen hatten tun wollen, die jetzt doch zu ihrem Ende kamen, und bedauerten, dass sie nicht gelernt hatten, Fahrrad zu fahren (Leonard), und nicht ihr Taschengeld für die schicke neue Schultasche gespart hatten (Frieda). Leonard hockte auf der Schaukel, die sein Großvater in den Baum gehängt hatte. Sie war wackelig, und er rutschte immer ans gleiche Ende des Sitzes, schwang halbherzig und schief hin und her. Frieda rekelte sich im Gras, seufzte und lutschte an den Zuckerwürfeln, die sie aus der Speisekammer stibitzt hatte. Leonard fragte sich, ob die Erwachsenen ihn, wenn er sich in dem verwaisten Plumpsklo bzw. Werkzeugschuppen am Rand des Gartens versteckte, finden und zwingen würden, zur Schule zu gehen. Voller Bedauern kam er zu dem Schluss, dass sie das vermutlich täten. Er glitt von der Schaukel und schlüpfte aus dem Tor an der Seite. Als er das Rasenstück mit seinen beiden Blumentöpfen passierte, das als Vorgarten durchging, bemerkte er mit Interesse, dass ein großer Lieferwagen versuchte, die schmale Seitenstraße herunterzufahren, und dabei Fetzen von Zweigen und Blättern an seinen Seitenspiegeln hängen blieben wie in einem riesigen Knopfloch. Leonard, der seinen Trübsinn vergessen hatte, kletterte auf die niedrige Mauer zwischen dem Garten und dem Bürgersteig. Zu seiner großen Freude kam der Lieferwagen direkt vor ihm bebend zum Stehen. Die Montagues bekamen nie etwas geliefert. Die Nachbarn schon, beinahe jede Woche, so erschien es Leonard zumindest, der jedes Mal herauskam, um von seinem Platz auf der Gartenmauer aus zuzusehen. Mit kribbelndem Neid hatte er verfolgt, wie nebenan der neue Fernseher geliefert worden war. Er war so groß und schwer, dass es dreier Männer bedurft hatte, um ihn den Weg zur Haustür entlangzuschleppen. Leonard schloss die Augen, reckte sein Gesicht gen Himmel und murmelte eins von Großvaters Tischgebeten, das er gedanklich jedoch in eine Fürbitte um ein Fernsehgerät verwandelte. Sein Gebet wurde von einem lauten Hupen gestört, und seine Mutter trat aus der Haustür. Ihr Lippenstift war so glänzend rot wie ein frischpolierter Briefkasten. Das verstand Leonard. Wenn er gewusst hätte, dass ein Fernseher geliefert würde, hätte er sich zu seinen Ehren die Haare gekämmt und seine Sonntagshose angezogen.
Juliet eilte den Weg entlang und rief: «Kinder, kommt und guckt euch mein Geburtstagsgeschenk an.»
Sie griff nach Leonards Hand und zog ihn zum Heck des Lieferwagens, wo sich zwei kräftige Männer eine hölzerne Kiste auf ihre breiten Schultern luden. Leonard beäugte sie misstrauisch. Fernseher sollte man eigentlich mit mehr Andacht transportieren. Frieda gesellte sich auf Socken zu ihnen, von der Aufregung ebenfalls beeindruckt.
Juliet scheuchte die Kinder ins Haus und folgte den Lieferanten auf dem Fuße. Zitternd vor Aufregung, tappte Leonard ins Wohnzimmer, während die Männer die Kiste aufzustemmen begannen. Frieda blieb in der Tür stehen, die Hände tief in ihren Taschen vergraben.
«Ich dachte, dein Geburtstagsgeschenk sollte ein Kühlschrank sein.»
Juliet errötete. «Ja. Sollte es auch. Aber dann, tja, habe ich beschlossen, dass das eigentlich ein ziemlich grässliches Geburtstagsgeschenk wäre.»
Weder Frieda noch Leonard sagten etwas. Sie hatten immer schon gefunden, dass Kühlschränke schrecklich öde waren, hatten aber geglaubt, sie wären einer dieser Gegenstände, die Erwachsene «etwas für Kenner» nannten. Sie waren überrascht, aber auch fasziniert zu entdecken, dass sie tatsächlich recht gehabt hatten. Als die Lieferanten den Deckel der Kiste lüfteten, traten Juliet, Frieda und Leonard näher.
«Oh», sagte Frieda. «Das ist viel besser als ein Kühlschrank.»
Leonard verspürte einen heftigen Stich, als er sah, dass der Gegenstand in der Kiste leider kein Fernseher war, und gleich darauf eine Welle des Erstaunens. Irgendwie wusste er, dass seine Mutter etwas Unerwartetes, etwas Wunderbares getan hatte und etwas, das Großmutter nicht billigen würde. Er blickte die Frau in der Kiste an, die seine Mutter war, aber in eine vertraute Fremde verwandelt. Er drehte sich zu Juliet um, die hinter ihm stand, den Kopf zur Seite geneigt, während sie ihr anderes Selbst begutachtete, und in dem Augenblick war auch sie eine Fremde.
Auf den Knien zog Juliet vorsichtig das Porträt aus der Kiste und kletterte dann damit, nachdem sie aus den Schuhen geschlüpft war, auf die Kommode und hängte es an die Wand.
«Hängt es gerade?»
«Nein», sagte Frieda. «Die eine Seite hängt niedriger. Die linke. Nein, die andere linke.»
Juliet sprang herunter und stand zufrieden zwischen ihren Kindern. «Erinnert ihr euch daran, dass hier mal ein anderes Bild hing?»
Leonard schüttelte den Kopf.
«Ich glaube schon», sagte Frieda. «Das war ein Mädchen.»
«Das war ich.»
Das war ich, dachte Juliet, und er hat mich gestohlen, als er verschwunden ist.
Wann immer sich die Gelegenheit dazu ergab, beschrieb Leonard gern den Tod seines Vaters. Er ließ ihm jedes Mal einen anderen Tod zuteilwerden und jedes Mal elender als zuvor. Aber er wusste, dass sein Vater nicht wirklich tot, sondern nur fort war und dass er nie wieder einen Fuß in dieses Haus setzen würde, so wahr mir Gott helfe. Er hörte, was die Erwachsenen sagten, wenn sie dachten, er könnte sie nicht hören – «George Montague war ein Schwein» und «ein Taugenichts» und «ein Feigling und ein Jammerlappen». Leonard konnte sich nicht einmal mehr daran erinnern, wie er aussah. Manchmal sah er, wenn er einschlief, das Bild eines sehr großen Mannes vor sich, und er fragte sich, ob er das war, aber es gab keine Fotografien, um das zu überprüfen, nicht mehr.
Eine Woche, nachdem das Porträt eingetroffen war, stahl er sich ins Schlafzimmer seiner Mutter und zog die Schuhschachtel mit den Fotos aus ihrem Versteck hinten in ihrem Schrank hervor. Er leerte auf der Suche nach Fotos von seinem Vater den Inhalt auf dem Fußboden aus. Er hatte schon viele Male die Schachtel durchstöbert, aber immer nur Schnappschüsse von seiner Mutter entdeckt, die neben einem ausgeschnittenen Loch stand. «Hochzeitsreise, Margate, George und Juliet, 1947», stand in Bleistiftschrift auf der Rückseite, aber da war kein George, nur Juliet und ein Loch, durch das Leonard das Teppichmuster sehen konnte. Auch an diesem Abend war es nicht anders, und er seufzte und begann die Fotos wieder in die Schachtel zu schieben, wobei er sich fragte, warum seine Mutter sich überhaupt die Mühe machte, sie aufzuheben, und warum er sie immer wieder von neuem betrachtete, und dann fiel ihm zum ersten Mal etwas anderes auf. Am Rand der Schachtel steckte ein Zettel. Er blickte über die Schulter. Die Tür war fest verschlossen. Von unten konnte er Stimmen aus dem Radio hören, die leise summten.
Er zog das Blatt Papier heraus:
EINBÜRGERUNGSURKUNDE:
George Montague, gebürtiger Molnár, György
Leonard verstand, was dieses dünne Durchschlagpapier bedeutete. Sein Vater war ein Spion. George Montague war nicht sein richtiger Name, das war nur eine von seinen Identitäten. Diese Urkunde bewies, dass George Montague – alias Molnár György – seine Familie hatte verlassen müssen. Er musste sich heftig gewehrt haben – Leonard stellte sich vor, wie der hochgewachsene Mann aus seinem Traum zu seinem Vorgesetzten sagte: «Das werde ich nicht tun. Nein. Ich werde meinen Sohn nicht verlassen … oder», ließ ihn Leonard hinzufügen, «meine Frauen.» Der Streit ging in Leonards Kopf weiter und weiter, aber schließlich sah er, wie sein Vater still wurde und im Flüsterton sagte, während er sich eine einzelne Träne wegwischte: «Dies ist das schlimmste Opfer, das ein Mann nur bringen kann. In all meinen Dienstjahren habe ich nie gedacht, ich könnte je zu so etwas gezwungen werden. Nur für Königin und Vaterland und für Leonard, meinen Sohn.»
Leonard schob das Dokument wieder in die Schachtel und stellte sie zurück in den Schrank. Als er nach unten kam, hatte seine Mutter aufgehört zu bügeln und faltete jetzt Hemden zu unordentlichen Stapeln. Auf dem Gemälde sah sie viel glücklicher aus, fand er. Auf dem Gemälde zuckte ein Lächeln um ihre Mundwinkel, so eins, wie wenn sie ein richtig gutes Geheimnis wusste, eines, das sie einem nicht verraten würde, noch nicht.
Juliet staunte darüber, dass im Haus ihrer Eltern so viele Menschen Platz finden konnten. Sie verstand nun, wie sie sich einst in den Schtetls gedrängt haben mussten, zu zehnt in einem Zimmer schlafend. Im Garten war es sogar noch quirliger. Die Jacob-Onkel und Sollie Greene versuchten, die linke Seite der Sukka abzustützen, die einzustürzen drohte, und die drei Lipschitz-Onkel hüteten mehr Kinder, als sie überhaupt zählen konnte, und die in die Sukka rein- und rausmarschierten, rein und raus, als übten sie für Noahs Arche. Sie bot einen seltsamen Anblick, diese schwankende Hütte aus Blättern mitten auf dem quadratischen Rasenstück von Victoria Drive Nummer sechsundzwanzig. Die Sukka bestand aus einer Masse ungebändigter Dinge, gebogener Weiden- und Haselnusszweige, Fetzen von Schlingpflanzen und wildem Kinderspiel. Sie spürten den Geruch der Wildnis und rannten herum und kreischten übermütig.
«Himmel, was für ein Getöse!», beschwerte sich Mrs. Greene. «Hier, nimm doch mal diese Tabletts. Wenn wir ihnen etwas zu essen geben, kehrt vielleicht mal ein bisschen Ruhe ein.»
Juliet nahm die Teller mit gefilte Fisch, eingelegtem Hering und Körben voller goldenem Challa und näherte sich der Hütte, wobei sie sich an Onkel Ed vorbeidrückte, der sich ein paar Haselnussgerten an den Kopf hielt wie Geweihe und die Kinder ums Blumenbeet jagte und in diesem Trubel völlig sein schlimmes Bein vergessen hatte. Die meiste Zeit des Jahres waren diese Leute fast ausnahmslos Stubenhocker, die vielleicht einmal in den Park gingen, wenn ungewöhnlich schönes Wetter herrschte, aber sich doch unendlich viel wohler fühlten, wenn sie in einem hübschen Zimmer mit etwas Heißem zu trinken saßen. Gutes Wetter konnte man schließlich auch angemessen würdigen, wenn man durchs Fenster sah, und ein Topf mit Geranien galt schon als Natur genug. Aber an diesem Abend war alles anders. Juliet trat einen Schritt zurück, damit sie nicht von Eds provisorischem Geweih aufgespießt oder vom rosa angelaufenen und schnaufenden Leonard überrannt wurde.
«Wie kommen Sie zurecht, meine Liebe?»
Juliet drehte sich um und erblickte Mrs. Ezekiel, die eine Reihe Kürbisse zurechtrückte, die so prall gefüllt waren, dass das Fleisch auf das Tablett tropfte.
«Sehr gut, und selbst?»
«Ich kann mich nicht beschweren. Kann mich nicht beschweren. Aber Sie, immer so tapfer. Wir finden es alle so großartig, wie Sie sich halten.»
Juliet sagte nichts, sie hatte sich seit langem mit der Tatsache abgefunden, dass sie ein gern besprochenes Thema unter den Frauen war, ähnlich wie der Preis von Lammkoteletts und die Länge von Rabbi Weiners Predigten.
«Ach, Brenda. Ich habe Juliet gerade erzählt, wie sehr wir sie bewundern», rief Mrs. Ezekiel einer Frau zu, die wie eine Wurst in ihren Wintermantel gestopft war.
«O ja. Eine Inspiration», sagte Mrs. Brenda Segal, eilte herbei und stellte eine Schüssel ab. «Das habe ich auch meiner Helen gesagt. Jammer nicht herum, dass du es mit den Kleinen schwer hast. Du hast Harold, was auch immer er für Fehler haben mag. Denk an die arme Juliet Montague.» Mrs. Segal begann, an der fetten grauen Zunge, die auf ihrem Teller lag, herumzuschneiden, die daraufhin zu wackeln begann. «Ach, unsere Töchter, immer müssen sie jammern. Dabei haben sie überhaupt kein Recht dazu. Überhaupt kein Recht.»
«Verwöhnt. So wie meine Sarah. Begreift gar nicht, wie gut sie es hat.»
«Ja, schrecklich», stimmte Mrs. Segal fröhlich zu.
Die beiden Frauen lächelten Juliet an, wobei sie ihre Köpfe zur Seite geneigt hatten wie ein Paar Buchfinken. Juliet war erschöpft von ihrem Mitleid, es klebte wie überzuckertes Marzipan. Sie stellte fest, dass sie sich geradezu nach einer Portion guter alter Verteufelung sehnte.
«Entschuldigen Sie mich», sagte Juliet und flüchtete über den Rasen. «Frieda!»
Widerwillig erschien Frieda, ihre Wangen glänzten.
«Was? Ich habe zu tun.»
«Zieh deinen Mantel an, Liebling. Du wirst frieren, wenn du dann mal fertig bist. Nein, verzieh bitte nicht so das Gesicht. Geh schon.»
Während Frieda ins Haus lief, lehnte sich Juliet an den Zaun und genoss einen Augenblick des Alleinseins. Vielleicht konnte sie den Rest des Abends im Dunkel bleiben. Die Kinder waren glücklich. Das war genug. Wenn sie ganz still blieb und niemanden ansah, ließ man sie vielleicht, ganz vielleicht in Ruhe. Sie murmelte ein stilles Gebet.
«Hallo, schöne Frau. Hübsch wie immer.»
«Danke, John.»
John Nature war einst die gute Partie ihrer Gemeinde gewesen – blaue Augen, schöne Züge, ein Lächeln, das die Mädchen einfach erwidern mussten. Vor zehn Jahren war er in Bromley Dritter bei den Amateur-Meisterschaften im Ringen geworden, eine Heldentat, die eine Menge Knie hatte weich werden lassen. Seitdem war das kantige Kinn von einer Dekade Schmaltz auf Toast und Lokschen-Pudding überrollt worden, und er rang nur noch mit der zum Platzen gespannten Gürtelschnalle. Aber seine Augen waren immer noch so blau, und er zwinkerte Juliet zu.
«Was hast du doch für hübsche Kinder. Aber das ist natürlich keine Überraschung. Sind ja schließlich deine.»
Bevor sie George kennengelernt hatte, hatte John bei verschiedenen Gelegenheiten versucht, mit ihr auszugehen, aber sie hatte immer abgelehnt. Sie wusste, dass er glaubte, sie trauere ihm nach. Männer wie er glaubten immer, dass die Frauen, die sie nicht geheiratet hatten, ihnen nachtrauerten. Jetzt sah er sie eindringlich an und erwies ihr die Gunst seines berühmten Lächelns.
«Was für ein wunderbarer Abend. Im Schoße der Familie. Umgeben von Freunden. Und hübschen Frauen.»
Juliet war die wohltätigen Komplimente der Ehemänner von Chislehurst durchaus gewohnt. Sie wusste, dass sie glaubten, ihr eine Mitzwa zu erweisen, aber sie wirkten dabei immer ein wenig argwöhnisch, als ob Juliet, ausgehungert von Sex, wie sie war, sie jeden Augenblick anspringen könnte. Selbst John hielt, trotz seines schmelzenden Lächelns, einen Sicherheitsabstand zwischen ihnen ein, falls die schiere körperliche Nähe zu ihm sie alle Selbstkontrolle vergessen ließe.
«Ich habe gehört, dass deine Frau ihre gefeierte Zimtschnitte gemacht hat.»
«Ach ja. Eine tolle Köchin, mein Mädchen. Ja, ja, mein Untergang», sagte er und tätschelte sich voll milder Genugtuung den Bauch. «Und du? Welche Köstlichkeit hast du mitgebracht? Ich bin sicher, du bist eine wunderbare Köchin.»
«Ich fürchte nicht. Das ist mein Untergang.»
Sie sprach mit solcher Bestimmtheit, dass Johns Gesicht einfiel, und Juliet wusste, dass er nun ernsthaft überlegte, ob dies der Grund für die unglückliche Geschichte mit George gewesen war. Sie lächelte zum Zeichen, dass das ein Scherz gewesen war, und er lachte erleichtert.
«Was macht es schon, wenn eine wunderschöne Frau nicht kochen kann? Dafür gibt es schließlich Restaurants.»
Juliet gab keine Antwort. Er wusste ganz genau, dass sie nicht mit einem Mann in ein Restaurant gehen konnte. Eine angekettete Frau musste zu Hause bleiben. Sie stellte sich vor, welchen Skandal es gäbe, wenn man sie dabei erwischte, wie sie ein Schnitzel mit einem Mann aß, der nicht ihr Gatte war, und wollte lächeln, merkte aber, dass sie es nicht konnte. Sie merkte, dass sie an Charlie Fussell dachte. Er konnte den Schandfleck nicht sehen. Sie hatte es ihm nicht erzählt, aber sie vermutete, dass er, selbst wenn sie es täte, ihn immer noch nicht sehen könnte. Er würde mit ihr nicht so vorsichtig reden wie diese guten Männer, ängstlich und heimlich entzückt darüber, dass sie, auch wenn sie fett, kahlköpfig und langweilig waren, unwiderstehlich für sie sein mussten. Charlie würde sie nicht mustern und sich dabei fragen, welcher heimliche Defekt wohl dazu geführt hatte, dass George Montague geflohen war.
Schließlich nahmen sie Platz, um zu essen. Juliet wartete, bis sich alle anderen gesetzt hatten, bevor sie still auf den letzten Stuhl schlüpfte. Sie wusste, dass sonst jeder die Plätze zu ihrer Linken und Rechten meiden würde – die Frauen zogen es generell vor, sie zu meiden, und die Männer hatten Angst vor ihr und noch mehr Angst davor, was ihre Frauen wohl sagen würden. Sie aß schweigend, sprach mit niemandem und badete im Konzert des Lärms anderer Menschen. Ab und zu kam von Onkel Sollie ein kameradschaftliches Zwinkern, und ihr Vater lächelte und seufzte.
Nach dem Essen machten sich die Frauen auf ihre Expedition in die Küche und erörterten dabei schnatternd, welche Trümmer das Festmahl hinterlassen hatte. Niemand kam auf die Idee, dass die Männer helfen sollten. Diese versammelten sich stattdessen an einem Tischende in der Sukka um eine alte Flasche Schnaps, aus der Mr. Greene kleine eierbechergroße Gläser befüllte, die für diesen Ausflug zweimal im Jahr eigens entstaubt wurden.
Die Kinder sammelten sich am anderen Ende der Sukka, die jüngeren saßen auf dem Boden und die Älteren setzten sich an den Tisch und spielten Erwachsene.
Leonard lümmelte sich im feuchten Gras und starrte durch das Gitterwerk der Blätter zum Himmel hoch. Die Sterne über der Stadt funkelten schwach, ihr Schein gedämpft wie das Licht einer Taschenlampe unter der Bettdecke. Er leckte sich das Fett vom Gaumen, schloss die Augen und fühlte sich geschützt von der Hülle des Geschwätzes der anderen.
«Gute Sukka, die hier.» Ein schmaler Junge setzte sich neben ihn und tippte mit dem Finger gegen die Segeltuchwände, ein Inspizient, der eine Prüfung durchführte. Seine blasse Haut war mit goldenen Sommersprossen bedeckt, was ihm den unersprießlichen Spitznamen Cornflake verschafft hatte.
«Danke.» Leonard stemmte sich auf seine Ellbogen. «Ich hab sie gebaut. Na ja, Opa hat mitgeholfen. Ein bisschen.»
Kenneth aus Nummer vierundzwanzig schlüpfte zwischen sie. Leonard mochte ihn nicht. Er war ein Junge, der die Banana Bunch-Comics für besser hielt als Dan Dare und dem man deshalb nicht trauen konnte. Oberhalb von Kenneths Lippen war die Andeutung eines Schnurrbarts zu erkennen, nicht dunkler als eine Bleistiftschraffur, aber das führte bei seinem Träger zu einer gewissen Angeberei.
«Hat dein Vater nicht geholfen?»
Leonard wickelte sich einen langen Grashalm um den Finger. «Du weißt doch, dass mein Papa tot ist.»
Kenneth nickte. «Natürlich. Genau. Wie ist er noch mal gestorben?»
Leonard hätte vielleicht sagen können: «Er ist krank geworden» oder: «Es war ein Unfall», aber das tat er nicht. Kenneths blödes Grinsen konnte er beinahe ertragen, aber nicht Cornflakes Blick, in dem neugierige Anteilnahme lag. Leonard Montague, der Sohn des George Montague, des flotten Heldenspions, wollte sich nicht von Erick «Cornflake» Jones bemitleiden lassen.
«Mein Papa war Pilot –»
«Was hat er denn geflogen?»
«Eine Spitfire. Die Supermarine Spitfire», sagte Leonard wie aus der Pistole geschossen. «Mein Vater war ein großer Kriegsheld. Das kannst du nachschauen, wenn du mir nicht glauben willst.»
Er blickte finster auf und hielt die Luft an und forderte Kenneth heraus. Eine Sekunde lang lag eine Spannung in der Luft, aber dann zuckte Kenneth mit den Schultern, und Leonard fuhr fort.
«Nach dem Krieg haben sie ihn als Flugzeugdetektiv behalten. Er ist nicht wirklich tot. Er ist auf irgendwelchen Einsätzen. Höchste Geheimsache von nationaler Bedeutung. Er hat andere Agenten gerettet. Bulgaren. Deshalb ist er nicht hier. Es ist nicht sicher genug.»
«Das ist doch der verdammte Biggles!», brüllte Kenneth. «Leonard glaubt, sein Vater ist der verdammte Biggles!»
«Das tue ich nicht», sagte Leonard und versuchte Kenneth dazu zu bringen, seine Stimme zu senken, aber die Kinder sahen alle zu ihnen hinüber, und das Gelächter verbreitete sich wie Keuchhusten.
«Tu ich nicht. Tu ich nicht. Tu ich nicht.» Leonard redete immer weiter, damit er nicht anfing zu weinen, aber dennoch sammelten sich Tränen hinter seinen Augäpfeln und kitzelten sie wie der Geruch von Zwiebeln.
«Lass ihn in Ruhe. Unser Papa ist tot.»
Zu seiner großen Überraschung erblickte Leonard seine ältere Schwester, die drohend über Kenneth stand, die Hand auf der Hüfte, Wut im Blick, eine Harpyie mit Zöpfen.
«Du bist ein fieser Junge, Kenneth Ibbotson. Immer musst du überall deinen großen, hässlichen Schnabel reinstecken.»
Kenneth empfand ein wenig Furcht vor Frieda. Sie war drei Jahre älter als er, zehn Zentimeter größer und, am schlimmsten von allem, sie war ein Mädchen. Dennoch hatte er erst vor ein paar Wochen an einem verregneten Sonntag Biggles: Air Detective gelesen, und er wusste, dass die Wahrheit nun mal auf seiner Seite war.
«Er hat gesagt, sein Papa wäre ein Flugzeugdetektiv. Das ist gar kein echter Beruf. Nur der verdammte Biggles macht das, verdammt.»