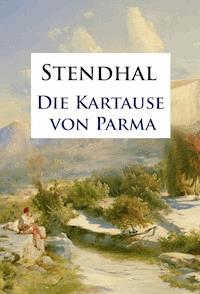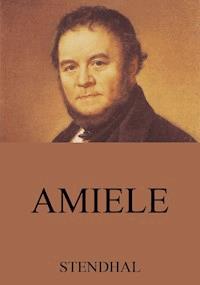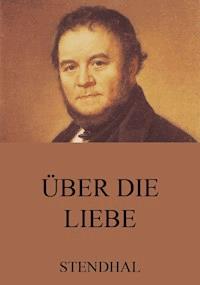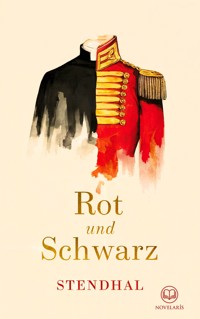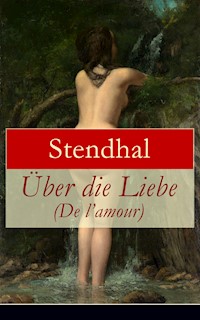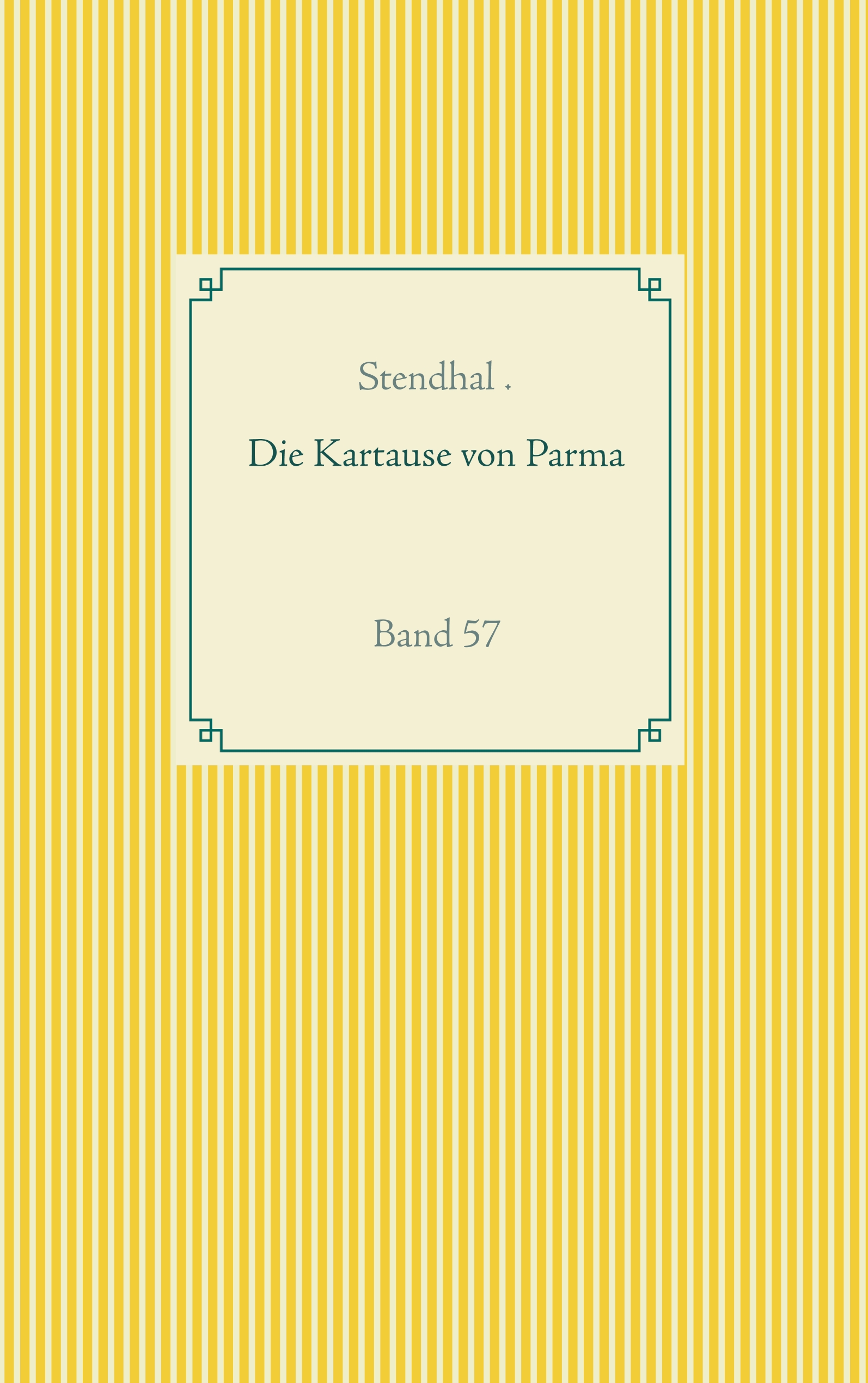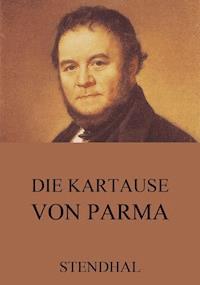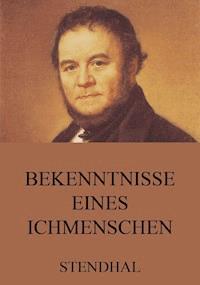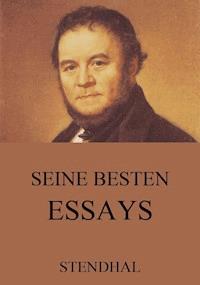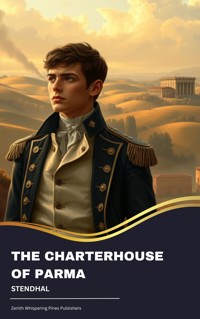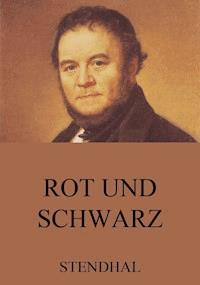
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Rot und Schwarz" ist die tragische Lebensgeschichte des ambitionierten aber spießigen Julien Sorel, der im reaktionären und intriganten regime der Restauration weder den Status eines Generals (rot) noch den eines Bischofs (schwarz) erreichen kann, sich dafür aber mit mehreren Frauen einlässt und schließlich dem Tod auf dem Schafott entgegen sieht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 801
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rot und Schwarz
Stendhal
Inhalt:
Stendhal – Biografie und Bibliografie
Rot und Schwarz
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
Rot und Schwarz, Stendhal
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849636753
www.jazzybee-verlag.de
Stendhal – Biografie und Bibliografie
Eigentlich Marie-Henri Beyle, franz. Schriftsteller, meist unter dem Pseudonym Stendhal (spr. stangdall, von Stendal, der Heimat des von ihm verehrten Winckelmann) auftretend, geb. 23. Jan. 1783 in Grenoble, gest. 23. März 1842 in Paris, wurde nach einem an Abenteuern reichen Jugendleben kaiserlicher Beamter. machte die Feldzüge in Deutschland mit, ward 1812 Auditeur im Staatsrat und ging nach der zweiten Restauration nach Italien, das jetzt sein Lieblingsaufenthalt wurde. Nach der Julirevolution von 1830 wurde er Generalkonsul in Civitavecchia. Seine hauptsächlichsten Schriften sind die Romane: »Armance« (1827, 3 Bde.), »Le Rouge et le Noir« (1831, 2 Bde.) und besonders »La Chartreuse de Parme« (1839, 2 Bde.; oft aufgelegt), in denen sich Vorzüge, wie scharfe Charakteristik, pikanter Stil und glänzender Witz, aber auch Fehler finden, wie krankhaftes Jagen nach Originalität und Mangel an sittlicher Idee. Unter seinen übrigen Schriften sind die bedeutendsten: »Lettres écrites de Vienne sur Haydn, etc.«(1814, unter dem Namen A. C. Bombet); »Histoire de la peintureen Italie« (1817, 2 Bde.); »De l'amour« (1822, 2 Bde.); »Racine et Shakespeare« (1823).Nach seinem Tod erschienen: »Nouvelles inédites« (1853); »Romans et nouvelles« (1854); »Correspondance inédite« (1855); »Vie de Henri Brulard«, eine leichtverkleidete Selbstbiographie (1890), von der weiteres in seinem »Journal« (1888) und in den »Souvenirs d'égotisme« (1892) enthalten ist, ferner: »ll:uvres posthumes. Napoléon etc.« (1881, 3. Aufl. 1897) und »Lettres intimes« (1892). Sein bedeutendster Schüler, Mérimée, übertrifft ihn an Eleganz des Stiles. Ihren größten Erfolg haben Beyles Romane erst in unsrer Zeit errungen. Unter den neuern Schriftstellern wollen sowohl die Naturalisten (Zola) als die Psychologen (Bourget) in ihm einen Vorgänger erblicken. Vgl. Paton, Henry B., a critical and biographical study (Lond. 1874); Cordier, Stendhal et ses amis (Evreux 1890); Rod, Stendhal (Par. 1892); Farges, Stendhal diplomate. Rome et l'Italie de 1829 à 1842 (das. 1892); P. Brun, Henri B. (Grenoble 1900); Stryienski, Comment a vécu Stendhal (Par. 1900; mit zwölf Porträten des Dichters); A. Chuquet, Stendhal-B. (2. Aufl., das. 1902); Rüttenauer, Aphorismen aus Stendhal (Straßb. 1901).
Rot und Schwarz
1. Kapitel
Die kleine Stadt Verrières kann für eine der hübschesten der Freigrafschaft gelten. Ihre weißen Häuser mit Spitzdächern von roten Ziegeln schmiegen sich dem Hang einer Höhe an, deren wellige Silhouette von den Wipfeln mächtiger Kastanien getragen wird. Ein paar hundert Schritt unterhalb der ehedem von den Spaniern erbauten, heute verfallenen Befestigungen fließt der Doubs.
Gegen Norden ist Verrières geschützt durch einen hohen Bergrücken, einen Ausläufer des Juragebirges. Die zackigen Gipfel des Verra sind schon bei den ersten Oktoberfrösten mit Schnee bedeckt. Ein munterer Bach, dem Gebirge entsprungen, durchrauscht das Städtchen und ergießt sich in den Doubs. Sein Wasser treibt eine Menge Sägemühlen. Diese einfache Industrie gewährt dem größeren Teil der mehr städtischen denn ländlichen Einwohnerschaft ein behagliches Dasein. Indessen verdankt das Städtchen seinen Reichtum nicht den Sägemühlen, sondern der Herstellung von bunter sogenannter Mülhauser Leinwand. Infolge der allgemeinen Wohlhabenheit sind seit Napoleons Sturz fast alle Häuserfassaden von Verrières neu erstanden.
Kaum hat man den Ort betreten, so zerreißt einem der laute Lärm einer dröhnenden, gar bedrohlich aussehenden Maschine die Ohren. Ein paar Dutzend wuchtiger Hämmer erschüttern mit ihrem Auf und Nieder das Straßenpflaster. Sie werden durch ein Rad gehoben, das der Gebirgsbach treibt. Jeder dieser Hämmer stellt täglich viele, viele tausend Nägel her. Frische hübsche Mädchen schieben den Ungetümen Eisenstreifen zu, die im Handumdrehen zu Nägeln verwandelt werden. So grob diese Arbeit ist, sie wird doch immer von den Fremden angestaunt, die zum erstenmal in die Berge zwischen Frankreich und der Schweiz kommen. Fragt man, wem die schöne Nägelfabrik gehöre, die einen halbtaub macht, wenn man die Hauptstraße dahingeht, so erhält man in der breiten Mundart der Gegend die Antwort: »Na, dem Herrn Bürgermeister!«
Wer ihn sehen will, braucht nur auf der Hauptstraße, die vom Doubs zur Höhe führt, eine Weile aufzupassen. Man kann hundert gegen eins wetten, daß alsbald ein großer stattlicher Mann mit gewichtiger Amtsmiene auftaucht, bei dessen Annäherung alle Leute flugs ihre Hüte ziehen.
Sein Haar ist ergraut. Und grau ist auch sein Anzug. Er ist Ritter mehrerer Orden. Er hat eine hohe Stirn, eine Adlernase und ein alles in allem nicht unübles Gesicht. Auf den ersten Blick findet man darin wohl die Würde des Stadtoberhauptes gepaart mit der geselligen Gewandtheit des angehenden Fünfzigers. Weltmännische Augen entdecken allerdings gar bald die unangenehmen Merkmale von Selbstzufriedenheit und Dünkel, denen sich geistige Beschränktheit und Phantasiearmut gesellen. Schließlich kommt man dahinter, daß die ganze Pfiffigkeit dieses Mannes darin besteht, sich prompt bezahlen zu lassen, was man ihm schuldet, seinen eigenen Pflichten dagegen möglichst spät nachzukommen.
So sieht also der Bürgermeister von Verrières aus: Herr von Rênal. Hat er die Straße gravitätisch durchschritten, dann verschwindet er im Rathaus. Hundert Schritte weiter bergauf erblickt man ein recht stattliches Haus, daran einen großartigen Garten hinter einem schmiedeeisernen Gitter. Darüber sieht man die Kammlinie der Burgunder Berge, wie zur Augenweide hingezaubert. Es ist ein Bild, vor dem der Wanderer den üblen Dunstkreis des kleinlichen Geldsinnes, der ihn eben umfangen wollte, wieder vergißt.
Man erfährt, daß dieses Haus dem Bürgermeister gehört. Die Erträgnisse seiner großen Nägelfabrik gestatten ihm diesen Prachtbau aus Hausteinen, der unlängst erst fertig geworden ist. Die Familie Rênal, angeblich alter spanischer Herkunft, war längst vor der Eroberung des Landes durch Ludwig XIV. hier ansässig.
Die Restauration von 1815 machte ihn zum Bürgermeister. Seitdem schämt sich Rênal, Fabrikant zu sein. Und doch wären die Mauern, die den herrlichen Garten in verschiedene Terrassen gliedern, bis hinab zum Doubs, ohne das kaufmännische Geschick ihres Besitzers nicht vorhanden.
Man findet in Frankreich bei weitem keine so malerischen Gärten wie im Umkreis von deutschen Handelsstädten wie Leipzig, Frankfurt, Nürnberg und andernorts. In der Freigrafschaft steigt man in der Achtung seiner Mitbürger, je mehr man Steine auf seinem Grundstück türmt. Der Garten des Herrn von Rênal war voll solcher Bauten, obendrein aber ein Gegenstand der Bewunderung, weil gewisse kleine Parzellen des Gartens bei ihrer Erwerbung buchstäblich mit Gold aufgewogen worden waren. So lag zum Beispiel die Sägemühle, die einem am Eingang von Verrières durch ihre Lage am Doubsufer und durch die am Dache angebrachte Firma mit dem Namen SOREL in Riesenlettern auffällt, noch vor sechs Jahren an der Stelle, wo man zur Zeit die Mauer der vierten Rênalschen Gartenterrasse aufführt. Der Bürgermeister hat bei all seinem Hochmut manchen Gang zum alten Sorel machen müssen, einem dickköpfigen groben Bauern, und ihm reichliche Goldfüchse auf den Tisch gezählt, ehe er die Verlegung der Mühle erreichte. Dazu mußte er in Paris seinen ganzen Einfluß aufbieten, bis er die Genehmigung zur Ableitung des öffentlichen Baches bekam, der die Mühle trieb. Dieser Gnadenbeweis ward ihm nach den Wahlen von 182* zuteil.
Sorel erhielt fünfhundert Schritt abwärts am Doubs vier Morgen Land für einen. Und obgleich der neue Platz für seinen Bretterhandel weit günstiger war, so verstand es Vater Sorel – wie er jetzt in seiner Wohlhabenheit allgemein hieß – doch, seinem ungeduldigen und gebietshungrigen Nachbarn überdies sechstausend Franken abzuknöpfen. Dieses Abkommen wurde von den durchtriebenen Spießbürgern viel bekrittelt. Und einmal, an einem Sonntag (es ist jetzt vier Jahre her), da begegnete Herr von Rênal, als er im Bürgermeisterstaat aus der Kirche kam, dem alten Sorel samt seinen drei Söhnen und merkte von weitem, wie der Alte, seiner ansichtig, lächelte. Bei diesem Lächeln ging dem Bürgermeister eine Erleuchtung auf. Seitdem meint er, den Tausch hätte er billiger haben können.
2. Kapitel
Das Glück stand Herrn von Rênal auch in seiner Eigenschaft als Bürgermeister zur Seite. Die Stadtpromenade, die sich mehr als dreißig Meter hoch über dem Flußbett am Berghange hinzieht, bedurfte einer mächtigen Untermauer. Dank ihrer wunderbaren Lage ist sie einer der malerischsten Aussichtspunkte Frankreichs. Aber jedes Frühjahr überfluteten die Bergwässer den Weg, rissen tiefe Furchen auf und machten ihn ungangbar. Dieser allgemein beklagte Übelstand versetzte Herrn von Rênal in die angenehme Notwendigkeit, seine Amtszeit durch ein Mauerwerk von sechseinhalb Meter Höhe und sechzig bis siebzig Meter Länge zu verewigen.
Das Stadtoberhaupt mußte drei Reisen nach Paris unternehmen, denn der vorige Minister des Innern war der erklärte Todfeind der Promenade von Verrières. Jetzt ist die Mauer mit ihrer mehrere Fuß hohen Brüstung bald fertig. Sie wird mit grauen, ins Bläuliche spielenden Steinplatten belegt, an die man sich gern lehnt, um den Blick in das Doubstal zu genießen. Drüben, auf dem andern Ufer, öffnen sich fünf oder sechs Täler, in deren geschlängelten Gründen Bäche glitzern, die immer wieder kleine Wasserfälle bilden, bis sie schließlich in den Doubs laufen. Die Sonne brennt heiß in diesem Berglande. Wenn sie im Zenit steht, muß sich der verträumte Wandrer unter die prächtigen Platanen der Stadtpromenade retten. Diese Bäume verdanken ihr üppiges Gedeihen und ihr schönes Blaugrün ebenfalls dem Herrn Bürgermeister, der beim Bau seiner großen Mauer die Promenade durch Erdanschüttungen um gut zwei Meter hat verbreitern lassen, ungeachtet aller Einreden des Stadtrates.
An besagter Stadtpromenade, dem Cours de la Fidélité (zu deutsch: Allee der Treue) – man liest diese patriotische Bezeichnung auf Marmortäfelchen an fünfzehn bis zwanzig Stellen, was Herrn von Rênal einen Orden mehr eingetragen hat – ist nur eines auszusetzen: die barbarische Art, mit der die hohe Obrigkeit die üppig wachsenden Platanen immer wieder stutzen läßt. Geschoren sehen sie mit ihren kugeligen nackten Schädeln wie gemeine Kohlköpfe aus, während sie viel lieber die herrlichen vollen Formen ihrer Schwestern drüben in England hätten. Aber der Wille des Herrn Bürgermeisters ist höchstes Gesetz, und sämtliche Bäume im Stadtgebiet werden alljährlich zweimal erbarmungslos verschnitten. Die Liberalen im Orte behaupten sogar (aber sie übertreiben), daß die Schere des Stadtgärtners noch unerbittlicher geworden sei, seitdem sich der Vikar Maslon den Ertrag der Baumschur anzueignen beliebt. Das ist ein junger Geistlicher, vor ein paar Jahren von Besançon herversetzt, um dem Abbé Chélan und etlichen andern Pfarrern der Nachbarschaft auf die Finger zu sehen.
Ein alter Stabsarzt der ehemaligen Armee in Italien, der sich in Verrières zur Ruhe gesetzt hatte und zu seinen Lebzeiten (wie der Bürgermeister zu sagen pflegt) Jakobiner und Bonapartist, alles beides zusammen, gewesen war, erlaubte sich gelegentlich einmal, über die regelmäßig wiederkehrende Verstümmelung der schönen Bäume Beschwerde zu führen.
Mit der leichten Herablassung, die angebracht ist, wenn ein Royalist mit einem napoleonischen Stabsarzt und Ritter der Ehrenlegion spricht, entgegnete Rênal:
» Ich liebe den Schatten. Ich lasse meine Bäume verschneiden, damit sie Schatten geben. Meiner Ansicht nach sind Bäume zu nichts anderm da. Eine Ausnahme macht der nützliche Nußbaum. Aber die Platanen bringen ja nichts ein!«
Etwas einbringen! Das war das geflügelte Wort, das in Verrières allenthalben den Ausschlag gab. Hierin verdichtete sich das Denken und Trachten von mehr als drei Vierteln der Einwohner.
Etwas einbringen! Das ist das Leitmotiv im Betriebe dieser Kleinstadt, die einem so gefällt. Der Fremde, der sie betritt, wird durch die Anmut der kühlen tiefen Täler ringsum bezaubert. Er bildet sich zunächst ein, ihre Bewohner seien empfänglich für das Schöne. Sie reden auch oft genug von den Reizen ihrer Heimat und rühmen sie gar sehr. Aber dies geschieht nur, weil es die Fremden anlockt, die ihr Geld in den Gasthäusern lassen, was, auf dem Umwege der Steuern, der Stadt etwas einbringt.
An einem schönen Herbsttage ging Herr von Rênal auf der Stadtpromenade spazieren, seine Frau am Arm. Sie hörte zwar ihrem Manne zu, der in gewichtigem Tone sprach, folgte aber mit ihren Blicken voller Unruhe den Bewegungen ihrer drei Knaben. Der älteste, der elf Jahre alt sein mochte, lief immerfort an die Brüstung und machte Miene, hinaufzuklettern. Jedesmal rief sie mit sanfter Stimme »Adolf!«, worauf der Junge von seinem kecken Vorhaben abließ. Frau von Rênal war offenbar eine Dreißigerin, doch noch sehr hübsch.
Ihr Mann redete immer weiter. Er sah schlechtgelaunt aus und blasser denn sonst.
»Es soll ihm übel bekommen, diesem lieben Herrn aus Paris!« sagte er. »Ich habe auch meine Freunde bei Hofe...«
Dieser liebe Herr aus Paris, auf den der Bürgermeister so schimpfte, war der bekannte Philanthrop Appert, der es zwei Tage vorher zuwege gebracht hatte, nicht allein das Stadtgefängnis und das Armen- und Arbeitshaus von Verrières zu besichtigen, sondern auch das Spittel, das vom Bürgermeister und den ersten Grundbesitzern des Ortes ehrenamtlich verwaltet ward.
»Sag einmal«, warf Frau von Rênal bescheiden ein, »was kann dir dieser Herr aus Paris denn anhaben, wo du das Gut der Armen mit peinlichster Gewissenhaftigkeit verwaltest?«
»Solche Leute kommen bloß, um alles mögliche auszuschnüffeln und hinterher in den liberalen Zeitungen zu benörgeln.«
»Die liest du ja nie, mein Lieber!«
»Aber man kriegt sie doch zu hören, diese Jakobinerartikel! Es stört einen und hindert uns an der sozialen Arbeit. Was mich anbelangt, ich werde das dem Pfarrer nie und nimmer verzeihen!«
3. Kapitel
Chélan, der Pfarrer von Verrières, war ein alter Mann von achtzig Jahren, der sich aber in der frischen Bergluft einer Gesundheit erfreute, die ebenso eisern war wie sein Charakter. Er hatte das Recht, das Stadtgefängnis, das Spittel und sogar das Armenhaus zu jeder Stunde zu betreten. Der ihm von Paris aus empfohlene Appert war wohlweislich in der neugierigen Kleinstadt früh Schlag sechs Uhr angekommen und hatte sich schnurstracks in das Pfarrhaus begeben.
Als der alte Mann den Brief las, den der Marquis von La Mole, Pair von Frankreich, der reichste Großgrundbesitzer des Kreises, an ihn richtete, stand er lange nachdenklich da.
»Ich bin alt und beliebt hier«, murmelte er schließlich vor sich hin. »Man wird es nicht wagen!«
Alsbald wandte er sich dem Herrn aus Paris zu. In seinen Augen glänzte das heilige Feuer der Freude über eine schöne, nicht ungefährliche Tat.
»Herr Appert, ich werde Sie führen«, sagte er. »Nur bitte ich Sie, sich in Gegenwart des Kerkermeisters und vor allem des Aufsehers im Armenhaus nicht über das zu äußern, was wir da sehen werden.«
Appert merkte, daß er es mit einem Gemütsmenschen zu tun hatte. Er folgte dem ehrwürdigen Geistlichen und besichtigte das Stadtgefängnis, das Spittel und das Armenhaus. Er stellte häufig Fragen, erlaubte sich jedoch selbst auf die verfänglichsten Auskünfte nicht das geringste Wort des Tadels.
Die Besichtigung dauerte mehrere Stunden. Hierauf lud der Pfarrer den Menschenfreund zu sich zum Mittagmahl ein. Der entschuldigte sich damit, er habe dringliche Briefe zu schreiben. In Wahrheit wollte er seinen hochherzigen Führer nicht noch mehr in Gefahr bringen.
Als die beiden Herrn am Nachmittag nochmals nach dem Stadtgefängnis kamen, stand der Kerkermeister, ein baumlanger Kerl mit Säbelbeinen, am Tor. Sein niederträchtiges Gesicht war vor Schreck verzerrt.
»Herr Pfarrer«, sagte er, sobald er ihn erblickte, »ist der Herr in Ihrer Begleitung nicht Herr Appert?«
»Warum?« fragte der Geistliche.
»Ich habe nämlich seit gestern die strengste Order... Der Herr Landrat hat extra den Brigadier hergejagt, und der ist die ganze Nacht unterwegs gewesen. Galopp hat er reiten müssen: ich soll Herrn Appert nicht in das Stadtgefängnis lassen.«
»Ich will ihnen nur sagen, Herr Noiroud«, gab ihm Chélan zur Antwort, »der Fremde, der mich begleitet, ist Herr Appert. Sie wissen wohl, daß ich zu jeder Stunde bei Tag und Nacht das Recht habe, das Gefängnis zu betreten, und daß ich mich dabei begleiten lassen kann, von wem ich will!«
»Jawohl, Herr Pfarrer!« gab der Kerkermeister kleinlaut zu und zog den Kopf ein wie eine Bulldogge, die sich vor dem Stocke duckt. »Aber, Herr Pfarrer, ich habe Frau und Kinder. Wenn es herauskommt, werde ich abgesetzt. Ich habe nichts zum Leben als bloß meine Stelle.«
»Auch mir wäre es sehr schmerzlich, wenn ich meine Stelle verlöre«, sagte der gutmütige alte Mann, und seine Stimme wurde immer weicher.
»Das ist ganz was andres!« erwiderte der Kerkermeister laut. »Sie, Herr Pfarrer, Sie haben bekanntlich eine Rente von achthundert Franken aus dem hübschen Landgütchen.«
Das waren die Geschehnisse, die man in Verrières seit zwei Tagen erörterte und in einem Dutzend verschiedener Lesarten entstellte. Sie hatten den Pfuhl der Leidenschaften des Städtchens bis in den Grund aufgewühlt. Augenblicklich gaben sie den Stoff zu dem kargen Gespräch zwischen Herrn von Rênal und seiner Frau.
Der Bürgermeister hatte am Vormittag in Begleitung von Herrn Valenod, dem Vorstand des Armenamts, den Pfarrer aufgesucht und ihm sein größtes Mißfallen ausgedrückt. Der Geistliche, der keinen hohen Gönner hatte, empfand die volle Schwere ihrer Worte.
»Meine Herren«, erwiderte er, »so werde ich denn mit meinen achtzig Jahren der dritte Pfarrer sein, den man in hiesiger Gegend absetzt. Ich bin jetzt sechsundfünfzig Jahre hier und habe nahezu alle Einwohner der Stadt getauft. Als ich herkam, war Verrières nur ein Marktflecken. Es ereignet sich Tag um Tag, daß ich junge Leute traue, deren Großeltern ich auch schon getraut habe. Die Stadt ist meine Familie. Aber als ich vorgestern den Fremden sah, den Herrn aus Paris, da habe ich mir gesagt: Möglicherweise ist das ein Liberaler. Deren gibt es ja viel zu viele. Aber was kann er unsern Armen und unsern Gefangenen Böses antun?«
Die Vorwürfe des Bürgermeisters und besonders des Armenamtsvorstandes wurden nur noch heftiger.
»Meine Herren!« rief der alte Pfarrer mit bebender Stimme. »Veranlassen Sie, daß ich gemaßregelt werde! Deswegen werde ich doch im Lande bleiben. Wie Sie wissen, habe ich vor achtundvierzig Jahren ein Grundstück geerbt, das mir achthundert Franken Pacht bringt. Davon werde ich leben. Meine Pfarre gewährt mir auch nur meinen Unterhalt, und so schreckt mich Ihre Drohung, sie mir zu nehmen, nicht besonders.«
Herr von Rênal lebte mit seiner Frau sehr glücklich. Trotzdem wollte er eben heftig werden, da er nicht wußte, was er sagen sollte, als sie ihm bescheiden jenen Einwand wiederholte:
»Was kann dieser Herr aus Paris den Gefangenen denn Böses antun?«
Da stieß sie plötzlich einen Schrei aus. Ihr zweites Söhnchen war eben auf die Brustwehr geklettert und lief darauf entlang, ungeachtet, daß die Mauer auf der andern Seite gegen zehn Meter senkrecht in den Weinberg abfiel. Die Furcht, der Junge könne einen Schreck bekommen und hinabstürzen, hinderte sie, ihn zu rufen. Schließlich sah sich das Kind, das an seiner Waghalsigkeit Freude hatte, nach seiner Mutter um und bemerkte ihre Angst. Da sprang es auf die Promenade und rannte zu ihr. Es ward tüchtig ausgescholten.
Der kleine Zwischenfall gab dem Gespräch eine Wendung.
»Auf jeden Fall möchte ich den jungen Sorel, den Sohn des Sägemüllers, zu uns nehmen«, erklärte Herr von Rênal. »Er soll die Kinder beaufsichtigen. Wir können die Racker schon nicht mehr bändigen .. Er ist angehender Priester, also ein tüchtiger Lateiner. Er wird sie vorwärtsbringen. Hat er doch einen festen Charakter, wie der Pfarrer meint. Ich werde ihm dreihundert Franken Jahresgehalt und Kost geben. Nur an seiner politischen Gesinnung zweifle ich ein bißchen. Er war nämlich der Liebling des alten Stabsarztes, des Ehrenlegionärs, der bei den Sorels gehaust hat, als angeblicher Vetter von ihnen. Wer weiß, ob das nicht ein verkappter Spion der Liberalen gewesen ist. Er sagte zwar immer, unsre Bergluft wäre gut gegen sein Asthma. Aber weiß man es denn? Er hat alle Feldzüge des Bonaparte in Italien mitgemacht. Man munkelt sogar, er habe seinerzeit gegen das Kaiserreich gestimmt. Dieser Jakobiner hat dem jungen Sorel das Latein beigebracht und ihm den Haufen Schmöker hinterlassen, den er mitgebracht hatte. Übrigens wäre es mir niemals eingefallen, den Sohn dieses Holzhackers zu unsern Jungen zu nehmen, aber der Pfarrer hat mir erzählt – gerade tags vor der Geschichte, die uns für ewig auseinandergebracht hat –, daß der Sorel seit drei Jahren Theologie studiert und in ein Priesterseminar eintreten will. Somit ist er kein Liberaler. Er ist Lateiner.«
»Auch in andrer Hinsicht ist mein Plan nicht übel«, fuhr Rênal fort, indem er seiner Frau einen verschmitzten Blick zuwarf. »Der Valenod protzt neuerdings mit den zwei prächtigen Normannen, die er sich für seine Kutsche gekauft hat. Aber einen Erzieher für seine Kinder hat er nicht.«
»Wenn er uns unsern nur nicht wegschnappt...«
»Du bist also auch dafür!« unterbrach Rênal seine Frau und dankte ihr für den trefflichen Einfall mit einem Lächeln. »Gut! Somit ist die Sache abgemacht!«
»Du mein Gott! Du bist recht schnell entschlossen, Bester!«
»Ja, ja! Weil ich weiß, was ich will! Der Pfarrer hat das heute auch verspürt. Wir wollen uns nichts vormachen: wir sind hier von Liberalen umringt! Alle diese Leinwandhändler sind voller Neid auf mich. Darüber bin ich mir ganz klar. Zwei oder drei von ihnen sind nahe daran, reiche Leute zu werden. Es soll mir Spaß machen, wenn sie die Kinder des Herrn von Rênal mit ihrem Erzieher auf der Stadtpromenade erblicken. Das wird ihnen imponieren. Mein Großvater hat uns oft erzählt, daß er in seiner Jugend einen Erzieher hatte .. Das kostet mich zwar hundert Taler, aber es ist für uns eine notwendige Ausgabe, um standesgemäß aufzutreten.«
Der plötzliche Entschluß versetzte Frau von Rênal in tiefes Nachdenken. Sie war eine große stattliche Erscheinung, ehedem der Stern der Gegend, wie man in den Bergen zu sagen pflegt. Ihr Wesen war unsagbar schlicht. Ihr Gang jugendhaft. Ihre unbewußte, keusche und frische Grazie wäre für einen Pariser süße Wollust gewesen. Aber Frau von Rênal hätte sich geschämt, wenn ihr ein solcher Eindruck bekanntgeworden wäre. Gefallsucht und Geziertheit waren ihrem Herzen fremde Dinge. Valenod, der Armenamtsvorstand, ein reicher Mann, hatte ihr, wie es hieß, den Hof gemacht, aber ohne Erfolg. Das hatte ihrer Tugend den Heiligenschein verliehen, denn Valenod war ein ansehnlicher junger Mann. Mit seinem kräftigen Körperbau, seinem roten Gesicht und seinem langen schwarzen Backenbart war er einer jener ungeschlachten, dünkelhaften und lärmigen Burschen, die unter Provinzlern für schöne Männer gelten.
Frau von Rênal, eine sehr scheue und sichtlich ganz andersartige Natur, war insbesondere durch die ewige Unruhe und die heftige laute Art Valenods abgeschreckt worden. Da sie sich von allem fernhielt, was in Verrières für lustig galt, war sie in den Ruf gekommen, ungemein adelsstolz zu sein. Derlei kam ihr gar nicht in den Sinn; nur war sie seelenfroh, daß die Verrièrer sie seltener aufsuchten. Übrigens galt sie in den Augen ihrer Bekanntinnen für dumm, dieweil sie ihrem Manne gegenüber so gar keine Diplomatin war und sich die besten Gelegenheiten, einen schönen neuen Hut aus Paris oder Besançon zu bekommen, regelmäßig entgehen ließ. Es war ihr alles recht, wenn sie nur in ihrem Garten einsam und allein bleiben durfte.
Bei ihrem harmlosen Gemüt verstieg sie sich weder dahin, ihren Mann zu kritisieren, noch gar, sich einzugestehen, daß er sie langweilte. Ohne es in Worte zu fassen, hatte sie sich damit abgefunden, daß es zwischen Mann und Frau keine weiteren Zärtlichkeiten gäbe. Am meisten liebte sie ihren Gatten, wenn er ihr von seinen Plänen mit den Kindern erzählte. Der eine sollte Offizier, der andre Verwaltungsbeamter und der dritte Geistlicher werden. Alles in allem fand sie ihren Mann weniger langweilig als alle anderen Männer, die sie je kennengelernt hatte.
Diese Beurteilung Rênals durch seine Gattin war durchaus verständig. Der Bürgermeister von Verrières galt für witzig und weltmännisch, und zwar, weil er über ein Dutzend spaßiger kleiner Geschichten verfügte. Die hatte er von einem Onkel geerbt, dem Hauptmann a. D. von Rênal, der vor der Revolution im Infanterie-Regiment des Herzogs von Orleans gestanden und in Paris in den Salons des Fürsten verkehrt hatte. Dort war er mit allerhand berühmten und berüchtigten großen Damen und Herren in Berührung gekommen. Diese Persönlichkeiten erschienen nun in den Anekdoten des Bürgermeisters oft genug, wenngleich er die Wiederholung dieser heiklen Geschichten allmählich selber satt bekam. Er gab sie nur noch bei besonderen Gelegenheiten zum besten. Da er außerdem sehr höflich war, abgesehen in Geldangelegenheiten, so galt er mit Recht für den größten Aristokraten von Verrières.
4. Kapitel
»Meine Frau ist wirklich ein gescheites Wesen!« sagte sich der Bürgermeister, als er am nächsten Morgen um sechs Uhr zum Vater Sorel nach der Sägemühle hinunterging. »Ich habe ihr zwar meine Absicht mitgeteilt, um die mir zukommende Superiorität zu wahren; aber das wäre mir beileibe nicht eingefallen! Gewiß! Wenn ich mir den kleinen Abbé, der Latein können soll wie ein junger Gott, nicht gleich nehme, so kann der Armenamtsvorstand, dieser Schelm, auf den nämlichen Gedanken kommen und mir ihn wegschnappen! Mit welcher Eingebildetheit würde er von dem Erzieher seiner Söhne reden! Hm! Wenn dieser Sorel einmal in meinem Hause ist, ob er dann jemals Geistlicher wird?«
Rênal grübelte noch über dieses Problem nach, als er von weitem einen Bauern erblickte, einen auffällig langen Mann, den Vater Sorel, der seit Tagesgrauen damit beschäftigt war, Baumstämme zu messen, die am Doubs auf dem Uferpfad lagen. Das Erscheinen des Bürgermeisters kam dem Alten ziemlich ungelegen, weil das Holz den Weg versperrte, was gegen die polizeilichen Vorschriften verstieß.
In hohem Maße überrascht und in noch höherem befriedigt war er aber, als er den sonderbaren Vorschlag vernahm, den ihm Herr von Rênal in betreff seines Sohnes Julian machte. Gleichwohl hörte er mit der mürrischen, unzufriedenen und gleichgültigen Miene zu, hinter der sich die Schlauheit des Bergvolkes versteckt. Eine gewisse Ähnlichkeit mit den Fellachen Ägyptens haftet diesem Menschenschlage von der Zeit der spanischen Fremdherrschaft her an.
Die Antwort, die Sorel gab, bestand zunächst in einer Flut von Höflichkeitsformeln, die er auswendig wußte. Während er diese hohlen Worte herleierte, grinste und greinte er, wodurch der verschmitzte und geradezu spitzbübische Grundzug seines Gesichts noch mehr hervortrat. Der rege Verstand des Alten suchte hinter die Gründe zu kommen, die einen so hohen Herrn wohl veranlaßten, seinen Taugenichts von Sohn in sein Haus nehmen zu wollen. Er war mit seinem Julian sehr unzufrieden, und diesem Bürschchen bot Herr von Rênal urplötzlich ein Gehalt von hundert Talern im Jahr, dazu Kost und Wohnung, ja sogar Bekleidung! Die letzte Bedingung hatte der schlaue Vater Sorel schnell noch gestellt, und Rênal war damit einverstanden.
Der Bürgermeister war verblüfft. Er sagte sich: »Da Sorel von meinem Vorschlage nicht besonders entzückt und überwältigt ist, wie er das doch eigentlich sein müßte, so ist es klar, daß ihm schon von andrer Seite Angebote gemacht worden sind. Und woher können die anders kommen als von Valenod?«
Vergebens drang Rênal in den Alten, sich sofort zu entscheiden. Der hinterlistige Sägemüller sträubte sich hartnäckig dagegen. Er wolle erst mit seinem Jungen reden, meinte er, als ob es auf dem Lande Sitte wäre, daß ein vermögender Vater mit einem Sohn, der nichts hat, auch nur pro forma unterhandelt.
Eine Sägemühle besteht aus einem Schuppen dicht am Wasser. Das Dach ruht auf einem Gerüst über vier starken Holzpfeilern. Acht bis zehn Fuß über dem Boden, in der Mitte des Schuppens, geht eine Säge auf und nieder, während eine ganz einfache Vorrichtung einen Stamm gegen die Säge drückt. Ein Schaufelrad, das vom Bache getrieben wird, leitet die doppelte Bewegung, sowohl die der Säge, die auf und nieder geht, wie die des Stammes, der sich der Säge langsam nähert und von ihr in Bretter zerteilt wird.
Als sich Vater Sorel seiner Mühle näherte, rief er mit Stentorstimme: »Julian!« Es kam keine Antwort. Er sah niemanden als die Hünengestalten seiner älteren Söhne, die mit schweren Äxten die Fichtenstämme bearbeiteten, ehe diese unter die Säge gelangten. Sie verwandten ihr ganzes Augenmerk darauf, den auf das Holz gezogenen schwarzen Strich genau einzuhalten. Jeder Axtschlag spaltete mächtige Splitter ab.
Die jungen Männer hörten den Ruf ihres Vaters nicht. Er wandte sich nach dem Schuppen und betrat ihn. Aber auf dem ihm zugeteilten Posten neben der Säge fand er den Gesuchten nicht. Er bemerkte ihn fünf oder sechs Fuß höher, im Reitsitz auf einem der Dachbalken. Anstatt den Gang des Sägewerks gewissenhaft zu überwachen, las er in einem Buche. Nichts war dem alten Sorel mehr zuwider. Die körperliche Schwäche, die seinen Jüngsten im Gegensatz zu den älteren Brüdern zu schwerer Arbeit untauglich machte, die hätte er ihm vielleicht nachgesehen, aber diese Lesewut haßte er. Er selber konnte nicht lesen.
Umsonst rief er zwei-, dreimal: »Julian!« Das Buch, in das der Junge sich vertieft hatte, war mehr noch denn der Lärm der Säge schuld, daß er die furchtbare Stimme seines Vaters überhörte. Schließlich sprang der Alte trotz seines Alters behend auf den Stamm, der sich der Säge entgegenschob, und von da auf den Querbalken unter dem Dach. Durch einen heftigen Schlag seiner Faust flog dem Leser das Buch aus der Hand, weit weg in den Mühlgraben. Ein zweiter, ebenso heftiger Schlag traf ihn auf den Kopf. Der Mißhandelte verlor das Gleichgewicht. Er wäre die zwölf bis fünfzehn Fuß hinabgestürzt, gerade in die auf und nieder gehende Säge, von der er zerschnitten worden wäre, wenn ihn sein Vater nicht im Fall an der linken Hand gepackt hätte.
»Siehst du, du Faulpelz! Liest immer wieder in deinen verfluchten Büchern, statt auf die Säge aufzupassen! Schmökre gefälligst abends, wo du deine Zeit beim Pfarrer vertrödelst!«
Julian war durch den starken Schlag halb betäubt; auch blutete er. Trotzdem schickte er sich an, seinen Posten bei der Säge wieder aufzusuchen. Die Tränen standen ihm in den Augen, weniger wegen des körperlichen Schmerzes als darüber, daß sein geliebtes Buch dahin war.
»Komm herunter, du Lümmel! Ich habe mit dir zu reden!« schrie der Alte; aber wiederum verschlang das Kreischen der Säge den Befehl.
Vater Sorel war bereits hinabgesprungen. Um nicht nochmals hinaufklettern zu müssen, ergriff er eine lange Stange, die zum Nüsseabschlagen diente, und stieß seinen Sohn damit an die Schulter. Kaum war Julian ebenfalls unten, so trieb ihn der Alte unter rohen Stößen nach dem Wohnhause.
»Gott weiß, was er mit mir vorhat!« dachte der junge Mensch und warf im Weglaufen einen wehen Blick nach dem Mühlgraben, in den sein Buch gefallen war, sein Lieblingsbuch: das Memorial von Sankt Helena. Seine Wangen waren erglüht. Er sah zu Boden.
Julian war ein Bursche von achtzehn oder neunzehn Jahren, schwächlich von Aussehen, mit unregelmäßigen, aber feinen Zügen und einer Adlernase. Seine großen schwarzen Augen, die im gewöhnlichen ruhigen Zustande versonnen leuchteten, blitzten jetzt voll von wildestem Haß. Sein kastanienbraunes, ziemlich tief angesetztes Haar ließ seine Stirn niedrig erscheinen und verlieh ihm im Moment des Zorns etwas Bösartiges. Unter den zahllosen Varianten des Menschenantlitzes ist keine eindringlicher als die zornig-böse. Seine schlanke, gutgewachsene Figur verriet mehr Gewandtheit denn Kraft. Er war von Kindheit an immer überaus grüblerisch und sehr blaß gewesen; daher hatte sein Vater geglaubt, er werde nicht lange leben oder, wenn er am Leben bliebe, seiner Familie nur eine Last sein. Von jedermann im Hause verachtet, haßte er seinerseits Vater und Brüder. An den Sonntagen, wenn die Jungen auf dem Markt spielten, bekam er immer Schläge. Erst seit einem Jahre begann ihm sein hübsches Gesicht Wohlwollen unter den jungen Mädchen zu verschaffen.
Als Schwächling von aller Welt geringgeschätzt, war er in schwärmerischer Liebe zu jenem alten Stabsarzt entbrannt, der den Bürgermeister einmal wegen der Platanen zur Rede zu stellen gewagt hatte. Der alte Kriegsmann kaufte ihn zuweilen bei seinem Vater tageweise los und erteilte ihm Unterricht im Latein und in der Geschichte, das heißt in der Geschichte des Feldzuges in Italien von Anno 1796. Bei seinem Tode hinterließ er ihm sein Kreuz der Ehrenlegion, die Ersparnisse von seiner dürftigen Pension und dreißig bis vierzig Bücher, deren köstlichstes eben in den öffentlichen Bach geflogen war, dem die Macht des Bürgermeisters einen neuen Lauf gegeben hatte.
5. Kapitel
Kaum war Julian im Hause, so fühlte er die Hand seines Vaters auf seiner Schulter. Es durchschauerte ihn. Er war auf Schläge gefaßt.
»Antworte mir ohne Lüge!« schrie ihm der Alte grob in die Ohren und drehte ihn dabei herum wie ein Kind einen Zinnsoldaten. Julians große, schwarze, tränenvolle Augen sahen sich dicht vor den kleinen, grauen, bösen Augen des Müllers, die ihn anblickten, als wollten sie sich in den Grund seiner Seele einbohren.
»Antworte mir ohne Lüge, wenn du das kannst, du Leseratte! Woher kennst du die Frau Bürgermeister? Wann hast du mit ihr gesprochen?«
»Ich habe nie mit ihr gesprochen«, antwortete Julian. »Nur in der Kirche habe ich die Dame gesehen.«
»Aber angestarrt hast du sie, du frecher Wicht?«
»Niemals. Sie wissen, in der Kirche schaue ich Gott allein.«
Julian sagte dies demütig und heuchlerisch. Er hoffte, dadurch weitere Maulschellen von sich abzuwenden.
»Das ist mir nicht ganz geheuer«, brummte der durchtriebene Bauen und schwieg einen Augenblick. »Aber aus dir kriegt man ja nichts heraus, verdammter Heuchler! Gott sei Dank, daß ich dich nun bald los bin. Nicht zum Schaden meiner Mühle. Du hast den Pfarrer oder wer weiß wen zum Freunde. Der hat dir die schöne Stelle verschafft. Pack deine Siebensachen ein! Ich werde dich zu Herrn von Rênal bringen. Du sollst der Erzieher seiner Kinder werden.«
»Was bekomme ich dafür?«
»Kost, Kleidung und hundert Taler im Jahre.«
»Ich mag kein Lakai sein!«
»Schafskopf! Wer sagt was von Lakai sein? Glaubst du, ich ließe zu, daß mein Sohn Lakai wird?«
»Aber mit wem am Tische esse ich da?«
Diese Frage brachte den alten Sorel aus dem Gleise. Er hatte das Gefühl, daß er leicht etwas Unvorsichtiges sagen könne, wenn er weiterredete. Maßlos heftig überhäufte er Julian mit Schimpfworten. Er sei ein Leckermaul. Dann ließ er ihn stehen und holte sich Rat bei seinen andern Söhnen.
Alsbald sah Julian, wie sie, auf ihre Äxte gestützt, miteinander berieten. Eine Weile schaute er hin. Da er aber keine Silbe verstehen konnte, nahm er seinen Platz an der Säge wieder ein, jedoch jenseits von ihr, um vor einem weiteren Überfall gedeckt zu sein. Er wollte sich das Angebot, das sein Schicksal mit einemmal änderte, überlegen, aber er war unfähig, dies nüchternen Sinnes zu tun. Seine Phantasie malte ihm immer nur vor, was in dem schönen Rênalschen Hause seiner wohl harrte.
»Lieber auf alles das verzichten«, sagte er sich, »als mich so weit erniedrigen, daß ich zusammen mit den Dienstboten esse! Mein Vater möchte mich offenbar dazu zwingen. Eher sterbe ich! Ich habe fünf Taler und vier Groschen in der Tasche, meine Ersparnisse. Damit laufe ich heute nacht fort. In zwei Tagen gelange ich auf Seitenwegen, wo ich keinen Gendarm zu fürchten habe, nach Besançon. Dort lasse ich mich zu den Soldaten anwerben. Nötigenfalls entwische ich nach der Schweiz. Mit der Karriere ist es dann freilich vorbei. Dann nützt all mein Ehrgeiz nichts. Lebe wohl, schöner Priesterstand, der einem alle Wege öffnet!«
Julians Abscheu vor dem gemeinschaftlichen Essen mit Dienstboten lag nicht in seiner Natur. Um vorwärtszukommen, hätte er noch viel peinlichere Dinge ertragen. Dieser Widerwille rührte aus Rousseaus Bekenntnissen her, dem Buche, nach dem er sich einzig und allein ein phantastisches Bild von der Gesellschaft machte. Nur die Bulletins der Großen Armee und das Memorial von Sankt Helena ergänzten diese seine Bibel. Für diese drei Bücher wäre er in den Tod gegangen. Allen andern mißtraute er. Einem Ausspruch des alten Stabsarztes zufolge hielt er die ganze Weltliteratur für Lug und Trug, für Machwerke von Narren und Strebern.
Zu Julians Feuerseele gesellte sich ein fabelhaftes Gedächtnis, wie es sonst eher törichte Leute haben. Um den alten Pfarrer Chélan zu gewinnen, von dem sein künftiges Schicksal abhing, wie er wohl wußte, hatte er das Neue Testament lateinisch auswendig gelernt, an dessen Echtheit er indessen nicht glaubte. Außerdem kannte er das Papstbuch von Maistre, das er aber auch nicht für Wahrheit nahm.
Wie aus stummer Übereinkunft vermieden es Vater und Sohn, an jenem Tage miteinander zu sprechen. Gegen Abend ging Julian zum Pfarrer, zum theologischen Unterricht. Aus Vorsicht erzählte er ihm nichts von dem sonderbaren Angebot, das man seinem Vater gemacht hatte. »Vielleicht war das nur eine Falle«, sagte er sich. »Ich muß so tun, als hätte ich die Sache gar nicht ernst genommen!«
Am andern Tage früh ließ Herr von Rênal den alten Sorel zu sich bitten. Nach länger denn einer Stunde begab sich der Sägemüller schließlich hin. Schon an der Tür erschöpfte er sich in tausend Entschuldigungen und ebensoviel Bücklingen. Im Laufe der Verhandlung vergewisserte sich Sorel nach allen möglichen Einwänden, daß sein Sohn für gewöhnlich die Mahlzeiten mit dem Herrn und der Frau des Hauses einnehmen, aber an Tagen, wo Gäste da wären, in einem besondern Zimmer zusammen mit den Kindern essen werde. Je mehr er merkte, daß es Rênal eilig hatte, um so mehr Schwierigkeiten machte er. Ebenso mißtrauisch wie verblüfft begehrte er unter anderm den Raum zu sehen, wo sein Sohn schlafen sollte. Es war ein großes, sehr freundlich ausgestattetes Zimmer, in das die Betten der drei Kinder bereits hereingeschafft wurden.
Der alte Bauer schmunzelte insgeheim, verlangte aber nunmehr, dreist geworden, den Anzug zu sehen, den sein Sohn bekäme. Herr von Rênal öffnete sein Schreibpult und nahm hundert Franken heraus.
»Mit diesem Geld«, sagte er, »wird Ihr Sohn zum Schneider Durand gehen und sich einen kompletten schwarzen Anzug machen lassen.«
»Wenn ich meinen Jungen aber einmal wieder von Ihnen fortnehme, kann er dann den Anzug trotzdem behalten?«
Sorel hatte jedwede Katzbuckelei vergessen.
»Gewiß!«
»Na, schön!« meinte Sorel bedächtig. »So bliebe nur noch eins auszumachen: Wieviel Gehalt wollen Sie geben?«
»Was!« fuhr Rênal entrüstet auf. »Darüber sind wir uns doch schon gestern einig geworden! Ich gebe hundert Taler. Ich dächte, das wäre genug, ja übergenug!«
»Das war Ihr Gebot! Sehr richtig!« erwiderte Vater Sorel. Seine Rede ward noch überlegsamer, und indem er Herrn von Rênal scharf anblickte, fügte er hinzu: »Andere Leute zahlen besser.«
Das war so recht die geniale Frechheit eines Bauern der Freigrafschaft! Der Bürgermeister sah im Augenblick ganz verdutzt aus. Er faßte sich jedoch sofort, und nach reichlich zweistündigem Hin- und Hergerede, wobei kein unüberlegtes Wort fiel, siegte die Schlauheit des Bauern über die Schlauheit des Patriziers, dieweil sie bei diesem nicht Daseinsbedingung war. Julians neue Lebensweise ward in einer langen Reihe von Punkten festgelegt. Sein Gehalt solle vierhundert Franken im Jahre betragen, zahlbar jeden Ersten des Monats im voraus.
»Also zahle ich ihm monatlich fünfunddreißig Franken!« erklärte Herr von Rênal.
»Sagen wir: sechsunddreißig, eine runde Summe.« Und schmeichlerisch fügte der Bauer hinzu: »Ein reicher und freigebiger Mann wie der Herr Bürgermeister wird sich nicht lumpen lassen!«
»Abgemacht!« sagte Rênal. »Aber nun bleibt es dabei!«
Der Zorn verlieh ihm plötzlich den Ton der Bestimmtheit. Der Bauer merkte, daß er nicht weiter gehen durfte. Jetzt gewann wieder Herr von Rênal die Oberhand. Er dachte nicht daran, die sechsunddreißig Franken für den ersten Monat dem Alten anzuvertrauen, der sie am liebsten auf der Stelle für seinen Sohn eingestrichen hätte. Auch fiel Herrn von Rênal ein, daß er seiner Frau etwas Imponierendes über seine Verhandlung mit dem Bauern berichten mußte.
»Geben Sie mir die hundert Franken wieder, die ich Ihnen vorhin eingehändigt habe«, sagte er ärgerlich. »Durand ist mir etwas schuldig. Ich werde mit Ihrem Sohne hingehen und den Anzug selber aussuchen.«
Sorel hatte seine Kraft erprobt; jetzt verschanzte er sich schlauerweise abermals hinter höflichem Gerede. Dies dauerte eine gute Viertelstunde. Als er am Ende aber einsah, daß platterdings nichts mehr zu erreichen war, empfahl er sich. Seine letzte Verbeugung ward von den Worten gekrönt:
»Ich schicke meinen Sohn sofort ins Schloß.«
So nannten die Unterbeamten des Bürgermeisters dessen Haus, wenn sie sich bei ihm einschmeicheln wollten.
Als der alte Sorel in seine Mühle zurückkam, suchte er seinen Sohn vergeblich. Dem ihm Bevorstehenden nicht trauend, war er mitten in der Nacht aufgebrochen, um seine Bücher und das Kreuz der Ehrenlegion in Sicherheit zu bringen. Er schaffte alles zu seinem Freund, einem jungen Holzhändler namens Fouqué, der in den Bergen oberhalb von Verrières wohnte.
Als er heimkehrte, schrie ihn der Vater an:
»Verfluchter Faulpelz, weiß der Teufel, ob du genug Ehre im Leibe hast, mir je das Geld wiederzuerstatten, das ich für deine Erziehung in den vielen Jahren aufgewendet habe. Jetzt schnür dein Bündel und scher dich zum Bürgermeister!«
Julian wunderte sich, daß er keine Prügel bekam, und trollte sich schleunigst von dannen. Aber kaum war er außer der väterlichen Sehweite, als er seine Schritte verlangsamte. Es fuhr ihm durch den Sinn, daß es von Nutzen sei, wenn er aus Scheinheiligkeit in der Kirche Station machte.
Scheinheiligkeit! Welche umständliche seelische Entwicklung gehört dazu, ehe ein Bauernkind solch ein abscheuliches Wort bewußt gebraucht!
Als kleiner Junge hatte Julian sechste Dragoner gesehen, in langen weißen Reitermänteln, mit großen schwarzen Haarbüschen auf den Helmen. Sie kamen auf ihrem Rückmarsch aus der Lombardei durch die Stadt, und etliche halfterten ihre Pferde am Fenstergitter seines Vaterhauses an. Dieser Anblick hatte den kleinen Julian für den Soldatenberuf begeistert. Später lauschte er voll Entzücken dem alten Stabsarzte, wenn er ihm von den Schlachten bei Arcole, Lodi und Rivoli erzählte. Die glühenden Blicke, die der alte Mann auf sein Ehrenkreuz warf, vergaß er nie.
Aber als Julian vierzehn Jahre alt war, wurde in Verrières eine Kirche erbaut, die in einem so kleinen Ort für prunkvoll gelten konnte. Besonders staunte er vier Marmorsäulen an. Sie wurden in der ganzen Gegend berühmt, denn sie waren der Anlaß der Todfeindschaft zwischen dem Ortsrichter und dem aus Besançon herversetzten jungen Vikar, der als Spion der Jesuiten galt. Der Ortsrichter hätte beinahe seinen Posten verloren – wenigstens war dies die allgemeine Meinung –, weil er es gewagt, in Zwist mit einem Priester zu geraten, der fast alle vierzehn Tage nach Besançon, offenbar zum Herrn Bischof, fuhr.
In der Folge hatte der Ortsrichter, Vater einer zahlreichen Familie, mehrere Urteile gefällt, die man als Ungerechtigkeit auffaßte, und zwar samt und sonders zuungunsten von Leuten, die den Constitutionnel, das Blatt der Liberalen, lasen. Die sogenannte gute Sache hatte also gesiegt! Es handelte sich bei besagten Urteilen allerdings nur um geringfügige Strafen, um ein paar Franken, aber eine dieser Entscheidungen traf einen Paten Julians, einen Nagelschmied. In seinem Zorn rief der Mann aus: »Ja, ja, die Zeiten haben sich geändert. Zwei Jahrzehnte hindurch galt uns der Ortsrichter als anständiger Mann!«
Julians Freund, der alte Stabsarzt, war tot. Urplötzlich hörte Julian auf, von Napoleon zu reden. Jetzt erklärte er die Absicht, Priester zu werden. Alsbald sah man ihn beständig in der Schneidemühle seines Vaters beim Auswendiglernen einer lateinischen Bibel, die ihm der Pfarrer geliehen hatte. Verwundert über die Fortschritte des jungen Menschen, verbrachte der alte Mann manchen langen Abend mit ihm, um ihn in der Theologie zu unterweisen. Julian offenbarte ihm nur fromme Regungen. Kein Mensch konnte ahnen, daß dieser bleiche, zarte, mädchenhafte Bursche den unerschütterlichen Vorsatz in sich trug, tausendmal sein Leben zu riskieren, wenn er nur sein Glück machte.
Sein Glück machen! Das hieß zunächst, aus Verrières hinauskommen. Er haßte seine Heimat. Alles, was er daselbst sah, hemmte sein phantastisches Innenleben.
Von klein auf hatte er Augenblicke höchster Erregung gehabt. In Wonnen träumte er sich aus, wie er eines Tages die Bekanntschaft hübscher Pariserinnen machen werde, nachdem er ihre Aufmerksamkeit durch eine außerordentliche Tat auf sich gezogen. Warum sollte er nicht von einer von ihnen geliebt werden, wie Bonaparte, noch arm, von der wunderschönen Frau von Beauharnais geliebt worden war? Schon viele Jahre lang war auch nicht eine Stunde verronnen, in der Julian nicht vor Augen gehabt, daß sich Bonaparte, der unbekannte mittellose Artillerieleutnant, durch seinen Degen zum Herrn der Welt gemacht hatte. Der eine Gedanke tröstete ihn in all seinem Ungemach, das er für ein großes Unglück hielt, und durchsonnte die Freuden, die ihm bisweilen zuteil wurden.
Der Kirchenbau und die Urteile des Ortsrichters waren die Ursache, daß es ihm mit einem Schlage wie Schuppen von den Augen fiel. Diese Erleuchtung machte ihn wochenlang toll und durchflammte ihn schließlich mit jener Allgewalt, die die erste selbstgefundene Idee in einer leidenschaftlichen Seele erzeugt.
Er sagte sich: »Als Bonaparte aus dem Dunkel hervortrat, stand Frankreich vor dem Einmarsch der fremden Mächte. Das Soldatentum war notwendig und Mode. Heutzutage sieht man Priester, die mit vierzig Jahren ein Einkommen von hunderttausend Franken haben. Das ist dreimal mehr, als die weltberühmten Divisionsgenerale Napoleons bezogen. Die Priester brauchen Helfershelfer. Da ist zum Beispiel dieser Ortsrichter, ein heller Kopf und bisher ein Ehrenmann – aber auf seine alten Tage entehrt er sich aus Angst vor einem jungen Vikar von dreißig Jahren! Ja, heutzutage muß man Pfaffe werden!«
Einmal freilich verriet sich Julian trotz aller seiner neuen Frömmigkeit, nachdem er bereits zwei Jahre Gottesgelehrter war, durch einen jähen Ausbruch der Glut, die seine Seele heimlich verzehrte. Es war im Hause des Pfarrers Chélan bei einem Priestermahle. Der gute Pfarrer hatte ihn als seinen Musterschüler vorgestellt; da hatte er das Mißgeschick, von Napoleon schwärmerisch zu reden. Zur Strafe und Buße band er sich den Arm in eine Binde, behauptete, er hätte sich ihn beim Wälzen eines Fichtenstammes ausgerenkt, und trug ihn acht Wochen lang in dieser unbequemen Lage. Nach dieser Selbsttortur verzieh er sich.
So war der neunzehnjährige Bursche, den man ob seines schwächlichen Aussehens kaum siebzehn Jahre alt schätzte. Sein kleines Bündel unterm Arme, betrat er die prächtige Kirche von Verrières. Sie war dunkel und menschenleer. Eines Kirchfestes wegen waren sämtliche Fenster des Schiffes mit scharlachrotem Tuch verhängt. An der Sonnenseite schimmerte Licht dahinter und schuf eine feierliche weihevolle Stimmung. Den einsamen Julian durchschauerte es. Er ließ sich auf der Kirchenbank nieder, die ihm am vornehmsten aussah. Sie trug das Wappen des Herrn von Rênal. Auf dem Brett für das Gebetbuch lag ein Stück bedrucktes Papier, das merkwürdig auffällig war. Sein Blick fiel darauf, und er las:
»Einzelheiten von der Hinrichtung und den letzten Augenblicken Ludwig Jenrels, enthauptet zu Besançon am ..«
Das Weitere war abgerissen. Auf der Rückseite standen die Anfangsworte einer Zeile:
»Der erste Schritt...«
»Wer mag das Papier hierhin gelegt haben?« fragte sich Julian. »Armer Teufel!« dachte er und seufzte auf. »Sein Name hat dieselbe Endsilbe wie meiner.«
Er knüllte das Papier zusammen.
Beim Wiederhinausgehen kam es Julian vor, als seien Blutflecke am Weihwasserbecken. Es war der Widerschein der Fensterbehänge, der ein paar übergespritzte Wassertropfen blutrot färbte. Da schämte er sich seiner geheimen Angst.
»Bin ich ein Feigling?« fragte er sich. »An die Gewehre!«
Dies Kommandowort, das in den Kriegserinnerungen des alten Stabsarztes eine große Rolle gespielt hatte, war für Julian ein Symbol des Heldentums. Er machte sich auf und ging raschen Schritts nach dem Rênalschen Hause.
Aber so tapfer er sein wollte, er wurde doch beim Anblick des Gebäudes von unüberwindlicher Scheu befallen. Die Gittertür des Vorgartens stand offen. Sie kam ihm prunkvoll vor. Um zur Haustür zu gelangen, mußte er hindurch.
6. Kapitel
Übrigens war es nicht allein Julian, der in Aufregung war. Die überaus zarte und scheue Frau von Rênal befand sich in der größten Unruhe, seit sie wußte, daß ein Fremdling fortan befugtermaßen zwischen ihr und ihren Kindern stehen sollte. Sie war daran gewöhnt, daß sie mit den drei Jungen zusammen in einem Zimmer schlief. Am Vormittag, als die drei kleinen Betten in das Zimmer getragen wurden, das nunmehr der Erzieher bewohnen sollte, waren viel Tränen geflossen. Vergebens bat sie ihren Mann, wenigstens das Bett von Stanislaus-Xaver in ihrem Schlafzimmer zu lassen.
Die weibliche Empfindsamkeit war in Frau von Rênal übertrieben entwickelt. Sie machte sich von dem künftigen Hauslehrer das widerlichste Bild, indem sie sich einen groben schlechtgepflegten Gesellen vorstellte, der den Auftrag hätte, ihre Kinder zu malträtieren, und dies aus keinem andern Grunde, als weil er Latein verstand, eine wildfremde unnütze Sprache.
Mit der behenden Grazie, die ihr eigen war, sobald sie sich unbeobachtet fühlte, war Frau von Rênal eben durch die Glastür des nach dem Vorgarten zu gelegenen Salons ins Freie getreten, da bemerkte sie am Tor einen Bauernjungen, der ihr beinahe noch wie ein Kind erschien, mit totenblassem Gesicht und Tränen in den Augen. Er hatte ein schneeweißes Hemd an und eine saubere ärmellose Weste aus rotblauem Wollstoff.
Seine Gesichtsfarbe war so licht und seine Augen so sanft, daß Frau von Rênal in ihrem ein wenig romantischen Sinn zunächst dachte, es sei ein verkleidetes Mädchen, das dem Bürgermeister irgendein Anliegen vorbringen wolle. Sie bekam Mitleid mit dem armen Wesen, das dort an der Haustür nicht den Mut hatte, die Glocke zu ziehen. Deshalb ging sie hin. Im Augenblick hatte sie Kummer und Sorge über die bevorstehende Ankunft des Erziehers vergessen.
Julian stand der Tür zugewandt und bemerkte das Nahen der Frau von Rênal nicht. Beim Klang einer leisen Stimme ganz dicht an seinem Ohre schrak er zusammen.
»Was willst du, mein Kind?« fragte sie.
Er drehte sich rasch um. Frau von Rênals Augen strahlten so viel Güte aus, daß sich ein Teil von Julians Schüchternheit verlor. Betroffen von ihrer Schönheit vergaß er alles, sogar den Anlaß, warum er hergekommen war.
Sie wiederholte ihre Frage.
»Ich soll hier Hauslehrer werden, gnädige Frau«, stotterte er endlich, und voll Scham über seine Tränen machte er den Versuch, sie wegzuwischen.
Frau von Rênal fand kein Wort mehr. Sie blickten einander in die Augen. Julian hatte noch nie eine so gut gekleidete Dame gesehen und vor allem noch nie eine, die so glänzende Haut gehabt und mit so sanfter Stimme zu ihm gesprochen hatte. Und sie, sie schaute auf die dicken Tränen, die auf den eben noch blassen, jetzt aber rosigen Wangen des Bauernburschen standen. Plötzlich begann sie fröhlich und übermütig wie ein junges Mädchen zu lachen. Sie machte sich über sich selbst lustig und vermochte ihr Glück nicht zu fassen. So sah also der Erzieher aus, den sie sich als einen unsauberen und schlecht gekleideten Priester vorgestellt hatte, als Schinder und Quäler ihrer Kinder!
»Aha!« sagte sie schließlich zu ihm. »Herr Sorel, der Lateiner!«
Die Anrede ›Herr‹ war dem jungen Manne so ungewohnt, daß er einen Augenblick nachdachte.
»Jawohl, gnädige Frau!« antwortete er befangen.
In ihrem Glücke wagte Frau Rênal die Frage: »Nicht wahr, Sie werden die armen Kinder nicht grob behandeln?«
»Ich – sie grob behandeln? Aus welchem Grunde?« fragte er erstaunt.
Sie schwieg eine kleine Weile. Dann fuhr sie leise und in wachsender Erregung fort: »Nicht wahr, Herr Sorel, Sie werden gut mit ihnen sein? Versprechen Sie mir das?«
Abermals hörte er sich in vollem Ernst ›Herr Sorel‹ nennen, dazu von einer so vornehmen Dame. Das übertraf seine kühnsten Träume. In seinen jugendlichen Hirngespinsten waren Damen nur dann so gnädig gewesen, mit ihm zu reden, wenn er eine schöne Uniform anhatte.
Frau von Rênal war nicht minder überrascht über Julians zartes Gesicht, seine großen schwarzen Augen und sein hübsches Haar, das heute lockiger denn sonst war, weil er, um sich zu kühlen, eben den Kopf in das Brunnenbecken am Markt gesteckt hatte. Ihre größte Freude aber an diesem fatalen Hauslehrer, vor dessen Strenge und Grobheit ihr so sehr gebangt hatte, war seine mädchenhafte Schüchternheit. Für das friedsame Gemüt der Frau von Rênal war der Widerspruch zwischen dem, was sie eben noch befürchtet hatte, und dem, was sie jetzt sah, ein wahres Ereignis. Endlich gewann sie ihren Gleichmut zurück. Nun erschrak sie, daß sie mit einem Bauernburschen in Hemdsärmeln an der Haustür stand.
Ziemlich verlegen sagte sie: »Kommen Sie mit herein, Herr Sorel!«
Nie in ihrem Leben hatte eine ungetrübt angenehme Empfindung sie so stark erregt, und noch nie war ihr etwas so Erfreuliches plötzlich an die Stelle von Angst und Sorge getreten. Ihre netten Jungen, die sie so hegte und pflegte, sollten also doch keinem schmutzigen und nörgelnden Priester in die Hände fallen!
Kaum in dem Hausflur, wandte sie sich nach Julian um, der ihr schüchtern folgte. Sie sah sein Staunen beim Anblick des prächtigen Hauses. Auch das gereichte ihm in ihren Augen zum Vorteil. Nur mit etwas konnte sie sich nicht abfinden: sie hatte das Gefühl, als müsse der Erzieher im schwarzen Rock gehen.
»Können Sie wirklich Lateinisch, Herr Sorel?« begann sie von neuem, indem sie stehen blieb. In all ihrem Glück hatte sie mit einem Male tödliche Angst, es könnte doch nicht so sein.
Ihre Frage verletzte Julians Stolz. Das Entzücken, in dem er eine Viertelstunde gelebt hatte, war dahin.
»Gewiß, gnädige Frau«, erwiderte er, wobei er sich Mühe gab, gleichgültig auszusehen. »Ich verstehe Lateinisch ebensogut wie der Herr Pfarrer; ja, wie er manchmal zu sagen beliebt, sogar besser.«
Frau von Rênal fand, Julian sähe jetzt recht böse aus. Er stand zwei Schritte von ihr entfernt. Dicht an ihn herantretend, flüsterte sie ihm zu: »Nicht wahr, in den ersten Tagen werden Sie meine Kinder nicht schlagen, auch wenn sie ihre Aufgaben nicht können?«
Beim Klange der sanften, fast flehentlichen Worte einer so schönen Frau vergaß Julian, was er seiner Würde als Lateiner schuldete. Frau von Rênals Gesicht war ganz nahe dem seinen. Er spürte den leisen Duft weiblicher Sommerkleider. Das verwirrte den armen Bauernjungen im höchsten Maße. Er ward feuerrot, und schweratmend sagte er mit bebender Stimme: »Fürchten Sie nichts, gnädige Frau! Ich werde Ihnen in allem folgsam sein!«
Erst jetzt, nachdem sie keine Sorge mehr um ihre Kinder hatte, fiel ihr auf, daß Julian ein sehr schöner Mensch war. Seine fast weiblichen Züge und seine verlegene Miene machten auf sie, die selbst so außerordentlich scheu und schüchtern war, durchaus keinen lächerlichen Eindruck. Im Gegenteil, das echt Männliche, das man gewöhnlich von Mannesschönheit verlangt, hätte Frau von Rênal Furcht eingeflößt.
»Wie alt sind Sie, Herr Sorel?« fragte sie.
»Bald neunzehn, gnädige Frau!«
»Mein Ältester ist elf Jahre«, erzählte sie, nunmehr völlig wieder im Gleichgewicht. »Er könnte beinahe noch Ihr Spielkamerad sein. Sie werden ihm Vernunft beibringen. Sein Vater hat ihn einmal strafen wollen, da ist das Kind eine volle Woche krank gewesen. Und doch war es bloß ein ganz leichter Schlag...«
»Wie anders ist es mir doch ergangen!« dachte Julian bei sich. »Noch gestern hat mich mein Vater geschlagen. Die reichen Leute haben es gut!«
Frau von Rênal glaubte bereits, in der Seele Julians bis in die geringsten Nuancen Bescheid zu wissen. Sie deutete die Betrübtheit, die ihn sichtlich ergriffen hatte, für Schüchternheit und wollte ihn ermutigen.
»Wie ist Ihr voller Name, Herr Sorel?« fragte sie, mit einer Innigkeit im Ton, deren Zauber Julian empfand, ohne sich sagen zu können, warum.
»Ich heiße Julian Sorel, gnädige Frau. Mir ist bange, weil ich zum ersten Male in meinem Leben ein fremdes Haus betrete. Darum bedarf ich Ihrer Fürsprache und in den ersten Tagen in vielen Dingen Ihrer Nachsicht. Ich bin nie in die höhere Schule gegangen. Dazu war ich zu arm. Auch habe ich nie mit andern Menschen gesprochen, außer mit dem Stabsarzt, einem Verwandten von uns. Er war Ritter der Ehrenlegion .. Und mit dem Herrn Pfarrer Chélan. Er wird Ihnen Gutes über mich sagen. Meine Brüder haben mich immer verprügelt. Denen dürfen sie keinen Glauben schenken, wenn sie mich schlechtmachen! Verzeihen Sie mir meine Fehler, gnädige Frau! Ich werde nie mit Absicht etwas Schlechtes tun.«
Während dieser langen Rede gewann Julian seine Selbstbeherrschung wieder. Er schaute Frau von Rênal an. Wirkliche angeborene Anmut ist allgewaltig, zumal wenn sie einem Menschen eigen ist, der gar nicht an sie denkt. Julian, der sehr wohl wußte, was Weibesschönheit ist, hätte in diesem Augenblick geschworen, Frau von Rênal sei erst zwanzig Jahre alt. Urplötzlich durchzuckte ihn der verwegene Gedanke, ihr die Hand zu küssen. Gleich darauf erschrak er freilich über sich selber. Aber dann wieder sagte er sich: »Es wäre feig von mir, wenn ich eine mir vielleicht nützliche Tat nicht ausführte. Es wird die Mißachtung verringern, die diese schöne Frau gegen mich armen Burschen, der eben der Sägemühle entronnen ist, wahrscheinlich hegt.« Sein Mut wuchs wohl ein wenig, weil er sich erinnerte, daß seit einem halben Jahre bisweilen sonntags von hübschen Mädchen hinter ihm getuschelt ward, er sei ein hübscher Kerl.
Wie er so mit sich kämpfte, unterwies ihn Frau von Rênal mit ein paar Worten über die Art, wie er sich bei den Kindern einführen solle. Die Gewalt, die er sich antat, machte ihn von neuem leichenblaß. Nur mit Mühe brachte er die Worte heraus: »Gnädige Frau, niemals werde ich Ihre Kinder schlagen. Das schwöre ich bei Gott!«
Bei diesen Worten wagte er Frau von Rênals Hand zu erfassen und an seine Lippen zu führen.
Die Geste hatte sie überrascht. Im Nachdenken ward sie betroffen. Es war ein sehr heißer Tag. Deshalb trug sie die Arme bloß, nur von einem Schal bedeckt. Als Julian ihre Hand an seinen Mund zog, war der eine ganz nackt gewesen. Alsbald zürnte sie sich selbst. Es dünkte sie, daß sie viel schneller hätte empört sein müssen.
In diesem Augenblick trat Herr von Rênal aus seinem Arbeitszimmer. Er hatte die Stimmen gehört. In dem salbungsvollen und väterlichen Ton, den er annahm, wenn er im Amt eine Trauung vollzog, sprach er zu Julian: »Es ist höchst wichtig, daß ich mit Ihnen rede, ehe die Kinder Sie zu sehen bekommen!«
Damit ließ er Julian in sein Zimmer eintreten. Seine Frau wollte die beiden allein lassen, aber Herr von Rênal hielt sie zurück. Nachdem die Tür geschlossen war, setzte er sich gravitätisch. Sodann begann er: »Der Herr Pfarrer hat mir gesagt, Sie seien ein tüchtiger Mensch. Es wird Sie hier jedermann mit Achtung behandeln, und wenn ich mit Ihnen zufrieden bin, werde ich Ihnen später behilflich sein, damit Sie einen kleinen festen Posten bekommen. Ich will, daß Sie fortan weder mit Ihren Verwandten noch mit Ihren Bekannten verkehren. Das Gehabe dieser Leute ist nichts für meine Kinder. Hier sind zwölf Taler für den ersten Monat! Aber ich verlange Ihr Ehrenwort, daß Ihr Vater keinen Groschen davon bekommt.«
Der Bürgermeister war auf den alten Sorel schlecht zu sprechen, weil er ihn bei dem Handel doch übertrumpft hatte.
»Zuvörderst, Herr Sorel... ich habe nämlich den Befehl gegeben, daß Sie hier jedermann mit Herr anzureden hat. Sie werden die Vorteile, in ein vornehmes Hauswesen gekommen zu sein, bald verspüren. Was ich sagen wollte, Herr Sorel: Es schickt sich nicht, daß die Kinder Sie in Hemdsärmeln sehen .. Sind die Dienstboten ihm so begegnet?«
Die letzte Frage richtete er an seine Frau.
»Nein, mein Lieber«, erwiderte sie versonnen.
»Um so besser. Hier, ziehen Sie das mal an!« Er reichte dem erstaunten jungen Mann einen Rock von sich. »So! Jetzt geht's zum Schneider Durand!«
Als Herr von Rênal mit dem neuen, nunmehr ganz in Schwarz gekleideten Hauslehrer nach einer reichlichen Stunde zurückkam, fand er seine Frau noch immer auf dem nämlichen Flecke sitzen. In Julians Gegenwart fühlte sie sich beruhigt. Während sie ihn musterte, verlor sie jede Angst vor ihm. Julians Gedanken aber weilten nicht bei ihr. Trotz aller seiner Menschen- und Schicksalsverachtung war er in diesem Augenblicke seelisch ein Kind. Es war ihm, als sei in den drei Stunden, seit er voll Hangen und Bangen in der Kirche gesessen, ein jahrelanges Stück Leben vergangen. Da bemerkte er die eisige Miene der Frau von Rênal. Er begriff, daß sie ihm zürnte, weil er ihr die Hand zu küssen gewagt. Aber mit den neuen Kleidern, die so ganz anders waren denn die, die er gewohnt war zu tragen, hatte sich das Gefühl des Stolzes bei ihm eingestellt. Er war über die Maßen erregt, aber gleichzeitig vom Drange beseelt, seine Freude zu verbergen. Dadurch kam etwas Jähes und Halbverrücktes in jede seiner Bewegungen. Frau von Rênal betrachtete ihn voller Erstaunen. Und Herr von Rênal ermahnte ihn: »Würde, Haltung! Das ist die Hauptsache, Herr Sorel! Sonst haben die Kinder keinen Respekt vor Ihnen.«