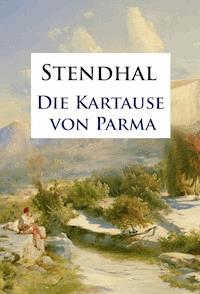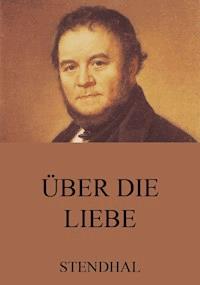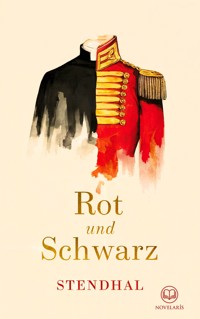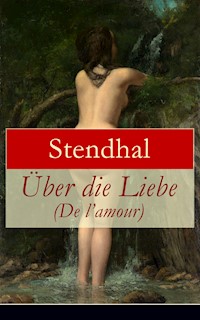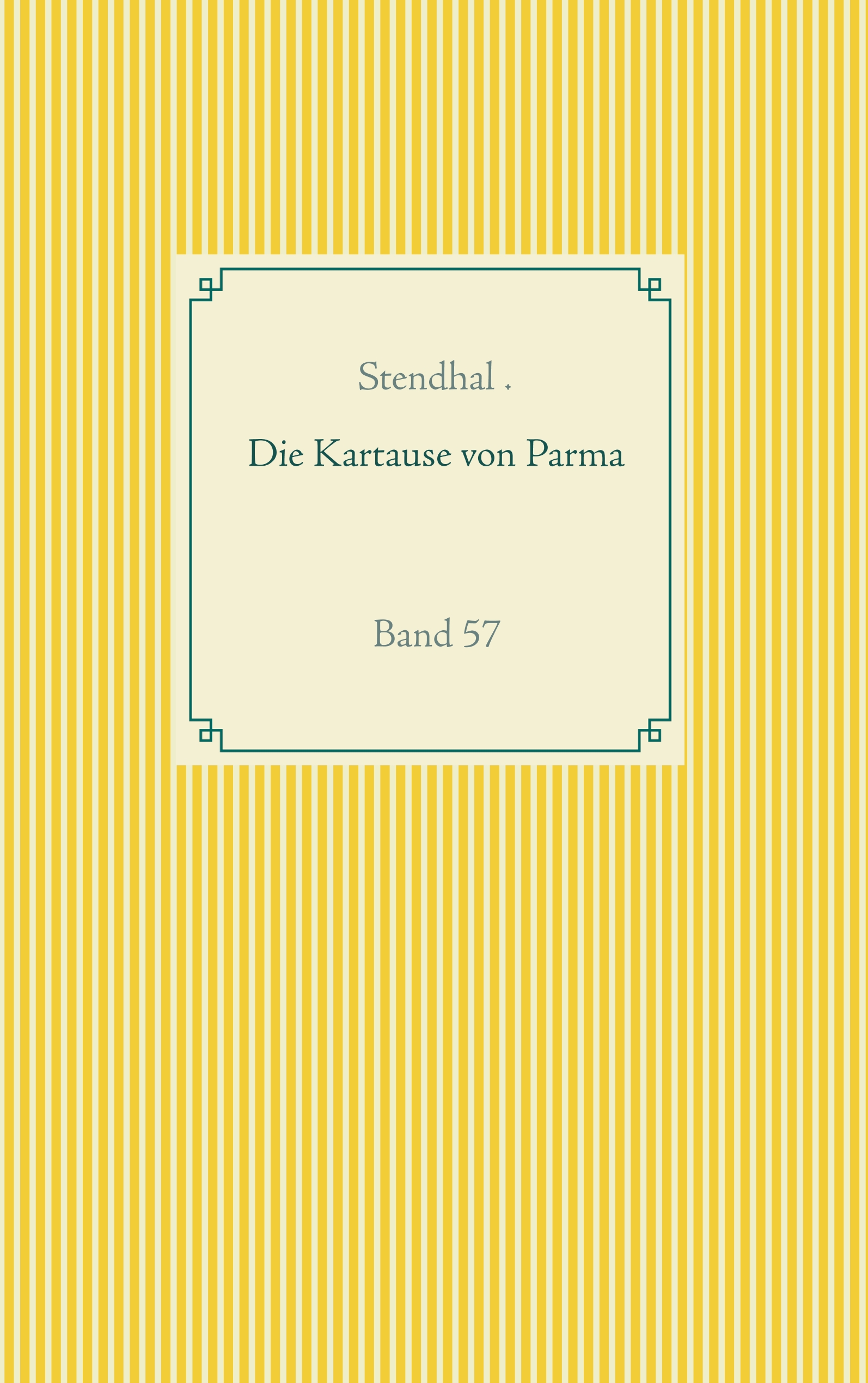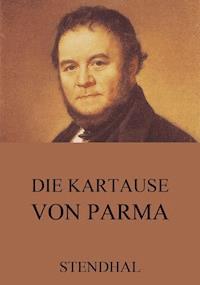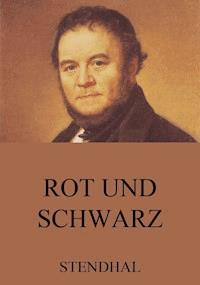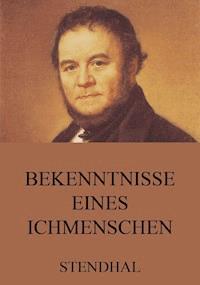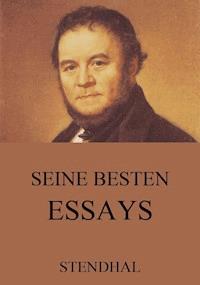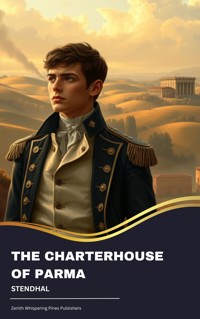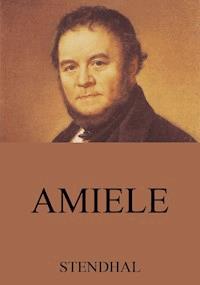
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amiele ist der letzte, 1839 begonnene und unvollendete Roman Stendhals und auch der einzige in dem es eine weibliche Titelhelden gibt.
Das E-Book Amiele wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amiele
Stendhal
Inhalt:
Stendhal – Biografie und Bibliografie
Amiele
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Aus einem späteren Kapitel
Bruchstücke
Anhänge
Letztes Bruchstück
Amiele, Stendhal
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849636692
www.jazzybee-verlag.de
Stendhal – Biografie und Bibliografie
Eigentlich Marie-Henri Beyle, franz. Schriftsteller, meist unter dem Pseudonym Stendhal (spr. stangdall, von Stendal, der Heimat des von ihm verehrten Winckelmann) auftretend, geb. 23. Jan. 1783 in Grenoble, gest. 23. März 1842 in Paris, wurde nach einem an Abenteuern reichen Jugendleben kaiserlicher Beamter. machte die Feldzüge in Deutschland mit, ward 1812 Auditeur im Staatsrat und ging nach der zweiten Restauration nach Italien, das jetzt sein Lieblingsaufenthalt wurde. Nach der Julirevolution von 1830 wurde er Generalkonsul in Civitavecchia. Seine hauptsächlichsten Schriften sind die Romane: »Armance« (1827, 3 Bde.), »Le Rouge et le Noir« (1831, 2 Bde.) und besonders »La Chartreuse de Parme« (1839, 2 Bde.; oft aufgelegt), in denen sich Vorzüge, wie scharfe Charakteristik, pikanter Stil und glänzender Witz, aber auch Fehler finden, wie krankhaftes Jagen nach Originalität und Mangel an sittlicher Idee. Unter seinen übrigen Schriften sind die bedeutendsten: »Lettres écrites de Vienne sur Haydn, etc.«(1814, unter dem Namen A. C. Bombet); »Histoire de la peintureen Italie« (1817, 2 Bde.); »De l'amour« (1822, 2 Bde.); »Racine et Shakespeare« (1823).Nach seinem Tod erschienen: »Nouvelles inédites« (1853); »Romans et nouvelles« (1854); »Correspondance inédite« (1855); »Vie de Henri Brulard«, eine leichtverkleidete Selbstbiographie (1890), von der weiteres in seinem »Journal« (1888) und in den »Souvenirs d'égotisme« (1892) enthalten ist, ferner: »ll:uvres posthumes. Napoléon etc.« (1881, 3. Aufl. 1897) und »Lettres intimes« (1892). Sein bedeutendster Schüler, Mérimée, übertrifft ihn an Eleganz des Stiles. Ihren größten Erfolg haben Beyles Romane erst in unsrer Zeit errungen. Unter den neuern Schriftstellern wollen sowohl die Naturalisten (Zola) als die Psychologen (Bourget) in ihm einen Vorgänger erblicken. Vgl. Paton, Henry B., a critical and biographical study (Lond. 1874); Cordier, Stendhal et ses amis (Evreux 1890); Rod, Stendhal (Par. 1892); Farges, Stendhal diplomate. Rome et l'Italie de 1829 à 1842 (das. 1892); P. Brun, Henri B. (Grenoble 1900); Stryienski, Comment a vécu Stendhal (Par. 1900; mit zwölf Porträten des Dichters); A. Chuquet, Stendhal-B. (2. Aufl., das. 1902); Rüttenauer, Aphorismen aus Stendhal (Straßb. 1901).
Amiele
Erstes Kapitel
Carville
Ich finde, wir sind ungerecht gegen die landschaftliche Schönheit der Normandie, die uns so nahe liegt, daß wir sie von Paris aus am Abend erreichen. Man rühmt die Schweiz; aber ihre Berge muß man mit drei Tagen Langerweile und den Scherereien mit den Zollbeamten und Paßämtern bezahlen. In der Normandie ist unser von der Gradlinigkeit der Großstadt und ihren Mauern ermattetes Auge alsbald von einem Meer von Grün umflutet. Paris entschwindet und mit ihm das trübselige graue Flachland. Die Landstraße schlängelt sich durch eine Reihe anmutiger Täler, zwischen ansehnlichen Hügeln, deren bewaldete Rücken sich zuweilen recht keck am Himmel abzeichnen. Der beengte Horizont regt die Phantasie an: ein ungewohntes Vergnügen für den Pariser.
Und kommt man weiter, so erschaut man zur Rechten zwischen den Bäumen, die die Felder verdecken, das Meer, – das Meer, ohne das sich keine Landschaft wahrhaft schön nennen darf.
Wenn das Auge, das in diesem Paradiese den Reiz der Fernen entdeckt, nach Einzelheiten sucht, so erkennt es, daß jeder »Busch« ein mit Wällen umgebenes Stück Land ist. Diese Dämme, von denen alle Felder gradlinig begrenzt werden, sind mit Reihen junger Ulmen gekrönt.
Solch ein Landschaftsbild sieht man, wenn man sich von Paris her dem Meere nähert, zwei Wegstunden vor dem Marktflecken, in dem sich in den dreißiger Jahren die Geschichte der Herzogin von Miossens und dem Doktor Sansfin abgespielt hat.
Nach Paris zu liegt das Dorf unter Apfelbäumen, in der Niederung verborgen. Zweihundert Schritte hinter den letzten Häusern, die sich von Nordwesten nach dem Meere und dem Sankt-Michels-Berg hin ausdehnen, kommt man, auf einer jüngsterbauten Brücke, über ein klares Bächlein, das munteren Geistes dahineilt. In der Normandie haben nämlich alle Dinge Geist. Nichts geschieht ohne Warum und Wieso, und oft ist dieses sehr schlau ausgeklügelt. Aber das ist es nicht, warum mir Carville lieb und wert ist; und damals, als ich zur Rebhühnerzeit dort weilte, hätte ich, wie ich mich erinnere, Französisch am liebsten nicht verstanden. Ich, der Sohn eines unvermögenden Notars, bekam Unterkunft im Schlosse der Frau von Albret-Miossens, der Gattin des ehemaligen Herrn dieser Gegend. Sie war erst 1814 wieder nach Frankreich gekommen. Um 1826 schätzte man solche Leute.
Carville zieht sich zwischen Wiesenland hin, in einem Tale, das beinahe mit dem Strand des Meeres gleichläuft, welches man von jeder kleinen Anhöhe aus erblickt. Dies liebliche Tal wird vom Schlosse beherrscht. Diese friedsamen Reize der Landschaft konnte meine Seele aber nur bei Tage in sich aufnehmen. An den Abenden – und diese begannen um 5 Uhr, wenn die Glocke zum Diner rief – mußte ich der Herzogin den Hof machen, und sie war keine Frau, die sich ihre Rechte schmälern ließ.
Frau von Miossens war 1778 geboren. Nie vergaß sie ihren hohen Rang, zumal sie in Paris Frömmlerin gewesen und von der Vorstadt St. Germain mit Vorliebe zur Patronesse bei wohltätigen Veranstaltungen gemacht worden war. Übrigens hatten sich damit die Huldigungen besagten Stadtviertels erschöpft. Sechzehn Jahre alt, war sie an einen Greis verheiratet worden, durch den sie eines Tages Herzogin werden sollte. Dies geschah aber erst vierundzwanzig Jahre später, als der Marquis d'Albret seinen Vater verlor. So ging ihre Jugend in der Sehnsucht nach den hohen Ehren hin, die noch zu Karls X. Zeiten (1824–1830) in Frankreich von der Gesellschaft einer Herzogin erwiesen wurden. Madame de Miossens war keine geistig hervorragende Frau.
Das war die große Dame, in deren Hause ich den September verlebte, gezwungen, mich von 5 Uhr abends bis Mitternacht den kleinen Ereignissen und dem großen Klatsch von Carville zu widmen. Den Ort findet man nicht auf der Landkarte. Die Schändlichkeiten, die ich mir von Carville zu erzählen erlaube, sind ein Stück Wahrheit. Mich vom Wirbel des Pariser Lebens zu erholen, dazu ließen mich die normannischen Schelme und Gauner nicht kommen.
Frau von Miossens hatte mich aufgenommen als Sohn und Enkel der trefflichen Herren Lagier, die schon immer die Notare der Familie von Albret-Miossens, d. h. des Hauses Miossens, das sich von Albret nannte, waren.
Die Jagd des Gutes war prächtig und vorzüglich gepflegt. Der Gatte der Schloßherrin, Pair von Frankreich, Ritter höchster Orden, ein Erzmucker, klebte dauernd am Königlichen Hofe, und das einzige Kind, Fedor von Miossens, war noch Schuljunge. Was mich anbelangt, so tröstete mich ein guter Schuß über alles Ungemach. Alle Abende hatte ich den Abbé Dusaillard zu ertragen. Das war ein Kongregationist vor dem Herrn, dessen Geschäft es war, die Pfaffen der Gegend zu überwachen. Sein taciteisches Wesen langweilte mich. Damals hatte ich wenig Verständnis für diese Sorte Charaktere. Dieser Dusaillard lieferte das Glossar zu den Tatsachen, die in der »Quotidienne« den sieben oder acht Krautjunkern des Kreises vermeldet zu werden pflegten.
Dann und wann tauchte im Salon der gnädigen Frau ein höchst drolliger buckliger Mensch auf. Der machte mir mehr Spaß. Er prahlte mit seinen galanten Erfolgen, und man munkelte, ein paarmal habe er wirklich welche gehabt. Dieser wunderliche Kauz nannte sich Doktor Sansfin. Im Jahre 1818 mochte er sechsundzwanzig bis achtundzwanzig Jahre alt sein.
Wenn er sich nicht hätte als Don Juan aufspielen wollen, wäre er gar nicht so übel gewesen. Einziger Sohn eines reichen Bauern jener Gegend, hatte er Medizin studiert, um sich hegen und pflegen zu können. Jäger war er geworden, um allezeit den vielleicht sonst spottlustigen Leuten des Dorfes bewaffnet zu begegnen. Und um sein Ansehen zu vollenden, hatte er einen Bund mit dem Abbé Dusaillard geschlossen.
Der Doktor hätte nicht als Narr gegolten und wäre sogar als Mann von Geist geschätzt worden, wenn er keinen Buckel gehabt hätte. Aber dies Unglück machte ihn lächerlich, zumal er sich anstrengte, durch allerlei witzige Kapriolen darüber hinwegzutäuschen. Er hätte weniger zum Lachen gereizt, wenn er sich angezogen hätte wie alle Welt. So aber wußte man, daß er seine Anzüge aus Paris kommen ließ, und – welch eine unerträgliche Anmaßung inmitten eines normännischen Dorfes! – er hatte zum Diener einen Friseur aus der Hauptstadt. Und da verlangte er, man solle nicht über ihn lachen!
Nun war der Doktor im Besitz eines prächtigen schwarzen, viel zu breiten und unbeschreiblich gutgepflegten Bartes. Der so geschmückte Kopf war wunderschön, wenn ihm – wie schon gesagt – nicht der dazugehörige Körper gefehlt hätte. Dies erklärt Sansfins Vorliebe für das Theater. Wenn er in einer Loge des ersten Ranges saß, so erschien er wie jeder andere Mensch; stand er auf, und ließ er sein armseliges Körperchen, bekleidet nach der neuesten Mode, sehen, so war der Eindruck unausbleiblich:
»Sehen Sie einmal den Frosch!« rief irgendeine Stimme im Parkett.
Dies galt einem Manne, der galante Erfolge haben wollte!
Eines Abends malten wir in die Asche am Kamin – so maßlos langweilten wir uns! – die Anfangsbuchstaben der Frauen, um deretwillen wir ehedem die unsere Eigenliebe demütigendsten Torheiten begangen hatten. Ich erinnere mich, der Anstifter dieser Liebesprobe gewesen zu sein.
Der Vicomte von Sainte-Foi malte ein M und ein B. Hoheitsvoll wie immer, forderte ihn die Herzogin auf, alle die dummen Streiche zu berichten, die er als junger Mann für diese M und diese B vollführt habe, soweit er sie noch wüßte. Herr von Malivert, ein alter Ritter des Ludwigs, dem er nach Möglichkeit gebeichtet hatte, gab er den Feuerhaken weiter an den Doktor Sansfin. Ein Lächeln spielte um aller Lippen. Aber stolz kritzelte dieser hin: D C J F.
»Donnerwetter! Sie sind jünger als ich und tragen schon vier Buchstaben im Herzen?« rief der Ritter Malivert, dem sein Alter ein wenig zu lachen gestattete.
Ernsthaft erwiderte der Bucklige:
»Da die Frau Herzogin uns das Gelübde der Aufrichtigkeit abgenommen, bin ich verpflichtet, diese vier Buchstaben zu zeichnen.«
Das Diner lag drei Stunden hinter ihnen. Es war vorzüglich gewesen. Unter anderem hatte es Frühgemüse gegeben, das durch einen der Diener in Paris besorgt worden war. Und nun waren wir unserer acht bis zehn, die sich abmühten, ein Gespräch im Fluß zu erhalten.
Bei der Erwiderung des Doktors leuchteten aller Augen auf. Wir rückten näher an den Kamin. Schon bei seinen ersten Worten erregte die gesuchte Ausdrucksweise des Erzählers unser Lachen. Seine Ernsthaftigkeit war zu komisch. Unsere Heiterkeit erreichte den Höhepunkt, als er uns versicherte, die Schönen namens D, C, J und F wären allesamt bis zur Raserei in ihn verliebt gewesen.
Frau von Miossens, die für ihr Leben gern mitgelacht hätte, machte uns Zeichen über Zeichen, wir möchten unsere Ausgelassenheit zügeln.
»Sie werden sich einen Schaden tun!« sagte sie zu Herrn von Sainte-Foi, der ihr am nächsten saß. »Geben Sie die Losung: Maß halten, meine Herren!«
Der Doktor war dermaßen in seine Gedankenwelt verloren, daß ihn nichts daraus zu vertreiben vermochte. Ich glaube, er dichtete die Einzelheiten eines Romans, den er in großen Zügen schon immer in sich trug, und sie vortragend, hatte er seine Freude daran. Eines fehlte ihm, wie in der Folge klar zutage trat, als das Glück an seiner Tür klopfte: er besaß auch nicht ein Lot gesunden Menschenverstands. An jenem Abend beichtete uns der gute Doktor sein Liebesglück; mehr noch, seine einzelnen Gefühle und Gefühlsnüancen, zu denen ihn das Verhalten jener unseligen D, C, J und F verführt hatte, die von ihrem Herrn und Meister häufig schlecht behandelt worden waren.
Der Vicomte von Sainte-Foi erinnerte den Doktor an den Marquis von Caraccioli, den bekannten Gesandten der beiden Sizilien, zu dem Ludwig XVI. einmal gesagt hat: »Sie fangen Liebesgeschichten hier in Paris an, Herr Baron?« – »Nein, Majestät, ich kaufe sie fix und fertig!« Den Doktor brachte nichts aus dem Geleise.
Abgesehen von ihrem Standesdünkel hatte die Herzogin ein entzückendes Wesen, und wenn man sie heiter stimmte, war sie überglücklich. Sie genoß die Fröhlichkeit der anderen. Heiterkeit aber schaffen, das verbot ihr der Hochmut vollständig. Ihr Benehmen war bewundernswürdig und dabei so sanft, daß es mich (der ich lediglich der Jagd wegen zwei- oder dreimal im Jahre nach dem Schloß Carville kam) in den ersten beiden Tagen immer wieder täuschte und ich ihr Gedankentiefe zutraute. In Wahrheit war sie nichts weiter als eine gewandt plaudernde Dame der Welt. Dies belustigte mich und überhob mich der Dummheit, ihr Haus ernst zu nehmen. Sie beurteilte alles vom Standpunkte des Hochadels, der auf dem alten Rittertume fußte.
Die Revolution von 1789, Voltaire, Rousseau regten sie nicht auf; alles das war für sie einfach nicht da. Diese Verrücktheit erstreckte sich bis in allerlei Kleinigkeiten. Zum Beispiel betitelte sie den Gemeindevorstand von Carville »Herr Schöppe!« Diese Sonderlichkeit söhnte mich, den Zweiundzwanzigjährigen, mit allem aus. Jedwede Taktlosigkeit glitt an mir ab, so sehr viele ihrer im Schlosse sich ereigneten. Sie hatte die gesamte Nachbarschaft vor den Kopf gestoßen.
Insgeheim langweilte sich die Herzogin unsäglich, während der Mensch, den sie über alles verabscheute, den sie einen »verruchten Jakobiner« nannte, in Paris glücklich war und daselbst regierte. Dieser Jakobiner war kein anderer als der liebenswürdige Akademiker, den man unter dem Namen Ludwig XVIII. kennt.
Des Pariser Treibens überdrüssig, hatte sie sich dem Leben auf dem Lande ergeben, und ihre einzige Zerstreuung war der Klatsch von Carville, über den sie auf das genaueste unterrichtet war, und zwar durch eins ihrer Stubenmädchen, Pierrette, die im Dorfe ihren Liebsten hatte. Es machte mir Spaß zuzuhören, wenn diese in ihrer drastisch-deutlichen Art einer Dame berichtete, die sich ihrerseits einer oft allzu verfeinerten und gedrechselten Sprechweise bediente.
So ödete ich mich so ziemlich im Schlosse. Da traf eine Mission ein, deren Haupt ein überaus redegewandter Mann war, der Abbé Lecloud. Vom ersten Tage an hatte er mich gewonnen.
Diese Gesellschaft versetzte die Herzogin in wahrhafte Glückseligkeit. Nun gab es abends zwanzig Gedecke. Bei Tisch ward viel von Wundern gesprochen. Die Gräfin von Sainte-Foi und etliche andere Damen aus der Umgegend, die abends im Schlosse erschienen, äußerten sich über mich dem Abbé Lecloud gegenüber: ich sei ein Mensch, aus dem etwas werden könne. Es ward mir klar, daß diese hochvornehmen klugen Damen nicht an Wunder glaubten, trotzdem aber nach Kräften diese Legenden unterstützten. Ich fehlte bei keiner der Predigten des Abbé. Angewidert von dem Blödsinn, den er den Landleuten vorschwatzen mußte, würdigte er mich seiner Freundschaft, und, weit entfernt von der Vorsicht des Abbé Dusaillard, sagte er eines Tages zu mir:
»Sie haben eine schöne Stimme, Sie verstehen trefflich Latein, Ihr späteres Erbteil beträgt höchstens 2000 Taler: treten Sie bei uns ein!«
Eine Weile überlegte ich mir den Vorschlag. Er war nicht übel. Wäre die Sekte vier Wochen länger in Carville verblieben, ich glaube, ich hätte mich auf ein Jahr anwerben lassen. Ich rechnete mir aus, daß ich dabei sparen und mir dann dafür ein gutes Jahr in Paris leisten könne. Mit der Empfehlung des Abbé Lecloud hätte ich Aussicht auf eine Unterpräfektur. Das dünkte mich damals der Gipfel des Erfolges. Hätte ich aber zufällig Geschmack an der freien Rede von der Kanzel herab gefunden, so hätte ich schließlich auch dieses Handwerk, gleich dem Abbé Lecloud, betrieben.
Zweites Kapitel
Die Mission
Am letzten Tage, an dem die Mission zu Carville predigte, füllten die Adligen, denen der Schreck von 1793 noch immer in den Gliedern lag, und reich gewordene Bürgerliche, die so taten, als gehörten sie dazu, das hübsche gotische Pfarrkirchlein in edlem Wettstreit. Es hatten aber nicht alle Gläubigen darin Platz. Über tausend Leute standen draußen im Friedhof. Auf Geheiß des Abbé Dusaillard waren die Kirchentüren ausgehoben worden, und so drangen hin und wieder Bruchstücke der Predigt hinaus zu der ungeduldigen, leise schwatzenden Menge.
Es hatten bereits zwei Redner gesprochen. Der Tag neigte sich, ein trübseliger Tag im späten Oktober. Ein Chor von sechzig frommen Jungfrauen, vom Abbé Lecloud einstudiert und dirigiert, trug einen besonders ausgesuchten Wechselgesang vor. Als sie geendet, war es vollkommen dunkel. Da bestieg der Abbé Lecloud die Kanzel, um ein erhebendes Schlußwort zu sprechen. Sowie er damit begann, drängte die Menge von draußen gegen den Eingang und an die unteren Kirchenfenster, von denen etliche eingedrückt wurden. Gläubiges Schweigen brütete über der Versammlung. Jedermann wollte den berühmten Kanzelredner hören.
Der Abbé redete an diesem Abend geschwätzig wie ein Blaustrumpfroman. In erschrecklichster Weise schilderte er die Hölle. Seine drohenden Worte hallten durch die dunklen gotischen Gewölbe. Kaum wagte man zu atmen.
Der Abbé schrie förmlich: der Teufel sei jederzeit allgegenwärtig, sogar am heiligsten Ort. Damit gedachte er die Gläubigen zu sich in seine Schwefelhölle zu reißen.
Mit einem Male hielt er inne, um sodann mit unheimlicher, banger Stimme aufzukreischen:
»Die Hölle, in dem Herrn Geliebte!«
Der Eindruck dieses qualvollen Rufes, der durch die finstere Halle der Kirche voller sich bekreuzigender Gläubigen gellte, war unbeschreiblich. Ich selbst fühlte mich ergriffen. Der Abbé starrte auf den Altar, als warte er auf irgend etwas. Und kreischend rief er zum anderen Male:
»Die Hölle, Geliebte in dem Herrn!«
Zwei Dutzend »Frösche« gingen hinter dem Altar los und übergossen die todblassen Gesichter mit blutrotem Höllenlicht. In diesem Moment empfand bestimmt kein Anwesender Langeweile. Ein halbes Hundert Frauen fielen ohnmächtig ihren Nachbarn in die Arme. Frau Hautemare, des Küsters Frau, lag leblos da. Und da sie unter den Frauen des Dorfes als Allerfrömmste galt, bemühte man sich allgemein um sie. Ein Haufen Jungens lief zum Küster. Unwirsch wies er sie fort. Die Pflicht hielt ihn auf seinem Posten. Er war eifrigst dabei, auch die winzigsten Reste der Platzpatronen aufzulesen und beiseite zu bringen.
Dieser Auftrag war ihm von Herrn Dusaillard, dem gefürchteten Seelenhirten des Dorfes, gegeben und mehr als einmal erläutert worden, und Hautemare hütete sich, dagegen zu verstoßen. Der Pfarrer war es hauptsächlich, dem der Küster seine Stellung verdankte; er erbebte, wenn er ihn nur die Stirn runzeln sah.
Der Pfarrer hatte seine Herde von der Orgelempore aus im Auge. Und wie er merkte, daß alles gut gegangen war und aus keinem Munde das Wort »Frösche!« laut ward, da lenkte er seine Schritte nach dem Kirchhofe. Mich dünkte es, er war ein bißchen eifersüchtig auf den Bombenerfolg des Abbé Lecloud.
Der Missionsprediger verfügte nicht über die Macht, im passenden Augenblick zu strafen oder zu belohnen und jedweden fremden Willen zu knebeln wie der Pfarrer. Dafür besaß er eine Redegewandtheit, über die jener nicht im entferntesten verfügte. Der Pfarrer gestand sich seine Unterlegenheit nicht ein.
Als er so viel Volk im Friedhofe sah, vermochte er der Versuchung nicht zu widerstehen. Er kletterte auf den Sockel des Kirchhofkreuzes und hielt seinerseits eine Ansprache an seine Herde. Was mich bei seiner Rede stutzig machte, war, daß er es vermied, den eben erfolgten Feuerzauber am Altar Wunder zu nennen. Er sagte sich, derlei dürfe man erst ein halbes Jahr später offen als Wunder bezeichnen.
Während seiner Rede horchte er gespannt, ob er nicht doch das Wort »Frösche« oder einen der heiligen Stätte unwürdigen Witz vernähme. Seine derart geteilte Aufmerksamkeit trug nicht dazu bei, in ihm zu entflammen, woran es ihm schon sowieso ermangelte: die Inspiration. Er ward mißlaunig und fing an, sich die räudigen Schafe herauszuholen. Der Ingrimm brachte seine Worte etwas in Feuer. Seine Blicke entflammten insbesondere über drei Individuen, die inmitten der frommen Weiber im Friedhofe standen.
Der arme Pernin, ein Mann mit schwindsüchtigem Gesicht, starrte den Pfarrer in einer Weise an, die diesem lästig war. Der blasse junge Mann war ehedem Mathematiklehrer an einem Königlichen Gymnasium gewesen; man hatte ihn weggejagt, weil der Anstaltsgeistliche erklärt hatte, Mathematiker seien Atheisten. Er hatte sich dann nach Carville geflüchtet, zu seiner unvermögenden Mutter. Er erteilte etlichen Kindern den ersten Rechenunterricht. Entdeckte er an dem oder jenem Buben die nötige Begabung, so unterwies er ihn unentgeltlich in der Geometrie.
Der Doktor Sansfin sandte ihm einen siegesfrohen Blick zu. Den reizsamen Pfarrer schüttelte es. Die kluge Opposition des Mediziners nötigte ihn zu allerhand Konzessionen. Der Gottesmann fand, Sansfin sei viel zu selbstherrlich; offenbar suchte er nach Gelegenheiten, ihn in eine jener Verschwörungen zu verstricken, die damals an der Tagesordnung waren. Er hielt ihn zu allem fähig; es kam ihm nur auf eines an: seinen Buckel von den Dorfschönen, denen er in unverschämter Art und Weise den Hof machte, als nebensächlich betrachtet zu sehen. »Das ist die Sorte Leute,« meinte Dusaillard bei sich, »die imstande ist, das gottlose Wort >Frösche!< in die Gemeinde zu schleudern. Geschieht es jetzt, so ist die ganze Sache im Nu zuschanden gemacht. In vier Wochen brauchen wir keine Angst mehr zu haben!«
Des Pfarrers Wut erreichte ihren Höhepunkt, als er keine zehn Schritte vor sich auch noch den ironischen verwunderten Blick eines städtischen Schülers auffing. Es war Fedor von Miossens, der einzige Sohn der Herzogin.
»Der Pariser Bengel!« murmelte der Pfaffe. »Aus dieser Brutstätte des Spottes ist noch nie etwas Gutes gekommen. Dicht am Altar ist der Ehrenplatz seiner Familie. Möglicherweise hat er die Zündschnur bemerkt. Er braucht bloß ein Wort fallen zu lassen, und die dummen Bauern, denen die Miossens halbe Götter sind, plappern es nach wie ein Orakel!«
Diese Überlegungen brachten die Beredsamkeit des Pfarrers schließlich gänzlich aus dem Geleise. Obendrein gewahrte er, daß die Weiber den Kirchhof in Masse verließen. Also mußte er wohl oder übel seine Kapuzinade abbrechen, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, am Ende vor dem leeren Platze zu predigen.
Eine Stunde später war ich Zeuge, wie der grimmige Dusaillard dem jungen Kaplan Lamairette, Fedors Erzieher, die schrecklichste Szene machte. Er stellte ihn auf das Schärfste zur Rede, weil er sich in der Kirche von seinem Zögling getrennt habe.
»Er ist mir entwischt, Herr Pfarrer!« stotterte der arme Kaplan schüchtern. »Ich habe ihn allerorts gesucht. Gewiß sah er mich auch, aber er wollte mir absichtlich fern bleiben.«
Der Pfarrer kanzelte ihn nach allen Regeln der Kunst ab, wobei er sogar mit der Ungnade der Frau Herzogin drohte.
Der verängstigte junge Mann stammelte:
»Herr Pfarrer, damit brächten Sie mich um mein Brot! Wenn mir auch noch die gnädige Frau Vorwürfe macht, weiß ich mir nicht mehr zu helfen. Was kann ich im Grunde dafür, wenn der kleine Graf, dem sein Diener von früh bis abends vorhält, er werde dermaleinst Herzog und steinreich sein, ein kleiner Schelm ist, dem es den größten Spaß macht, mich zum besten zu haben?«
Diese Antwort gefiel mir. Ich erzählte sie der Herzogin wieder und brachte sie zum Lachen.
Pfarrer und Kaplan redeten weiter.
»Ich möchte am liebsten wieder zu meinem Vater, der im herzoglichen Palast in Paris Pförtner ist, und meinen Ehrgeiz darauf beschränken, sein Nachfolger zu werden.«
»Sie frecher Jakobiner!« schrie der Pfarrer. »Wer bürgt Ihnen dafür, daß Sie sein Nachfolger werden, wenn ich Ihnen das Genick breche?«
»Der Herr Herzog ist mir gnädig gesinnt!«
Dem kleinen Kaplan standen die Tränen in den Augen; er mußte alle Kraft zusammennehmen, um seine tiefe Erregung vor seinem schrecklichen Berufsgenossen zu verbergen.
Fedor war gekommen, um die reine Luft seiner Heimat vierzehn Tage zu genießen. Er sollte mit Macht gescheit werden. Zu diesem Zwecke kamen täglich acht Lehrer, ihn zu unterrichten. Übrigens hatte er bei seiner schwächlichen Gesundheit Erholung recht nötig. Gleichwohl mußte er am zweiten Tage nach dem Wunder nach Paris zurück. Der einstige Erbe so vieler schöner Besitztümer durfte somit nur drei Tage im Schlosse seiner Väter übernachten. Das war das Werk des Pfarrers. Wir, Lecloud und ich, lachten. Es war dem Pfarrer nicht leicht geworden, die Herzogin zum Nachgeben zu bewegen. Er sah sich genötigt, mehr denn einmal das allgemeine Interesse der Kirche ins Spiel zu ziehen.
Er fand die Herzogin außer sich. Die »Frösche« hatten sie zu Tode erschreckt. Im ersten Augenblick hatte sie einen neuen Aufstand der vereinten Jakobiner und Bonapartisten zu erleben vermeint. Wieder im Schlosse, entdeckte sie einen zweiten Anlaß, im höchsten Maße ungehalten zu sein. In der Aufregung über den Feuerzauber hatte sich ihr falsches Haar verschoben, und eine Stunde lang waren etliche Silbersträhne sämtlichen Dorfbewohnern unverdeckt zur Schau gestellt gewesen, sodann den Dienstboten, die zuvörderst getäuscht werden sollten.
»Warum haben Sie mich nicht ins Vertrauen gezogen?« sagte sie in einem fort zum Pfarrer. »Ist es recht, daß man in meinem Dorfe etwas ohne mein Wissen tut? Gedenkt die Geistlichkeit, ihren sinnlosen Kampf gegen den Adel wieder aufzunehmen?«
Es war ein weiter Schritt von diesem Grad der Empörung bis zur Zurücksendung Fedors nach Paris. Der Ärmste, der so blaß aussah und so glücklich war, im Park herumzutollen und aufs Meer hinauszuschauen! Trotzdem gewann Dusaillard die Oberhand.
Der Junge fuhr betrübt wieder ab, und der Abbe Lecloud sagte zu mir:
»Dieser Dusaillard kann nicht reden, aber er versteht es, die Kleinen zu behandeln und die Mächtigen herumzukriegen, was beides gleich wertvoll ist.«
Während Fedors Abreise das Schloß beschäftigte, hatte Frau Hautemare, des Küsters Ehefrau, eine ernste Unterredung mit ihrem Manne. Dies ward alsbald der Herzogin getreulich hinterbracht; sie fand so viel Spaß daran, daß sie ihres Sohnes Weggang vergaß.
Hautemare versah als Küster, Kantor und Schulmeister drei Ämter, die alle mit der Kirche in Verbindung standen. Sie trugen ihm monatlich insgesamt 20 Taler ein. Im zweiten Jahre der Regierung Ludwigs XVIII. (1816) hatten der Pfarrer und die Herzogin ihm die Genehmigung erwirkt, eine Schule für die Kinder der legitimistischen Bauern zu eröffnen. In der Folge hatte das Ehepaar Hautemare anfangs 20, dann 40, schließlich 60 Franken allmonatlich zurücklegen können. Sie wurden wohlhabende Leute.
Ehrenmann, der er war, hatte Hautemare der Herzogin den Namen eines Jakobiners verraten, eines Bauern, der sich erdreistet hatte, Hasen wegzuknallen. Überzeugt, daß sämtliche Hasen der Gegend zu ihren Fluren gehörten, faßte sie den Hasenmord als persönliches Attentat auf.
Diese Denunziation hatte des Küsters und seiner Schule Glück begründet. Die Herzogin geruhte im großen Saale des Schlosses eine Preisverteilung abzuhalten. Sie ließ den Raum festlich schmücken und Stuhlreihen aufstellen in zwei Abteilungen. Der Haushofmeister lud die Gutsbesitzersfrauen, die Mütter von Schuljungen waren, auf den ersten Platz ein; die gewöhnlichen Bauernfrauen auf den zweiten. Hatte bis dahin die Schülerzahl ein Dutzend betragen, so stieg sie jetzt auf ein Schock. Zugleich stieg das Vermögen des Schulleiters; und so war es nicht lächerlich, daß Frau Hautemare am Tage des Feuerzaubers nach dem Abendessen zu ihrem Manne sagte:
»Es ist dir wohl nicht entgangen, daß der Herr Abbé Lecloud gegen Ende seiner Ermahnung von der Pflicht der Reichen gesprochen hat? Je nach ihrem Vermögen sollen sie Gott eine Seele darbringen. Diese Worte lassen mir keine Ruhe. Der liebe Gott hat uns Kinder versagt. Wir machen beträchtliche Ersparnisse. Wem fallen sie dermaleinst zu? Werden sie zu erbaulichen Dingen verwendet werden? Wessen Schuld wäre es, wenn dies Geld in die Hände übelgesinnter Leute kommt, z.B. in die Hände deines Neffen, dieses gottlosen Menschen, der 1815 in einem jener Räuberregimenter, »Freikorps« genannt, gegen die Preußen marschiert ist? Es wird sogar gemunkelt (woran ich aber nicht glauben mag), er habe einen Preußen erschossen ...«
»Nein, nein!« unterbrach sie der biedere Hautemare. »Das ist nicht wahr! Einen Verbündeten unseres vielgeliebten Königs Ludwig gemordet! Nein, nein! Mein Neffe ist ein Tollkopf. Wenn er einen sitzen hat, ist er ein Lästermaul. Ich gebe auch zu: in die Messe geht er selten. Aber einen Preußen hat er nicht getötet!«
Frau Hautemare ließ ihren Gatten eine Stunde lang über diesen Gegenstand weiter schwatzen, ohne ihm die Gnade einer Widerrede zu gönnen. Als sie der Rederei überdrüssig war, sagte sie endlich:
»Das beste wäre, wir nähmen ein kleines Mädchen an Kindesstatt an, erzögen es in Gottesfurcht und brächten damit dem lieben Gotte buchstäblich eine Seele dar. Und in unseren alten Tagen hätten wir eine Stütze.«
Der Vorschlag machte sichtlich tiefen Eindruck auf ihren Ehemann; hieß dies doch, seinen Neffen Wilhelm Hautemare, einen Träger seines eigenen Namens, enterben. Er sträubte sich umständlich dagegen; schließlich aber meinte er kleinlaut:
»Dann wollen wir wenigstens die kleine Yvonne annehmen.«
Das war das Jüngste seines Neffen.
»Dies Kind wäre nie und nimmer wirklich unser«, erwiderte Frau Hautemare. »Sobald der Jakobiner sieht, daß wir sie gern haben, etwa nach einem Jahre, wird er damit drohen, sie uns wieder wegzunehmen. Dann sind die Rollen vertauscht. Dein Neffe, der Jakobiner und Kriegsfreiwillige von 1815, hat die Entscheidung. Es wird uns pekuniäre Opfer kosten, die Kleine behalten zu dürfen.«
Ein halbes Jahr lang quälten sich die beiden Eheleute mit dieser schwierigen Frage ab. Das Ende vom Liede war, daß der biedere Hautemare, versehen mit einem Empfehlungsschreiben des Abbé Dusaillard, in dem er den Titel »Direktor« führte, in Begleitung seiner Frau im Rouener Findelhause erschien.
Sie suchten sich ein kleines vierjähriges Mädchen aus, das vorschriftsmäßig geimpft war und soweit recht nett aussah.
Es war Amiele.
Nach Carville zurückgekehrt, verbreiteten sie, die kleine »Aimable Miel« sei eine Nichte, aus der Nähe von Orléans gebürtig, das Kind eines Vetters namens Miel, Schreiners von Beruf. Die Dorfbewohner ließen sich nichts weißmachen. Und der bucklige Doktor Sansfin meinte, die Kleine sei der Angst entsprossen, die der Teufel ihnen am Tage des Feuerzaubers eingejagt habe.
Es gibt überall gute Menschen, sogar in der Normandie, dort allerdings weit seltener als anderswo. Die Guten von Carville entrüsteten sich, wie sie sahen, auf welche lieblose Weise Hautemares Neffe mit seinen sieben Kindern enterbt ward. So bekam Amiele den Namen »Teufelskind«. Verheult kam Frau Hautemare zum Pfarrer und fragte ihn, ob dieser Name ihnen nicht Unglück bringen müsse. Zornentbrannt drohte ihr dieser, solcher Zweifel mache sie allein schon reif für die Hölle. Er fügte hinzu, er nähme Amiele fortan unter seinen persönlichen Schutz.
Acht Tage später machten die Herzogin und er bekannt, Hautemare richte eine zweiklassige Schule ein. Die Herzogin ließ die Schulbänke mit altem Stoff bekleiden. Das waren die Sitze für die Kinder der Ersten Klasse. Die Zweite Klasse saß auf den rohen Holzbänken. Die Erste Klasse zahlte nicht vier Franken Schulgeld, wie bisher, sondern fünf. Und Fräulein Anselma, der Herzogin erste Zofe, vertraute ein paar Busenfreundinnen an, ihre Herrin habe die Absicht, bei der nächsten Preisverteilung die Mütter aller Schüler der Ersten Klasse auf die ersten Stuhlreihen einzuladen, auch wenn sie nur einfache Bauerfrauen wären.
Ein halbes Jahr darauf mußten beinahe alle Schulbänke mit Stoff bezogen werden. So wurden Hautemares reiche Leute. Sie verdienen es, daß wir uns etwas näher mit ihrem Charakter beschäftigen.