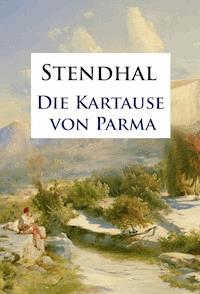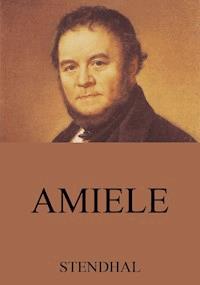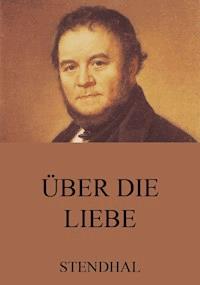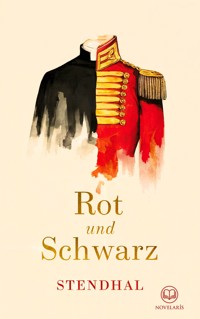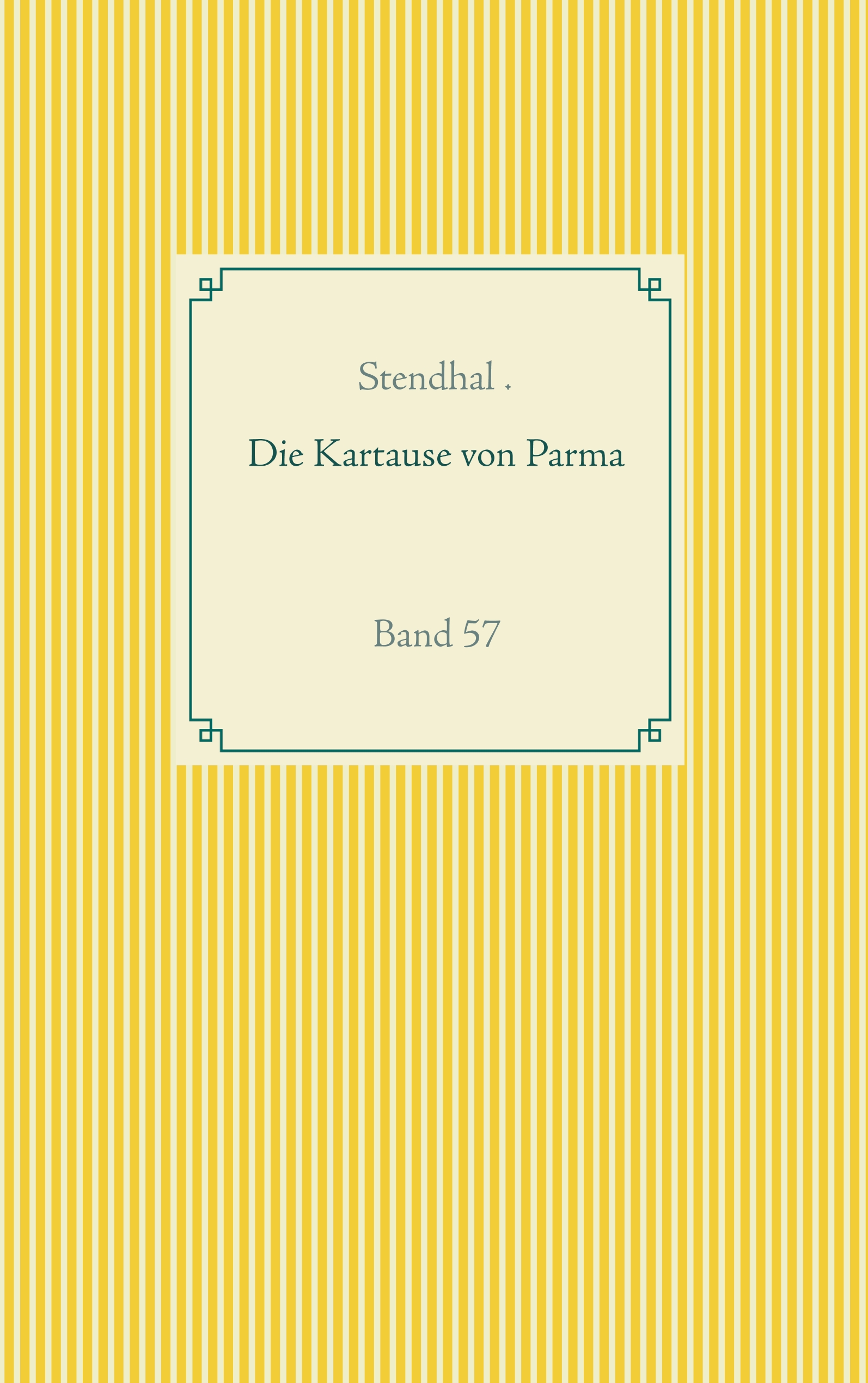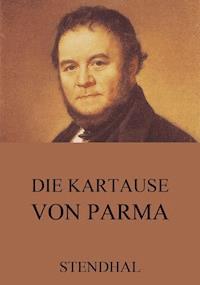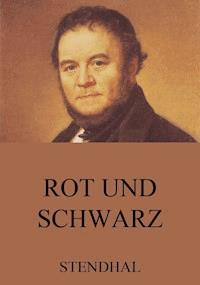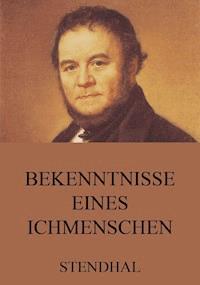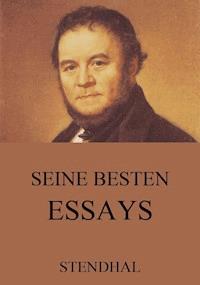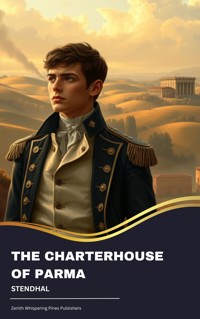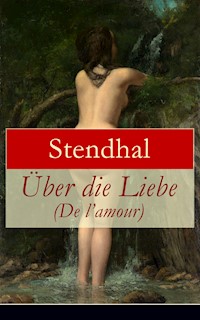
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Über die Liebe (De l'amour)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Über die Liebe sind Aufzeichnungen des französischen Schriftstellers Stendhal von 1822, in denen er eine Art Liebestheorie entwirft. In einem Teil geht Stendhal auf das Funktionieren der Liebe als Gefühl ein. Er untersucht das Entstehen der Liebe und wie sie sich entwickelt. Wichtiges Schlagwort in diesem Bezug ist die Kristallisation. Stendhal zeichnet das Bild einer sich immer weiter verändernden und neue Facetten bildenden Liebe. Neben anderen Eigenarten, die mit dem Verliebtsein verbunden sind - wie zum Beispiel Hoffnung, Scham oder Blicken-, schreibt Stendhal auch über die Schattenseite der Empfindung wie Stolz und Eifersucht. Marie-Henri Beyle (1783 - 1842) besser bekannt unter seinem Pseudonym Stendhal, war ein französischer Schriftsteller, Militär und Politiker. In seiner Zeit eher als Journalist, Kritiker und Essayist bekannt, gilt er heute durch die analytischen Charakterbilder seiner Romane als einer der frühesten Vertreter des literarischen Realismus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Liebe (De l'amour)
Die Liebe aus Leidenschaft, Galanterie, Sinnlichkeit und Eitelkeit
Übersetzer: Arthur Schurig
Inhaltsverzeichnis
Einleitung zur zweiten Auflage
Inhaltsverzeichnis
Ich schreibe nur für hundert Leser, für unglückliche, liebenswerte, prächtige, aller Heuchelei bare, durchaus amoralische Menschen. Manchen, dem dieses Buch in die Hände kommt, möchte ich fragen: Bist du in deinem Leben einmal ein halbes Jahr lang aus Liebe unglücklich gewesen? Und eine zweite indiskrete Frage: Liesest du hin und wieder eins jener anmaßenden Bücher, die den Leser zum Nachdenken zwingen, zum Beispiel ’Emil‘ von Jean Jacques Rousseau oder die Werke Montaignes? Wenn du niemals unglücklich warst ob jener Schwäche der starken Seelen, wenn du die widernatürliche Angewohnheit, beim Lesen nachzudenken, nicht hast, so wird dich das vorliegende Buch gegen den Verfasser stimmen, denn es muß dich ahnen lassen, daß es ein gewisses großes Glück gibt, das du nicht kennst, jenes Glück, das Julie de Lespinasse erfahren hat. Aber Wunder kann ich nicht tun, ich kann die Blinden nicht sehend und die Tauben nicht hörend machen.
»Die Liebe gleicht dem, was man am Himmel Milchstraße nennt. Sie ist ein schimmerndes Meer, von Myriaden kleiner Sterne gebildet, von denen der einzelne meist nicht wahrnehmbar ist. In der Literatur hat man vier-bis fünfhundert von den kleinen aneinandergereihten Empfindungen festgestellt, die einzeln zu erkennen so schwierig ist und die zusammen jene Leidenschaft ausmachen, dazu die größeren, freilich nicht ohne sich häufig zu irren, indem man Begleiterscheinungen für Hauptdinge gehalten hat. Die besten solcher Bücher von der Art der ’Manon Lescaut‘, der ’Neuen Heloise‘, der ’Briefe der Mademoiselle de Lespinasse‘ sind in Frankreich geschrieben, also in dem Lande, wo das Pflänzlein namens Liebe, erstickt unter den Forderungen der Nationalleidenschaft, der Eitelkeit, fast nie zu seiner vollen Größe gedeiht.
»Damit will ich aber keineswegs sagen, man könne die Liebe aus Romanen kennen lernen. Und wenn man sie in hundert berühmten Büchern beschrieben gefunden hätte und hätte sie niemals selber gefühlt, was wäre es, wenn man aus dem Gelesenen die Erklärung jener Torheit ergrübeln wollte? Wie ein Echo muß ich antworten: Torheit! Dieses kleine Buch ist kein amüsanter Roman, sondern lediglich eine wissenschaftlich genaue Beschreibung einer gewissen in Frankreich ungemein seltenen Torheit. Die Herrschaft der Wohlanständigkeit, die täglich größer wird, mehr infolge der Furcht vor dem Sichlächerlichmachen als durch die Lauterkeit unsrer Sitten, hat aus dem Worte, das diesem Buche den Titel gibt, einen Ausdruck gemacht, den man an und für sich vermeidet und der sogar anstößig klingen kann…
»Im Jahre 1814 machten mich die veränderten Verhältnisse, die dem Sturze Napoleons folgten, berufslos. Bereits vordem, unmittelbar nach den gräßlichen Erlebnissen auf der Retraite de Moscou, hatte mich der Zufall nach Mailand geführt, einer liebenswürdigen Stadt, in der ich am liebsten den Rest meiner Tage beschlossen hätte. Das war mein Lieblingsgedanke. In der glückseligen Lombardei, in Mailand, in Venedig, da ist die Hauptsache oder besser gesagt der Brennpunkt des Daseins: das Vergnügen. Da kümmert man sich kein bißchen um das Tun und Lassen seines Nachbars.
»Es war dort in Mailand zu den glänzenden Maskenbällen des Karnevals von 1820, im Hause der liebenswürdigen Frau Pietragrua, in einer Abendgesellschaft, wo über ein paar selbst für dortige Verhältnisse tolle Liebesgeschichten sehr lebhaft debattiert wurde. Mir fiel beiläufig ein, daß ich von all’ diesen wunderlichen Tatsachen und den ihnen zugeschriebenen Ursachen schon nach einem Jahre kaum noch eine verschwommene Erinnerung haben würde, und das veranlaßte mich, mir heimlich Aufzeichnungen auf ein Konzertprogramm zu machen. Man wollte Pharao spielen. Wir saßen unsrer dreißig um einen Spieltisch, aber die Unterhaltung war so lebhaft, daß darüber das Spiel vergessen ward. Als dann noch der Oberst Scotti hinzukam, der zufällig die Intimitäten jener bizarren Vorfälle kannte und davon erzählte, erschienen sie mir in ganz neuem Lichte. Ich zeichnete mir auch diese neuen Momente auf. Auf gleiche Weise machte ich mir auch in anderen Salons, wo von denselben Dingen die Rede war, Aufzeichnungen, und bald hatte ich das Bedürfnis, ein allgemeines Gesetz für die verschiedenen Grade der Liebe festzulegen.
»Wenige Monate darauf mußte ich Mailand verlassen. In Paris vereinigte ich meine aphoristischen Aufzeichzeichnungen zu einem Hefte, das ich einem Verlagsbuchhändler schenkte. Der Drucker erklärte aber, es sei ihm unmöglich, diese Bleistiftnotizen zu drucken; offenbar hielt er das Setzen nach einem derartigen Manuskript für unter seiner Würde. Ich mußte es dem Druckerlehrling noch einmal diktieren. Als ich dann die Korrekturen dieser meiner moralischen Reise durch Italien und Deutschland las, deren Fakta immer am Tage, wo ich sie beobachtet hatte, niedergeschrieben sind, habe ich das Manuskript mit seiner umständlichen Beschreibung aller Zustände jener Krankheit, genannt Liebe, voll blinder Ehrfurcht behandelt etwa wie ein Gelehrter des dreizehnten Jahrhunderts eine eben aufgefundene alte Handschrift des Lactantius oder des Quintus Curtius.
Wenn der Leser auf irgend eine dunkle Stelle stößt, und das wird ihm, offengestanden, häufig passieren, so bitte ich, jenem alten Ich die Schuld zuzuschieben. Ich gestehe, meine Ehrfurcht vor dem Originalmanuskript ist so weit gegangen, daß etliche Stellen gedruckt worden sind, die ich selber nicht mehr verstand …
»Es war eine Gefahr für mich, die Korrekturen eines Buches zu lesen, das mich alle Nuancen meiner Empfindungen in Italien von neuem durchleben ließ. Ich hatte die Schwäche, ein Zimmer in Montmoreney zu mieten. Abends fuhr ich mit der Post hinaus. Mitten im Walde korrigierte ich meine Bogen. Ich wäre dabei beinahe verrückt geworden. Häufig machte ich die Korrekturen auch im Park der Gräfin Beugnot in Corbeil. Dort konnte ich den trüben Träumeieien aus dem Wege gehen; sobald ich mit arbeiten aufhörte, ging ich in den Salon. Mit allen Sinnen war ich bei Mathilde; oft hatte ich Tränen in den Augen. Ich hegte wohl den Plan, mein Buch umzuarbeiten, aber tiefer über Dinge der Liebe nachzudenken, machte mich zu traurig. Es war mir, als ob man mit rauher Hand an eine kaum vernarbte Wunde rührte. An dem Buche zu arbeiten, tat mir weh. So nötig es gewesen wäre, ich habe es auch später nicht umzuarbeiten vermocht…
»Ich veröffentlichte ein Schmerzenskind.
»Obgleich ich das Manuskript dem Verleger Mongie geschenkt hatte, druckte er es auf schlechtem Papier und in lächerlichem Duodezformat.
»Ich habe dem Publikum nicht geschmeichelt, und das in einer Zeit nach gewaltigen Umwälzungen und Niederlagen, wo die ganze Literatur nur den Zweck zu haben schien, unsere Eitelkeit in ihrem Unglück zu trösten. Unter Ludwig dem Fünfzehnten war die Liebe in Frankreich allmächtig; die Namen am Hofe machten ihre Liebhaber zu Obersten. Heute, nach fünf radikalen Umwälzungen in Zweck und Form der Regierung, vermöchte einem auch die einflußreichste Frau der regierenden Bourgeoisie oder des grollenden Adels kaum noch einen Tabaksverschleiß in einem Dorfe zu verschaffen. Die Frauen sind nicht mehr in Mode. Die goldne Jugend, die sich gern einen frivolen Anstrich gibt, um als Erbin der guten Gesellschaft von ehedem dazustehen, spricht lieber von Pferden oder spielt im Klub, wo keine Frauen zugelassen sind. Eine tödliche Froschblütigkeit hat unsre Generation ergriffen. Die Gesellschaft von 1778, wie wir sie in Diderots Briefen an seine Geliebte, Mademoiselle Voland, oder in den Memoiren der Madame d’Epinay finden, ist unsrer Zeit völlig unverständlich geworden.«
Soviel erzählt Beyle selbst teils in verschiedenen Vorreden für eine künftige Neuausgabe von De l’Amour, die er nicht mehr erleben sollte, teils in seinen »Erinnerungen«. Heute ist dieses Buch, das einst in zwölf Jahren nur siebzehn Käufer gefunden hat, über den ganzen Erdball verbreitet, es ist sogar eins der wenigen Literaturwerke, die die Japaner in ihre Sprache übertragen haben, weil es ihnen geeignet erscheint, die gelbe Rasse in die ihr geheimnisvolle Empfindungsweise der Europäer einzuweihen. Sein Verfasser, dem es lebenslang wie ein ungezogenes Lieblingskind am Herzen lag, hat somit nicht zu Unrecht gesagt: »Man wird es um 1900 lesen.«
Stendhal nennt sein Buch ein livie d’idéologie. »Ich bitte die Philosophen um Verzeihung,« schreibt er in einer (fortgelassenen) Anmerkung, »daß ich das Wort Ideologie gewählt habe. Ich will gewiß niemandem etwas ihm Zustehendes rauben. Wenn man unter Ideologie eine ausführliche Beschreibung der Ideen und aller ihrer Bestandteile versteht, so ist dieses Werk eine ausführliche und sorgfältige Beschreibung aller Gefühle, die die Leidenschaft der Liebe ausmachen. Ich kenne leider kein griechisches Wort für ’Abhandlung über Gefühle‘, wie Ideologie ’Abhandlung über Ideen‘ bedeutet. Schon mit dem AusdruckKristallbildungwerde ich mißfallen.«
An diese Randglosse anknüpfend hat ein Kritiker der ersten Auflage der vorliegenden deutschen Übertragung mit vollem Verständnis bemerkt: »Stendhals Buch über die Liebe ist in der Hauptsache egotistisch, denn es schildert als Ergebnisse feinster Selbstanalyse die Empfindungsweise seines heißblütigen Verfassers und hält sich von aller Metaphysik fern. Es vervollständigt das Selbstbildnis Stendhals, das wir in seinen ’Bekenntnissen eines Egotisten‘ besitzen. Nur aus Verlegenheit, vielleicht auch in verehrender Hinsicht auf Destutt de Tracy, für dessen ’Ideologie‘ sich Stendhal schon in früher Jugend begeistert hatte, ist die unzutreffende Bezeichnung livre d’idéologie gewählt worden. Jene charakteristische Bemerkung verweist uns darauf, aus welchem Bedürfnis heraus Stendhal das Wort Egotismus geschaffen, als es galt, diese persönliche Empfindungsweise selbst einschließlich aller Absonderlichkeiten des Nervensystems anzudeuten und endlich eine Bezeichnung zu finden für die psychologische Erforschung und systematische Darstellung des eigenen Gefühlslebens.«Das Buch über die Liebe ist in zärtlichen Liebesträumereien entstanden, die einer schönen Italienerin galten, und manche Seite spricht wohl unmittelbar zu ihr. Es war eine unglückliche Liebe, die Beyle zu Mathilde Dembowska hegte, einer Mailänderin, der Gattin eines napoleonischen Generals, die von ihrem sie schlecht behandelnden, treulosen Manne getrennt lebte. Es ist ihrer an anderer Stelleausführlich gedacht worden. Sie hat die leidenschaftliche Liebe Beyles nie erhört, vielleicht weil sie ihm bei seinem lebemännischen Ruf die Wahrheit seiner Gefühle nicht glauben konnte. Beyle hat sie als Ideal des lombardischen Frauentypus, der ihm als Meisterstück aller Rassen galt, verherrlicht. Sie ist im Jahre 1825 in Mailand gestorben, achtunddreißig Jahre alt, und ihrem Anbeter sein ganzes Leben lang »eine zarte, wehmütige Traumgestalt geblieben, deren Erinnerung ihn gut, gerecht und nachsichtig stimmte.«
Obgleich für eine Frau geschrieben, ist das Buch über die Liebe doch kein Frauenbuch nach jener delikaten Vorschrift Diderots: »Wer für Frauen schreibt, muß seine Feder in den Regenbogen tauchen und seine Schriftzüge mit dem Staube von Schmetterlingsflügeln trocknen.« Es ist im Gegenteil ein männliches Buch und offenbart die ganze Kraft des Stendhalschen Geistes, »mit seinen Sprüngen und Abwegen, feinem Genie und seiner Feinheit, seinen Spitzfindigkeiten und Übertreibungen, seiner Abgerissenheit und seinen Widersprüchen. Trotz seiner freien Ideen und seiner absichtlichen Immoralität überrascht es uns, daß der Schüler eines Cabanis in der Liebe etwas anderes erblickt als allein den Sinnengenuß. Sein Buch mischt in die Befriedigung der Begierde und in das Fieber der Sinne die Zartheit seelischer Empfindungen. Es ist im Grunde eine Studie über die Macht der Phantasie in der Liebe.«
Es ist auch der beste Schlüssel zum Verständnis des merkwürdigen Charakters Beyles und seiner Romane. Hier finden sich die reichen Erfahrungen seines bewegten Lebens gleichsam mit der Kraft einer Sammellinse konzentriert, hier ist In abtracto niedergelegt, was Stendhal später mit so packender Gewalt in »Rot und Schwarz« und in der »Kartause von Parma« zu neuem Leben erweckt hat, hier wird das feine und haarscharfe Instrument geschliffen, mit dem er später die »feinen und seltenen« Seelenregungen seiner dichterischen Gestalten bloßlegt. Er selbst war ein Liebender und ein Romantiker, der, wie so viele von Rousseau bis Wagner, die ewigen Rechte der Leidenschaft proklamiert hat: bald mit italienischer Glut und Skrupellosikeit, bald mit deutscher Inbrunst, die diesen Trieb als eine Emanation des Göttlichen ansieht. Aber derselbe Stendhal war auch ein Schüler der geistreichen und leichtfertigen Rokokophilosophen, die den Menschen aus Lust und Unlust erklärten und der Lust lächelnd das Vorrecht gaben. Dazu steckten in ihm ein von seinen mütterlichen Vorfahren ererbter »spanischer« Abenteurerzug, den er mit seinen Helden Julian Sorel und Fabrizzio del Dongo teilt, und der sein heimliches Werihertum so gern ironisierende Hang zur Don-Juanerie. Die Überlegenheit des freien Geistes zog das Ergebnis aus allen diesen Faktoren und setzte die Liebe aus Leidenschaft als obersten Wert ein, jenefreie Liebe, von der Beyles Zeitgenosse Saint-Simon geschwärmt und die das junge Deutschland alsbald so begeistert verkündet hat.
Wie alle Bücher Stendhals verrät auch De l’Amour eine umfangreiche Belesenheit in verschiedenen Sprachen und Disziplinen, die um so erstaunlicher ist, als er bis in sein einundreißigstes Lebensjahr das rastlose Wanderleben eines napoleonischen Soldaten durch halb Europa geführt hat. Stendhal ist bis in die Fingerspitzen literarisch, wenngleich er (S. 250) die Paar Bücher, die Lisio Visconti, das heißt er selber, gelesen habe, von oben herab abtut. Widmen wir den wichtigsten Werken, die ihm Ideen oder Beispiele zu seinen eigenen Erörterungen an die Hand gegeben haben, ein wenig unsre Aufmerksamkeit.
Neben Cabanis und Destutt de Tracy, den Beyle bekanntlich hochverehrte, hat die Philosophie des Helvetius einen hervorragenden Einfluß auf Stendhals Schriften, insbesondere auch auf gewisse Ideen im vorliegenden Buche, ausgeübt. Dann sind hier Montaigne und der »witzigste aller Moralisten«, Nicolas Chamfort zu erwähnen. Es ist, nebenbei bemerkt, lehrreich zu vergleichen, wie verschieden zwei so geistvolle Weltleute wie Chamfort und Stendhal gegen Ende ihres Lebens die Frauen beurteilt haben; Chamfort ist ihnen gegenüber zum bittersten Pessimisten geworden, während Beyle trotz allem durch sie erfahrenen Ungemach sie noch in seinem letzten Roman »Luzian Leuwen« in unverbesserlichem Optimismus vergöttert und idealisiert.
Eine lange Reihe von Schlüssen und Beispielen hat Stendhal in Memoiren und Briefwechseln gefunden. Insbesondere sind hier hervorzuheben die Liebesbriefe der Julie de Lespinasse an den Grafen Guibert, Diderots Briefe an Sophie Volantund die Briefe Mirabeaus an Sophie de Monnier. Da die erstgenannten in Deutschland selbst unter Literaturfreunden nur wenig bekannt sind, so möchte ich durch folgende, dem geistreichen Buche der Gebrüder Goncourt »Die Frau im achtzehnten Jahrhundert«entnommene Stelle auf sie aufmerksam machen:
»Bei Fräulein de Lespinasse ist die Liebe ein verzehrendes Brennen, ein immer glühendes, immer wieder aufloderndes Feuer, das unaufhörlich in sich selber wühlt, treibt und arbeitet. Dieses Gefühl lebt von seiner Aktivität, Energie, Heftigkeit, seinem Wüten und Toben. Es dauert, indem es sich langsam erschöpft, und man untersuche es nur einmal: es wird einem unter der Hand zittern als der stärkste Herzschlag des achtzehnten Jahrhunderts. Denn diese Liebe des Fräuleins von Lespinasse ist nicht bloß das Fieber dieser einen Frau, sie läßt die Krankheit und das Streben ihrer Zeit sehen. Sie enthüllt das geheime Leiden jener kleinen Zahl von höheren Menschen, die für ihr Jahrhundert zu reich ausgestattet, fast auf den ersten Anlauf schon alles bis ans Ende getrieben haben und alles bis auf die Hefe geleert, was ihnen das Vergnügen, das Glück, die Aktivität der Gesellschaft an Beschäftigungen geben und an Fülle mitteilen konnten. Voller Ekel stehen sie vor den Dingen, vor der Leere des gewöhnlichen Lebens, krank am Reichtum ihrer Seelen, und entdecken in dieser Atmosphäre voller Trockenheit und Egoismus in sich ein unwiderstehliches und wütendes Bedürfnis zu lieben, zu lieben mit Narrheit, mit Verzückung, mit Verzweiflung. Wie in einen Gießbach wollen sie sich in die Liebe stürzen, ganz und gar in ihr versinken, sich von ihrer ganzen Macht am Herzen gepackt fühlen. Sie gestehen es, sie verkünden es ganz laut: es handelt sich für sie nicht darum, zu gefallen, schön und geistreich befunden zu werden, jene große Ehre der Zeit zu genießen, die Ehre einer Bevorzugung, den Kitzel der Eitelkeit zu spüren: was sie wollen, sind nur Erfolge des Herzens, ihr Stolz ist, zu lieben. Alles, was sie ambitionieren, gipfelt darin, der Liebe für fähig und für würdig befunden zu werden, zu leiden. Umgewühlt, gerührt, von Leidenschaft durchschauert zu werden, das ist der innige Wunsch dieser Seelen, die ungeduldig sind, der Kälte ihres Jahrhunderts zu entrinnen, die fröhlich beflissen sind, sich von der Gesellschaft zu befreien und in sich selbst einem einzigen Gedanken zu leben. Diese Frauen, die im allgemeinen in ihrer Kindheit und ersten Jugend die Gefühle der Frömmigkeit nicht erfahren haben, kommen zur Liebe wie zu einem Glauben. Sie bringen eine Art hingebeugter Ergebung hinein. Diese Seelen aus reiner Vernunft, die bis dahin keinen sittlichen Sinn, kein Gewissen und keinen Herrn hatten als den Verstand, diese so stolzen, verwöhnten, eben noch so leeren Seelen verlieren, sobald sie nur getroffen, das Gefühl ihres Wertes und ihrer Stellung; sie stürzen sich in die Niedrigkeit einer Magdalena, einer verliebten Kurtisane. Ihre Eigenliebe, diesen großen Antrieb ihres ganzen Wesens, werfen sie restlos unter die Füße des geliebten Mannes; sie empfinden Vergnügen daran, sie von ihm treten zu lassen. Sie stehen vor ihm wie vor dem Gott ihres Daseins, unterwürfig und demütig, gebeugten Hauptes, klaglos und auf alles resignierend, fast fröhlich über ihr Leid.
»Diese absolute Unterwerfung findet man bei Fräulein von Lespinasse so ausgeprägt, daß dieses Element ihrer Liebe weit stärker hervorzuleuchten scheint als ihre Verzückung und Heftigkeit. Wie soll man die Herrin eines der ersten Salons von Paris in dieser Frau wiedererkennen, die sich in der Liebe so klein macht, die den schlechtesten Platz im Herzen ihres Geliebten so furchtsam und mit so leiser Stimme erbittet, die sich so lebhaft für den Ausdruck des Interesses bedankt, mit dem man ihr zu schreiben geruht, die sich so sanft darob entschuldigt, daß sie dreimal in der Woche schreibt? So wenig man ihr auch gewährt, sie empfängt es wie eine Gunst, die sie nicht verdient; ja, sie findet ihre Dankbarkeit noch kalt, auch wenn sie alle ihre Zärtlichkeit hineinlegt. Nichts vermag sie aus dieser knienden und flehentlichen Haltung emporzureißen, und alle Zeichen der Liebe, die ihr zuteil werden, vermögen sie nicht zu jenem Vertrauen zu ermutigen, kraft dessen man fordert, was man vom Geliebten wünscht. Unaufhörlich demütigt sie sich vor Herrn von Guibert, und die Hingebung, mit der sie ihren Willen in den seinen, sich selbst in ihn ergießt, ist so absolut, daß sie sich nicht mehr im Einklang mit der Gesellschaft, in Übereinstimmung mit dem Ton und den Gefühlen der großen Welt findet. Die Vergnügungen und die Zerstreuungen, denen sie noch um sich begegnet, können ihr nichts gewähren; und der Liebe gegenüber, die sie erfüllt, erscheint ihr die öffentliche Meinung so geringfügig, daß sie bereit ist, ihrem Urteil zu trotzen und fortzufahren, Herrn von Guibert zu sehen und ihn in jedem Augenblick ihres Lebens zu lieben. Ein wunderbarer Schwung lebt in ihr, eine höchste Elevation, ein beständiges Streben; allen ihren Gedanken, allen Kräften ihrer Seele, allen Mächten ihres Herzens entringt sich der Schrei der Zärtlichkeit und Verzückung: eine heiße Bitte um einen Kuß. »In jedem Augenblicke meines Lebens: mein Freund, ich leide, ich liebe Sie und ich erwarte Sie!«
»Die von ihrem Objekt völlig absorbierte Liebe hat kein größeres Beispiel in der modernen Menschheit als diese Frau, die alle ihre Gefühle und all’ ihre inneren Regungen auf ihren Liebhaber bezieht, ihm alle ihre Gedanken schenkt, deren Eigentum sie sich nach ihrem feinsinnigen Ausdruck, nur zu sichern glaubt, indem sie sie ihm mitteilt, die sich alles verbietet, woran er keinen Anteil hat, die zufrieden damit ist, nur von ihm zu leben, ihrer eigenen Persönlichkeit beraubt und gleichsam für sich selbst abgestorben, die sich weigert zu reden, die den Besuchen Diderots die Türe schließt, weil sein Gespräch, wie sie sagt, ihre Gedanken gewaltsam ablenkt, die allein, ohne Bücher, ohne Licht und in Schweigen bleibt, ganz und gar dem Genuß des neuen Seeleninhalts hingegeben, den ihr Guibert mit den drei Worten geschaffen: ,Ich liebe Sie’, und zugleich so tief in diesem Genuß versunken, daß sie darüber die Fähigkeit verliert, sich der Vergangenheit zu erinnern und der Zukunft zu gedenken.
Außer mit solchen und anderen Dokumenten der Liebe stützt Stendhal seine Behauptungen mit Beispielen und Hinweisen auf Gestalten und Handlungen in einer Reihe von französischen und englischen Romanen. Hier ist nun in erster Linie Jean Jacques Rousseau zu nennen. Es wird wohl niemals ein Buch über die Geschichte der Liebe der europäischen Menschenrasse geschrieben werden, in der sein Name nicht einen wichtigen Markstein bedeutet. Ich will einem geistvollen Essay über Rousseau von Wilhelm Weigand folgenden Abschnitt entnehmen: »Leidenschaftliche Leute, wie der Vergötterer der Energie Stendhal, haben behauptet, die Liebe sei in Frankreich seltener als sonstwo zu finden: in der Tat, die Frauen vor Rousseau waren bessere Freundinnen als Liebende; sie legten als Töchter einer kaltsinnlichen Zeit vielleicht zu wenig Wert auf die letzte Gunst, als daß sie sich in Liebesleidenschaft verzehrten. Man genoß das Leben, indem man geistreiche Briefe schrieb, sich mit den Wissenschaften abgab, wie die göttliche Emilie Voltaires, Venus-Newton, das Herz auf der Zunge trug, geistreiche Maximen über Moral und Sitte schmiedete und mit den intimsten Erlebnissen Staat machte. Die Natur ist wortkarg, jede reife Zivilisation hingegen geschwätzig. Obwohl Rousseaus Einfluß auf die Frauen allmächtig war, so blieben doch einzelne Naturen, wie die geistreiche Lästerbase Marquise du Deffant und die reizende Frau des Ministers Herzogs de Choiseul, der alten gallisch-heiteren Tradition treu, die in dem Bürger von Genf einen Scharlatan der Tugend erblicken mußten. Die Frau ist in viel höherem Grade ein Geschöpf des Milieu als der Mann, und so ist denn auch die Julie Rousseaus kein Lebewesen der freien Natur, sondern einer höchst verdorbenen Gesellschaft, die sich, wie geistreiche Leute zu tun Pflegen, selbst vergötterte, ohne sich gerade gut zu kennen. Dieser Julie fehlt, wie allen Französinnen von dreißig oder mehr Jahren, die reine Naivität des Herzens, der Zauber einer naturfrischen Persönlichkeit: sie ist, man kann es nicht genug betonen, die geistige Tochter eines Literaten von wollüstiger Natur, die an allen Krankheiten der Zeit leidet; sie spricht wie Rousseau selbst in unausstehlicher Weise über die Tugend und kommt doch zu Fall. Die Marquise de Pompadour, die als Maitresse des Allerchristlichen Königs in der alten Tradition verharren mußte, spottete in einem Briefe an eine Freundin witzig über diese Tugendenthusiastin: ,Welch ein langweiliges Wesen ist doch diese Julie! Wieviel Vernünftelei und tugendhaftes Geschwätz, um sich endlich einem Manne zu geben!’ Der Hang zum Räsonieren in zweideutigen Lagen ist vielen Frauen dieser Epoche gemeinsam als ein Zug der Galanterie, die in Frankreich, vor allem am Hofe, ihre Heimat hat. Rousseau ist nicht galant, ja, er haßt die Galanterie, diese Blüte der französischen Zivilisation, als ein Plebejer, dem Anmut und sichere Frechheit des schönschwätzenden Edelmanns fehlen. Wenn man Rousseau mit den lüsternen Erzählern des ancien régime vergleicht, so erscheint er wirklich als großer Dichter, und so verspürten denn auch die Schmetterlinge der Salons einen Hauch von Poesie, zumal auch die ganze Nation geneigt ist, blühende Rhetorik als Sprache der Dichtkunst hinzunehmen. Rousseau zog es, seiner eigenen Natur folgend, vor, bei den Frauen ,sublim’ zu sein, mit dem Reichtum eines leidenschaftlichen Herzens zu glänzen, das mit mißtrauischer Sicherheit fühlte, wie schlecht ihm die leichtfertige, tändelnde Sprache der müßigen Eroberer stand. Die Zeitgenossen täuschten sich nur halb, wenn sie in Rousseau das Urbild des Saint-Preux sahen. Das war ein Plebejer wie Rousseau selbst. Die Liebe eines bürgerlichen Mannes zu einer Frau der vornehmen Gesellschaft war nichts Neues; die nachsichtigen philosophischen Ehemänner erlaubten ihren Frauen herabzusteigen, wenn sie nur Prinzen und Lakaien verschmähten, vor welchen Extremen ein geistreicher Mann seine galante Frau warnte. Viele solcher leichtfertigen Verbindungen der Geschlechter, die der vergötterte Geist auf eine Höhe trug, erregten in der übermütigen Welt weiter kein Aufsehen. Neu hingegen war die Liebe eines Plebejers zu einem vornehmen Mädchen, das der Sitte gemäß seinen Gatten aus der Hand der Eltern empfangen sollte. Freilich verliert Saint-Preux als der einzelne vor einer mächtigen Gesellschaft seine Geliebte, aber mit ihm war doch der Plebejer in die Literatur eingeführt und eine Welt neuer Konflikte geschaffen. Napoleon tadelte in seiner berühmten Unterredung mit Goethe zu Erfurt mit Unrecht die Vermischung zweier Motive im Werther: nämlich der Leidenschaft und des plebejischenressentiment. War der klassische Lateiner, der in seiner Jugend die ganze Wertherei durchgemacht und aus Italien an den Vorabenden seiner Schlachten glühende Wertherbriefe an die Kokette Josephine geschrieben hatte, aus ästhetischen Gründen, als Bewunderer Corneilles, gegen diese gerechtfertigte Gleichstellung zweier Motive?«
Stendhal erwähnt im vorliegenden Buche Rousseau, insbesondere die »Neue Heloise« und deren Gestalten Saint-Preux und Julie d’Etanges so häufig, daß sich der aufmerksame Leser vielleicht angeregt fühlen wird, die »Neue Heloise« zur Hand zu nehmen. Rousseau bleibt auch für uns ein genialer Geist, des beispiellosen Einflusses auf seine Zeitgenossen würdig, trotzdem gehört er nicht zu den großen Schriftstellern, deren Bücher sich durch die Jahrhunderte hindurch frisch erhalten. Auch hierzu möchte ich einige Worte Weigands als die eines anerkannten Kenners der Literatur und Kultur Frankreichs im achtzehnten Jahrhundert anführen: »Wenn wir heute bei einem durchaus veränderten Geschmacke die ’Neue Heloise‘ lesen, so finden wir sie langweilig, rhetorisch, gemacht, französisch, und wir bedürfen unseres hochentwickelten historischen Sinns, um die ungeheure Wirkung des Buches zu begreifen. Rousseau ist der Vater der modernen Literatur, aber die ’Neue Heloise‘ ist veraltet; Männer von feinstem modernen Geschmacke sagen: ein unausstehliches Buch, das uns eine Arbeit auferlegt, wenn wir es genießen wollen …«
Im Grunde hat Stendhal diesen Roman nicht viel anders als der moderne Leser beurteilt. Er schreibt im Jahre 1832: »Mein Glück und meinen Genuß, als ich die ’Neue Heloise‘ zum ersten Male (als Zwölfjähriger) las, ist unmöglich zu beschreiben. Heute erscheint mir dieses Buch pedantisch, und sogar im Jahre 1814, in der tollsten Liebesstimmung, habe ich darin keine zwanzig Seiten hintereinander lesen können,« Ähnlich urteilt er bereits im vorliegenden Buche (vgl. S. 292).
Einen ebenso bedeutsamen, ja vielleicht auf Beyles eigenes Liebesleben viel nachhaltiger wirkenden Einfluß hat ein anderer berühmter Roman auf ihn ausgeübt, dieLiaisons dangereuses, der 1782 erschienen ist.Von den zahlreichen französischen Ausgaben sei die des Mercure de France genannt. Den Liaisons dangereuses gilt die Xenie Goethes:
»Warnung reizt uns oft, ich seh’ es; denn jegliche Schöne Liest und wünscht insgeheim sich derVerbindungGefahr.«
Im Gegensatz zur »Neuen Heloise« und zu den Liebesbriefen der Lespinasse ist er frei von den sentimentalen und demokratischen Einflüssen Rousseaus, er ist das letzte bedeutende literarische Dokument des echtenancien régime, ein Buch voller Herrenmoral. Der Verfasser, der Artilleriegeneral Choderlos de Laclos, war einer der geistvollsten Köpfe der napoleonischen Armee, ein universell begabter Weltmann, gleich gewandt als Diplomat, als Taktiker, als Artillerist.
Aus fremden Sprachen treten – außer den Romanen Scotts, Richardsons und Fieldings – hinzu Werke Virgils, Shakespeares, Byrons, Goethes, Schillers, Dantes, Petrarcas, Cervantes u. a., aus der neulateinischen Literatur der »Traktat von der Liebe« des Andreas Capellanus und die »Briefe der Heloise an Abälard«, aus dem Altarabischen der »Diwan der Liebe« des Ibn-Abi-Hagala, schließlich einige provenzalische Handschriften des dreizehnten Jahrhunderts. Den von Andreas Capellanus in lateinischer Sprache überlieferten altprovenzalischen »Liebesregeln« habe ich die niederdeutsche Übersetzung des Eberhard Cersne (nach der Handschrift von 1404) und die mittelhochdeutsche des Doktors Hans Hartlieb (gedruckt 1482) in einer Anmerkung beigefügt. Auf die arabischen Handschriften (in der Pariser Nationalbibliothek) ist Stendhal durch den Orientalisten und Akademiker Fauriel aufmerksam gemacht worden, wahrscheinlich rührt der französische Text von ihm her.
In dieses reiche literarische, psychologische und völkerpsychologische Beiwerk mischen sich allenthalben Beyles eigene Erfahrungen und Beobachtungen. Wie wertvoll, wie genial und sicher seine knapp ausgedrückten Beobachtungen sind, das bestätigt uns die enthusiastische Bewunderung eines Goethe, eines Hippolyte Taine eines Friedrich Nietzsche. Dazu zeigen uns die »Bekenntnisse eines Egotisten« die Reihe von Hermen geliebter Frauen, die Beyles Lebenspfad geschmückt haben. Es sei an seine jugendlichen Liebesschwärmereien erinnert, dann an die sentimentale Liaison des Marseiller Intermezzos, an die lustige blonde Minette in Braunschweig,Briefe einer Schwester Wilhelmines an Albert von Wedell, einen der Schillschen Offiziere, hat die Baronin Edith von Cramm unter dem Titel »Briefe einer Braut aus den Jahren 1806-1813« veröffentlicht (Berlin, Fleischel, 1905). Porträts beider Schwestern haben sich erhalten.an die glücklichen Wiener Tage in der Gesellschaft der eleganten Gräfin Daru, an die sinnliche Angela Pietragrua, die »schöne Sibylle«, an die »göttliche, tolle, liebenswürdige Nina«, die reizende Elena Viganò »mit der herrlichsten Stimme Italiens«.
Trotz all dieser Vielseitigkeit hat Stendhal sein Thema nicht erschöpfend dargestellt. Fast jeder Kritiker des Buches vermißt irgend eine Abart der Liebe. So sagt Arthur Chuquet in seiner bereits erwähnten Stendhalbiographie: »Das Buch über die Liebe ist nicht, wie Beyle unbescheidenerweise sagt, eine vollständige Analyse jener Leidenschaft, ja nicht einmal eine bis in alle Einzelheiten gehende, peinlich genaue Beschreibung aller Empfindungen, aus denen sie sich zusammensetzt. Stendhal vergißt die Gehirnliebe, die Kopf-oder Phantasieliebe, die er später in Mathilde de la Mole in ’Rot und Schwarz‘ gelegt hat. Er vergißt die Liebe aus Gewohnheit, die Freundschaftsliebe, die Liebe aus Vertrauen und eine Menge anderer Spielarten, die ihm doch bekannt waren. Wenn er auch flüchtig erwähnt, daß die beiden Geschlechter ungleich disponiert sind, so hebt er doch die Unterschiede der Liebe eines Mannes und eines Weibes nicht hervor, das eitle, leichtfertige, schwache, launenhafte, falsche, zwischen Extremen schwankende Wesen, in dem Haß neben Zärtlichkeit schlummert. Er zeigt uns nicht, daß hinter der unbeständigen Laune ein physischer Mangel steckt. Er führt uns den Einfluß des Nervensystems auf die Seelenregungen nicht vor Augen.«
In anderer Hinsicht schreibt Friedrich von Oppeln-Bronikowski in einer Studie über Stendhals Buch sehr treffend: »Einen wunden Punkt hat dieses ganze System für uns superkluge Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts, und ich zweifle nicht, daß Stendhal, wenn er noch unter den Lebenden weilte, ihn zuerst herausgefühlt hätte. Er hat sich zwar redliche Mühe gegeben, die Liebe nicht nur vom Standpunkte des Junggesellen – heiße er Werther oder Don Juan – zu betrachten, sondern auch die Beziehungen zwischen Liebe und Ehe zu erforschen. Er hat die Ehescheidung als Damm gegen den Ehebruch gefordert und das protestantische Deutschland, wo die Ehescheidung schon zu seiner Zeit gesetzlich erlaubt war, als das Land der glücklichen Ehen hingestellt. Immerhin fällt er in den Unverstand zurück, wenn er sich wundert, daß man in Deutschland die Ehe heilig halte, und daß die Frauen ihre Männer dort nicht betrögen. In seinen Anschauungen liegt eine seltsame Doppelheit. Daß die Liebe heilig und ewig sei, daß sie von den Deutschen als eine Emanation des Göttlichen angesehen wird, findet bei ihm, dem Romantiker und Liebenden, vollen Anklang. Aber es darf eben nur die freie Liebe sein. Eheliche Treue wirkt auf ihn komisch. Doch dem Liebhaber muß man unverbrüchliche Treue halten. So baut sich auf dem Ehebruch eine zweite ’ideale‘ Ehe auf, die sich von der ersten nur in einem Punkte unterscheidet: sie bleibt ohne Nachkommenschaft, Die Kehrseite der Medaille, die Goethes Gretchentragödie und die »Wahlverwandtschaften« so schonungslos enthüllen, ignoriert der Franzose vollständig, und nachdem derart die Liebe um ihren eigentlichen Zweck und Sinn – den der Fortpflanzung – gebracht ist, fällt natürlich auch der soziale Zweck der Ehe, die Erziehung der Kinder, in nichts zusammen. Dem Romantiker Beyle war es noch nicht gegeben, jenen Schritt weiter zu tun, den der große ’Immoralist‘ Nietzsche über ihn hinaustat, indem er die Ehe und zwar die fruchtbare Liebesehe als Sakrament seines Übermenschenkults wieder einsetzte. Der Ehemann spielt bei Stendhal begreiflicherweise die Rolle des notwendigen Übels… In diesem Punkte also gerät Beyle in eine ganz schiefe Stellung, indem er die Liebe gegen die Ehe ausspielt,– aus übertriebener Angst, für einen Heuchler und Mucker zu gelten. Der englische cant, ist begreiflicherweise seine bête noire, und auch die Prüderie der französischen Provinz malt er in grellen Farben. Dabei ist Beyle, wie gesagt, keineswegs lasziv; man würde ihn grausam mißverstehen, wenn man hinter der reichen Fülle seiner feinen und tiefen Gedanken diesen spiritus rector wittern wollte. Er sieht nur als der Romantiker, der er trotz seines kalten Verstandes stets gewesen ist, in der Liebe sein »unermeßliches, einziges und letztes Glück‘; ’ohne Liebe bin ich nichts‘, bestätigt er auch in seinem Tagebuche.«
Einleitung
Inhaltsverzeichnis
Viel bedauerlicher als die von Arthur Chuquet vermißte, bei einem so subtilen Thema unmögliche Vollständigkeit hinsichtlich etlicher Abarten der Liebe ist es, daß »der scharfe Darsteller der Zustände der Renaissancezeit«, – so wird Stendhal von Jacob Nurckhardt in der »Kultur der Renaissance in Italien« (II, 179) genannt, – unterlassen hat, die Liebe und die vergeistigte Galanterie der Italiener jener Epoche und die Theorie der vornehmen Liebschaft etwa aus dem Cortigiano oder den Asolanen und Briefen des Pietro Vembo oder verwandten Quellen im klaren Spiegel seines Geistes wiederzugeben.
Einem Punkt der zu Anfang dieser Einleitung angeführten Worte Stendhals gebührt noch eine Erläuterung. Er hat uns da das Unverständliche einiger Stellen selbst eingestanden. In einer (fortgelassenen) Anmerkung sagt er von seinem Buche: »Man muß beim Lesen den Bleistift in die Hand nehmen und das Fehlende zwischen die Zeilen schreiben.« Der Hauptfaktor dieser Unklarheiten ist an anderer Stelle, in den »Bekenntnissen eines Egotisten«, dargelegt worden. Stendhal hat – gleich seinem Geistesbruder Nietzsche – eine eigentümliche Neigung, seine Person, sein Leben, seine Werte und Gedanken hinter erdichtete Namen und Figuren zu verstecken, teils aus reinem Mutwillen, teils aus einem gewissen Schamgefühl heraus, um seine intimsten Erlebnisse und aufrichtigsten Bekenntnisse nicht dem ersten besten preiszugeben. Mehr als in seinen anderen Büchern kommt dieser Hang in De l’Amor zum Ausdruck. »Dieses ganze Buch«, heißt es in einer (fortgelassenen) Anmerkung, »ist eine freie Übersetzung nach dem italienischen Manuskript des Lisio Visconti, eines jungen Mannes von höchster Distinktion, der soeben in seiner Vaterstadt Volterra gestorben ist und dem Übersetzer am Tage seines plötzlichen Todes gestattet hat, den von ihm verfaßten Essay über die Liebe zu veröffentlichen, vorausgesetzt, daß es ihm gelänge, ihn in anständige Form zu bringen. Castel-Fiorentino, den 10. Juni 1819.« Dieser Lisio Visconti ist eine Mystifikation, hinter der sich Beyles eigene Person verbirgt; der Name hat wohl einen absichtlichen Anklang an den Mädchennamen der Generalin Dembowska (Mathilde Viscontini). Mathilde selbst trägt in De l’Amour den Namen Leonore. Leonores Freundin Alviza ist in Wirklichkeit Mathildes Cousine und Freundin, die reiche Frau Traversi, die übrigens auch der intriganten Marchesa Raversi in der »Kartause von Parma« als Modell gedient hat. Es finden sich auch in verschiedenen Anmerkungen angebliche Worte jenes Lisio zitiert, in einem Fall mit dem launigen Zusatz: »Hier verliert sich der arme Lisio in den Wolken,« und um die Verwirrung zu vollenden, macht Stendhal auch noch Auszüge aus den angeblichen Memoiren seines »verstorbenen Freundes, des Barons von Bottmer«, sowie aus dem Tagebuche eines anderen ebenfalls toten Freundes namens Salviati. Man darf wohl auch hinter diesen beiden Masken Beyle selbst suchen. Lisio bekommt ferner einen Freund del Rosso zugeschrieben, und daneben treten noch andere Proteusgestalten auf, wie Alberic, Lord Mortimer, Graf Delfante, Kapitän Trab, der Hauptmann von Wesel u. a. Alle diese übermütigen oder verschämten Maskeraden sind in der vorliegenden Übertragung teilweise unterdrückt, teilweise ein wenig aufgehellt worden. Sie wirken auf einen Leser, der nicht gerade ein genauer Kenner von Beyles Leben ist, nur störend, und selbst der französische Text.De l’ Amour. Avec une étude sur Stendhal par Paul Limayrac. Paris, Eugène Didier, 1853. – 2.De l’Amour par Stendhal (Henri Beyle). Seule édition complète, augmentée de préfaces et de fregments entièrement inédits.Paris, Michel Lévy frères, 1853. Mehrere Auflagen nach den alten Platten. Später: Paris, Calmann-Lévy (Preis 3 Frcs., später auf schlechterem Papier: Preis 1 Frc.). – 3. Physiologie de l’Amour par de Stendhal. Illustrée (25 Vignettes) par Bertall. Paris, Barba (1854). – 4. Stendhal. Physiologie de l’Amour. Paris, E. Dentu, 1886. (Preis 1 Fr.) – Im Buchhandel ist zurzeit nur noch die Einfrankausgabe von Calmann-Lévy zu haben.– zumal in der lieblosen Verfassung, in der die Firma Calmann-Lévy in Paris die Oeuvres complètes de Stendhal immer noch zu bieten wagt – bedarf zweifellos kundiger Erläuterungen. Ein solcher Kommentar möchte die vorliegende deutsche Ausgabe über ihre eigentliche Aufgabe hinaus sein. Es ist in ihr überall angestrebt worden, die sibyllinische Sprache des Originals indem von Stendhal gewollten Sinne klar wiederzugeben. Die Übertragung selbst schließt sich an den Text der französischen Erstausgabe an. Von den Anhängen, die erst 1853 aus Beyles Nachlaß in die neueren französischen Ausgaben aufgenommen worden sind, ist Ernestine ou le naissance de l’amour als entbehrlich weggelassen worden. Neu hinzugekommen ist aus Beyles Nachlasse ein Romanfragment, das, weniger literarisch als vielmehr psychologisch interessant, Beyles Beziehungen zu Mathilde beleuchtet. Die zahlreichen Fußnoten des Originals sind hinter den Text gesetzt worden, einige Literatur-Verweise, die an ihrer eigentlichen Stelle mit dem Text nur in ganz loser Verbindung stehen, sind in der Anmerkung 86 übersichtlicher vereinigt worden.
Schließlich hat Stendhal über sein Buch eine Flut von Daten und Ortsangaben ausgeschüttet. Bald heißt es am Kopf eines Kapitels: »In einem kleinen Hafen, dessen Namen ich nicht kenne, bei Perpignan, am 25. Februar 1822,« ein andermal mitten im Text: »München, 1820,« dann wiederum: »Cassel, 1808, – Dresden, 1818, – Auf einem Hoffeste in den Tuilerien, 1811, – Auf dem Gardasee, 1811, – in Giat, 1812, – in Orscha, 13. August 1812, – Wilna, 1812, – Königsberg, 1812, – Loreto, am 11. September 1811, – Berlin, 1807, – Bologna, am 18. April, 2 Uhr morgens, – Modena, 1820, – Znaim, 1816, – London, den 20. November 1821, – Träumereien auf den Borromeïschen Inseln, – Posen, 1807, – Neapel, 1821, – Venedig, 1810,« usw. usw. Wenn man alle diese Angaben nachprüft, findet man, daß sie mit Beyles tatsächlichem Leben häufig in Widerspruch stehen. Wohl hat er alle die angeführten Orte ein oder viele Male in seinem Leben besucht, zumeist aber nicht an den willkürlich angegebenen Daten. So war er, um nur zwei Beispiele herauszugreifen, in Dresden nicht im Jahre 1818, sondern mehrere Wochen des Jahres 1813, ferner in Orscha sicherlich nicht am 13. August 1812, sondern erst auf dem Rückmarsch von Moskau im November desselben Jahres (vgl. Bd. V dieser Ausgabe, S. 136). Es macht den Anschein, als habe Stendhal mit solchen Angaben dokumentieren wollen, daß sein – anonymes – Buch nicht die Arbeit irgend eines theoretisierenden Stubenhockers in Paris oder gar irgend einem Winkel der Provinz sei, sondern Stücke aus dem lebensfrischen Tagebuche eines weltmännischen Europäers. Heute, wo seinen Lesern sein vielbewegtes Wanderleben wohlbekannt ist, bedarf es natürlich jenes Mittels nicht mehr. Somit muß man über diese überflüssig gewordenen Zutaten hinwegsehen, ohne ihm wie einer seiner neueren französischen Biographen pedantische Vorwürfe zu machen.
Am 2. September 1806 Arthur Schurig
Erstes Buch
Inhaltsverzeichnis
1. Von den Arten der Liebe
Inhaltsverzeichnis
Ich suche mir klar zu werden über jene Leidenschaft, die stets, wenn sie sich aufrichtig äußert, das Kennzeichen der Schönheit trägt. Es gibt vier Arten der Liebe.
Erstens:die Liebe ausLeidenschaft; es ist die der Portugiesischen Nonne, die der Heloise zu Abälard.
Zweitens:Die Liebe ausGalanterie, die in Paris um 1760 herrschte, wie wir sie in den Memoiren und Romanen dieser Zeit finden, bei Crebillon, Lauzun, Duclos, Marmontel, Chamfort, Frau von Epinay und anderen.
Sie ist wie ein Gemälde, auf dem alles bis in die Schatten hinein rosenfarbig sein soll, in das unter keinem Vorwande etwas Häßliches geraten darf, um nicht gegen die Sitte, den guten Ton und das Zartgefühl zu verstoßen. Ein Mann von guter Herkunft weiß im voraus genau, wie er sich in den verschiedenen Phasen dieser Liebe zu Verhalten hat und was ihm in jeder einzelnen bevorsteht. Da es hierbei keine Leidenschaft und nichts Unerwartetes gibt, hat sie oft mehr Zartgefühl als die wahre Liebe; das Hirn behält immer die Herrschaft. Sie ist wie eine hübsche, aber kalte Miniatur gegenüber einem Bilde der Carracci; und während uns die Liebe aus Leidenschaft alle äußeren Vorteile vergessen läßt, weiß die Liebe aus Galanterie sich ihnen stets anzupassen. Nimmt man dieser armseligen Liebe den äußeren Schein, so bleibt wahrlich recht wenig übrig; der Illusion beraubt, gleicht sie einem Kranken, der sich nur mühsam weiterschleppt.
Drittens: die Liebe ausSinnlichkeit.
Auf der Jagd einem hübschen drallen Bauernmädchen nachlaufen, das in den Wald flüchtet. Jedermann kennt solche Liebesfreuden. Ein Charakter mag noch so hart und unglücklich sein, auf diese Weise fängt man mit sechzehn Jahren an.
Viertens: die Liebe ausEitelkeit.
Bei weitem die meisten Männer, besonders in Frankreich, begehren und besitzen schicke Frauen, wie man sich ein schönes Pferd hält, aber wie jeden beliebigen andern zum Luxus eines jungen Mannes gehörigen Gegenstand. Die mehr oder weniger geschmeichelte oder gereizte Eitelkeit ist die Ursache solcher Neigung. Manchmal mischt sich auch sinnliche Liebe hinein, aber nicht immer, oft fehlt sogar der körperliche Genuß. »Eine Herzogin ist in den Augen eines Bürgerlichen nie älter als dreißig Jahre,« sagte die Herzogin von Chaulnes. Und die Hofgesellschaft des trefflichen Königs Ludwig von Holland erinnert sich noch mit Vergnügen einer hübschen Dame im Haag, die nicht umhin konnte, jeden Herzog oder Prinzen liebenswert zu erachten. Sowie aber ein Prinz am Hofe erschien, fiel streng nach monarchischem Grundsatz der Herzog in Ungnade. Sie war gleichsam der Orden des diplomatischen Korps.
Im glücklichsten Falle gewinnt bei solchen oberflächlichen Beziehungen das sinnliche Vergnügen durch die Gewohnheit an Wert. Die Erinnerung umgibt es mit einem schwachen Abglanz von wahrer Liebe.
Einsam, grollen wir aus Eitelkeit und sind voller Trauer. Romanhafte Gedanken benehmen uns den Kopf, und wir kommen uns verliebt und melancholisch vor; denn die Eitelkeit redet sich gern eine große Leidenschaft ein. In der Tat werden die Freuden der Liebe, gleichgültig welcher Art von Liebe sie entsprungen sind, durch das Hinzukommen einer seelischen Erregung lebhafter und bleiben länger in der Erinnerung. Dabei übertrifft, im Gegensatz zu den meisten anderen Leidenschaften, die Erinnerung an das Verlorene scheinbar alles, was wir von der Zukunft zu erwarten haben.
In der Liebe aus Eitelkeit erzeugt mitunter der längere Umgang oder die Hoffnungslosigkeit, die ideale Liebe zu finden, eine gewisse, in ihrer Art freilich verächtliche Freundschaft. Sie prahlt mit Beständigkeit,
Die Sinnlichkeit ist etwas Natürliches; jeder kennt sie, aber in den Augen zärtlicher und leidenschaftlicher Naturen hat sie nur einen untergeordneten Rang. Wenn solche Menschen in der Gesellschaft oft lächerlich erscheinen, wenn die Lebewelt sie durch ihre Intrigen unglücklich macht, so erfahren sie als Ersatz dafür Freuden, die denen nie zuteil werden, deren Herzen nur für die eitle Ehre oder für das Geld schlagen.
Viele tugendhafte und feinfühlige Frauen kennen die Sinnlichkeit so gut wie gar nicht. Sie setzen sich ihr selten aus, wenn ich so sagen darf, und selbst wenn sie es tun, erstickt die körperliche Lust geradezu in der Glut der Leidenschaft.
Es gibt Menschen, die Opfer und Werkzeuge eines teuflischen Hochmutes sind, eines Hochmutes, wie ihn Alfieri besaß. Solche Menschen, die vielleicht grausam sind, weil sie wie Nero fortwährend in Angst schweben und alle Menschen nur nach sich selbst beurteilen, finden an der Sinnlichkeit nur so lange Vergnügen, als ihr Hochmut dabei voll befriedigt wird, das heißt, solange sie beim Genusse Grausamkeiten verüben können. So sind die Scheußlichkeiten in Sades »Justine« zu erklären. Nirgends finden jene Menschen das Gefühl der Sicherheit.
Schließlich könnte man, anstatt vier verschiedene Arten von Liebe zu unterscheiden, sehr gut eine Menge weiterer Abarten aufstellen. Unter uns Menschen gibt es gewiß ebensoviel Möglichkeiten, etwas zu fühlen, wie etwas zu sehen. Aber Unterschiede in der Benennung ändern nichts an den folgenden Betrachtungen.
Alle Liebe auf Erden findet ihre Entstehung, ihre Dauer und ihr Ende oder die Unsterblichkeit unter denselben Gesetzen.
2. Die Entstehung der Liebe
Inhaltsverzeichnis
Die Liebe entsteht, indem ein Weib in uns
1. Bewunderung erregt,
2. Gedanken, wie: welche Lust, es zu küssen und von ihm geküßt zu werden,
3. Hoffnung.
Wir suchen nach Vorzügen. In dieser Zeit sollte sich ein Weib hingeben; dann wäre der sinnliche Genuß der denkbar höchste. Selbst bei sehr spröden Frauen glühen im Augenblicke der Erwartung die Augen. Ihre Leidenschaft ist so mächtig und ihre Sinnlichkeit so erregt, daß sie sich an auffälligen Zeichen verraten.
4. Die Liebe ist entstanden.
Liebe ist die Freude, ein liebenswertes und liebendes Wesen mit allen Sinnen und in nächster Nähe zu sehen, zu berühren und zu fühlen.
5. Es beginnt die erste Kristallbildung.
Wir haben Gefallen daran, eine Frau, deren Liebe wir sicher sind, mit tausend Vorzügen auszuschmücken und uns unser Glück selbstgefällig bis in alle Einzelheiten auszumalen. Mit anderen Worten, wir überschätzen ein kostbares Geschenk, das uns der Himmel gerade in den Schoß geworfen hat und das uns ganz fremd ist, und betrachten es als unser sicheres Eigentum.
Beobachten wir einmal, was innerhalb von vierundzwanzig Stunden im Kopf und Herzen eines Liebenden vorgeht.
Wenn wir in den Salzbergwerken bei Salzburg in die Tiefe eines verlassenen Schachtes einen entblätterten Zweig werfen und ihn nach einigen Monaten wieder hervorziehen, so ist er über und über mit glitzernden Kristallen bedeckt. Selbst die kleinsten Ästchen, die kaum größer sind als die Krallen einer Meise, sind mit unzähligen hellfunkelnden Diamanten besät, so daß man den kahlen Zweig nicht wiedererkennt.
In diesem Sinne nenne ich Kristallbildung die schöpferische Tätigkeit unseres Geistes, der bei jeder neuen Betrachtung der Geliebten immer neue Vorzüge an ihr entdeckt.
Zum Beispiel erzählt ein Vielgereister von der Frische der Orangenhaine am Golf von Genua während der Glut des Sommers: welche Wonne, denken wir, diese Kühle mit der Geliebten zu genießen!
Oder einer unserer Freunde bricht auf der Jagd einen Arm: welche Seligkeit, sich der Pflege einer geliebten Frau zu überlassen. Immer mit ihr zusammen zu sein, ungehindert ihre Liebe vor Augen zu haben, das muß doch beinahe dazu verleiten, den Schmerz zu segnen. Und man kommt vom Krankenlager des Freundes zurück, ohne mehr an der engelhaften Güte der Geliebten zu zweifeln. Mit einem Worte, der bloße Gedanke an eine Vollkommenheit genügt, sie an dem geliebten Wesen alsbald zu erblicken.
Diese wundersame Erscheinung, die ich also Kristallbildung nennen will, hat ihre Begründung in der Natur, die uns ebenso die Sehnsucht nach Genuß eingibt, wie sie das Blut durch unsere Adern kreisen läßt, in dem Gefühl, daß sich der Genuß mit der Vollkommenheit der Geliebten steigert, und in dem Gedanken: »Sie ist mein.« Ein Wilder hat keine Zeit, zu dieser Verfeinerung zu kommen. Er genießt, aber seine Gedanken folgen bereits dem Damhirsche, der in den Wald flieht und mit dessen Fleisch er wieder neue Kräfte gewinnen muß, um nicht unter der Axt seines Feindes zu fallen.
Das andere Extrem der Kultur bildet ohne Zweifel die feinfühlige Frau, die sinnlichen Genuß nur bei dem Manne zu empfinden vermag, den sie liebt. Sie ist der volle Gegensatz zum Wilden. Bei den zivilisierten Völkern hat die Frau wenig Beschäftigung; dagegen ist der Wilde durch sein Tagewerk so in Anspruch genommen, daß er sein Weib wie ein Haustier behandelt. Auch unter den Tieren sind die Weibchen meistens um so glücklicher, je müheloser die Männchen ihren Lebensunterhalt aufbringen.
Aber verlassen wir den Urwald, um nach Paris zurückzukehren. Ein leidenschaftlicher Mensch sieht der Geliebten alle Vollkommenheiten an. Und doch ist er noch nicht mit ganzer Seele der ihre, denn der Mensch übersättigt sich leicht an allem Eintönigen, selbst am vollkommenen Glück. (Damit soll gesagt sein, ein und dieselbe Nuance des Seins hat immer nur einen Augenblick vollendeten Glückes; doch die Art und Weise zu sein, wechselt bei einem leidenschaftlichen Menschen zehnmal am Tage.) Um ihn ganz zu fesseln, kommt noch etwas anderes hinzu.
6. Es entstehen Zweifel.
Nach zehn-oder zwölfmaligem Sichsehen oder nach einer langen Reihe anderer Erlebnisse, die nur einen Augenblick ober viele Tage ausfüllen können, und die erst die Hoffnung erweckt und dann groß gezogen haben, überwindet der Liebende seine anfängliche Unruhe und vertraut seinem Glücke fester. Vielleicht schwebt ihm auch irgend ein Lehrsatz vor, der aber nur auf den Durchschnitt der Fälle anwendbar ist, wenn es gilt, leichtfertige Weiber zu erobern. Kurz, er verlangt ein greifbareres Unterpfand der Liebe und will sein Glück zum Siege führen.
Fühlt er sich zu siegesgewiß, so wird auf der anderen Seite mit Gleichgültigkeit, Kälte oder gar Entrüstung abgewehrt. Französinnen haben noch eine gewisse ironische Art, die zu sagen scheint: »Du bildest dir ein, weiter zu sein, als du bist!« So benimmt sich eine Frau, wenn Liebesrausch und Scham in ihr kämpfen und sie fürchtet, die letztere verletzt zu haben, oder einfach aus Vorsicht oder aus Gefallsucht.
Der Liebende beginnt dadurch an dem erhofften Erfolge zu zweifeln. Bitter ergeht er sich über die Gründe seiner Hoffnung, die er klar vor sich zu sehen vermeinte.
Er will sich wieder den anderen Zerstreuungen des Lebens in die Arme werfen, aber er findet sie schal. Das Bewußtsein, namenlos unglücklich zu sein, erfaßt ihn und damit eine tiefe Nachdenklichkeit.
7. Es beginnt die zweite Kristallbildung. Wie Diamanten bilden sich die Bestätigungen des Gedankens: »Sie liebt mich.«
In jeder Viertelstunde der Nacht, die dem ersten Zweifel folgt, und nach Augenblicken des tiefsten Unglücks redet sich der Verliebte ein: »Sie liebt mich doch,« und die Kristallbildung fördert immer neue Reize zutage, bis mit einem Male neuer Zweifel den Liebenden mit teuflischen Augen anstarrt und ihn wieder ganz niederdrückt. Seine Brust atmet kaum mehr; er fragt sich: »Liebt sie mich auch wirklich?« In diesem bald freudevollen, bald qualvollen Entweder-Oder fühlt der Verliebte lebhaft: »Sie würde mir Freuden gewähren, wie sie mir kein anderes Weib auf Erden geben kann.«
Gerade die Handgreiflichkeit dieser Wahrheit, wo wir gleichsam am äußersten Rande eines grausigen Abgrundes schreiten und mit einer Hand schon das seligste Glück erfassen, verleiht der zweiten Kristallbildung im Vergleiche zur ersten einen viel tieferen Gehalt.
Der Liebende schwankt beständig zwischen drei Gedanken hin und her:
1. Sie hat alle erdenklichen Vorzüge,