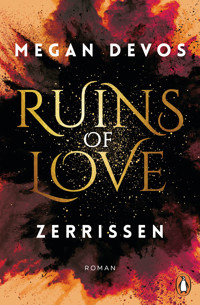9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Grace & Hayden
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Spicy Romantasy: Der Beginn der süchtig machenden Lovestory von Grace und Hayden!
Sie ist clever und schön – und bereit, ihn zu töten
Seit die Welt, in der er aufgewachsen ist, in Schutt und Asche liegt, kämpft Hayden wie der Rest der Menschheit ums Überleben – doch als Anführer des Blackwings-Camps trägt er mehr Verantwortung als jeder andere. Eines Nachts geht er auf einen Beutezug in das verfeindete Greystone-Lager und blickt plötzlich in den Lauf einer Pistole und die blitzend grünen Augen einer jungen Frau namens Grace. Hayden kann es nicht glauben, als sie ihn verschont – aber noch mehr stört es ihn, nun in ihrer Schuld zu stehen. Als er Grace, verletzt und verlassen, beim nächsten Mal begegnet, muss er ihr einfach helfen – und nimmt sie als Gefangene mit. Obwohl es für Hayden nichts Wichtigeres als die Sicherheit der Blackwing-Bewohner gibt, holt er sich mit Grace den Feind in sein Zuhause. Doch sein inneres Bedürfnis, Grace mit allen Mitteln zu beschützen, ist mächtiger als jeder Zweifel ...
Dramatisch und prickelnd – lies auch die weiteren Bände der Reihe und lass dich gefangen nehmen von einer schicksalhaften Liebe:
1. »Ruins of Love – Gefangen«
2. »Ruins of Love – Gespalten«
3. »Ruins of Love – Zerrissen«
4. »Ruins of Love – Vereint«
Du bist hier genau richtig, wenn du auf diese Tropes stehst:
• Enemies to Lovers
• Forced Proximity
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Ähnliche
Zum Verlieben und Verschlingen: Die süchtig machende Lovestory von Grace und Hayden in vier mitreißenden Bänden!
Sie ist clever und schön – und bereit, ihn zu töten
Seit die Welt, in der er aufgewachsen ist, in Schutt und Asche liegt, kämpft der 21-jährige Hayden wie der Rest der Menschheit ums Überleben – doch als Anführer des Blackwings-Camps trägt er mehr Verantwortung als jeder andere. Eines Nachts geht er auf einen Beutezug in das verfeindete Greystone-Lager und blickt plötzlich in den Lauf einer Pistole und die blitzend grünen Augen einer jungen Frau namens Grace. Hayden kann es nicht glauben, als sie ihn verschont – aber noch mehr stört es ihn, nun in ihrer Schuld zu stehen. Als er Grace, verletzt und verlassen, beim nächsten Mal begegnet, muss er ihr einfach helfen – und nimmt sie als Gefangene mit. Obwohl es für Hayden nichts Wichtigeres als die Sicherheit der Blackwing-Bewohner gibt, holt er sich mit Grace den Feind in sein Zuhause. Doch sein inneres Bedürfnis, Grace mit allen Mitteln zu beschützen, ist mächtiger als jeder Zweifel …
Dramatisch und prickelnd – lies auch die weiteren Bände der Reihe und lass dich gefangen nehmen von einer schicksalhaften Liebe:
1. Ruins of Love – Gefangen
2. Ruins of Love – Gespalten
3. Ruins of Love – Zerrissen
4. Ruins of Love – Vereint
MEGANDEVOS arbeitet als Operationsschwester und lebt in South Dakota. Das Schreiben ist schon immer ihre größte Leidenschaft. Ihre vierbändige Serie Ruins of Love ist eine Wattpad-Sensation: Weltweit sind Millionen von Lesern süchtig nach der dramatisch-prickelnden Liebesgeschichte von Grace und Hayden.
Megan DeVos
RuinsofLove
Gefangen
Aus dem Englischen von Nicole Hölsken
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel Anarchy bei Orion Books, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2018 der Originalausgabe by Megan DeVos
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe by Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion/Lektorat: Christiane Sipeer
Covermotiv und -gestaltung: www.buerosued.de
Satz: MR
ISBN 978-3-641-26385-0V002
www.penguin-verlag.de
Für meine Leserinnen und Leser, die von Anfang an an meiner Seite waren. Ohne euch wäre dieses Buch nicht möglich gewesen.
Kapitel 1
Raubzug
Hayden
Ich ließ die Schultern kreisen, verlagerte den dicken Gurt des Sturmfeuergewehrs, der mir beim Gehen ins Fleisch schnitt. Durch mein dünnes T-Shirt hindurch fühlte sich das Metall des Gewehrs sengend heiß auf der Haut an, denn es war noch vor kurzem benutzt worden. Niemand schenkte der Waffe über meiner Schulter besondere Beachtung, als ich vorbeiging; an den Anblick waren sie gewöhnt.
Ich konnte das laute Knirschen meiner Stiefel auf dem Boden hören, während ich den staubigen Weg zur Kommandozentrale zurücklegte. Eine leichte Brise fuhr durch mein Haar, das ich mit einem Bandana zurückgebunden hatte, damit es mir nicht ins Gesicht fiel. Es war mittlerweile zu lang, aber ich hatte im Augenblick einfach nicht den Kopf frei, um mich darum zu kümmern. Ein Haarschnitt war momentan die geringste meiner Sorgen.
Gesichter zuckten vorüber, während ich schnell und zielstrebig voranschritt. Es war bereits dämmrig, und ich wollte den Raubzug ins Rollen bringen, bevor die Dunkelheit uns alle einhüllte. Ich scannte die Menge auf der Suche nach ganz bestimmten Gesichtern, aber sie waren nicht zu entdecken. Der Pfad war zu beiden Seiten von provisorischen Hütten gesäumt. Das Material dafür hatten wir bei unseren Plünderungsaktionen in der Stadt gefunden. Holzbalken, Metall und Glas waren zu überraschend stabilen Bauten zusammengefügt worden, die den Menschen als Behausung dienten. Die Bäume ragten hoch empor, verbargen unser Waldlager vor neugierigen, unliebsamen Blicken.
Zwar ignorierten alle die Waffe, die über meinem Arm lag, trotzdem warfen mir Menschen aller Altersgruppen ehrfürchtige Blicke zu, als ich vorbeiging. Ich war noch relativ jung, weshalb mein Aufstieg an die Spitze umso beeindruckender war. Mit nur einundzwanzig Jahren trug ich die Verantwortung für diese Menschen. All diese Leute, angefangen von kleinen Kindern bis hin zu jenen, die so alt waren, dass sie kaum mehr laufen konnten. Sie standen unter meiner Obhut, unter meiner Aufsicht. Ich war für ihren Schutz verantwortlich, dafür, dass sie am Leben blieben.
Das Gewicht dieser Verantwortung war mir durchaus bewusst, und schnell beherrschte es auch jetzt wieder meine Gedanken, als ich den Kopf einzog, um die Kommandozentrale zu betreten. Dieses Gebäude war am stabilsten, komplett aus Metall mit richtigen Schlössern an den Türen – im Gegensatz zu den simplen Holzriegeln, die wir in den Hütten der Menschen angebracht hatten. Stets waren mindestens zwei Wachleute zugegen, um unsere Vorräte zu beaufsichtigen. Als Lagerplatz für unsere Waffen und unsere Munition war dies einer der wichtigsten Orte in der gesamten Siedlung.
Ich nickte den beiden diensthabenden Wachen zu: einem Mann mittleren Alters, dessen Gesicht ich kannte, an dessen Namen ich mich allerdings nicht erinnern konnte, und einem Jungen von zehn Jahren, den ich sehr gut kannte. Ich seufzte, wünschte, jemand anders hätte jetzt Dienst, denn ich wusste, was mit Sicherheit folgen würde.
»Hi Hayden!«, rief er fröhlich, sprang sofort auf die Füße und stürmte zu mir hin. Ich sah auf ihn herab, bevor ich auf einen der Waffenkoffer zuging, die im Gebäude aufbewahrt wurden. Ich schob den Gurt über meinen Kopf und legte die Waffe ab, um sie wieder an Ort und Stelle zu verstauen. Er sah so schludrig aus wie immer, mit einer wilden Haarmähne, die ihm in die Augen fiel, und Klamotten, die ihm viel zu groß waren. Er ertrank beinahe in seinem T-Shirt, und seine Jeans schleifte bei jedem Schritt über den Boden.
»Jett, du musst weiter deine Pflicht erfüllen«, erinnerte ich ihn und zog eine Augenbraue hoch. Ein besorgter Ausdruck zuckte über sein Gesicht, dann verkniff er sich das Lächeln und setzte eine pseudo-ernsthafte Miene auf.
»Ja, Sir. Ich weiß …«
»Nenn mich nicht ›Sir‹«, knurrte ich sogleich. Mittlerweile taten das einige hier, besonders die Kinder, und es war mir verhasst.
»Okay, sorry, Si…, äh, Hayden.« Beinahe hätte er den gleichen Fehler noch einmal gemacht. Ich ignorierte ihn und holte eine 9mm Handfeuerwaffe heraus. Nachdem ich den Verschlusshebel geöffnet hatte, entdeckte ich, dass sie halb leer war.
»Also, äh, ich habe mich gefragt …«
»Nein«, sagte ich rundheraus, denn ich wusste, was er fragen wollte. Ich holte ein paar Patronen aus der Schachtel, um die Waffe zu laden.
»Aber warum denn nicht?«, quengelte er. »Ich bin jetzt alt genug! Nimm mich mit!«
»Du bist noch nicht alt genug. Noch ein Jahr«, antwortete ich sanft. Er nervte zwar durch seinen Übereifer, aber andererseits bewunderte ich seine entschlossene Beharrlichkeit. Er versuchte mich schon seit Jahren zu beschwatzen, ihn mit auf einen unserer Raubzüge zu nehmen, aber ich erteilte ihm jedes Mal wieder eine Abfuhr.
»Das hast du schon letztes Jahr gesagt«, erwiderte er verdrossen.
Er hatte Recht, aber das würde ich wohl kaum zugeben. Ich hatte vor einem Jahr geglaubt, dass er vielleicht jetzt bereit sein würde, aber er war nach wie vor weit davon entfernt. Er war noch immer ein Kind, zu jung, um die akute Gefahr zu erkennen, die mit Raubzügen einherging, und zu wenig ausgebildet, um sich selbst verteidigen zu können. Er würde nur jeden, einschließlich sich selbst, in Gefahr bringen.
»Nächstes Jahr«, wiederholte ich. Ich rammte den Verschlusshebel wieder in die Waffe und schob sie mir dann in den Bund meiner Jeans. Das Metall fühlte sich kühl an meiner Haut an, wo es den Rücken berührte, gab mir aber trotzdem einen seltsamen Adrenalinstoß. So langsam wurde es Zeit.
»Okay, dann wollen wir mal loslegen«, sagte plötzlich eine Stimme. Sie dröhnte förmlich durch den relativ kleinen Raum. Ich wandte den Blick von Jetts enttäuschtem Gesicht ab und sah Dax und Kit eintreten. Wie immer schien Dax begeistert zu sein, wenn ein Raubzug bevorstand, während Kits Miene steinern und ernst war. Beide Männer waren ungefähr in meinem Alter und absolut gegensätzlich. Aber ich hätte es mir nicht im Traum einfallen lassen, einen Überfall ohne sie zu riskieren.
»Hayden.« Kit nickte mir zum Gruß zu, bevor er sich einer anderen Kiste auf der gegenüberliegenden Seite des Zimmers zuwandte, um sich seine Ausrüstung zu holen. Dax schritt zu Jett und mir an der anderen Kiste hinüber und nahm sich ebenfalls eine Waffe.
»Jett, wie sieht’s aus? Kommst jetzt endlich mal mit, oder was?«, fragte er leichthin und grinste auf den Jungen herab. Ich runzelte die Stirn, verärgert, dass Dax ihn auch noch ermutigte.
»Hayden lässt mich nicht. Er sagt, ich bin immer noch zu jung«, grummelte der Junge und warf mir aus den Augenwinkeln wütende Blicke zu, während ich ein Springmesser in meine Tasche gleiten ließ.
»Nein, ich lasse dich nicht«, pflichtete ich ihm bei und drehte den beiden den Rücken zu, um mich weiter auszurüsten. Ich schnappte mir einen kleinen Rucksack, in den ich Verbandszeug und eine Flasche Wasser stopfte.
»Ach, keine Sorge, deine Zeit wird schon noch kommen, kleiner Mann«, meinte Dax und klopfte ihm auf die Schulter – ein wenig härter, als er wahrscheinlich beabsichtigt hatte. Jetts Körper zuckte unter dem Schlag ein paar Zentimeter zur Seite, was nur Beweis genug dafür war, wie ungeeignet er für einen solchen Raubzug tatsächlich war.
»Aber ich will jetzt mitgehen«, murmelte er, sah zu Boden und vergrub die Schuhspitze im Staub, der den Holzboden bedeckte.
Dax zerzauste ihm mit gutmütigem Glucksen das Haar, dann nahm auch er sich noch einen Materialrucksack. Statt Verbandszeug verstaute er jedoch Kabel, Batterien und andere elektrische Utensilien darin, bevor er ihn aufsetzte. Dax war unser Technikexperte und bekam beinahe alles wieder ans Laufen, egal, wie marode oder kaputt es war. Er war ein Drittel unseres Kernteams, bestehend aus ihm, Kit und mir.
Kit wiederum war vornehmlich auf Beobachtungsposten und kümmerte sich, wenn nötig, um unsere Waffen. Er war derjenige, der in den meisten Fällen die Gewehre abfeuerte, die wir dabeihatten, oder der das trügerisch große Messer benutzte, das er in der Gesäßtasche mit sich trug. Unsere Feinde taten gut daran, sich nicht mit ihm anzulegen, wenn sie einen unserer Raubzüge unbeschadet oder auch nur lebendig überstehen wollten. Kit war aus einem bestimmten Grund so, und er hatte mehr als nur ein paar Menschen auf dem Gewissen, um diese Befürchtung zu rechtfertigen.
Meine Rolle im Trio richtete sich danach, worauf wir es bei unseren Plünderungsaktionen gerade abgesehen hatten. Ich deckte sämtliche Gebiete ab – Technik, Kommunikation, Kampf, Beobachtung, Auskundschaften, einfach alles. Das war einer der Gründe, warum ich so weit aufgestiegen war, obwohl ich das damals eigentlich gar nicht vorgehabt hatte. Eigentlich hatte ich immer nur am Leben bleiben und keinesfalls ein ganzes Lager leiten wollen. Ich hatte nie um diese Verantwortung gebeten, aber jetzt hatte ich sie nun mal, und ich widmete mich dieser Aufgabe mit ganzer Kraft.
Jett beobachtete uns aufmerksam, als wir uns um den mittleren Tisch versammelten, der durch eine von der Decke herabbaumelnde Glühbirne erhellt wurde. Es gab nur drei Gebäude in unserem Lager, die durch Generatoren betriebenen Strom besaßen: die Küche, die Krankenstation und das Kontrollzentrum. Die restlichen Bauten wurden durch Laternen und Kerzen erhellt. Die Glühbirne war die einzige Lichtquelle im Raum, weshalb unsere Schatten sich scharf an den Wänden abzeichneten. Nun, da wir unsere Waffen und unsere Ausrüstung beisammenhatten, gab es nur noch eins zu tun.
»Na gut, also dann«, begann ich. Ich fuhr mir mit dem Daumen über die Unterlippe, während ich darüber nachdachte, wie wir am besten vorgehen konnten. »Wir gehen nach Greystone, und wir brauchen Petroleum für die Laternen. Mehr nicht.«
»Was?«, protestierte Dax sofort. »Wir gehen ins verdammte Greystone und holen uns nichts als Petroleum? Was soll das alles dann?«
»Was das soll? Wir brauchen Petroleum. Mehr ist nicht nötig, und wir gehen kein Risiko ein«, sagte ich entschieden. Ich sah ihn grimmig an, verärgert, weil er Raubzüge grundsätzlich als großen Spaß und weniger als Gefahr betrachtete. Wenn er so weitermachte, würde er eines Tages unweigerlich verletzt werden. »Besonders nicht in Greystone.«
Dax runzelte die Stirn, enttäuscht, dass diese Mission keine von den größeren war. Aber er akzeptierte, dass ich das Sagen hatte. Nicht, dass er wirklich eine Wahl gehabt hätte – ich hatte immerhin die Verantwortung. Sowohl er als auch Kit waren meine engsten Freunde und Verbündeten. Es war also gar nicht so einfach, ihnen Befehle zu erteilen, ohne mir wie ein machthungriges Arschloch vorzukommen. Ich vertraute ihnen mein Leben an und sie mir das ihre.
In Zeiten wie den unsrigen war Vertrauen etwas ungeheuer Wichtiges. Man konnte nur der eigenen Gruppe vertrauen, sonst niemandem. Je nachdem, was wir plünderten, nahmen wir mehr oder weniger Leute mit. Da es sich hierbei um einen relativ kleinen Raubzug handelte, waren nur wir drei vonnöten. So war es mir am liebsten, denn größere Aktionen mit vielen Teilnehmern machten mich immer nervös. Je mehr Menschen man mitnimmt, umso größer ist das Risiko, erwischt und getötet zu werden.
»Können wir uns von dort nicht wenigstens noch ein bisschen Munition mitnehmen? Uns gehen langsam die Granaten aus«, wagte Dax einen letzten Vorstoß.
»Wir haben noch jede Menge Granaten«, sagte Kit von der anderen Tischseite, wie immer hatte er mit ernsthafter Miene dem Plan zugehört. »Und jetzt halt den Mund und nimm deine Befehle entgegen.«
»Ja, ja. Nun bleib mal locker, ja?«, antwortete Dax und schüttelte enttäuscht über unseren Mangel an Begeisterung den Kopf. Ich ignorierte ihn.
»Das wäre also geklärt. Weiß jeder noch, wo es ist?«
Beide Männer nickten.
»Linker Hand, und der Wachmann kommt alle zehn Minuten vorbei«, antwortete Kit. Ich nickte.
»Ganz genau. Dann also los, bevor es zu dunkel wird und man ohne Lampe nichts mehr sehen kann«, verkündete ich.
Jett war bis jetzt einigermaßen schweigsam geblieben und hatte nur ein entrüstetes Schnauben von sich gegeben, weil er ausgeschlossen war.
»Haltung bewahren, kleiner Mann«, sagte Kit und warf ihm ein seltenes Grinsen zu. Jedermann hatte Jett ins Herz geschlossen, sogar der stets so ernste Kit.
»Kleiner Mann«, murmelte Jett und verschränkte die Arme über der Brust, bevor er nochmals leise schnaubte. »Ich hasse es, wenn ihr mich so nennt.«
Dax lachte herzhaft. Er war schon wieder bester Laune, nachdem ich kurzerhand seine Idee, einen großangelegteren Überfall zu starten, niedergebügelt hatte. Einem Raubzug konnte er nun mal einfach nicht widerstehen, egal, wie einfach es werden würde.
»Gehen wir«, sagte ich mittlerweile ungeduldig. Mit Rucksäcken auf dem Rücken und gesicherten Waffen nahmen wir uns jeder eine Fackel, bevor wir uns von Jett und dem zweiten Wachmann verabschiedeten.
Draußen war es mittlerweile schon erheblich düsterer als bei meinem Hereinkommen, und ich wollte den Wald durchqueren, bevor es komplett dunkel war. Unter dem dichten Baldachin der Baumkronen war es schon jetzt stockfinster, und sich mit Fackeln durch die Bäume zu bewegen, war eine todsichere Methode, um die eigene Deckung aufzugeben.
Gemeinsam durchquerten wir das Camp, nickten anderen im Vorbeigehen zu, konzentrierten uns aber vornehmlich auf den bevorstehenden Raubzug. Wir schwiegen, als wir uns dem Rande der Hütten näherten, und wurden sogar noch stiller, nachdem wir zwischen den Bäumen verschwunden waren. Behände stiegen wir über die Äste und Zweige, die auf dem Boden verstreut lagen. Durch jahrelange Übung vermochten wir uns zwischen den Schatten beinahe lautlos zu bewegen.
Greystone war die nächstgelegene Siedlung zu unserem Lager und etwa eine Meile von uns entfernt. Während unser Lager in den Wäldern verborgen lag, befand sich Greystone etwa neunzig Meter vom Waldrand entfernt, also vollkommen ungeschützt. Normalerweise kommt einem die Vorstellung von einem Lager, das buchstäblich keinerlei Deckung hat, abwegig vor, aber in diesem Fall war die Lage Absicht und Strategie. Greystone war für uns wahrscheinlich gefährlicher als alle anderen Camps: Die Einwohner waren allesamt bis an die Zähne bewaffnet und hatten eine Vorliebe für den Kampf. Sie gehörten nicht zu den Leuten, mit denen man sich anlegen wollte, und schon gar nicht zu denen, die man in dunkler Nacht bestehlen wollte. Durch den fehlenden Baumbewuchs um ihr Lager aus Steinbauten hatten wir buchstäblich keinerlei Deckung, was es den diensthabenden Wachleuten erleichterte, Eindringlinge sofort zu entdecken.
Andere Camps wie Whetland oder Crimson waren erheblich schlechter geschützt und leichter zu plündern, aber sie lagen auch viel weiter entfernt. Für größere Raubzüge nahmen wir die Tour durch die Einöde der Stadt und zurück durchaus auf uns, aber bei kleineren Streifzügen wie diesem zogen wir es vor, uns nach Greystone einzuschleichen. Es gab auch noch andere Gruppen, die sich zusammengerottet hatten. Sie alle waren nur einander und niemandem sonst gegenüber loyal. Sie lebten allesamt in provisorischen Dörfern in einem Ring um die Stadt herum. Diese Siedlungen hatten sich vor vielen, vielen Jahren gebildet. So war es beinahe zeit meines Lebens gewesen.
Abgesehen von den organisierten Camps, gab es dann noch die, die in der Stadt geblieben waren – das waren die gefährlichsten und brutalsten, die einfach nur zum Spaß töteten. Sie wohnten in den zerstörten Überresten der Häuser, ernährten sich von dem, was sie arglosen Passanten stahlen, und nutzten alles Erdenkliche als Waffen, mit denen sie ihre Umwelt bedrohten. Diese Menschen schienen das Rad der Evolution etwas zurückgedreht zu haben. Um zu überleben, setzten sie ausschließlich auf ihre barbarischsten Instinkte und sonst nichts. Wir nannten sie Brutes, und sie waren ein weiterer Grund, warum wir lieber Greystone überfielen, als uns in die Stadt zu schleichen.
Die Menschheit war gespalten, und man traute nur denen aus dem eigenen Lager. So funktionierte es nun mal – man kämpfte für sein eigenes Camp, und das war’s. Wenn man etwas brauchte, stahl man es oder riskierte einen Plünderungszug durch die Stadt. Man stahl, man schlich sich heimlich an, man log, man kämpfte, alles nur, um zu überleben. Entweder das, oder man starb.
»Ich sehe es«, flüsterte Dax, verlangsamte seinen Schritt und deutete nach vorn. Das riss mich aus meinen Gedanken, und ich spähte mit zusammengekniffenen Augen in die Dunkelheit. Und in der Tat erkannte ich in der Richtung, in die Dax’ Finger deutete, die dunklen Umrisse von Steinhäusern. Dieses Camp war kreisförmig angeordnet. Die wichtigsten Gebäude und Ressourcen befanden sich in der Mitte. Genau wie bei uns waren ständig Wachen auf Patrouille, um Diebe wie uns fernzuhalten. Sie waren bewaffnet und jederzeit bereit abzufeuern. Schon mehr als einmal hatten wir Mitglieder unseres Lagers an die Leute von Greystone verloren.
Wir blieben am Waldrand und spähten über die neunzig Meter große, freie Fläche zwischen uns und der äußeren Grenze ihrer Siedlung. Leise zogen wir unsere Waffen aus den verschiedenen Haltern und brachten sie in Anschlag.
»Da«, flüsterte Kit. Sein Blick war unverwandt auf einen Schatten gerichtet, der sich zwischen den kleinen Gebäuden bewegte. Der Umriss eines Gewehrlaufs war deutlich zu erkennen. »In zehn Minuten ist er wieder hier.«
»Sollten wir nicht nochmal warten, um sicherzugehen?«, fragte Dax. Auch seine Augen folgten dem Schatten.
»Nein, es sind immer zehn Minuten. Jedes Mal«, antwortete Kit. Ich nickte schweigend, mehr zu mir selbst denn als Antwort. Kit hatte Recht. Bei jedem einzelnen Überfall, den ich mitgemacht hatte, kam einer ihrer Wachleute innerhalb von zehn Minuten wieder vorbei. Nie mehr, nie weniger, und ich war bei vielen Raubzügen dabei gewesen.
»Denkt dran, linke Seite«, flüsterte ich. Der Schatten war jetzt beinahe verschwunden. Das war unsere Gelegenheit. »Los!«
Ohne noch einen Augenblick zu zögern, sprinteten wir drei wie stumme Schatten von den Bäumen zum Lager. Unsere Füße glitten flüsterleise über den Grasfleck. Meine Muskeln genossen die Anstrengung. Ein guter Lauf gab ihnen nach dem langen, langsam zurückgelegten Weg das Gefühl, lebendig zu sein. Ich atmete tief und gleichmäßig, um das Tempo zu halten, und hörte, wie Dax und Kit es neben mir gleichtaten. Von der ständigen körperlichen Anstrengung waren wir in bester physischer Verfassung. Unaufhörlich scannte ich die Häuser auf der Suche nach einem weiteren Schatten, einem weiteren Wachmann oder vielleicht auch einfach nur nach einer Person, die gerade ihr Haus verließ, aber ich entdeckte niemanden.
Nach ein paar Sekunden erreichten wir das erste Gebäude und pressten uns stumm an eine Wand, Schulter an Schulter, so dicht wie möglich, um uns vor den Blicken zu verbergen. Unser Atem ging leise, obwohl wir gerade neunzig Meter im Sprint zurückgelegt hatten. Ich stellte die Ohren auf, horchte angestrengt nach Geräuschen, ob irgendjemand uns bemerkt hatte oder einen Warnruf abließ, aber es war nichts zu hören. Ich nickte den beiden zu, bevor ich vorsichtig um die Ecke lugte. Mein Herz pochte von dem Adrenalinschub, den nur ein Raubzug hervorrufen kann.
»Die Luft ist rein«, flüsterte ich, bevor ich mich um das Gebäude herumschlich. Sie folgten mir leise. Lautlosigkeit war uns mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen.
In Greystone war es sehr dunkel. Sie schienen die gleichen Probleme mit dem Strom zu haben wie wir. Hie und da flackerte eine Kerze, sodass immer noch genug Licht da war, um unser Ziel zu erkennen. Das Gebäude, auf das wir es abgesehen hatten, war relativ unscheinbar, und das Einzige, was es von den anderen langweiligen, grauen Bauten unterschied, war eine kleine, aufwendige Schnitzerei an der Tür, die ein Feuer darstellte – Feuer, das eben nur mit Petroleum brennen kann.
Ich scannte die Umgebung erneut, entdeckte aber immer noch nichts. Im Geiste hielt ich nach, wie die Minuten verrannen, jede Pause verschwendete mehr und mehr unserer kostbaren Zeit, um einzudringen, uns unsere Beute zu schnappen und wieder hinauszugelangen. Mit einem winzigen Wink meiner Hand signalisierte ich ihnen, mir zu folgen, bevor ich über den Pfad sprintete und vor der Tür landete. Ich hielt nur ein paar Sekunden inne, um das Ohr gegen die Tür zu pressen, lauschte, ob wider Erwarten jemand drinnen war. Aber es herrschte vollkommene Stille.
Ich drehte den Türknauf, um einzutreten. Kit und Dax folgten mir auf dem Fuße. Unsere Beute war überall im Raum verteilt, Stapel um Stapel, die an den Wänden aufgetürmt standen. Kaum waren wir eingetreten, nahmen wir uns mehrere Gallonen Petroleum, warfen einen in unsere Rucksäcke und trugen noch einen weiteren in der Hand, um die zweite für unsere Waffen frei zu haben.
»Hayden«, flüsterte Kit. »Alles klar, wir gehen als Erste raus, dann geben wir dir ein Zeichen.«
Ich nickte, winkte sie zur Tür hinaus und beobachtete, wie sie in der Dunkelheit verschwanden. Dann drehte ich mich noch einmal um, um zu schauen, ob es hier noch etwas anderes Nützliches gab. Sie waren erst ein paar Sekunden verschwunden, als ich es hörte. Ganz plötzlich erklang ein lautes Scheppern hinter mir, gefolgt von einem erstickten Keuchen.
Ich wirbelte herum, suchte nach dem Wachmann und erwartete ein Gewehr, das sich auf meinen Kopf richtete. Was ich aber sah, war noch schlimmer. Dort im Türrahmen, neben einem Stapel umgekippter Petroleumkanister stand Jett mit einem überraschten Ausdruck auf seinem Gesicht und der Hand über dem Mund.
»Jett!«, zischte ich. »Was zum Teufel hast du hier zu suchen?«
»Ich wollte bei dem Raubzug helfen!«, antwortete er, und sein Flüstern war viel zu laut. Mit seinem Feuereifer wirkte er viel zu glücklich über unsere augenblickliche Situation, besonders, nachdem er solch einen Radau gemacht hatte. Anscheinend war ihm der Ernst der Lage absolut nicht bewusst. Wahrscheinlich hatte er das gesamte Camp alarmiert, von dem die Hälfte in wenigen Minuten bei uns sein würde.
»Tut mir lei…«
Ich machte Pst!, um ihm das Wort abzuschneiden, die Augen vor Zorn weit aufgerissen. Was war er doch für ein Idiot, dass er uns hierher gefolgt war; jetzt würde er uns alle umbringen.
Mein Blick schoss zur Tür, und erleichtert stellte ich fest, dass nirgends eine Spur von Dax oder Kit zu sehen war. Wenigstens sie hatten es hinaus geschafft. Jett stand da, blies sich, so gut es ging, auf, versuchte mutig und furchtlos zu erscheinen. Seine kleinen Fäuste waren entschlossen geballt.
»Jett, wir müssen hier raus. Jetzt!« Ich schäumte vor Wut, preschte voran und zerrte ihn am Arm mit mir. Er grummelte leise, murmelte etwas von »wollte doch nur helfen«. Mein Griff war fest. Ich wartete an der Tür, hielt nach Wachen Ausschau. Aber wundersamerweise war die Luft rein.
»Komm schon«, flüsterte ich und zerrte ihn voran. Ich trat vor, zog uns aus dem Versteck der Dunkelheit in die schwache Beleuchtung der Straße.
»Stehen bleiben«, sagte eine Stimme direkt hinter mir. Mir sank das Herz. Ich hörte das deutliche Klicken von Metall auf Metall – das Geräusch einer Waffe, die entsichert wird. Ich schloss die Augen und zog eine Grimasse, als ich Jett vor mir herschob, ihn vor dem, was immer hinter mir war, abschirmte. Ich hörte, wie sein entsetztes Keuchen sich durch seine falsche Tapferkeit Bahn brach, die er so mühsam aufrechtzuerhalten versuchte. Sie wich der Angst, die er eigentlich die ganze Zeit schon hätte haben müssen, wäre er nicht so vernebelt gewesen.
»Umdrehen«, befahl die Stimme. Sie gehörte einem Mädchen, wie ich überrascht feststellte, obwohl sie durchaus gebieterisch klang. Langsam drehte ich mich um die eigene Achse, steckte meine Waffe dabei klammheimlich in meinen Hosenbund und konnte Jett dabei auch weiterhin hinter mir halten. Nachdem ich den Kanister Petroleum neben mich gestellt hatte, hob ich beide Hände neben meinem Kopf in die Luft. Ich machte mir mehr Sorgen darum, wie ich den verängstigten Jett hier rausbekommen sollte, als um mich selbst.
Mein Blick wanderte vom Boden ihren Körper hinauf und richtete sich auf die Waffe in ihrer Hand, mit der sie direkt auf meine Brust zielte. Dann sah ich ihr in die Augen. Sie waren tiefgrün, und ihr Gesicht war von blonden Haarsträhnen umrahmt, die sich aus ihrem unordentlichen Knoten gelöst hatten. Sie war zweifellos schön – und absolut bereit, mich zu töten.
Kapitel 2
Schwach
Grace
Ich hielt die Hände ruhig und streckte die Arme aus, um mit der Waffe auf seine Brust zu zielen. Er verzog keine Miene; falls er Furcht hatte, verbarg er sie vollkommen. Allerdings schien er mir sowieso nicht der ängstliche Typ zu sein. Mit hartem Blick sah er mich an, und einen Moment lang war ich verblüfft über das tiefe Grün seiner Augen, die er zu Schlitzen verengte.
Er hatte mich erst entdeckt, als er aus der Tür hinausgetreten war. Hastig hatte er sich überall umgesehen, allerdings nicht genau nach links, wo ich im Schatten verborgen stand. Auch der kleinere Schatten, der ihm zur Tür hinaus folgte, hatte mich nicht überrascht, denn immerhin hatten sie im Gebäude einen Heidenlärm verursacht. Ihre Gesichter hatte ich allerdings bislang nicht erkennen können. Das änderte sich erst, als er sich zu mir umdrehte. Beinahe wünschte ich mir, er hätte es nicht getan, denn ich konnte nicht umhin festzustellen, wie attraktiv er hinter meinem Gewehrlauf aussah. Er war etwa in meinem Alter, einundzwanzig oder so, und da er das zerzauste, dunkle Haar mit einem Bandana zurückhielt, war die markante Linie seines Kinns, das durchdringende Grün seiner Augen und die beinharte Entschlossenheit seiner Miene nicht zu übersehen.
Ein leises Wimmern ertönte hinter seinem Rücken und brach den Bann, mit dem er mich sekundenlang offenbar belegt hatte. Zum ersten Mal sah ich Sorge in seinen Augen unter den zusammengezogenen Augenbrauen aufflackern. Ich trat einen Schritt näher, entschlossen, ihm so energisch wie jedem anderen Plünderer entgegenzutreten, den ich auf frischer Tat ertappte.
»Wer steht da hinter dir?«, fragte ich in scharfem Ton und deutete mit einem Kopfnicken über seine Schulter hinweg.
»Nur ein Kind«, antwortete er. Seine Stimme war tief und rau. Er sprach leise, um nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Wahrscheinlich war ihm nicht entgangen, dass ich bislang noch keinen Alarm geschlagen hatte, obwohl ich wusste, dass die anderen schon auf dem Weg waren.
»Ich will ihn sehen.«
»Erst runter mit dem Gewehr«, sagte er entschieden. Er hielt die Hände immer noch in die Höhe, aber ich sah, wie die Muskeln unter seiner Haut spielten, sein Körper sich anspannte und er bereit war, sofort zu reagieren.
»Netter Versuch.«
Noch während ich das sagte, schob eine kleine Hand sein Hemd etwas beiseite. Dann spähte ein Kopf hinter seinem Rücken hervor. Weit aufgerissene braune Augen starrten mich an, offensichtlich zutiefst verängstigt. Der Junge stieß ein leises Fiepsen aus, als er merkte, dass ich ihn ansah, und versteckte sich dann wieder hinter dem Mann. Wieder sah ich ihm ins Gesicht, wobei ich das Gewehr weiterhin auf seine Brust richtete.
»Wo kommt ihr her?«, fragte ich. Er sah mich verächtlich an, verweigerte jede Antwort, und sein Kinn verkantete sich. Ich hatte allerdings auch keine Antwort erwartet. Das war eine der ersten Regeln bei Raubzügen: Wenn man erwischt wurde, schwieg man, und in den meisten Fällen starb man. Es hatte seinen Grund, warum kaum jemand es wagte, Greystone zu plündern, und das war gleichzeitig auch der Grund, warum er jetzt keine Informationen herausrückte. Wahrscheinlich war ihm klar, dass er hier nicht mehr herauskommen würde, und er wollte keine Vergeltungsmaßnahmen gegen den Rest seines eigenen Camps riskieren.
Das war allerdings nicht immer so. Oftmals lieferten die Gefangenen jede Menge Informationen, wenn auch nur die leiseste Chance für sie bestand, mit dem Leben davonzukommen. Wer immer er war, er war loyal und mutig.
»Warum bringst du ein Kind mit auf einen Raubzug?«, fragte ich. Meine Stimme klang eine Spur verärgert. Ich fand es ätzend, dass er mich in diese Lage gebracht hatte, denn eigentlich hätte ich beide auf der Stelle erschießen müssen. Der Gedanke, ein Kind zu töten, war mir aber zuwider. Er war so klein und verängstigt, dass ich es kaum vor mir selbst hätte rechtfertigen können, und wenn er tausendmal an diesem Raubzug beteiligt war.
»Hab ich nicht«, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Seine Nackenmuskeln arbeiteten, und er beobachtete mich aufmerksam. Sein Blick schoss zur Seite, zum ersten Mal, seit er ihn auf mich gerichtet hatte, sah er mir nicht mehr in die Augen, denn jemand rief meinen Namen.
»Grace!«, hörte ich eine Stimme. Ruckartig kehrte sein Blick zu mir zurück. Er zog die Augenbraue hoch, als wolle er mich fragen, ob ich damit gemeint war.
»Lass wenigstens den Kleinen laufen«, sagte er kurz angebunden. Er wirkte beinahe verärgert, dass ich ihn noch nicht erschossen hatte. Ich starrte ihn an, das Gewehr immer noch erhoben und bereit.
»Grace!«, wiederholte die Stimme, diesmal viel näher. Ich erkannte in ihr jetzt meinen älteren Bruder Jonah, der nicht nur unbarmherzig, sondern auch aufbrausend war und nicht zögern würde, beide niederzustrecken. Ein weiteres Wimmern erklang hinter dem Rücken des Mannes. Der Junge schien vor Schreck wie gelähmt zu sein. Das gab den Ausschlag. Noch bevor ich die Entscheidung bewusst getroffen hatte, senkte ich schon meine Waffe.
»Raus hier«, knurrte ich. Ich war sauer, weil ich sie laufen ließ, aber ich brachte es einfach nicht fertig, ein unschuldiges Kind zu erschießen. »Aber wenn ich euch nochmal hier erwische, seid ihr tot. Dann ist es mir egal, wen du dabeihast.«
Er nickte zackig, dann drehte er sich um. Seine Rückenmuskeln unter dem dünnen Shirt arbeiteten, als er sich vorbeugte, um dem Kind etwas zu sagen.
»Und jetzt laufen wir ganz schnell los, kleiner Mann.«
Er packte den Jungen am Arm, während ich schweigend dastand, verwirrt über seinen sanften Ton zu dem Kind, während er mich so verächtlich behandelt hatte. Sie sahen sich noch einmal um, dann setzten sie sich in Bewegung. Der Kleine rannte zum nächsten Haus, während der Mann sich überraschend nochmal zu mir umdrehte und mich ansah.
»Danke«, sagte er, wenn auch irgendwie widerwillig. Ich blinzelte vor Verblüffung, bevor ich mich zu einer grimmigen Miene zwang, entschlossen, trotz seines ungewöhnlichen Verhaltens hart zu bleiben.
»Geh!«, sagte ich nur, seinen Dank ignorierend. Er nickte noch einmal, dann wandte er sich um und sprintete davon. Sein T-Shirt bauschte sich hinten im Wind auf. Er war gerade um die Ecke gebogen, als mein Bruder aus der entgegengesetzten Richtung herannahte. Ich atmete tief ein, als er neben mir schlitternd zum Stehen kam.
»Was zum Teufel war das denn?«, bellte er, woraus ich schloss, dass er den Mann doch noch gesehen hatte, bevor dieser verschwunden war. Seine Brust hob und senkte sich vor Wut, und er funkelte mich an. Ich konnte den Blick nicht von dem Schatten abwenden, der den Fremden verschluckt hatte, obwohl ich spürte, wie mein Bruder mich fixierte.
»Ich hab ihn laufen lassen«, antwortete ich, als sei das nicht offensichtlich. Ich hatte keine Lust, nach diesem seltsamen Vorfall auch noch einen seiner Wutausbrüche über mich ergehen zu lassen.
»Du hast ihn laufen lassen«, wiederholte er fassungslos. »Warum?«
»Er hatte ein Kind bei sich«, antwortete ich und drehte mich endlich doch um, um seinem wütenden Blick mit ähnlicher Miene zu begegnen. Er war vielleicht aufbrausend, aber ich konnte es in puncto Temperament durchaus mit ihm aufnehmen, und nichts konnte mich so sehr auf die Palme bringen wie er.
»Und?«, spie er hervor.
»Und?« Nun ging ich vollends in die Luft. »Ich hielt es nicht für nötig, ein kleines Kind zu töten.«
»Ich habe kein Kind gesehen.«
»Tja, wahrscheinlich weil du dafür zu langsam warst«, murmelte ich und wandte mich ab, um in den Hauptteil des Lagers zurückzukehren. Aber er packte mich am Arm und zerrte mich zurück, drehte mich ruckartig um, damit ich ihn wieder ansah.
»Au, lass los!«, rief ich wütend und versetzte ihm einen so heftigen Stoß gegen die Brust, dass er unwillkürlich seinen Griff lockerte. Ich warf ihm einen angewiderten Blick zu und war beinahe versucht, gegen ihn von meiner Waffe Gebrauch zu machen, nur damit er mich in Ruhe ließ.
»Wohin willst du, verdammt nochmal?« Er kochte vor Wut und sah auch weiterhin zornig auf mich herab.
»Nach Hause. Mein Dienst ist vorbei«, antwortete ich. Mein Ton forderte ihn heraus, und er war offensichtlich stinksauer, weil ich nicht klein beigab. Als Kind hatte ich mich von ihm herumkommandieren und mir sagen lassen, was ich zu tun und zu lassen hatte. Aber in den letzten Jahren war ich erheblich stärker geworden und auf jeden Fall deutlich autoritätsresistenter.
»Wohl kaum. Du musst den Überfall Celt melden. Und sag ihm auch, dass du ihn hast laufen lassen«, knurrte er. Ich verdrehte die Augen.
»Na gut.«
Ich drehte mich auf dem Absatz um und ging davon, stellte aber verärgert fest, dass er mir folgte. Laut knirschten seine Stiefel im Schotter.
»Ich kenne den Weg. Du musst mich nicht begleiten.«
»Doch schon, weil ich sichergehen will, dass du ihm die Wahrheit sagst«, antwortete er rundheraus. Ich ignorierte ihn und stapfte weiter den Weg an den provisorischen Hütten entlang. Mittlerweile war es vollkommen dunkel, und der Pfad, den wir entlangschritten, war spärlich von vereinzelten Laternen beleuchtet. Wir gingen in eisigem Schweigen weiter, beide wütend auf den anderen, während wir der Kommandozentrale näher und näher kamen, in der, wie ich wusste, Celt sich aufhielt.
Jonah warf mir erneut einen wütenden Blick zu, als ich die Hand hob, um an die Tür zu klopfen, was eigentlich nur eine Formalität war.
»Was?«, grummelte ich leise, extrem sauer über seine Anwesenheit. Er genoss es offenbar, den miesen Typen rauszukehren. Er sagte nichts und schüttelte nur den Kopf, als drinnen eine Stimme ertönte.
»Kommt rein.«
Ich drehte den Knauf und warf mich mit der Schulter gegen die Tür, um sie aufzustoßen. Das Gebäude war so krumm und schief, dass sie sich schon mal verkantete. Das einzige Licht im Zimmer stammte von einer Kerze auf einem Schreibtisch, der von Papieren übersät war. Celt saß davor, das Gesicht angespannt vor Sorge, bevor sein Kopf nach oben fuhr und er mir in die Augen sah. Die Schatten vertieften die Fältchen um seine Augen und schienen die einzelnen grauen Strähnen hervorzuheben, die sein Haar immer mehr durchzogen. Dadurch kam er einem älter vor, als er tatsächlich war. Ein Lächeln umspielte seine Lippen, als er mich erblickte.
»Grace! Komm rein und setz dich«, sagte er und deutete auf den Stuhl, der seinem Schreibtisch gegenüberstand. Ich schenkte ihm ein schwaches Lächeln, trat nun vollends ein und setzte mich, dicht gefolgt von Jonah.
»Jonah, du natürlich auch«, fügte er hinzu. Jonah ignorierte das Angebot und stellte sich mit über der Brust verschränkten Armen neben mich. Celt warf ihm einen tadelnden Blick zu. Dann wandte er sich wieder mir zu.
»Welchem Umstand verdanke ich diese Ehre?«, fragte Celt. Er schob ein paar der Papiere zusammen, die er studiert hatte, und ordnete sie zu einem akkuraten Stapel. Jonah neben mir schnaubte entrüstet.
»Ja, sag’s ihm, Grace«, forderte er mich angespannt auf.
Celt musterte mich eindringlich, und sein Gesicht wurde ernst.
»Was ist passiert?«
»Hm, es gab einen Überfall auf das Petroleumlager«, antwortete ich, wobei ich die wichtigsten Details ausließ.
»Und …«, soufflierte Jonah.
»Und sie sind entkommen.«
»Und warum sind sie entkommen?«, fragte Jonah. Ich wandte mich ihm zu und funkelte ihn wütend an, wütend, dass er mich vor Celt wie eine Idiotin dastehen ließ.
»Weil ich sie laufen gelassen habe«, murmelte ich verdrossen und mit zusammengebissenen Zähnen.
»Warum hast du das getan?«, fragte Celt. Er rieb sich die Schläfen, als ob ihn das alles extrem stresste.
»Er hatte ein Kind bei sich!«, sagte ich zu meiner Verteidigung.
»Ja, und weißt du was? Der Kleine hat an einem Raubzug teilgenommen. Mit anderen Worten: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er mit der Waffe auf dich zielt«, knurrte Jonah neben mir.
»Ganz sicher nicht. Der Junge war total verängstigt. Es würde mich überraschen, wenn er überhaupt jemals wieder das Camp verließe«, antwortete ich kopfschüttelnd.
»Hast du herausgefunden, aus welchem Lager sie kamen?«, fragte Celt. Seine Stimme klang eine Spur enttäuscht, sodass ich mich absolut beschissen fühlte.
»Nein«, bekannte ich.
»Du bist echt zu nichts zu gebrauchen«, spie Jonah hervor. »Du bist ein Schwächling.«
»Hältst du jetzt endlich mal die Klappe? Nur weil ich kein herzloses Arschloch bin, heißt das noch lange nicht, dass ich schwach bin«, schoss ich zurück. Ich hatte nicht übel Lust, aufzuspringen und ihm einen Kinnhaken zu versetzen.
»Celt, unternimmst du jetzt was dagegen? Wir können sie nicht mehr Wache schieben lassen, wenn sie Angst hat, jemanden zu töten«, sagte Jonah aufgebracht. Er fuchtelte mit den Händen in meine Richtung, als könne er es nicht fassen, dass ich die Feinde einfach so hatte laufen lassen.
»Du weißt, dass das nicht stimmt«, antwortete ich. Ich hatte durchaus schon Menschen getötet, und das wusste er. Die Tatsache, dass er es überhaupt wagte, mir so etwas ins Gesicht zu sagen, machte mich stocksauer. Ich tötete nicht gern, aber ich tat, was getan werden musste, um zu überleben.
»Nur weil du diesen Typ am liebsten gevögelt hättest …«
»Was?! Nein, so war das nicht …«
»… ist das noch lange kein Grund, ihn laufen zu lassen. Du bist schwach«, wiederholte er in dem Wissen, dass diese Stichelei mich am meisten ärgern würde. Ich hasste es, als schwach bezeichnet zu werden, nur weil ich ein Mädchen war.
»Du bist so ein Mistkerl …«
»Stopp!«, brüllte Celt plötzlich, und unsere Köpfe wirbelten zu ihm herum. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich aufgesprungen war und nun Auge in Auge Jonah gegenüberstand. Ich wich einen Schritt zurück und atmete tief durch; dann zwang ich mich, mich wieder hinzusetzen.
»Ihr beide müsst mit diesem sinnlosen Gezänk aufhören und miteinander klarkommen. Wie sollen andere Leute darauf vertrauen, dass ihr für ihr Überleben sorgt, wenn ihr euch ständig an die Gurgel geht?«
Keiner von uns gab eine Antwort auf diesen Tadel. Scham färbte meine Wangen rot; ich hasste es, Celt zu enttäuschen.
»Sorry«, murmelte ich. Celt sah Jonah erwartungsvoll an.
»Sorry«, murmelte auch er, allerdings wenig überzeugend.
»Ich dachte, ihr beiden hättet eine bessere Erziehung genossen«, setzte Celt noch einen obendrauf. Er schüttelte bedächtig den Kopf, bevor er mich wieder ansah. »Und Grace, ich weiß deinen Charakter durchaus zu schätzen, aber du kennst die Regeln. Wenn du einen Plünderer erwischst, dann tötest du ihn auch. So einfach ist das.«
»Ich weiß«, murmelte ich kleinlaut.
»Was machst du also beim nächsten Mal, wenn du jemanden erwischst?«, bohrte er nach.
»Ihn töten«, stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Genau. Ich weiß, es ist grauenvoll, aber so ist es nun einmal. Es darf sich keinesfalls herumsprechen, dass wir Plünderer einfach so laufen lassen, sonst haben wir bald nichts mehr«, sagte er sanft.
»Ja, Celt.«
»Komm schon, du weißt, dass ich es nicht mag, wenn du mich so nennst«, sagte er, und jetzt umspielte seine Lippen die Andeutung eines Lächelns. Ich seufzte, legte den Kopf in den Nacken und richtete ihn dann wieder auf, um ihm in die Augen zu sehen.
»Ja, Dad.«
Kapitel 3
Spontan
Hayden
Zorn brodelte durch meine Adern, als ich Jett hinterherlief. Durch meine starken Beine hatte ich ihn auf seiner Flucht schnell eingeholt. Er warf mir einen entsetzten Blick aus den Augenwinkeln zu und rannte weiter. Ich verlangsamte meinen Schritt, damit er mithalten konnte. Ich biss vor Wut die Zähne zusammen und bemühte mich, nicht wild zu fluchen, weil er so unglaublich leichtsinnig gewesen war.
»Dumm«, entfuhr es mir trotzdem leise. Er antwortete nicht, aber ich hörte, wie schwer sein Atem ging. Sein Körper war einfach noch nicht an die physische Anstrengung gewöhnt, die bei einer Plünderungsaktion vonnöten war. Der Waldrand näherte sich schnell, und ich wusste, dass Kit und Dax sich außer Sichtweite versteckt hatten und auf uns warteten. Ich verlangsamte mein Tempo gerade genug, damit Jett vor mir durch die Lücken zwischen den Bäumen hindurchschlüpfen konnte.
Kaum waren wir in Deckung, griff ich nach seinem Arm und wirbelte ihn zu mir herum, damit er mich ansah.
»Was zum Teufel, Jett?«, fragte ich und hatte Mühe, leise zu sprechen. Obwohl wir hier in Deckung waren, waren wir noch lange nicht in Sicherheit. Wütend funkelte ich auf ihn herab, und auch sein jämmerlicher Gesichtsausdruck konnte meinen heftigen Zorn nicht lindern.
»Ich hab doch gesagt, es tut mir leid!«, protestierte er schwach. Mit großen braunen Augen blickte er zu mir auf. Sie waren voller Reue.
»Jett, du Idiot!«, stimmte Kit mit ein, der hinter einem Baum hervorkam. Er war total geladen. »Willst du dich unbedingt umbringen?«
»Nein«, murmelte der Junge betreten. Er wagte es kaum, Kit anzusehen, der ihn finster musterte.
»Du kannst uns nicht einfach folgen, kleiner Mann. Das ist nicht sicher«, sagte Dax. Er klang von uns dreien immer noch am freundlichsten. Man musste sich schon anstrengen, damit Dax sauer wurde, aber dennoch war klar, dass er Jetts Leichtsinn nicht guthieß. Ich beobachtete, wie Jett uns dreien verstohlene Blicke zuwarf. Er wirkte eingeschüchtert, und die wütenden Mienen von uns älteren und größeren Männern machten sein winziges bisschen Mut nun vollends zunichte.
»Ich wollte einfach nur genauso tough und mutig wie ihr sein«, sagte er leise und blickte wieder zu Boden. Ich seufzte tief und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Geduldig zu sein, ist auch eine Form von Mut, Jett«, belehrte ich ihn. Er hob den Kopf und sah mich mit sanften Augen an.
»Ihr Jungs wart in meinem Alter, als ihr zum ersten Mal auf Raubzüge gegangen seid«, meinte er leise. Das stimmte. Kit, Dax und ich nahmen seit unserem zehnten Lebensjahr an derlei Plünderungsaktionen teil, aber wir waren auch immer schon besser gewesen als Gleichaltrige. Wir waren klüger, schneller, stärker und genauso tödlich wie ältere. Jett kapierte einfach nicht, dass er nicht wie wir war, egal, wie sehr er es sich wünschte.
»Wir werden wissen, wenn du bereit bist«, meinte Dax und bewahrte mich davor, Jett die peinliche Wahrheit mitzuteilen: Er war einfach noch nicht so weit.
»Okay«, murmelte Jett. »Es tut mir wirklich leid. Ich wollte niemanden in Gefahr bringen.«
»Denk beim nächsten Mal daran«, sagte Kit barsch und schwang sich den Rucksack über die Schulter. »Und jetzt verschwinden wir lieber. Nachher verfolgen sie uns noch.«
»Gute Idee. Es war sowieso schon knapp«, erwiderte ich. Ich rückte die Waffe in meinem Hosenbund zurecht, um mich davon zu überzeugen, dass sie nach dem schnellen Lauf immer noch gesichert war. Die anderen nickten, und wir traten den Rückweg durch die Dunkelheit der Bäume an, um wieder in unser Lager zu gelangen. Wir sprachen kein Wort mehr, bis wir uns ein ganzes Stück von Greystone entfernt hatten.
»Warte, wie bist du überhaupt entkommen?«, fragte Dax plötzlich, als sei ihm gerade erst aufgegangen, was ich da gesagt hatte. »Haben sie dich erwischt, oder was?«
»Ein Mädchen hat mich erwischt, ja«, antwortete ich. Plötzlich tauchte vor meinem inneren Auge ihr Gesicht auf, wie sie die brennend grünen Augen verengte und mich entschlossen musterte. »Sie hatte zwar eine Waffe, aber sie hat uns trotzdem laufen lassen.«
»Was?«, fragte Kit ungläubig. Er sah mich skeptisch an, wobei ich seinen Gesichtsausdruck in der Dunkelheit eigentlich gar nicht richtig deuten konnte.
»Sie hat uns laufen lassen«, wiederholte ich und zuckte mit den Schultern.
»Sie war hübsch«, meldete sich Jett jetzt, der zwischen Dax und mir ging. »Aber ganz schön angsteinflößend.«
»Warum zum Teufel sollte sie euch gehen lassen? Ich habe noch nie gehört, dass jemand, der in Greystone gefangen wurde, es lebendig wieder herausgeschafft hat«, forschte Kit.
»Keine Ahnung«, antwortete ich aufrichtig. Ihr Verhalten war auch mir ein Rätsel, aber ich erinnerte mich an ihren gereizten Ton, als sie nach Jett gefragt hatte. »Wahrscheinlich wegen des Jungen. Sie wollte offenbar kein Kind erschießen.«
»Da ist sie da drüben wahrscheinlich die Einzige«, grummelte Dax. Greystone war berüchtigt für die Brutalität und Herzlosigkeit, mit der sie töteten.
»Dann habe ich dich also gerettet?«, fragte Jett mit einem Mal mit vor Aufregung lauterer Stimme.
»Nein. Du warst immerhin der eigentliche Grund, warum sie mich überhaupt geschnappt haben«, blaffte ich, um seinen irrationalen Gedanken gleich im Keim zu ersticken.
»Oh.«
Wortlos gingen wir weiter. Unsere Reise war beinahe beendet, denn schon flackerten die Lichter unseres Camps durch die Bäume. Während wir uns voranbewegten, hörten wir nur das leise Plätschern des Petroleums in den wenigen Kanistern, die wir bei unserem Überfall hatten stehlen können, und unsere leisen Atemzüge. Es war jetzt erheblich später und stockdunkel, deshalb nahm ich an, dass die meisten Bewohner des Lagers sich in ihre jeweiligen Hütten zum Schlafen zurückgezogen hatten.
Diese Einschätzung erwies sich als zutreffend. Das Camp lag einigermaßen still da. Nur die Nachtwachen machten ihre Runde. Ich nickte der Frau mittleren Alters und dem halbwüchsigen Jungen zu, die vorübergingen, froh, dass sie ihre Waffen im Anschlag hatten, um im Falle einer Bedrohung sofort reagieren zu können.
»Jett, geh zu Maisie. Du beichtest ihr besser alles selbst, sonst erfährt sie es nämlich von mir«, sagte ich zu ihm. Er stieß ein leises Quieken aus, weil er Angst hatte, es ihr zu erzählen. Jetts Eltern waren beide tot, Opfer der Welt, in der wir jetzt lebten. Maisie hatte ihn unter ihre Fittiche genommen. Sie fungierte nicht nur als seine Adoptivmutter, sondern auch als die des gesamten Lagers. Sie sorgte für Nahrung, arbeitete in der Kantine, damit alle im Camp sich vernünftig ernährten. Sie war in den Vierzigern, freundlich und sanft, besaß aber einen starken Willen und würde mit Sicherheit keinen Unsinn tolerieren. Jedermann respektierte sie, und Jett liebte sie zwar heiß und innig, hatte aber auch ziemlichen Respekt vor ihr; er war mit Sicherheit nicht begeistert von der Idee, ihr alles erzählen zu müssen. Sie würde stinkwütend sein.
»Ja, Sir«, quiekte er, nickte und eilte davon, bevor ich ihn tadeln konnte, weil er mich »Sir« genannt hatte.
»Du fasst ihn nicht hart genug an«, grummelte Kit neben mir. Ich sah ihn an und zog eine Augenbraue hoch.
»Er kommt nicht damit klar, wenn man grob zu ihm ist«, erwiderte ich. Jett war zu zart, um ihn so zu behandeln, wie es Kit lieber gewesen wäre.
»Grmpf«, machte der und nahm den Kanister mit dem Petroleum in die andere Hand. Schweigend gingen wir weiter, bis wir den Lagerraum erreicht hatten. Dax schwang die Tür auf und begrüßte den Wachmann so laut, dass dieser bei unserem plötzlichen Eintreten erschrocken zusammenzuckte.
»Du schläfst doch nicht etwa, oder?«, neckte Dax ihn und sah den älteren Mann, der gerade Dienst hatte, mit hochgezogenen Augenbrauen an.
»Niemals, Dax«, antwortete der Mann lächelnd. Im Lager gab es niemanden, der Dax nicht mochte.
Ich wartete geduldig, bis Kit und Dax ihre Beute abgestellt haben, nahm den einen gestohlenen Kanister aus meinem Rucksack und stellte ihn neben ihre. Ich nickte dem Mann zu, bevor wir das Gebäude wieder verließen, um unsere Waffen und andere Hilfsmittel erneut in der Kommandozentrale unterzubringen. Wir verstauten die Waffen wieder in den Kisten und legten die Rucksäcke an ihren Platz zurück.
Mit steinerner Miene grüßte Kit die Wachleute, jetzt ein anderer Mann und eine andere Frau als vorher. Dann traten wir wieder in die Nacht hinaus. Wir gingen gemeinsam auf unsere eigenen Hütten zu, die auf der rechten Seite des Lagers lagen. Wir waren schon beinahe angelangt, als ein Mann von etwa fünfzig Jahren aus seiner Hütte trat.
»Hayden«, grüßte er mich. Er streckte mir die Hand entgegen, und ich schüttelte sie energisch.
»Barrow«, antwortete ich und nickte ihm zu.
»Zurück von eurem Streifzug, wie ich sehe?«, bemerkte er und grüßte Kit und Dax mit einem Kopfnicken.
»Jep.«
»Alles gut gelaufen?«, erkundigte er sich.
»Gut würde ich nicht sagen, aber wir sind wieder da«, antwortete ich. Dax neben mir schnaubte. Er konnte schon wieder darüber lachen, auch wenn es noch so gefährlich gewesen war.
»Schön zu hören«, meinte Barrow und lächelte uns an. »Ich habe eben nach dir gesucht, dich aber anscheinend verpasst – wir brauchen neue Stromkabel.«
Ich seufzte und fuhr frustriert mit dem Finger über meine Lippe. »Stromkabel? Wofür?«
»Der Generator in Küche und Kantine gibt den Geist auf«, antwortete Barrow. »Ist alles verschmort, und wenn er ganz kaputtgeht, dann haben wir gar keinen Strom mehr.«
»Dafür müssen wir in die Stadt«, sagte Kit neben mir. Ich runzelte die Stirn.
»Ich weiß.«
Barrow sah mich bedauernd an. »Soll ich ein Team zusammenstellen? Ich kann auch gehen.«
»Nein, schon gut«, antwortete ich. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie Dax grinste. »Wir ziehen morgen los.«
Raubzüge in der Stadt unternahm man am besten tagsüber, auch wenn das bedeutete, dass man leichter entdeckt wurde. Bei Nacht war die Stadt der gefährlichste Ort überhaupt, denn dann trieben die Brutes ihr Unwesen. Es war ihr Territorium, und sie wussten genau, wie sie es verteidigen mussten.
Barrow nickte. »Okay. Dann holt euch eine Mütze voll Schlaf, Jungs. Wir wollen schließlich, dass ihr wohlbehalten zurückkommt.«
»Weißt du, es ist schon mehr nötig als ein paar Brutes, um uns den Garaus zu machen«, antwortete Dax leichthin, grinste und stieß Barrow gegen die Schulter. Der erwiderte das Grinsen, wusste die Begeisterung des jüngeren Mannes zu schätzen. Hin und wieder nahm er selbst immer noch an Plünderungsaktionen teil, aber es waren nicht mehr annähernd so viele wie früher. Nachdem ein Ausflug nach Crimson furchtbar schiefgelaufen war, war sein linkes Knie schwer verwundet worden, weshalb es ihm heute schwerfiel, das Tempo, das man bei einem solchen Beutezug vorlegen musste, aufrechtzuerhalten. Er verlor nie ein Wort darüber, aber ich wusste, wie sehr es ihn betrübte, zurückbleiben zu müssen, wenn wir loszogen. Er war derjenige, der uns alle ausgebildet hatte.
»Ja, ja, das unbesiegbare Trio«, scherzte Barrow jetzt. »Wir sehen uns.«
»Ich freu mich immer, dich zu sehen, Barrow«, sagte Kit gemessen und schenkte ihm ein schwaches Grinsen. Barrow kehrte in seine Hütte zurück, sodass auch wir jetzt endlich nach Hause konnten. Nur noch ein kurzes Stück und schon standen wir vor unseren jeweiligen Hütten, die zufällig nebeneinanderlagen.
»Was haltet ihr von neun Uhr morgens?«, fragte ich. Kit zupfte an seinem Fingernagel herum und nickte.
»Ja, klingt gut.«
»Träumt süß, Jungs! Freue mich, dass dein Arsch Glück hatte und noch hier ist, Hayden«, sagte Dax leichthin, drehte sich um und ging hinein. Kit gluckste dröhnend vor sich hin. Nun, da wir wieder zu Hause waren, ließ der Stress so langsam nach.
»Ich auch«, sagte ich lachend, und auf meinem Gesicht breitete sich das seit einer gefühlten Ewigkeit erste Lächeln aus. Damit verschwanden wir allesamt in unseren Hütten, um noch ein paar Stunden zu schlafen, bevor es auf den morgendlichen Raubzug ging. Normalerweise unternahmen wir Überfälle dieser Art nicht an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, aber Kabel für die Generatoren waren einfach zu wichtig. Das konnten wir nicht aufschieben. Wenn wir in der Küche keinen Strom hatten, gab es nichts zu essen.
Ich griff mit der Hand nach hinten, packte mein T-Shirt und zerrte es mir über den Kopf, wobei mir das Bandana ebenfalls herunterrutschte. Mein Haar fiel mir ins Gesicht, als ich meine Stiefel und meine Jeans auszog und beides auf dem Boden liegen ließ. Innerhalb weniger Sekunden fiel ich vollkommen erschöpft ins Bett und schlief schon, kaum dass mein Kopf das Kissen berührt hatte. Der Stress des vergangenen Tages hatte mich komplett umgehauen.
Gefühlte Sekunden später riss ein Klopfen an der Tür mich wieder aus dem Schlaf.
»Hayden, Kumpel, los geht’s!«, schrie Dax.
»Ja, raus aus dem Bett, du Faulschwanz«, fügte Kit hinzu. Für seine Verhältnisse klang er überraschend fröhlich. Ich seufzte tief, drückte mein Gesicht ins Kissen, stützte dann aber die Arme auf die Matratze, um aufzustehen.
»Ja, ja, ich komm ja schon«, rief ich. Ohne groß nachzudenken, zog ich die Jeans wieder an, die ich am Abend zuvor auf den Boden geworfen hatte, und warf mir ein marineblaues Flanellhemd über. Ich schnappte mir das Bandana vom Boden, schob mir damit das Haar aus dem Gesicht und band mir gleichzeitig die Stiefel zu. Dann ging ich zu dem provisorischen Waschbecken in dem kleinen Badezimmer hinüber, das an meine Hütte angebaut worden war, um mir Wasser ins Gesicht zu klatschen.
Als Anführer des Camps gehörte ich zu den wenigen, die tatsächlich sogar über ein eigenes Badezimmer verfügten. Ein Eimer mit Wasser diente als Waschbecken und ein hängender, perforierter Sack, den man mit Wasser füllen konnte, als Dusche. Leute wie Dax hatten tatsächlich rudimentäre Rohrleitungen zusammengeschweißt, durch die das Wasser vom Boden nach draußen abgeleitet wurde. Ich hatte sogar eine Latrine inklusive eines Systems, das den gesamten Unrat aus dem Camp hinausspülte, während die übrigen Bewohner die Gemeinschaftslatrinen benutzen mussten. Ich hatte Glück: Ich hatte es besser als viele andere.
Das Sonnenlicht blendete mich, als ich die Tür aufriss. Draußen standen ein überraschend aufgeregt dreinblickender Kit und Dax.
»Morgen, Sonnenscheinchen«, meinte Dax und drückte mir eine Waffe und den Rucksack in die Hand. »Hab deine Klamotten schon herausgeholt, dann können wir gleich los!«
»Wo ist mein …«
Dax ließ mein Springmesser wenige Zentimeter vor meinem Gesicht aufschnappen und schnitt mir so das Wort ab. Er grinste, als ich bei seiner plötzlichen Bewegung zurückzuckte. Mit tadelnd gerunzelter Stirn sah ich ihn an, nahm es ihm ab und klappte die Klinge wieder ein.
»Danke.«
»Kommt jetzt, Jungs. Ich will rechtzeitig zum Mittagessen wieder zurück sein. Maisie macht dieses tolle Hühnchengericht«, meinte Dax aufgeregt.
»Na gut, na gut«, murmelte ich. Ich schwang mir den Rucksack über die Schultern, schob mir die Waffe in den Taillenbund, wo ich sie immer hatte. Mein Rucksack war erheblich schwerer als am Abend zuvor, und ich wusste, dass Kit und Dax mehr Munition und Hilfsmittel hineingepackt hatten, da wir in die Stadt hinauszogen. Der Tag war strahlend hell und sonnig, als wir schnellen und zielstrebigen Schrittes das Camp verließen.
Manchmal nahmen wir eines der Fahrzeuge, die wir noch hatten, aber an Tagen wie heute, an denen unsere Beute leicht sein würde, legten wir die Strecke lieber zu Fuß zurück, um unseren kostbaren Sprit zu sparen. Schon bald bahnten wir uns den Weg durch die Bäume, die unser Lager umgaben, allerdings in die genau entgegengesetzte Richtung von gestern Nacht. Die Stadt lag nicht viel weiter entfernt als Greystone, weshalb unsere Wanderung nicht allzu lang dauerte.
Vor uns erhoben sich die Ruinen der Stadt, die heruntergekommenen, grauen Gebäude, die mit jedem Besuch, den wir diesem Ort abstatteten, mehr in sich zusammenfielen. In den Ritzen des Zements wucherte das Unkraut, sodass die einstige Metropole noch trostloser wirkte. Wir bewegten uns vorsichtig, schlichen leise durch die Straßen. Beständig suchten wir die Alleen und die Gebäude nach den sich bewegenden Schatten potentieller Angreifer ab.
Wir waren noch nicht weit gekommen, als wir auf einen kaputten Bus stießen, eine hervorragende Quelle für Kabel. Ich nickte Dax stumm zu und sah, wie seine Augen bei diesem Anblick aufleuchteten. Er war der Technologie-Experte, seine Aufgabe war es also, die notwendigen Kabel aus dem Bus zu entfernen. Wir zückten unsere Waffen, streckten sie vor uns aus und bewegten uns darauf zu, wobei wir niemals zu lang in nur eine einzige Richtung sahen.
Nachdem die Bustür offen war, kletterte ich leise und behände hinein. Sorgfältig sah ich mich um, das Gewehr immer vor mir ausgestreckt, falls ich schießen musste, aber der Bus war vollkommen leer. Ich nickte meinen Kameraden hinter mir zu, bedeutete Dax, hereinzukommen und alles Notwendige in Angriff zu nehmen. Kit bezog an der Tür Stellung, mit dem Rücken zu uns, um nach sich nähernden Feinden Ausschau zu halten.
»Los, Dax«, sagte ich leise. Er riss sich den Rucksack herunter, kauerte sich auf den Boden, um das notwendige Werkzeug herauszukramen, und begann, das Armaturenbrett auseinanderzunehmen. Ich spähte unaufhörlich zu den Fenstern hinaus, ob sich irgendetwas bewegte. Als Dax die Armaturen aufstemmte, zuckte ich zusammen. Das laute Quietschen zerrte an meinen Nerven. Er arbeitete schnell, zog die Kabel aus den Buchsen und schnitt alles heraus, was er brauchen konnte.
Da ertönte ein lauter Knall – ein vertrautes Geräusch. In nicht allzu weiter Ferne war ein Schuss abgefeuert worden.
»Scheiße«, fluchte Kit und drehte sich angespannt in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Dax fluchte ebenfalls von seiner kauernden Position am Boden aus, schob Werkzeug und Kabel in seinen Rucksack und schwang ihn sich über die Schulter.
»Ich bin fertig, lasst uns verschwinden«, sagte er. »Garantiert war das ein Brute. Die können jeden Moment hier sein.«
»Runter!«, zischte Kit plötzlich, kletterte behände in den Bus und duckte sich unters Armaturenbrett. Ich folgte ihm, blieb aber gerade hoch genug sitzen, um durch die Windschutzscheibe hinausspähen zu können. Was mochte Kit wohl gesehen haben?
»Auf zehn Uhr«, flüsterte Kit. Ich wandte den Blick ab, und tatsächlich schlich sich eine Vierergruppe durch die Ruinen der Stadt, die Waffen gezückt und auf Habachtstellung. Einer von ihnen humpelte leicht, und alle wirkten ziemlich nervös.
»Wette, die haben Brutes gesehen, was?«, meinte Dax, der neben mir aufgetaucht war, um ebenfalls einen Blick auf die Gruppe zu werfen. Sie hatten uns nicht entdeckt, zu abgelenkt von dem, worauf auch immer sie eben gestoßen waren. Ich ließ den Blick über sie hinwegwandern: zwei Männer mittleren Alters und ein junger Mann von etwa fünfundzwanzig Jahren. Dann entdeckte ich die vierte im Bunde: ein Mädchen mit blondem Haar und atemberaubenden grünen Augen, die vor wenigen Stunden noch mit einer Waffe auf mich gezielt hatte.
Das Mädchen aus Greystone.
Mir blieb der Mund vor Schreck offen stehen, während ich beobachtete, wie sie sich weiterbewegte. Ihr Körper war stark und gut trainiert, und sie vermied jedes Geräusch. Kit regte sich neben mir und hob die Waffe. Dax tat auf meiner anderen Seite das Gleiche.
»Ich übernehme die ersten beiden, und ihr jeder einen weiteren«, murmelte Kit und zielte auf einen der Männer.
»Kapiert«, antwortete Dax. Es gehörte zur Standardprozedur, jeglichen Feind, auf den man während eines Raubzuges traf, zu töten. Je weniger Plünderer die anderen Lager hatten, umso besser. Mein Herz klopfte wie wild. Mir war nicht wohl bei dem Gedanken, dass jemand das Mädchen töten würde, das mich verschont hatte.
»Wartet …«
Wieder hallte ein Schuss von den Wänden wider, und der erste Mann sackte zusammen. Ich sah meine Kumpel an, die überraschte Gesichter machten. Sie hatten nicht gefeuert, aber jemand hatte einen der vier gerade erschossen.
Wieder sah ich nach vorn, als ein zweiter Schuss abgefeuert wurde. Die Kugel prallte neben dem jüngeren Mann vom Asphalt ab. Er zerrte das Mädchen zu Boden und aus der Schusslinie. Der andere Mann floh, verschwand zwischen zwei Häusern. Dann sprang der Jüngere auf die Füße und folgte ihm. Ich riss überrascht die Augen auf, als das Mädchen ihnen folgte und zum Sprint ansetzte, den ersten Mann zurückließ. Die Blutlache um ihn herum war bereits zu groß; er war tot.
Sie rannte pfeilschnell, ihre Arme pumpten, das blonde Haar wehte hinter ihr her. In diesem Moment fiel wieder ein Schuss. Fast augenblicklich stürzte sie zu Boden, landete schwer auf dem Asphalt, als die Kugel sich in ihr Bein bohrte. Ohne innezuhalten, versuchte sie, wieder auf die Beine zu kommen. Sie zog eine Grimasse, als ihr Bein nachgab. Auch nur der kleinste Druck verursachte ihr zu viel Schmerz, um sie noch tragen zu können.