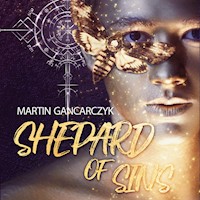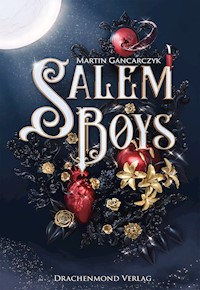
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Drachenmond VerlagHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Vier alte Blutlinien aus Salem. Zwei Jungs, unterschiedlich wie Tag und Nacht. Ein dunkler Wald, der in den Schatten lauert. Kein Entkommen. Harlow McQueen und Jax Ingram haben es geschafft: Der Abschluss an der Eliteschule St. Andrews in Sydney liegt erfolgreich hinter ihnen. Das echte Leben als Hexe kann beginnen - für den einen in der High Society, für den anderen als Straßenhexe. Jedenfalls dachten sie das. Doch eine Entführung zwingt sie, die Lichtwelt zu verlassen und die Schattenseite zu betreten. Jene Welt, in der die Hexen den Wald von Salem eingesperrt haben, der seither darauf lauert, die Hexen für immer zu unterjochen. Schnell stellen Harlow und Jax fest, dass ihr bisheriges Leben nur ein winziger Teil einer großen Lüge und ihr Schicksal seit jeher verbunden war. Nur gemeinsam können sie in dieser neuen Welt bestehen. Doch ihre Mission wird sie entweder für immer verbinden oder für ewig auseinanderreißen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SALEM BOYS
MARTIN GANCARCZYK
Copyright © 2022 by
Drachenmond Verlag GmbH
Auf der Weide 6
50354 Hürth
https://www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Sarah Nierwitzki
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout Ebook: Stephan Bellem
Umschlagdesign: Martin Gancarczyk
Charakterillustrationen: Martin Gancarczyk
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-137-5
Alle Rechte vorbehalten
INHALT
1. Harlow
2. Jax
3. Harlow
4. Jax
5. Harlow
6. Jax
7. Harlow
8. Jax
9. Harlow
10. Jax
11. Harlow
12. Jax
13. Harlow
14. Jax
15. Harlow
16. Harlow
17. Jax
18. Harlow
19. Jax
20. Harlow
21. Jax
22. Harlow
23. Jax
24. Harlow
25. Jax
26. Harlow
27. Jax
28. Harlow
29. Harlow
30. Harlow
31. Jax
32. Jax
33. Harlow
Epilog
Danksagung
Drachenpost
Für meine Familie
Meine leibliche.
Meine gefundene.
Und meine queere.
Dieses Buch ist für uns, denn auch wir
können Helden in Geschichten sein.
HARLOW
SECHZIG TAGE BIS ZUM BLUTMOND
Heute war der angeblich beste Tag meines Lebens, der, auf den alle meine Klassenkameraden und ihre Familien hingefiebert hatten – nur ich hasste ihn, seit dem Moment, als ich aufgestanden war.
Als ich die Wohnung von Angelina und mir am Martin Place verließ, wehte mir Jingle Bells entgegen, getragen von der heißen Sommerluft. Mit aufgerissenen Augen bestaunte eine Menschentraube den riesigen Weihnachtsbaum, der auf dem Platz vor unserem Hochhaus jährlich aufgestellt wurde und vor dem in sieben Wochen die Fernsehübertragung des Weihnachtskonzerts aufgezeichnet werden würde.
»Abgefahren! Wir haben 39 Grad Anfang November! Crazy!«, scherzten Backpacker und Touristinnen und Touristen aus aller Welt und schüttelten dabei ungläubig ihre Köpfe.
Normalerweise schmunzelte ich darüber, nicht so heute.
Heute nervte es. Sehr sogar.
Was hatten sie erwartet? Australien lag auf der südlichen Halbkugel, und Sommer herrschte hier von Dezember bis März. Hätten sie sich halt vor ihrer Reise informieren sollen.
War ich gerade unsachlich und unfair? Ja.
War das meine übliche Art? Nein, da ich sonst immer den freundlichen Sohn mimte.
Nur war in diesem Moment offensichtlich, dass sich meine Laune heute, im Gegensatz zu den hochsommerlichen Temperaturen, frostig zeigte.
Menschen und ihre Erwartungen nervten mich. Und da lag die Wurzel meiner schlechten Laune. Nicht die Touristen trugen die Schuld, sondern meine Familie, mein Coven und die St. Andrew Academy. Alle erwarteten von mir, gerade heute, das perfekte Abbild eines wohlerzogenen Jungen zu mimen, der, Zitat: »Großes leisten wird«.
In vier Stunden würde ich die Schulhymne auf der Abschlussfeier singen. Eine Ehre, die nur den besten Studierenden zuteilwurde. Mit Namen Harlow McQueen, Sohn des ehrwürdigen McQueen-Coven, direkter Nachfahre der berühmten Angelina – bla, bla, bla. Der ganze Mist, der seit einundzwanzig Jahren mein Leben bestimmte.
»Sir, Ihr Fahrer wartet. Haben Sie Gepäck, das ich tragen soll?«
Ich wandte mich vom Weihnachtsbaum ab, bevor ich ihn aus Versehen in Brand steckte, und sah zu Carlton.
»Nein danke, Carlton.« Müde lächelte ich unserem Butler zu. »Es ist bereits alles in der Schule, nur ich fehle.«
»Ein großer Tag, Sir. Wir sind außerordentlich stolz auf Sie.« Carlton lächelte ehrlich. An manchen Tagen fühlten sich er und seine Frau, die bei uns als Köchin angestellt war, mehr nach Familie an, als meine tatsächliche es tat.
»Wie stehen die Chancen, dass Fred mich zum Flughafen statt St.Andrew fährt?«, fragte ich mit einem Seufzen.
»Ich befürchte, das würde Ihre Frau Mutter nicht erfreuen.«
Untertreibung des Jahrhunderts. Angelina Grace Loveage McQueen würde ganz Sydney unter Wasser setzen und mich wie eine Ratte aus dem Flughafen fluten, wenn ich die Eier besäße, mich ihr zu widersetzen. Gut, dass sie mich nahtlos in das High-Society-Korsett gepresst hatte und ich deswegen ausführte, was sie anordnete. Immerhin war ich ein braver Sohn, der spurte wie ein Paradepferd.
Selbstachtung? Brauchte ich nicht, weil mich die Hexengemeinde vergötterte. Redete ich mir zumindest ein.
»Na, dann werde ich zur Abschlussfeier fahren«, sagte ich zu Carlton. »Angelina bekommt schließlich immer, was sie verlangt.«
Carlton nickte. Nur in seinen Augen blitzte etwas auf, was mich an Mitleid erinnerte. Das schlimmste aller Gefühle.
* * *
Zehn Minuten später überquerte meine Limousine die Harbour Bridge vom Sydney Business District nach Nordsydney. Rechts von mir erblickte ich das Sydney Opera House mit seinen weißen Segeln. Die Vormittagssonne tanzte über die hellen Dächer und tauchte die zahllosen Touristinnen und Touristen in einen weichen Schein. Viele von ihnen nahmen die Fähren vom Circular Quey, um so zum Zoo oder zum bekannten Manly Beach zu gelangen. Das öffentliche Verkehrssystem in Sydney bestand nicht nur aus Bussen und U-Bahn, sondern ebenso aus Fähren, die primär die Nordseite der Stadt ansteuerten. Der Naturhafen, über den die Harbour Bridge gebaut worden war, war durchzogen von Booten, Kreuzfahrtschiffen und den gelb-grünen Fähren. Wie elegante Schwäne zogen sie ihre Bahnen durch das klare Wasser und standen für Freiheit, während ich in mein Gefängnis namens St. Andrew Academy fuhr.
»Sir, wir sind jeden Augenblick da«, erklang Freds Stimme durch die Sprechanlage. »Sie sollten sich entsprechend kleiden.«
Brummend riss ich den Blick von dem Wasser los und betrachtete meine Shorts und das Tanktop. Betrat ich so die Bühne, würde das einen Skandal auslösen. Einen Moment dachte ich ernsthaft darüber nach.
Was sollte St. Andrew machen? Mich rausschmeißen?
Heute fand sowieso nur der formale Abschluss statt – unsere Zeugnisse waren schon geschrieben und jede Hexe freute sich auf das anstehende Uni-Leben. Nur ich nicht. Ich würde ins Familiengeschäft einsteigen und lediglich dem Schein nach studieren. Meine tatsächliche Ausbildung würde ich im Coven erhalten und das Glatteis der Politik und gehobenen Gesellschaft betreten.
»Danke, Fred«, murmelte ich. Mit den Fingern fuhr ich wehmütig über meine sommerliche Kleidung. Es half nichts. Es gab Regeln – und an diese musste ich mich halten.
Geschmeidig stimmte ich einen Ton mit meinen Stimmbändern an, ließ ihn zwischen Zwerchfell und Kehlkopf tanzen. Er vibrierte warm und tief. Ich konzentrierte mich darauf, den Bass zu verstärken und weiter die Tonleiter hinabzusteigen. Einen Augenblick später resonierte die richtige Tiefe durch meinen Brustkorb und die Melodie entwich über meine Lippen. Formte Töne und verwob die Magie mit der kurzen Klangfolge. Ein goldenes Licht legte sich um mich, Funken tanzten meinen Körper entlang, wandelten meine Kleidung um, und nur einen Wimpernschlag später trug ich die Schuluniform.
Jede Hexe der St. Andrew beherrschte diesen Canto – oder auch Belcanto genannt. Da unsere Hexenmagie auf Gesang, Melodien und Musik aufbaute, stellte der richtige Ausdruck für Zauber Belcanto dar – kurz Canto, wenn man nicht jenseits der hundert Jahre alt war. Was erstaunlich viele Hexen in Sydney in der Tat waren.
Der Belcanto mit Namen St. Andrews Stolz galt als Basiszauber des College, und wir hatten ihn am ersten Tag gelernt. Für viele von uns war es jedoch nicht der erste Canto, den wir in unserem Leben beigebracht bekommen hatten. Die meisten von uns hatten durch ihre Coven schon einige simple magische Anwendungen gelernt und unser Wissen in Cantos wurde dann in der St. Andrew vertieft.
Trotz der Klimaanlage lief Schweiß meinen Nacken hinab und wurde durch den engen Hemdkragen aufgefangen. Als Mitglied der Hexenwelt-Elite trug ich selbst bei fast 40 Grad einen Anzug. Meine Hose und das Jackett in einem Dunkelblau legten sich über das hellblaue Hemd und wurden komplettiert durch eine tiefrote Krawatte, auf der sich eine verzauberte Bestickung in Form einer goldenen Schlange bewegte. Für gewöhnliche Menschenaugen offenbarte sich dort ein Karomuster – für uns Hexen hingegen schlängelte sich das Wappentier langsam über das Stück Stoff, das mir das Atmen erschwerte, so eng war sie gebunden. Manchmal fragte ich mich, ob St. Andrew die Krawatte absichtlich eng in Erscheinung treten ließ, um uns zu quälen. Mit feuchten Fingern löste ich den Krawattenknoten ein wenig. Immerhin würde ich gleich die Hymne singen – und dafür brauchte ich Luft.
Die Limousine kam zum Stehen. Ich atmete tief ein und aus, beruhigte damit meinen Puls, verstaute meine schlechte Laune hinter einer lächelnden Maske und stieg aus.
Mein Fuß hatte kaum den makellos weißen Kies des Hauptplatzes des College berührt, da riefen die ersten Leute, die dort offenbar auf andere Studierende oder manche sogar auf mich warteten, meinen Namen. Freundlich nickte ich ihnen zu, verteilte ein paar High Fives und Umarmungen, bevor ich mich auf das Haupthaus aus weißem Marmor mit Goldverzierungen zubewegte.
Auf dem Weg erreichten Floskeln und belanglose Gespräche meine Ohren, ohne dass sie mich interessierten. Ich lächelte weiterhin freundlich, zeigte die strahlenden Zähne, wie um einen Zahnpastawerbespot zu drehen, und nickte geistesabwesend. Ein perfekt dressiertes Äffchen, das auf Kommando mit Bravour das Parkett der High Society betrat, seine Pirouetten drehte und sich dann brav verbeugte.
Eine Fassade aus Lügen, die ich über die Jahre meisterlich errichtet hatte und mit voller Inbrunst hasste.
Wie durch Watte registrierte ich die Sätze, die mir entgegengeworfen wurden, während ich weiter auf das Haupthaus zusteuerte, ohne zu antworten. Mein Lächeln musste genügen, denn mit den Augen hatte ich ein anderes Ziel fixiert.
»Glückwunsch, Harlow«, sagte jemand und klopfte mir auf die Schulter.
Ich antwortete mit einem Nicken.
»Krass, dass die drei Jahre schon rum sind«, kam von einer mir unbekannten Person.
Eine gespielt erstaunte Geste, indem ich die Arme fassungslos ausbreitete, als würde es mir nicht am Hintern vorbeigehen.
»Bald studieren wir«, sagte ein Kumpel, von dem ich vermutete, er war nur wegen meines Reichtums und des Ansehens mit mir befreundet.
Ein weiteres Nicken von mir.
»Mate, heute Abend feiern wir!«, brüllte Oliver, einer meiner wenigen echten Freunde, in mein Ohr. »Champagner für alle!«
Als würde ich mich die Aussicht darauf erfreuen, streckte ich meine zur Faust geballte Hand gen Himmel – doch mein Blick verweilte unaufhörlich auf einer Person, die in der Tür des Haupthauses stand.
Der Geruch von Ozon und verschiedenen Blumen – ihrer Magiesignatur – wehte mir entgegen. Dort, in ein wallendes Kleid aus teurem schwarzem Stoff gehüllt, thronte meine Mutter Angelina Grace Loveage McQueen, die bedeutendste und einflussreichste Hexe Australiens – wenn nicht sogar der ganzen Welt. Ihr Brustkorb hob sich unmerklich zu einem Canto, während ihr weißblondes Haar, wie von einer unsichtbaren Hand getragen, sanft um ihren Kopf wehte. Die stechend grünen Augen auf mich gerichtet, öffnete sie den Mund. Ich musste den Canto nicht einmal hören, um zu wissen, was mir bevorstand.
»Harlow Jammison Cassidy McQueen! Wo bleiben deine Manieren?«, dröhnte ihre Stimme in meinen Gedanken. Wie ich es hasste, wenn sie, ohne zu fragen, mental in meinen Kopf eindrang.
»Ma’am? Ich bin hier, lächele und werde gleich singen. Was habe ich nun wieder verbrochen?« Gerade so widerstand ich dem Drang, meine Hände wütend zu Fäusten zu ballen.
»Es heißt Madam President! Erinnere dich dran, dass du den gesamten Coven und zudem den Namen McQueen repräsentierst! Was denken die Leute, wenn der Sohn der Präsidentin sich benimmt wie eine covenlose Hexe?«
Hatte ich erwähnt, dass Angelina nicht nur meine Mutter und die Oberste Hexe unseres Covens war, sondern ebenso die Präsidentin der Hexengemeinschaft Australiens? Ups.
Die Hexe vor mir stellte das volle Paket an Macht, Einfluss und politischem Kalkül dar und gehörte damit zu den mächtigsten Frauen weltweit. Etwa gleichauf mit der US-Präsidentin und der deutschen Hexenkanzlerin. Kein Mensch in einer Machtposition reichte diesen drei Frauen das Wasser. Was der Grund war, weswegen nur ranghohe und einflussreiche Personen der menschlichen Politik über die Hexengemeinschaft im Bilde waren. Die meisten Sterblichen nahmen uns als ihresgleichen wahr. Wussten nicht, dass es einen Friedensvertrag zwischen ihnen und Hexen gab, in dem wir zugesichert hatten, kriegerische Konflikte von ihnen zu lösen, aber dafür die Macht über jegliche Regierungsentscheidungen erhielten.
Weltweit gab es keinen Menschen mehr, der das oberste politische Amt innehielt – jegliches Amt war bekleidet von einem Mitglied der Hexengemeinschaft. Zu groß war die Angst der Menschen, es sich mit den Hexen des eigenen Landes zu verscherzen und so unserer übernatürlichen Macht unterlegen zu sein. Wir kontrollierten die Welt, aber regelte das alle Unstimmigkeiten und Kriege? Mitnichten, denn auch Hexen gierten nach Macht. Was dazu geführt hatte, dass die Konflikte sich verschoben hatten.
»Harlow Jammison Cassidy McQueen, hör auf zu träumen. Der Sohn des Verteidigungsministers spricht zu dir!«
Verwundert sah ich zu Oliver, der mich breit angrinste.
»Mate, hörst du mir überhaupt zu?« Mittlerweile standen wir vor meiner Mutter, die ihre Nase rümpfte bei Olis Wortwahl.
»Oliver King, immer wieder eine Freude, dich zu sehen«, begrüßte sie ihn zuckersüß.
Als ob. Meine Mutter hasste ihn und seinen Vater. Und doch hatte sie meine Hochzeit mit Olis Schwester, Ruby King, bereits vor Jahren arrangiert. Trotz dieser völlig überholten und dämlichen Tradition, Hexenhochzeiten zu arrangieren, hielt ich ihr wenigstens zugute, dass sie es für Einfluss und ein gemeinsames Kind getan hatte. Wir Hexen heirateten meist nicht aus Liebe, sondern aus Vernunft und zur Machtstärkung. Für Menschen mutete so etwas sicherlich merkwürdig an, doch für uns war es so normal wie das Singen von Zaubern – oder eben auch Cantos genannt.
Um es mit den Worten von Angelina auszudrücken: »Sohn, mich stört nicht, dass du schwul bist. Zur Urmutter, ich selbst bin bisexuell. Bei der Ehe geht es nicht um Liebe. Ihr müsst nur ein Kind zeugen, um die Blutlinien zu vereinen. Das funktioniert auf magischem Weg. Glaubst du, ich hätte mit deinem Vater geschlafen? Ganz sicher nicht! Was denkst du, wie viele Hexen neben ihrem Ehepartner einen anderen Partner lieben? Niemand verbietet dir, einen Freund zu haben.«
Richtig, ich wurde wie ein Handelsgut verscherbelt, sollte nur ein Kind zeugen und könnte nebenher einen Mann lieben. Kein Ding. Überhaupt nicht überholt, diese Vorstellung, oder invasiv in mein Leben.
Willkommen in der Familie McQueen.
JAX
SECHZIG TAGE BIS ZUM BLUTMOND
Tosender Applaus hallte über die Menge an Absolventen und deren Eltern, als der Eisprinz, wie ich ihn abfällig hinter seinem Rücken nannte, die Bühne betrat.
»Und jetzt singt unser Spitzenabsolvent Harlow Jammison Cassidy McQueen die Schulhymne für uns. Welch eine Ehre!«, schleimte die Schulleiterin mit Herzchen in den Augen. Ihr Kopf steckte so weit in seinem Arsch, dass sie freie Sicht auf seine Mandeln hatte.
Klar, der Wunderknabe brauchte drei Vornamen, weil ein einzelner nur in Kreisen wie meinem verbreitet war. Dem Pack, das keinem Coven angehörte. Mein Frühstück stieg mir die Speiseröhre empor und ich wandelte es in ein Rülpsen. Was mir wiederum ein paar pikierte Blicke von den größtenteils reichen Schnöseln einbrachte, die um mich herum saßen. Wenigstens hatte ich keinen Ruf zu verlieren, da ich nur dank eines Stipendiums und der Quote wegen hier meinen Abschluss absolviert hatte. Neben mir gab es nur zwei andere Hexen, die keinem Coven angehörten – was in den Augen der Hexengemeinschaft den Bodensatz der Gesellschaft bildete.
Im Grunde störte es mich nicht, ein Covlo zu sein, wie man uns Covenlose abfällig nannte. So blieben mir wenigstens die Regeln, Rituale und der andere aufgesetzte Mist erspart. Was mich jedoch störte, war das hässliche Gesicht meines Vaters, dem Verteidigungsminister, der in diesem Moment die Präsidentin angrinste. Bruce King hatte meine Mutter geschwängert und uns dann fallen lassen, um mit seiner perfekten Bilderbuchfamilie ein elitäres Leben zu führen.
Arschloch – wie sein Sohn Oliver, mit dem ich an der St. Andrew Academy drei Jahre Krieg geführt hatte. Einzig Ruby stellte eine Ausnahme der King-Familie dar. Man könnte meinen, sie sei eine Heilige. Pflegte verletzte Tiere, kümmerte sich um die Gärten des College, war freundlich zu jedem Wesen und passte gar nicht in die kingsche Blutlinie. Was ebenso nicht passte? Ihre Freundschaft zum Eisprinzen, denn unterschiedlicher konnten zwei Personen nicht sein.
Jeder liebte ihn. Harlow hier, Harlow da. Harlow war so nett. So schön. So freundlich. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Bla, bla, bla. Doch die Leute sahen nicht genau hin. Sein Lächeln und die Worte wirkten stets warm, in seinen Augen lag allerdings pures Eis. Wie vermutlich in seiner Seele und seinem Herzen. Nur wenn er mit Ruby Zeit verbrachte, schmolz das Eis in seinen Augen.
Ob ich neidisch war? Schon. Auf wen? Beide.
Ich hätte gern mehr Zeit mit Ruby verbracht, was dank ihres Bruders kaum möglich gewesen war, da er mich mit Beleidigungen stets vertrieb und seine Schwester regelrecht von mir abschirmte.
Na ja, und ehrlich gesagt, hätte ich auch nichts dagegen gehabt, wenn Harlow und ich jede Matratze von St. Andrew entweiht hätten. Mehrfach.
Trotz der Kälte in seinen Augen war der Typ absolut heiß. Es war nicht so, dass ich Poster von ihm an den Wänden in meinem Collegezimmer geklebt hatte – im Gegensatz zu einigen anderen Studierenden. Denn so eine Person war Harlow: eine, von der es verdammte Poster und Fanartikel zu kaufen gab. Hieß aber nicht, dass ich morgens in Gedanken an ihn nicht einige nette Momente unter der Dusche durchlebt hatte.
Das ist ganz normal für einen Mann von einundzwanzig Jahren – hab es gegoogelt. War selbst nicht sicher.
»Herzlichen Glückwunsch, Abschlussklasse!«, rief Harlow mit seinem berühmten Tausend-Watt-Grinsen von der Bühne aus. Die Menge jubelte. Ich schnaubte. Alles wie immer.
Sanft stimmte der Eisprinz die ersten Töne an. Selbst ohne dass er Magie mit ihnen verwob, gestand ich mir ein, dass er ein begnadeter Sänger war. Kein Wunder, weshalb seine Cantos unglaublich stark in Erscheinung traten. Während er die Hymne trällerte, verknüpfte er mit einer für mich erstaunlichen Leichtigkeit einzelne Töne mit seiner Magie. Ein Feuerwerk erschien am Himmel. In tausend bunten Farben tanzte es über unseren Köpfen hinweg. Formte sich neu und zeigte Bilder der Zeit an der St. Andrew. Schöne Momente, die wir erlebt hatten – alle, außer mir.
Genervt nahm ich den Blick vom Himmel und fixierte Harlow. Sein breites Grinsen und jede verdammt perfekt getroffene Note beschleunigten meinen Puls. Ich stimmte drei Töne mit meinem Zwerchfell an, ließ sie über meine Stimmbänder spielen und sang sie kaum hörbar vor mich hin. Nur einen Augenblick später wackelte die Bühne unter Harlow.
Doch anstatt sich zu verhaspeln – wie ich gehofft hatte –, lächelte Mister Perfekt nur breiter, sang fehlerlos weiter und suchte mit seinen grünen Teufelsaugen das Publikum ab. Sein Blick fand meinen, woraufhin ich zwinkerte. Die Kälte in seinen Augen verkündete eine neue Eiszeit, während sich das Lächeln auf seinen Lippen kein bisschen verzog. Das allein stellte schon eine Kunst dar. Doch dann sah ich eine Vibration an seinem Hals, die nicht zur Hymne gehörte. Unmöglich!
Ein Schwall Wasser des nahen Brunnens traf mich ins Gesicht, und dieses Mal zwinkerte mir Harlow voller Ironie zu. Er hatte es geschafft, die Hymne fehlerlos weiterzusingen und dennoch einen anderen Canto beizumischen. Wäre ich in dem Moment nicht so angepisst gewesen, hätte ich ihm applaudiert. So aber zog ich die Absolventenkappe tiefer ins Gesicht und verschränkte die Arme vor der Brust.
Hoffentlich hatte dieser Abschlusszirkus schnell ein Ende.
* * *
Eine Stunde später winkte mir die Freiheit verlockend zu. Alle Absolventen trugen ein Zeugnis in den Händen und warfen die dämlichen Kappen in die Luft, während Angehörige Fotos knipsten und freudig lachten.
Meine Mutter sah mich stolz an. Im Gegensatz zu den anderen Angehörigen mit ihren überteuerten Handys der neuesten Generation hielt sie eine alte Polaroidkamera in der Hand. Mühsam quälte ich mir ein Lächeln auf die Lippen, um ihr nicht den Tag zu verderben. Es war nicht so, dass wir arm waren, sondern bloß untere Mittelklasse – nur fühlte man sich neben der Hexenelite Sydneys schnell klein und unbedeutend. Ich kannte es nicht anders. Meine Mutter hingegen tat mir leid, da sie zuvor Teil dieser affektierten Gesellschaft gewesen war.
Vor Bruce King. Bevor sie nach meiner Geburt von der Familie King verleumdet und aus ihrem Coven sowie der High Society geschmissen wurde.
Wenigstens hatte sie nicht das gleiche Schicksal ereilt wie ihren Bruder, von dem ich nur Geschichten kannte. Dieser war zur Strafe, weil er dem Arschking ins Gesicht geschlagen hatte, auf die Schattenseite verbannt worden. Die magische Art des Gefängnisses. Auf jeden Fall munkelten die Leute das – niemand schien zu wissen, was dieser ominöse Ort in Wahrheit war.
Schwere Straftaten von Hexen wurden mit dem Verätzen der Stimmbänder geahndet oder wir wurden, so es das Gericht entschied, gänzlich verbannt. Letzteres hielt sich jedenfalls hartnäckig als Gerücht.
Ein Angriff auf einen der Minister plus ein paar geschickt gefälschte Beweise hatten ausgereicht, um meiner Familie den Stempel Verbrecher aufzudrücken. Nach der Verbannung meines Onkels und dem Ausschluss unserer Familie aus dem Coven legten sich die Gerüchte zwar, sorgten aber bis heute dafür, dass kein Coven es wagte, uns aufzunehmen.
Was den Bogen zu diesem Tag zurückschlug und ich dämlich grinsend ein Foto über mich ergehen ließ, nachdem ich mit einem Stipendium meinen Abschluss an der renommierten St. Andrew hinter mich gebracht hatte.
In den Augen meiner Mutter blitzten Tränen auf, als sie den Knopf des Fotoapparats drückte. Mit einem leisen Surren fuhr das Foto heraus und sie schüttelte es sachte. Eine hochnäsige Frau rümpfte die Nase und betrachtete meine Mutter pikiert. Ungewollt stimmte ich einen Ton in meinem Brustkorb an, während ich die olle Kuh mit finsterem Blick fixierte. Aus den Augenwinkeln sah ich meine Mutter vehement den Kopf schütteln. Sie hatte ja recht. Ohne meine Magie mit dem Ton zu verknüpfen, atmete ich aus und ein leiser Pfiff erklang.
Unser Ruf war schon schlecht genug, kein Grund, meiner Mutter weitere Sorgen zu bereiten, indem ich den pompösen Hut der hochnäsigen Trulla in Brand steckte.
Genervt schüttelte ich den Kopf und atmete tief durch, flutete so meine Lunge mit der frischen Luft. Die Mittagssonne hing schwer über dem offenen grünen Park. Sonnenstrahlen brachen durch die hohen Eukalyptusbäume hinter meiner Mutter – so golden und satt, wie sie nur im Sommer auftraten. Im Hintergrund, auf der anderen Seite des Naturhafens, tanzte das Sonnenlicht über die Dächer des Opernhauses. Allein die Aussicht und Lage, die St. Andrew ihr Eigen nannte, rechtfertigten die horrenden Schulgebühren.
Ein Grinsen legte sich auf meine Lippen und gefror nur einen Augenblick später zu einer Grimasse, als mein Blick auf eine Gruppe von fünf Leuten fiel. Sahen das Sydney Opera House und meine Mutter in dem goldenen Licht wunderschön aus, so hielten sie dennoch nicht gegen die beinah göttliche Aura des Eisprinzen stand. Die Sonne liebte ihn, umspielte seine Gesichtszüge, legte ihre Strahlen auf sein rötliches Haar und ließ es wie Feuer wirken. Es glühte förmlich, als würden ihn Flammen umspielen. Selbst die Sommersprossen auf seiner Nase schienen zu tanzen, während er Ruby anlächelte. Er besaß zudem diese ätzenden Grübchen, die ich überhaupt nicht attraktiv fand. Kein bisschen. Nein.
Zu allem Überfluss fing sein Blick mein Starren ein. Das zuvor ehrliche Lächeln verformte sich zu einer berechnenden Dämonenfratze. Zugegeben, das mochte ein wenig melodramatisch sein, dennoch verflog die Wärme aus seinen Augen. Der Winter war zurück dank Harlow – trotz 40 Grad im Schatten.
»Jax!«, rief er und winkte mich herüber.
Ich gab ein Schnauben von mir und blinzelte meiner Mutter entgegen, die jedoch mit einem Lächeln nickte. Dachte sie, ich sei mit dem Kerl befreundet? Der einzige Grund, weswegen Harlow mich zu sich rief, war vermutlich Ruby. Oder die unzähligen Reporter, die ihn den ganzen Tag umschwärmten. Ein Foto mit einem Sozialprojekt wie mir? Immer gut für sein Image. Selbst wenn in diesem Augenblick kein Reporter in der Nähe war, hieß das nichts. Diese Leute waren schlimmer als die Ibisse an der Oper, die plötzlich aus dem Nichts über ahnungslose Menschen hereinbrachen.
Mit gestrafften Schultern und Muskeln, die gespannt waren wie Klaviersaiten, schlenderte ich zu der Gruppe, in der sich auch Oliver King befand.
»Was gibt es, Eure Hoheit?«, fragte ich und vollführte einen übertriebenen Knicks vor Harlow.
»Männer verbeugen sich, Frauen machen einen Knicks«, sagte er. »Außerdem bin ich nicht königlich.«
Meinte er das ernst?
»Sehr fortschrittlich, dass du weiterhin an veralteten Geschlechterrollen festhältst«, gab ich zuckersüß zurück.
Die Ader an seiner Stirn pulsierte und färbte sich ähnlich rot wie sein Haar, von dem einzelne Strähnen in sein Gesicht hingen.
»Schnauze, Covlo«, platzte es aus Oliver hervor.
»Oliver!« Ruby boxte ihm gegen die Brust. »Das Wort ist gemein. Ich dachte, du hättest mehr Anstand. Nicht jeder hat das Glück, einem Coven anzugehören.«
Glück? Ich hielt ein abfälliges Lachen zurück.
»Was ist so witzig?« Der Prinz des ewigen Winters musterte mich mit schief gelegtem Kopf. Sollte das etwa unschuldig wirken?
»Nichts, nichts«, antwortete ich und versuchte meinen steigenden Puls zu zügeln. Doch selbst meine flachen Atemzüge konnten mich kaum beruhigen.
»Erhelle uns mit deiner Weisheit, Covl–« Bevor Oliver den Satz zu Ende sprach, räusperte sich Ruby. »Jax«, setzte er dann mit einem gequälten Lächeln nach, jedoch klang mein Name bei ihm wie eine Beleidigung.
»Na ja«, sagte ich lang gezogen. »Bedenkt man, dass unser Vater schuld daran ist, dass ich covenlos bin, Bruder, dann ist Glück vermutlich der falsche Begriff – es sei denn, Ruby meint damit heuchlerische Willkür.«
Meine Worte hingen einige Sekunden in der Luft. Stille umgab uns, so laut, dass sie nahezu schmerzte – und das, obwohl die Angehörigen einige Meter weiter fröhlich ihre Gespräche führten. Dann vernahm ich eine Vibration an Olivers Kehlkopf, die sich kurz darauf in einen Feuerball manifestierte. Gerade rechtzeitig drehte ich mich zur Seite, sodass er nur meine Schulter streifte. Alle meine Synapsen feuerten wütende Impulse zeitgleich. Wut übernahm meinen Körper. Ich kombinierte acht Töne, ließ den Bass in ungeahnte Tiefen tauchen und summte sie in einem Staccato.
Während mein Körper sich in dicken schwarzen Rauch verwandelte, weiteten sich die Augenpaare der drei Personen vor mir.
Ja, ihr Schnösel, das ist Straßenhexerei!
Doch die Verwandlung war nicht die beste Entscheidung des Tages – oder allgemein der letzten Jahre. Nun war sie jedoch schon geschehen, also bewegte ich mich auf Oliver zu, umhüllte ihn mit dem Rauch, der ihn husten ließ. Augenblicke später liefen seine Lippen blau an und die Augen quollen hervor, während meine Vernunft den Schleier der Wut durchstieß.
Ich löste den Canto auf und nahm wieder meine Form an.
»Das reicht!«, knurrte Harlow.
Die Schulleiterin eilte zu uns herüber. Ihre Nickelbrille hüpfte auf der Nase auf und ab und die Augen dahinter waren zu Schlitzen verengt. Panik stieg meinen Rücken empor, legte sich auf meinen Nacken und drohte mich zu verbrennen. Das war gar nicht gut. Hatte ich es übertrieben? Steckte ich in der Scheiße?
»Was geht hier vor?«, donnerte sie.
»Ich … das …«, stammelte ich. O verdammt. Konnten sie mir meinen Abschluss aberkennen? Hatte ich es echt am letzten Tag noch vermasselt?
»Wir haben nur etwas probiert, es ist meine Schuld«, sagte Harlow mit unschuldiger Miene. »Tut mir leid, Direktorin Carnigal.«
Ihr Blick flog zwischen ihm und mir hin und her, doch dann nickte sie. Wenn der Sohn der Präsidentin die Schuld auf sich nahm, würde sie ihm nicht widersprechen. Zum ersten Mal wurde ich Empfänger dieses Freifahrtscheins.
»Na gut, aber ihr solltet euch nur an den Belcantos probieren, die ihr hier oder in eurem Coven gelernt habt. Keine … Straßenhexerei.« Mit einem bestimmten Nicken drehte sie sich um und breitete die Arme aus, während sie gaffende Angehörige der anderen Studierenden beruhigte.
Keine Straßenhexerei … Das war natürlich leicht gesagt für sie. Immerhin gehörte sie einem Coven an, im Gegensatz zu mir.
Alle von uns Hexen konnten theoretisch jeden Belcanto lernen, doch die Realität sah anders aus. Wir beherrschten nur, was uns auch wirklich beigebracht wurde. Woher sollten wir auch sonst die anderen Lieder kennen?
In Harlows Fall waren das die Sonnen- und Licht-Cantos des McQueen-Covens plus jegliche Cantos, die wir in den drei Jahren an der St. Andrew gelernt hatten.
In meinem Fall hingegen? Tja, da wurde es schwierig.
Ich beherrschte natürlich alles, was wir hier am College gelernt hatten – sehr gut sogar. Da ich aber keinem Coven angehörte, hatte mir nie jemand weitere spezielle Cantos beigebracht.
Jeder Coven behütete seine speziellen Cantos wie ein Staatsgeheimnis und brachte sie lediglich ihren eigenen Mitgliedern bei. Nur äußerst selten gab es mal ein Tauschgeschäft, und selbst diese kamen mit Verschwiegenheitsklauseln und Strafen bei Vertragsbruch.
Ich hingegen probierte herum. Testete Töne, wie sie mit meiner Magie reagierten, und früh hatte ich gelernt, dass ich eine Affinität für Schatten- und Mond-Cantos besaß – so wie man es dem Ingram-Coven nachsagte. Jenem Coven, aus dem wir geflogen waren.
Da ich aber ohne Anleitung einfach nur herumprobierte, was meine Magie mit ausgedachten Cantos bewirkte, galt meine Art des Zauberns als Straßenhexerei. Unbeständig, gefährlich und experimentell – gesetzlich eine Grauzone und an der Grenze zum Illegalen. Von der Hexengesellschaft deswegen absolut verpönt und gehasst.
Und genau das hatte ich gerade unbedacht auf meiner Abschlussfeier zum Besten gegeben und somit jeder Person, die an mir zweifelte, recht gegeben, dass Hexen wie ich instabil und gefährlich waren.
Oliver durchbohrte mich mit seinem Blick, doch er schwieg. Was auch daran lag, dass ihn Harlow fest am Oberarm hielt. So sehr, dass dessen Handknöchel weiß hervortraten.
»Wir wollten dich nur fragen, ob du heute zum Abschlussfeuer kommst«, durchbrach Ruby mit ihrer sanften Stimme die Stille.
»Das wäre nicht schlau«, antwortete ich zähneknirschend.
»Ich finde es sogar äußerst schlau.« Harlow lächelte mich milde an. Schmolz da etwas ein Gletscher? Unmöglich. Ein freundlicher Harlow passte nicht in mein Weltbild.
»Was weiß ich schon von schlau?«, gab ich zurück, denn ich kam nicht damit klar, dass der große Harlow Sympathie für mich und meine Lage bereithielt. Es machte mich ungewöhnlich schüchtern. Und ich hasste es.
Dass Harlow mich weiterhin fixierte, brachte mich zudem ins Schwitzen. War er ein heißer Kerl? Ja, und zwar von der Sorte, die einem unangebrachte Träume bescherte.
Aber wollte ich, dass er nett zu mir war, obwohl ich in Lebzeiten keine Chance bei ihm haben würde? Bitte nicht. Das war der Stoff, aus dem Albträume und Liebeskummer gewebt wurden.
»Du bist der zweitbeste Absolvent – und das ohne Coven«, antwortete Harlow. »Ich glaube sehr wohl, dass du weißt, was es bedeutet, schlau zu handeln.«
Wieso wurden meine verräterischen Wangen denn auf einmal heiß? O Shit, ich musste hier weg. Jetzt.
»Mal sehen. Muss los.« Hektisch drehte ich mich herum und war mit wenigen Schritten bei meiner Mutter. »Mom, komm. Wir gehen. Ich helfe dir im Laden.«
»Ach Süßer, das musst du nicht.«
»Doch. Jetzt. Bitte«, murmelte ich und schob sie förmlich zum Ausgang des Parks. Weit weg von Harlow, dieser verdammten Schule und den verwirrenden Gefühlen, die ich schon seit Jahren für ihn hegte.
HARLOW
SECHZIG TAGE BIS ZUM BLUTMOND
Jax Ingram – niemand schaffte es, mich derart wütend und so schmachtend zugleich werden zu lassen wie dieser Kerl. Mein Kryptonit. Während mir seine Art ungeheuerlich auf die Nerven ging, wurden meine Knie dennoch weich, sobald ich seine volle, tiefe Stimme vernahm. Und bei der Urmutter, wann immer er sang. Totaler Fan-Boy-Modus bei mir – und das war völlig unangebracht. Wenn meine Mutter Angelina davon wüsste, wäre ich erledigt.
Also tat ich, was jeder unreife, verwöhnte Einundzwanzigjährige tat, der nicht auf sein Erbe verzichten wollte: Ich behandelte die Straßenhexe von oben herab, strafte ihn mit eisigen Blicken. Was dazu geführt hatte, dass er mich heimlich Eisprinz nannte, was ich wiederum nur durch Zufall im zweiten Jahr an der St. Andrew mitbekommen hatte, als Jax es im Vorbeigehen vor sich hin genuschelt hatte. Und später durch Ruby bestätigt worden war, die es mir grinsend verraten hatte.
Genervt pflückte ich ein Blütenblatt vom Blauen Hibiskus neben mir und warf es von unserem Balkon des Penthouse. Langsam segelte es in Richtung des Opernhauses, während ich weiterhin versuchte, Jax’ Augen aus meinen Gedanken zu verdrängen. Das Braun seiner Iriden strahlte wie die Glut von Feuer, sobald die Sonnenstrahlen sie trafen. Eingerahmt von wilden dunkelbraunen Strähnen seines Haars und unterstrichen durch die vollen Lippen, umringt von einem Dreitagebart.
Wunderbar. Jetzt dachte ich wieder an seine Lippen.
Fokus, Harlow!
»Zur Urmutter …«, murmelte ich vor mich hin. Es war Zeit, meine ungezügelte Lust in den Griff zu bekommen. Mehr würde es sowieso nie werden.
Ein Lachen hinter mir ließ mich herumfahren. Im Türrahmen zu unserem Wintergarten stand Teagan, meine Sicherheitschefin und Oberste Leibwächterin. Selbst der schlichte schwarze Anzug, die zurückgegelten Haare und die riesige Sonnenbrille, die ihr halbes Gesicht bedeckte, waren nicht in der Lage, ihre atemberaubende Schönheit zu schmälern. Egal wie sehr Teagan sich bemühte, ihr Aussehen hinter nüchterner Kleidung und der großen dunklen Brille zu verstecken, nichts vermochte ihre strahlende Aura zu dämpfen. Wieso sie in den Sicherheitsdienst der Präsidentin gegangen war, statt ein millionenschweres Supermodel zu werden, blieb mir schleierhaft.
Der Geruch von Äpfeln, nassem Tierfell und verrottendem Holz, durchzogen mit einem Hauch verbrannter Asche, wehte zu mir herüber. Als ich ihn das erste Mal gerochen hatte, war mir übel geworden, doch ich hatte mich mittlerweile dran gewöhnt. Interessant hingegen war, dass Menschen diesen Geruch wie eine Droge wahrnahmen. Sich danach verzehrten. Öfter hatte ich schon Leute begierig in die Luft schnüffeln sehen, wenn Teagan an ihnen vorbeistolziert war.
»Wieso lachst du?«, fragte ich mit einem halben Lächeln auf den Lippen.
»Weil es niedlich ist, wie du dich gegen die Liebe sträubst.« Lässig lehnte sich Teagan an den Türrahmen.
»Liebe? Warst du zu viel in der Sonne?«
»Ach Kleiner, ich rieche Liebe zehn Kilometer gegen den Wind, glaub mir. Erinnere dich an meine Worte.«
»Ja klar. Nicht nötig, denn von Liebe steht nichts im Fünfjahresplan, den Angelina für mich aufgestellt hat.«
»Wie du meinst.« Mit einem süffisanten Grinsen auf den Lippen schlenderte Teagan an meine Seite und schnupperte an mir. Dann lachte sie erneut. »Oh, là, là, die Straßenhexe. Gute Wahl. Unerwartet, ja. Aber nicht sonderlich überraschend.«
Reflexartig sprang ich ein Stück in die Luft, was Teagans Lachen nur verschärfte. »Ich habe keine Ahnung, wovon du redest!«
»Einundzwanzig müsste man noch mal sein«, antwortete sie mit einem theatralischen Seufzen.
Schreie aus dem Stockwerk unter uns durchbrachen das Geplänkel zwischen Teagan und mir. Waren das meine Mutter und Mr King?
»Harlow.« Jegliche Leichtigkeit hatte Teagans Stimme verlassen. Ihre Stirn lag in Falten, die Augen waren zu Schlitzen verengt.
»Wie können die Namen meiner Kinder in dem Buch auftauchen?«, brüllte Bruce, seine Stimme überschlug sich. Das Blut, das in meinen Ohren rauschte, war einen Moment lang das Einzige, was ich vernahm. Und es war lauter als die Wasserfälle in den Regenwäldern im Norden Australiens.
»Nicht so laut!«, keifte meine Mutter, und plötzlich verstummte das Geschrei. Sie hatte mit Sicherheit einen Canto gesungen, der ihr Gespräch verschleierte.
»Nein«, flüsterte ich, während mein Körper unkontrolliert zitterte. Instinktiv wusste ich, um welches Buch es ging. Immerhin lebte ich schon lange in diesem Haus und war mit den politischen Gepflogenheiten mehr als nur vertraut. »Bitte nicht.«
»Harlow, du kannst nichts –«, setzte Teagan an, aber ich sprintete in unsere Wohnung. Genervtes Grummeln erklang hinter mir, doch ich rannte den Flur entlang zu Angelinas Arbeitszimmer. In diesem Moment scherte ich mich nicht darum, dass mir der Zutritt verboten war.
Schwer atmend kam ich vor dem robusten Mahagonitisch zum Stehen. Neben einem Haufen Papieren und Akten lag dort ein in schwarzes Leder gebundenes Buch. Goldene Verzierungen rankten sich unablässig über die Oberfläche. Der Einband strahlte eine Kälte aus, die mich frösteln ließ. Spielte um mich, legte sich auf meine Haut und durchdrang meine Knochen. Von dem Buch der Finsternis ging eine Macht aus, die nicht von dieser Welt zu sein schien.
Mit zitternden Fingern schlug ich es auf und blätterte frenetisch durch die Seiten. Zahllose Namen flogen vor meinem Auge dahin. Jeder einzelne war mir völlig egal. Mich interessierten ausschließlich die letzten Einträge.
»Harlow, nicht«, sagte Teagan in der Tür des Arbeitszimmers. Ihre Stimme klang weich, leiser als sonst – besorgt.
Zu spät. Mein Blick verschwamm, während ich zwei Namen las.
Oliver King.
Ruby King.
Heiße Tränen rollten meine Wangen hinab. Das durfte nicht wahr sein. Ein Irrtum. Unmöglich konnten diese beiden Namen dort stehen.
Ich hob langsam den Kopf. Tränen rannen weiterhin meine Wangen hinab, während mein Atem stockend ging, denn meine Kehle war wie zugeschnürt.
»Teagan, sag mir, dass es ein Fehler ist.«
Sie schloss die Augen. Atmete tief ein und aus. Dann öffnete sie die Lider und Trauer huschte über ihr Gesicht.
»Es tut mir leid.«
»Nein!« Ich schlug das verdammte Buch zu und stürzte zur Tür. Bevor ich hindurchrennen konnte, hielt mich Teagan am Arm fest. So sehr, dass Schmerz durch meine Muskeln fuhr. Dennoch kochte die Wut in mir über und ich funkelte sie finster an.
»Lass mich sofort los. Das ist ein Befehl!«
Ohne ihren Griff zu lösen, lächelte sie traurig und entließ ein leises Schnauben.
»Mein Befehl ist es, den Sohn der Präsidentin zu beschützen. Sobald ich eine Gefahr sehe, haben weder du noch deine Mutter das Kommando – sondern ich.«
Erneut schossen mir Tränen in die Augen. Der Raum verschwamm und drehte sich rasend schnell. Kraftlos boxte ich gegen Teagans Schulter, versuchte mich zu befreien. Nur war es vergebens, ihre Kraft überstieg meine bei Weitem.
Sie zog mich in eine feste Umarmung. Ihr Eigengeruch war so prägnant wie nie zuvor. Er durchspülte den gesamten Raum und das Schwindelgefühl nahm mehr und mehr zu.
»Hör mir jetzt genau zu.« Langsam drückte sich mich von sich. Das Weiß ihrer Augen verfinsterte sich zu purer Schwärze. Für einen Augenblick erblickte ich ledrige Flügel an ihrem Rücken, doch als ich blinzelte, waren sie verschwunden.
»Du … Was … Was bist du?«, stotterte ich.
»Ein Sukkubus, aber das spielt jetzt keine Rolle. Willst du mein wahres Wesen diskutieren oder deine Freunde retten?«
»Ich …« Keine Ahnung, was die Antwort darauf war. Beides? Mit offenem Mund starrte ich meine Leibwächterin an.
»Wo sind Oli und Ruby?«, fragte sie mit fester Stimme.
»Beim Feuer. Sie eröffnen es. Ich wollte gleich dorthin.«
»Okay. Hör mir nun wirklich ganz genau zu, Harlow.«
Ich nickte benommen. Spürte, wie ein Tropfen Schweiß meine Stirn hinablief.
»Kein Wort zu deiner Mutter. Du hast die Namen nie im Buch gesehen, verstanden? Wisch dir die Tränen aus dem Gesicht und streif die fröhliche Maske über.«
»Was? Ich –«
»Zuhören, habe ich gesagt!«, fuhr Teagan mich an. »Wenn Madam President erfährt, dass du es weißt, lässt sie dich nicht zum Feuer. Und das bedeutet, dass wir keine Chance haben, deine Freunde zu erreichen, bevor … sie verschwinden. Wenn sie es nicht ohnehin schon sind.«
Ich wusste nur vage etwas über das Buch – das einzig Sichere war, dass jede Person, deren Name darin erschien, spurlos verschwand. Aus Reflex griff ich nach meinem Handy und Teagan nickte mir zu. Per Kurzwahl rief ich Oli an. Mailbox. Seine Stimme sagte den üblichen lustigen Spruch, doch bevor er zu Ende gesprochen hatte, legte ich auf.
Zittrig wählte ich Rubys Nummer. Ebenso Mailbox. Scheiße. Beide waren sonst immer erreichbar für mich.
»Wir müssen los«, durchbrach Teagan meinen Schreck. »Jetzt!«
* * *
Vermutlich hätte es mich mehr verstören müssen, wie einfach es mir gefallen war, die lächelnde Maske überzustreifen und zu tun, als wäre alles cool. Angelina hatte mir sogar viel Spaß beim Feuer gewünscht und sich ein unechtes Lächeln auf die Lippen gequält.
Was für ein Monster war ich geworden? Selbst die australische Präsidentin schaffte es nicht, eine glaubwürdige Maske anzulegen in der drohenden Gefahr.
Meine beiden einzigen, echten Freunde standen kurz davor zu verschwinden, oder waren es längst, und ich spielte den unbekümmerten Freund? Wann hatte ich es geschafft, meine Gefühle von meinem Körper zu trennen?
Eisprinz.
Jax’ Worte hallten mir durch den Kopf. War ich wirklich eiskalt und verdiente den Spitznamen: der Eisprinz?
»Harlow, Fokus«, sagte Teagan, während sie den Wagen am Strand von Manly Beach einparkte. »Wenn du dich nicht konzentrierst, dann brechen wir es sofort ab. Zur Urmutter, ich hätte dich gar nicht erst mitnehmen dürfen. Es ist zu gefährlich!«
»Danke, dass du es getan hast«, antwortete ich leise und legte meine Hand auf ihren Unterarm. Sie lächelte mir milde zu und nickte.
»Du machst, was ich sage. Verstanden?«
Ich atmete tief durch. »Das kann ich dir nicht versprechen.«
»War von auszugehen«, murmelte sie. »Glaub mir, du hast keine Ahnung, wie gefährlich es ist, und wie unsinnig meine Entscheidung ist, zusammen mit dir hierherzukommen. Wenn dir etwas passiert, erwürge ich dich zusätzlich. Sei bereit, dein ganzes Arsenal an Belcantos zu nutzen.«
Wir lächelten uns einige Augenblicke lang an, entschlossen und nicht fröhlich. Dann nickte Teagan und wir stiegen aus dem Auto.
Schweigend eilten wir die Promenade entlang, die den Hauptstrand von der geschützten Bucht Shelly Beach, in der das Feuer brannte, trennte. Fünf Minuten später stand ich mit flachem Atem, beinah paralysiert auf dem feinen gelben Sand. Funken stoben aus dem Feuer durch die anbrechende Nacht und verflogen in dem klaren Himmel. Gut dreihundert junge Hexen von St.Andrew tummelten sich hier. Mehrere Stände mit Essen und Getränken standen um das Feuer. Doch mein wilder Blick fand Ruby und Oli nicht unter ihnen. Laute Musik dröhnte über das Meer, während ein paar Leute tanzten. Auch hier sah ich meine Freunde nicht. Verdammt, wo waren sie?
Überall vernahm ich Gespräche, lachende Absolventen und sah feiernde Jugendliche. Einige spielten Beerpong, weitere badeten im seichten, klaren Wasser der Bucht. Unter anderen Umständen hätte ich die Party genossen. Immerhin war sie das Event des Jahres für Studierende an der St.Andrew. Doch mein Blick suchte weiterhin panisch nach Oliver und Ruby.
Eine Gruppe, unter der sich auch Freunde der Geschwister befanden, stach mir ins Auge. Ich rannte zu ihnen.
»Habt ihr Oli gesehen?«, fragte ich mit zittriger Stimme.
»Hey, McQueen, du bist da!«, brüllte ein betrunkener Freund von Oli aus dem Rugbyteam und versuchte mir ein High Five zu geben.
»Wo ist Oli?«, hakte ich nach, ignorierte die Geste.
»Keine Ahnung, Mate. Vermutlich irgendein Mädel abschleppen.«
Eine junge Hexe, die mit Ruby befreundet war, boxte dem Typen gegen den Oberarm.
»Was? Jeder weiß, dass Oli nur Spaß sucht und seine Freundinnen täglich wechselt!« Er lachte laut.
»Kein Grund, das so zu feiern, du Prolet«, murmelte sie und funkelte ihn genervt an.
»Weißt du, wo Ruby ist?«, fragte ich die junge Hexe. Aus dem betrunkenen Kerl würde ich keine Antworten herausbekommen.
Ihr Gesicht verfinsterte sich. »Ich … Nein … Harlow, ich …«
»Hey, sag es mir einfach!«, forderte ich ungewollt schroff. »Sie bekommt keine Probleme, versprochen«, setzte ich freundlicher nach.
»Ich dachte, sie hätte wie immer die Finger vom Alkohol gelassen. Aber sie benahm sich plötzlich so komisch. Ihre Augen waren glasig und ihre Stimme verwaschen.«
»Ruby trinkt keinen Alkohol«, stimmte ich ihr zu.
»Genau. Aber sie redete wirr. Von Bäumen und einem Wald. Ich habe Oli mit ihr in Richtung Buschland torkeln sehen. Vermutlich will er sich abseits um sie kümmern.« Das schlechte Gewissen schwang deutlich in der Stimme der jungen Hexe mit.
Jede von uns Hexen bekam von Kindesbeinen an eingebläut, dass wir große Ansammlungen von Bäumen und Büschen zu meiden hatten. Nur den Hyde-Park inmitten von Sydney durfte ich besuchen, wenn ich die Lust nach Natur verspürte, da der Baumbestand dort verteilter war als im Buschland.
Zur Urmutter, ich erinnerte mich noch genau, wie Angelina ausgerastet war, als ich fragte, ob wir die Blue Mountains besichtigen könnten. Kilometer von Eukalyptusbäumen bildeten dort eine riesige Waldlandschaft, die durch den Dunst der Bäume blau schimmerte. Nie zuvor hatte ich Angelina so wütend und verängstigt zugleich erlebt. Es erübrigte sich zu erwähnen, dass ich nach einundzwanzig Jahren nicht einmal in die Nähe der Blue Mountains gekommen war, oder?
Teagan musterte die junge Hexe, dann mich. Sie schüttelte kaum merklich den Kopf. Ihre Augen waren durchtränkt von Sorge, die vollen Lippen zu einer dünnen Linie zusammengepresst.
Ich hingegen hatte genug. Diese unnormale Angst vor Bäumen, die uns Hexen anerzogen wurde wegen eines unsinnigen Märchens, würde mich nicht davon abhalten, nach meinen Freunden zu sehen.
Was bitte sollten Bäume so Schreckliches ausrichten? Immerhin beherrschte ich mehrere Feuer-Cantos. Selbst wenn die Dinger zum Leben erwachten, was völlig abwegig war, würde ich sie locker niederbrennen.
Entschlossen stapfte ich Richtung Buschland, das die Bucht zur Nordseite vom Ozean trennte.
»Hey!«, sagte Teagan energisch und hielt mich an der Schulter fest.
»Lass los!« Wir starrten uns finster an. Einige Momente vergingen, dann seufzte sie und entließ mich.
»Ich bin die schlechteste Leibwächterin überhaupt«, murmelte sie, während sie mit schweren Schritten an mir vorbei zum Buschland ging.
Erstaunt starrte ich ihr hinterher, denn ich hatte mit deutlich mehr Diskussion gerechnet.
»Willst du ewig da stehen bleiben?«, rief sie mir mit einem Blick über die Schulter zu. »Halt deine Stimmbänder bereit. Das wird gefährlich. Verstanden?«
Ich nickte und eilte ihr hinterher.
JAX
SECHZIG TAGE BIS ZUM BLUTMOND
Ich saß auf unserem Balkon in Manly und flocht eingeweichte Ästchen von Eukalyptusbäumen mit Hibiskuszweigen zusammen. Der markante Duft umspielte meine Nase, während ich Wermutkraut in kleinen Büscheln dazwischenwebte. Ein paar Minuten später bildete ich aus dem Zopf einen Kreis und stimmte eine kurze Melodie an.
Funken tanzten über die beiden Enden und verschmolzen den Strang zu einem Talisman. Pfeifend – ohne den Tönen Magie beizumischen – griff ich nach dem Himalajasalz und den kleinen Jaspis. Hellrot durchzogen mit dunkleren Flecken leuchteten sie in der Abendsonne. Ich zerrieb das Salz und streute es auf den Talisman. Danach legte ich drei Jaspis ins Zentrum und pfiff eine Melodie, deren letzten Ton ich hielt. Feuer flammte aus meinem Mund, und ich blies es so lange auf die Steine und das Salz, bis sie fest mit dem Schmuckstück verschmolzen.
»Du bist so talentiert, mein Kleiner.«
Ich schreckte hoch, wobei mir der Talisman auf den Tisch fiel. Meine Ma lächelte mich fürsorglich an.
»Und du vergisst die Welt um dich, sobald du Sachen erschaffst.«
Damit hatte sie recht. Es war meine Art der Meditation. Immer wenn ich nicht mehr nachdenken wollte, bastelte ich magische Artefakte, Talismane und andere kleine Konstrukte.
»Dein Onkel wäre stolz auf dich«, flüsterte sie und seufzte. »Er war ebenso ein begnadeter Bastler. Wie unsere gesamte Familie. Wobei ich nicht gut im Konstruieren bin.«
Leise lachte ich auf und grinste. »Nicht gut ist eine Untertreibung.«
»Och, du kleiner Fiesling.« Meine Mutter schlug verspielt mit einem Küchentuch nach mir.
»Deine Tränke, Salben und Tees sind dafür in ganz Sydney beliebt.«
Während das Konstruieren mir in die Wiege gelegt worden war, hatte meine Mutter das Talent für Alchemie erhalten. In Kombination erschufen wir lauter Waren, die Menschen und Hexen zu gleichen Teilen begehrten. Unser Laden lief ordentlich. Zwar waren wir keine reichen Schnösel, aber wir vollbrachten etwas Gutes und davon ließ sich leben.
Meine Mutter betrachtete den Talisman, dann lachte sie laut. Ich zog fragend eine Augenbraue in die Höhe.
»Ein Liebestalisman zur Steigerung der Lust und Potenz?«
Verwundert sah ich zu dem roten Jaspis. Mist. Der Plan war es gewesen, Bernstein zu verarbeiten, da dieser Entscheidungen erleichterte und Ängste nahm. Wieso hatte ich die Sexsteine genommen, wie wir Jaspis scherzhaft zu Hause nannten?
»Denkt da jemand an einen attraktiven Sohn unserer Präsi–«
»Nein, denkt er nicht!«
Doch, total. Andauernd. Das war ja mein Problem!
»Wolltest du nicht Bernsteintalismane herstellen?«
Mehr oder weniger unauffällig schob ich den Sack voller Bernsteine unter den Tisch.
Meine Mutter lachte so laut, dass sie sich vornüberbeugte. Ich stimmte ein, und für ein paar Minuten genoss ich diesen Moment mit ihr.
»Er macht mich wahnsinnig«, gab ich zähneknirschend zu. »Ich hasse ihn, wirklich, und dennoch … geht er mir nicht aus dem Kopf.«
»Er ist halt ein McQueen – so war das schon immer. Die Ingrams hatte seit jeher eine Schwäche für sie.« Meine Mutter lächelte mir zu und tätschelte meine Schulter. »Es gab eine Zeit, da herrschte eine Fehde zwischen den beiden Gründerfamilien. In einer anderen Epoche, beinah einer anderen Welt, mein Junge.« Sie setzte sich ins Innere in Bewegung. »Da wärt ihr als Romeo und Julius bekannt geworden.«
»Romeo und Julius, Ma? Wirklich?«
»Eine dramatische Liebe.« Sie blieb stehen, sah noch einmal zu mir. »Ein Tipp: Schluck kein Gift, bevor du nicht seinen Puls gecheckt hast.«
Mit offenem Mund stand ich da und sah ihr hinterher.
»Ach, es gibt übrigens Essen. Wenn du gleich auf eurer Party trinkst, brauchst du eine Grundlage.«
Langsam trottete ich ihr hinterher in unser Wohnzimmer und weiter in die Küche. Dort lehnte ich mich in den Türrahmen und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Ich gehe da eh nicht hin.«
»Jax Ingram, natürlich gehst du da hin!«
»Mit drei Vornamen wie beim großen Harlow hätte das definitiv bedrohlicher geklungen. Blöd, dass wir nur entfernte Verwandte der Gründerfamilie Ingram sind und keine direkten Nachfahren«, scherzte ich und lachte. Erwartete ich, dass sie mit einstieg, irrte ich mich jedoch. »Ma?«
»Es gibt Lasagne, die liebst du doch.«
»Äußerst subtil.«
Seufzend drehte sie sich zu mir. In ihren Augen lag die Last von all dem Mist, der uns widerfahren war.
»Ach Jax.« Sie kam zu mir herüber und fuhr mit der Hand durch mein Haar. »Ich wollte es dir ohnehin nach dem Abschlussfeuer sagen. Irgendwann erfährst du es eh.«
»Was meinst du?«
»Dein Geburtsname ist Jax Gunnar Baldwin Ingram. Wir sind keine von den Ingrams, die nur entfernt in diese Familie eingeheiratet haben.«
»Aber ich dachte, dein verstorbener Mann …«
»War kein Ingram, ich bin eine. Und nicht nur irgendeine. Gunnar und ich sind Kinder der ersten Ingrams. Du bist ein direkter Nachfahre. Es … tut mir leid. Ich hatte geplant, es dir … Na ja, einfühlsamer zu beichten? Aber es gibt Gründe …« Ma kräuselte die Nase und Sorge blitzte in ihren Augen auf.
»Das ist unmöglich.« Ich schüttelte den Kopf. »Das hätte sich herumgesprochen nach … nach der Sache mit Bruce King.«
Meine Mutter setzte sich auf einen Stuhl und bedeute mir, mich ebenso hinzusetzen.
»Sie haben mir alles genommen, aber wenigstens die Familienehre haben sie uns Ingrams gelassen. Nur die Obersten Hexen der Gründerfamilien wissen darüber Bescheid. Und Bruce. Aber er wurde mit einem Schweige-Belcanto belegt. Alle anderen Hexen mit einem Vergessens-Belcanto. Durch den Belcanto wurden meine ganze Identität, Alter und Herkunft in allen offiziellen Dokumenten geändert, und jeder glaubt, ich sei eine eingeheiratete Ingram. So blieb der Familienname makellos.«
Wütend ballte ich meine Hände zu Fäusten. »Hatte er deswegen eine Affäre mit dir?! Um ein Ingram zu werden?«
Ma nickte traurig. »Als ich ihm sagte, dass wir bei einer Heirat seinen Namen annehmen würden, ließ er uns sitzen.«
»Aber wieso wolltest du seinen Namen?«
»Weil er schon zwei Kinder hatte.«
»Ich verstehe nicht.«
»Das wirst du. Wir vier Gründerfamilien von Sydney und ebenso die anderen acht großen Blutlinien der Welt haben viele Geheimnisse. Eines sind die Blutgaben. Die Ingrams besitzen die Gabe des Konstruierens.« Sie lächelte mir milde zu und deutete zu einem Talisman, der auf dem Küchentisch lag. »Es ist kein Zufall, dass wir Gegenstände so gut herstellen können. Die McQueens beherrschen das Erwecken. Dubois die Hellsicht. Und Rinaldi das Umformen.«
Ich sah sie weiterhin fragend an, denn ich verstand nichts.
»Nur die unmittelbaren Nachfahren der alten Blutlinien besitzen Gaben, alle anderen Hexen mit vermischten oder schwächeren Blutlinien beherrschen ausschließlich Belcantos als Magie, mein Kleiner.« Müde lächelte sie mir erneut zu. »Deswegen konnten Ruby und Oliver nicht den Namen Ingram annehmen – die Kinder der alten Blutlinien müssen von einer Hexe des alten Bluts geboren werden. Es ist kompliziert. Viele Regeln, uralte Belcantos und Sitten sorgen für die Einhaltung. Eine Hexenhochzeit verändert dein Blut. Heiratest du einen direkten Nachfahren einer alten Blutlinie, wirst du einer von ihnen. Dein Blut verwandelt sich in das der jeweiligen alten Linie. Dieser Transformationszauber wirkt aber nur, wenn du bisher keine Kinder gezeugt und dein Blut nicht vererbt hast – was Bruce durch Oliver und Ruby schon getan hatte. Wie du weißt, heiraten wir Hexen hauptsächlich aus Vernunft und nur selten aus Liebe. Es dient zur Stärkung der Macht und des Einflusses. Und eine Hexenehe ist nur erlaubt, wenn du kinderlos bist. Nur war ihm das nicht klar, bis ich es ihm sagte. Du hingegen wurdest von mir geboren und hast deswegen das reine Ingram-Blut in dir.«
»Der Hundesohn hat dich ausgenutzt und dann fallen lassen, als er nicht bekam, was er sich zu erschleichen versuchte!«
»Er ist immer noch dein Vater«, flüsterte sie.
»Nein, ist er nicht.« Ruckartig erhob ich mich. »Ein Vater wäre für seinen Sohn da gewesen und hätte unsere Familie nicht ruiniert!«
»Jax, Süßer. Bitte.«
»Nein, Ma. Es reicht. Du musst ihn nicht in Schutz nehmen.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte ich mich um und stürzte aus der Wohnung.
* * *
Eine halbe Stunde rannte ich ziellos durch die Gegend, steckte ein paar Büsche in Brand und jagte Mülltonnen in die Luft. Nun stand ich wieder vor unserer Haustür. Ich hatte zwar weiterhin keine Lust auf die Feier, aber ich wollte meine Gedanken betäuben – und dafür benötigte ich Alkohol. Und den gab es in Massen bei der Feier. Keine sonderlich intelligente Lösung, meine Gefühle damit zu betäuben, aber definitiv eine effektive. Was ich außerdem brauchte: Ablenkung. Nur deswegen machte ich mich schließlich auf den Weg zum Abschlussfeuer.
Zum Glück lag Shelly Beach, an dem es stattfand, nur ein paar Gehminuten von unserer Wohnung entfernt. Genervt begab ich mich in den Durchgang, der neben dem Laden meiner Mutter zu dem mittleren Teil von Manly Beach führte. Einzelne Sonnenstrahlen fanden ihren Weg in die enge Gasse. Sie klammerten sich an die Oberflächen von Müllcontainern und Sperrmüll, als würden sie der Nacht keinen Platz machen wollen.
»Hey, Stinker, herzlichen Glückwunsch!«, erklang es von der Promenade am nördlichen Ausgang der Gasse. Das Licht umspielte die gut trainierte Statur einer ansonsten zierlichen Frau.
Grinsend näherte sich mir Eliss, die ich nun besser erkannte, wo mich die Sonne nicht mehr blendete. Ihr blaues kurzes Haar leuchtete so grell wie eine Neonreklametafel und stand zu einem Iro gestylt gen Himmel. Sie hatte die dreifach gepiercte Augenbraue in die Höhe gezogen. In ihrer Nase wackelte ein Septum und hing beinah hinab bis zu den Piercings in ihrer Oberlippe. An ihrem Oberarm klebte Folie.
Eliss folgte meinem Blick und grinste breit.
»Frisch gestochen. Gleiches Motiv wie auf dem Shirt.« Stolz straffte sie ihr grellgelbes Top mit der Aufschrift Fuck The System.
»Ein Wunder, dass du überhaupt noch einen Platz findest, der tätowiert werden kann«, antwortete ich eine Spur zu scharf und bereute es unmittelbar darauf. Sie konnte nichts für den Sturm, der in mir tobte. Zwar hatten die Mülleimer, die ich hochgejagt hatte, meine Laune etwas gebessert, aber dennoch kochte die Wut weiterhin in mir. Und das wiederum nervte mich ungemein. Der Arschking war es nicht wert, dass ich nur einen Gedanken an ihn verschwendete.
»Hey, ich habe nur …« Eliss zog die Nase kraus. »Zehn, na ja, elf Tattoos. Was hat dir die Laune verhagelt?«
»Bruce King!«
»Yikes!«
»Ja, genau!«
»Willst du drüber reden?«, fragte sie mit schief gelegtem Kopf.
»Eher nicht. Alternativplan: Wir trinken den reichen Säcken ihren Alk weg.«
»Deal! Vielleicht finde ich da eine Bettpartnerin oder einen Partner für heute Nacht.« Abwechselnd hob und senkte sie die Augenbrauen, und ich kommentierte es mit einem Grunzen. »Was denn? Ich bin nicht so wählerisch wie du und schmachte direkt den Sohn –«
»Nicht.«
»Schon gut. Du bist heute echt empfindlich.« Sie hob entschuldigend die Arme.
»Ma hat eine Bombe über mein Leben platzen lassen. Können wir nicht drüber reden?«
»Oh!« Ihre Augen weiteten sich und ihre Wangen erblassten.
»Eliss?« Ich musterte meine Kindheitsfreundin. »Du … wusstest es.«
»Zur Urmutter«, antwortete sie brummend und trat nach einem Pappkarton am Boden. »Ja, Stinker. Ich wusste es. Schon immer.«
»Wie konntest du es mir verschweigen?«, donnerte ich.
»Fuck!«, brüllte sie in den anbrechenden Abend. »Weil es meine Aufgabe ist, dich zu beschützen. Verdammt, hätte deine Mutter mich nicht vorwarnen können?«
In meinem Kopf verknoteten sich die Gedanken. Kein einziger ergab Sinn.
»Deine Aufgabe?«
»Bevor wir hier einen auf großen Hollywoodfilm-Streit machen und du dramatisch davonstürzt: Unsere Freundschaft ist echt. War sie immer. Ich habe dir nie etwas von den Gefühlen vorgespielt.«
»Wovon redest du?« Verwirrt schüttelte ich den Kopf.
Eliss seufzte. Für einen Moment sah sie mir fest in die Augen, dann drängte sie mich tiefer in die Gasse.
»Ich bin in deiner Welt, um dich zu beschützen. So eine richtige Bad-Ass-Aufpasserin. Nur in supercool.« Sie lächelte gekünstelt. Bevor ich etwas antwortete, führte sie eine Handbewegung aus und …
»Shit!« Mit geweiteten Augen sprang ich einen Satz zurück.
An einigen Stellen durchbrachen verwelkte Apfelblüten und morsche Zweige Eliss’ aschgraue Haut. Grünliche Adern schimmerten wie kleine Wurzeln hindurch. Ihr Gesicht wirkte abgemagert, als hätte sie monatelang kaum gegessen. Der Geruch von Äpfeln, verbrannter Asche und verrottetem Holz stieg mir in die Nase, während sie mich aus pechschwarzen Augen musterte.
»Überraschung, ich bin eine Banshee.« Trotz der Situation grinste ich, als sie einen Tanz mit Jazzhänden zur Unterstreichung der Aussage vollführte.
»Was geht hier ab? Träume ich?«
»Wacher, als du es je warst, Stinker.«
»Mutig, mich Stinker zu nennen, wenn du selbst wie ein vergammelter Komposthaufen riechst.«
Eliss blinzelte einmal. Ein zweites Mal. Dann lachte sie schallend los.
»Touché, mein Lieber.« Sie vollführte eine übertriebene Verbeugung. »Aber mal im Ernst, es gibt vieles, was du nicht weißt. Was aus guten Gründen vor dir geheim gehalten wurde.« Gerade als ich etwas erwidern wollte, legte Eliss eine Hand auf meine Schulter und schüttelte den Kopf. »Nicht hier. Ich verstehe, dass du Fragen hast, aber hier draußen ist es zu gefährlich, darüber zu reden. Wir sollten rein–«
Ihr Blick wurde plötzlich glasig. Schwarze Schatten wirbelten in ihren Augen umher. Dann flatterten ihre Lider.
»Eliss?« Ich rüttelte sie besorgt. Mein Puls hämmerte laut und pumpte das Blut schnell durch meine Adern. »Eliss, komm schon! Das ist nicht witzig.«
Keine Reaktion. Shit!
Auf einmal flog ihr Kopf in den Nacken und sie murmelte Worte in einer Sprache, die ich nicht verstand. Ihr Körper zitterte und verkrampfte. Hilflos sah ich meine Freundin an. So plötzlich, wie ihr Anfall gekommen war, verebbte er wieder. Die Schatten in Eliss’ Augen wichen. Mein Atem ging stoßweise.
»Was zur Urmutter war das?« Ich legte eine Hand an ihren Oberarm.
»Wir müssen zum Feuer!«
»Was? Du hattest einen Anfall und willst feiern?«
»Jetzt, Jax. Die Hexenkönigin und der Wald von Salem haben den Befehl erteilt, zwei Hexen aus der Lichtwelt zu holen.« Elias drehte sich um und zerrte mich mit sich zur Strandpromenade.
»Ich verstehe kein Wort!« Es kostete mich große Mühe, nicht zu stolpern, so fest hielt sie ihren Griff und zog an mir.
»Lange Geschichte.« Ihre Stimme klang flatterig und weiterhin atemlos. »Kurzform: Ich habe eine Verbindung zum Wald, und wenn er seine Kinder ruft, höre ich den Befehl.«
»Aha. Welcher Wald? Und was hat das mit mir zu tun?«
»Er will deine Geschwister, Ruby und Oliver.«
Mit diesen Worten drehte sich die Welt deutlich schneller um mich, geriet aus ihren Fugen, während Panik seine kalten Klauen in meinen Geist stieß.
HARLOW
SECHZIG TAGE BIS ZUM BLUTMOND
Mit großen Schritten eilten Teagan und ich die gut hundert Meter zum Buschland. Wir erreichten eine schmale Treppe aus eierschalenfarbenem Stein, die auf die Anhöhe, gefüllt mit Bäumen und Büschen, führte. Allesamt wirkten bräunlich statt grün. Die Sommerhitze Sydneys setzte ihnen zu, und wenn sich niemand täglich um sie kümmerte, wie es im Hyde-Park der Fall war, verloren sie schnell ihr grünes Farbkleid.
Im Licht der untergehenden Sonne und des nahen Lagerfeuers wirkte das trockene Buschland wie aus einem Horrormärchen. Die braunen, kargen Äste streckten sich, in diesem Licht unheimlich glühend, nach uns aus und mir lief ein Schaudern den Rücken hinab. Die antrainierte Angst vor Wäldern funktionierte offensichtlich blendend.
Ich schüttelte den Gedanken ab. Es waren nur Pflanzen, was sollten sie mir antun? Teagan hielt mich am Arm, bevor ich die Stufen hinaufrennen konnte.
»Ich gehe vor! Harlow, du hast keine Ahnung, mit wem wir uns anlegen.«
Trotz des Impulses zu diskutieren nickte ich ihr zu. Selten hatte ich ihre Stimme so angespannt und von Angst durchzogen erlebt. Teagan gehörte zu den furchtlosesten Personen, die ich kannte, und doch zitterten ihre Hände, wie ich bemerkte. Auch aus dem Grund ließ ich ihr den Vortritt und folgte schweigend. Leise summend bereitete ich meine Stimmbänder darauf vor, sie im Notfall einzusetzen. Einmal eingestimmt, gestaltete es sich deutlich einfacher, Cantos zu singen.
Am Treppenabsatz angekommen, betraten wir den ausgetretenen Sandpfad, der zwischen den Bäumen hindurchführte. Gesäumt von Büschen und vereinzeltem Abfall, vermutlich mal wieder von Touristen, lag er still im Zwielicht. Die Musik vom Lagerfeuer in der kleinen Bucht wurde durch den dichten Bewuchs der Natur geschluckt. Nur der Bass wummerte über den Boden, mischte sich mit dem Knirschen der Blätter unter meinen Schuhen und dem Zirpen der Heuschrecken.