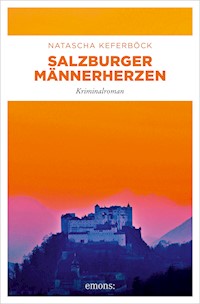
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Raphael Aigner
- Sprache: Deutsch
Kauzige Charaktere treffen auf schrägen Humor und Salzburger Charme. Als am Eröffnungsabend des jährlichen Volksfests ein umstrittener Lokalpolitiker tot aufgefunden wird, drängt sich die Frage auf: War es ein Mord aus Eifersucht, oder war der Mann in ein krummes Ding verstrickt? Kommissar Aigner stürzt sich kopfüber und mit zweifelhaften Methoden in die Ermittlungen und bekommt es mit unwirklich schönen Schönheitschirurgen, Kleinkriminellen und zwielichtigen Oldtimerliebhabern zu tun.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichten zu erzählen hat für Natascha Keferböck, Jahrgang 1969, schon als Kind eine wichtige Rolle gespielt. Mit dem Aufschreiben hat sie allerdings erst später begonnen. Sie ist seit vielen Jahren beruflich in der Technik- und Finanzwelt zu Hause. In ihren Flachgauer Krimis rund um das fiktive Dorf Koppelried bei Salzburg zollt die Autorin ihrer Liebe zum Salzburger Land und seinen Menschen humorvoll Tribut.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang befindet sich ein Glossar.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Westend61/Axel Ganguin
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Christiane Geldmacher, Textsyndikat Bremberg
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-048-8
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Wer am Ende ist, kann von vorn anfangen, denn das Ende ist der Anfang von der anderen Seite.
Donnerstag
»Chef, da ist jemand ins Radar g’fahren. Auf der B158 in Richtung Salzburg, aber noch in unserem Zuständigkeitsgebiet.« Die Gerti steckt den Kopf durch die Tür zu meinem Büro, die ich beinahe immer geöffnet habe.
»Ja und? Was hat das mit uns zu tun? Der Fahrer wird seine Strafe schon bekommen, sobald die Radarmessungen ausgewertet werden.«
Die Gerti, unsere Verwaltungsangestellte und meine allerliebste Sekretärin, grinst von einem Ohr zum anderen. »Aber nein, Chef, ein Mann ist in den Radarkasten selbst g’fahren. Das Renaterl ist grad zufällig mit dem Auto vorbeigekommen und hat uns informiert. Dem Fahrer scheint nix passiert zu sein, aber i hab vorsichtshalber die Rettung g’rufen.«
Das schaue ich mir persönlich an, denke ich mir schmunzelnd, wenn uns schon mal einer direkt in den Radarkasten kracht. Also hole ich den Schorsch, Gruppeninspektor Baumgartner, und kurz drauf brausen wir mit dem Streifenwagen Richtung Bundesstraße.
An der Unfallstelle winkt uns die Renate zu und weist uns professionell zwischen dem Rettungs- und ihrem Wagen ein, während die blitzgelben Hosen im leichten Föhnwind um ihre dünnen Beine flattern. Sie ist unsere Kirchen-Organistin, aber eher Buddha als dem lieben Gott zugetan. Erst vor Kurzem hat sie ihren Klavierlehrerinnenjob an den Nagel gehängt und Maries ehemaliges Feinkostgeschäft gemietet. Keine zweihundert Meter von unserer Kirche entfernt, hat sie dort mit inoffizieller Billigung unseres Pfarrers eine Art Asia-Laden eingerichtet, den ich meide, so gut es geht. Obwohl ich sie wirklich mag. Aber schon einige hundert Meter vor der Ladentür steigt einem der unerträglich aufdringliche Geruch von ganzen Büscheln Räucherstäbchen in die Nase.
Mit einem Grinsen lasse ich die Seitenscheibe herunter. »Na, Renate, es scheint, du hast alles perfekt im Griff. Brauchst du uns überhaupt noch?«
Die große, hagere Organistin im schwarz-weiß gestreiften T-Shirt lacht so sehr über meinen kleinen Scherz, dass die runde Metallbrille auf der Nase auf und ab hüpft. »Aber geh, Raphi! Natürlich brauch ich euch. Also, passiert ist dem Fahrer zum Glück nix, der Notarzt schaut ihn sich grad an. Ich glaub, der Mann ist nüchtern und war meiner Meinung nach halt ein bisserl zu schnell unterwegs.«
Kein Wunder bei dem Auto, denke ich mir, während ich aussteige. Ein blitzblauer Porsche Panamera Turbo mit Salzburger Kennzeichen hat das Radar frontal gerammt und sich dann förmlich um den aus der Verankerung gerissenen Kasten herumgewickelt. Neugierig gehe ich näher ran, weiche aber gleich wieder zurück. Die gesamte Technik ist quasi aus dem Beton herausgerissen, und aus einigen der losen Kabel funkt es verdächtig. Also bitte ich rasch meinen Polizisten, die Straßenaufsicht zu verständigen, damit ein Techniker die Stromzuleitung zum Radarkasten prüfen kann. Nicht dass noch etwas Schlimmeres passiert.
Ein kurzer Blick ins Auto zeigt mir, da wurde offenbar während der Fahrt mit dem Handy hantiert. Denn das Mobiltelefon lugt unter dem Airbag auf dem Boden vom Fahrersitz hervor.
»Ui, beim Fahren mit dem Handy spielen, das konnte ja net gut gehen.« Neugierig schielt mir unsere Organistin über die Schulter. Ich drehe mich zu ihr um und ziehe sie sanft, aber bestimmt von der Unfallstelle weg.
Während der Schorsch vorschriftsmäßig den Unfallort sichert, folgt mir die Renate zum Krankenwagen, der in sicherem Abstand zum Unfallauto geparkt hat.
Auf der Ladefläche sitzt ein Mann mit silbergrauer Lockenmähne im schmalen Business-Outfit. Der Notarzt misst seinen Blutdruck am linken Arm, während der Verursacher des Unfalls lässig sein Sakko über die rechte Schulter hält.
»Glück gehabt, dass Ihnen bei dem Buserer nix Schlimmes passiert ist.« Der Arzt packt seinen Blutdruckmesser zurück in die Tasche. »Ich möchte Sie trotzdem ins Krankenhaus zu einem kurzen Check mitnehmen, wir wollen ein Schleudertrauma so gut es geht vermeiden, gell.«
Der elegant gekleidete Lockenkopf winkt lässig ab und antwortet in gepflegtem Hochdeutsch: »Danke, ich weiß selbst am besten, wie es mir geht. Ich bin zufällig auch Arzt, und ins Krankenhaus gehe ich bestimmt nicht. Wenn Sie mich allerdings nach Salzburg mitnehmen würden, Herr Kollege, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Ich müsste nämlich dringend zu einem Termin.«
»Wie Sie wollen, dann aber auf Ihre Verantwortung«, antwortet sein Gegenüber leicht verstimmt. »Sie müssen uns das halt dann nur unterschreiben, aber das kennen Sie ja.«
»Entschuldigen Sie«, grätsche ich in die Unterhaltung der beiden und wende mich an den Notarzt, »aber zuvor würde ich mich gerne kurz mit dem Herrn sprechen. Oder pressiert’s?«
Der Angesprochene schüttelt den Kopf und geht zur Seite, wo er leise mit dem Sanitäter redet, den Blick dabei mit gerunzelter Stirn fest auf seinen Salzburger Kollegen mit der silbergrauen Mähne gerichtet.
Zufrieden bemerke ich, dass der Schorsch Fotos vom Unfallort macht, und widme meine Aufmerksamkeit dem Salzburger, der mittlerweile von der Ladefläche des Krankenwagens aufgestanden ist, trotz der Hitze sein Sakko übergezogen hat und sich den nicht vorhandenen Staub aus der Anzughose klopft.
Dabei würdigt er mich keines Blickes. Also räuspere ich mich laut und tippe mir dann mit der Hand kurz an meine Kappe. »Grüß Sie, Kommandant Aigner, Polizeiinspektion Koppelried. Haben S’ wohl während dem Fahren ein bisserl am Handy herumgespielt? Könnte es sein, dass Sie dabei auch etwas zu schnell unterwegs waren? Wie viel PS hat der Wagen? Fünfhundert?«
Der Mann dreht sich zu mir, fährt sich mit der Hand durch die volle Lockenpracht und würde mich quasi gerne von oben herab mustern, ist aber mindestens einen Kopf kleiner als ich. »Na hören Sie mal, was sind das für Unterstellungen? Ich war vorschriftsmäßig unterwegs.«
»Keine Sorge, der Sachverständige wird das alles noch genau feststellen. Haben Sie Alkohol getrunken?«, muss ich routinemäßig fragen und seufze. Solche überheblichen Typen machen mir diesen ohnehin wenig aufregenden Job nicht gerade leichter.
»Jetzt machen Sie aber mal halblang«, nimmt er mir das sofort krumm, »es ist fünf Uhr nachmittags.« Genervt wirft er einen Blick auf seine teure Armbanduhr.
»Ich muss Sie das fragen, oder möchten Sie lieber ins Röhrl blasen?« Ich schnuppere unauffällig, aber Alkoholgeruch kann ich an ihm nicht wahrnehmen.
»Sie sind wohl nicht ganz bei Trost. Ich werde das bestimmt nicht tun!«, schreit mich der Typ ungehalten an.
»Dann können Sie auch gerne mit uns aufs Revier mitkommen«, entgegne ich und winke den Schorsch heran. Er nickt und steht keine zwei Minuten später mit dem Alkovortestgerät neben uns. Seine eindrucksvolle Erscheinung mit knapp zwei Metern und mindestens hundertdreißig Kilogramm Lebendgewicht lässt den arroganten Kerl sofort kapitulieren. Brav bläst er in das Messgerät.
In der Zwischenzeit treffen die Feuerwehr und die Techniker der Straßenverwaltung ein. Nach kurzer Begutachtung des ramponierten Radargeräts kommt einer der Feuerwehrler herangelaufen und erklärt uns atemlos, dass die Techniker die Stromleitung abklemmen müssten und wir uns daher schleunigst vom Acker machen sollten.
Wortlos hält mir der Schorsch das Testgerät unter die Nase. Von wegen kein Alkohol! Null Komma vier Promille. Gerade an der Grenze des Erlaubten, der Typ hat Glück.
»Ich war halt bei einem Geschäftstermin und musste ein Glas Gin mittrinken. Mehr nicht. Hören Sie, meine Zeit ist wirklich kostbar, ich bin in Eile und sollte schon längst in Salzburg sein.« Ungeduldig wippt der Mann von einem Fuß auf den anderen.
Völlig unbeeindruckt ziehe ich gemächlich den Stift aus meinem Handy, und die Notizfunktion öffnet sich automatisch. »Name, Adresse? Das brauchen wir noch.« Ich lasse mich mit dem unsympathischen Kerl auf keine weitere Diskussion mehr ein.
»Dr. Christoph Trenkheimer, Salzburg, Imbergplatz 77A. Der neue Wohnpark mit Blick auf die Festung, gegenüber der Altstadt, natürlich oberste Etage«, erklärt er überheblich. Nobel, denke ich mir dabei, dort muss man sich erst mal eine Wohnung leisten können, geschweige denn ein Penthouse.
»Ich kenn das, wieder so ein Spießer-Bunker mehr, dem die schönen, altehrwürdigen Häuserl unserer Mozartstadt weichen mussten«, rümpft die Renate, die immer noch neben mir steht, ihre lange Nase.
Der schnöselige Fremde mustert ihre gelbe Flatterhose und ihr schwarz-weiß gestreiftes Shirt geringschätzig. »Und wer ist das bitte schön? Kommissarin Biene Maja? Nimmt die jetzt meine Aussage auf?«
Grinsend rücke ich mir mit dem Stift die Polizeikappe etwas nach hinten, während unsere Organistin empört die Hände in die Hüften stemmt und sich zwischen mich und den Mann im Anzug drängt. »Frechheit! Diese arroganten Schlipsträger! Bleifuß auf dem Gas, unschuldige Menschen auf der Straße gefährden und nicht mal eine Freisprecheinrichtung im Aut–«
»Vielen Dank für deine Hilfe, Renate«, unterbreche ich sie und schiebe sie sanft zur Seite, während der Mann so etwas Ähnliches wie »Dorfdeppen« murmelt. Dann wende ich mich streng an den Lockenkopf. »Ich an Ihrer Stelle würde mich einfach nur auf meine Fragen konzentrieren, denn Sie sind gefährlich nah an der Grenze zu einer Anzeige wegen Alkohol am Steuer, Herr Dr. Trenkheimer. Ich könnte auch einen Test am Alkomaten verlangen, allerdings bei uns in der Inspektion.«
Direkt gibt er sich kooperativer, und ich lasse mir seinen Führerschein zeigen. Den fotografiere ich mit unserer Polizei-App ab, damit die Unfallmeldung sofort im Zentralsystem gespeichert wird. In Windeseile nehme ich seine knappe Aussage auf, und dann räumen wir endlich alle das Feld für Feuerwehr und Techniker und machen uns auf den Weg zurück in Richtung Koppelried.
»So a Zipfi, so a depperter«, grunzt Gruppeninspektor Baumgartner neben mir auf dem Beifahrersitz. Mein Kollege verliert nie viele Worte. Er ist der Bruder meines besten Freundes und Vielleicht-irgendwann-mal-Schwagers Andi. Während der, seines Zeichens Gymnasiallehrer für Mathematik und Sport, sich seit einem halben Jahr bei meiner Schwester eingenistet hat, wohnt sein Bruder und mein Kollege, der gutmütige, schwergewichtige Riese Schorsch, immer noch bei seiner Mutter. Obwohl er die fünfzig schon längst überschritten hat.
»Da kann ich dir nur recht geben«, grinse ich breit, und mein Kollege verzieht seinen Mund ebenfalls zu einem Lächeln.
So fahren wir eine Zeit lang schweigend weiter, bis sich die Gerti über Funk bei uns meldet. Unsere Sekretärin heißt eigentlich Gertrude Schwaiger und ist seit Jahrzehnten die gute Seele der Inspektion, deren gesamte Organisation in Wahrheit sie schupft – nicht ich. Innerlich verfluche ich schon den Tag, an dem sie einmal in Pension gehen wird.
»Seids ihr schon fertig, Chef?«, hören wir ihre Stimme aus dem Funkgerät.
»Ja, Gerti. Gibt’s noch was? Ich hab nämlich bald Dienstschluss und muss zu einer unglaublich wichtigen Einladung«, schmeichle ich ihr. Denn ich sollte bald mal meine Freundin und meinen Sohn vom Freibad abholen, weil wir heute Abend bei den Schwaigers zum Grillen eingeladen sind.
»Das geht sich locker aus, Chef«, lacht sie. »I muss dahoam eh noch die Salate vorbereiten. Aber die Mitzi aus dem Freibad hat grad eben ang’rufen, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Da dürfte ein nackertes Mädel im Freibad herumspazieren.«
»Echt? Das wollen wir uns nicht entgehen lassen, was, Schorsch?« Vergnügt zwinkere ich meinem Polizisten zu, der verzieht den breiten Mund zu einem schiefen Grinsen, und dann steige ich aufs Gas.
An der Kassa erwartet uns eine entzürnte Mitzi, die Pächterin des Freibad-Büfetts. »Endlich seids ihr da!«, ruft sie uns schon von Weitem vorwurfsvoll entgegen. »Die Bachler Klara, die ist vor einer halben Stund da reinspaziert und hat sich pudelnackert auszogen. Die ausg’schamte Kanaille liegt seelenruhig beim Fünf-Meter-Turm, und die Burschen kriegen die Pappn nimmer zua. Saufrech ist das depperte Mensch, die hat mich glatt nur ausg’lacht, wie i sie rausschmeißen hab wollen. Ich sei nicht dazu befugt, hat die g’sagt. Aber die kann sich da bei uns net oafach ausziagn, net vor den ganzen Kindern. Wir sind a anständiges Bad.« Vor Wut wird ihr Gesicht krebsrot, und sie holt tief Luft. »Und der Loisl, dieses Waserl, traut sich gar nix. Er moant, wir müssten die Bachlerin in Ruh lassen, die hat zahlt, und in den Baderegeln würde halt nix von so an Verbot drinnenstehen. Dass i net lach. Was die ihren Eltern für a Schand macht. Die arme Herta und der arme Alfons, da bist du wirklich g’schlagen mit so oana Tochter. Rabenbratl, elendiges!«
Der Blick des alten Kassiers wandert kopfschüttelnd von der Büfett-Pächterin zu uns, und dann öffnet er uns wortlos die automatische Absperrung. Ich passe problemlos durch, aber der breite Schorsch muss sich ein wenig durch den schmalen Durchgang zwängen. Die Mitzi wartet nicht auf uns, sondern wälzt sich schon die Treppe hinunter ins Freibad. Da unten ist es rappelvoll, kein Wunder bei dem schönen Wetter. Es ist ein heißer Augusttag, es sind Schulferien, und die Badesaison ist in vollem Gange. Allerdings tut mir der hohe Geräuschpegel in den Ohren fast schon weh: Die Kinder kreischen, und die Jugendlichen spielen an jeder Ecke laute Musik mit ihren Handys. Weil ich auf diesen Tumult hier gar nicht stehe, bin ich froh, wenn sich meine Freundin opfert und brütend heiße Sommernachmittage mit meinem Sohn Felix hier verbringt.
Bei unserer Runde um das große Zwei-Meter-Becken kann ich sie auch schon entdecken. Sie ist einer der vielen Köpfe im Wasser, der hübscheste natürlich. Logisch.
Direkt neben ihr versucht sich mein Bub mit Kraulen und macht das wirklich schon recht gut. Nun sieht sie mich und winkt mir fröhlich zu. Dann deutet sie augenzwinkernd hinüber zum Becken für die Turmspringer, denn dort ist der Unruheherd.
Der Schorsch und ich wandern in unseren Sommeruniformen vorbei am Schwimmerbecken bis zum separaten Sprungbecken, wo rundherum mehrere Holzpritschen für die Badegäste angebracht sind. Hier tummelt sich in den Schulferien gerne die Koppelrieder Jugend.
Der Lois, unser Bademeister, steht unschlüssig vor einer dieser Pritschen und kratzt sich dabei am rechten Ohr. Sein Pfeiferl hängt über dem dicken braun gebrannten Bauch, seine weißen Bermudashorts hat er bis zu den tief hängenden Brustwarzen hochgezogen.
»Gut, dass ihr endlich da seids. I woaß nimmer, was i tun soll. Die Mitzi sitzt mir im Gnack, aber das Mädel macht doch nix, also net wirklich. I kann die net oafach so rausschmeißen, das ist doch die Tochter von unserem Bürgermoaster«, flüstert er uns zu und wischt sich dabei den Schweiß von der Stirn. Dann schielt er ängstlich zur Mitzi, die sich mit verschränkten Armen neben dem Schorsch platziert hat. Hinter ihr hat sich zur Unterstützung der halbe Koppelrieder Hausfrauenverein versammelt.
Dann erst entdecke ich die junge Frau.
Sie liegt auf die Ellenbogen gestützt auf dem Rücken, ganz allein auf einer der Holzpritschen, winzig kleine Kopfhörer in ihre Ohren gestöpselt. Ihre langen braunen Beine schwingen im Takt mit, und sie lächelt versonnen. Ein paar junge Burschen auf der Pritsche neben ihr starren sie mit offenem Mund an, aber das scheint ihr egal zu sein. Überhaupt alle rundherum starren die junge Frau an. Auch der Schorsch neben mir kriegt seinen Mund nicht mehr zu, und selbst die Mitzi neben ihm starrt böse und mit vor Aufregung immer noch hochrotem Kopf. Und ich starre wahrscheinlich auch.
Ich muss zugeben, so hatte ich die ältere Tochter unseres Bürgermeisters nicht in Erinnerung, als sie vor einigen Jahren irgendwohin zum Studieren gegangen ist. Auf der Straße hätte ich das früher unscheinbare Mädchen niemals wiedererkannt. Und um ganz ehrlich zu sein, noch nie habe ich einen so perfekten Busen auf einem so perfekten Körper in natura gesehen. Klaras Haut ist tief gebräunt, und die junge Frau trägt nichts weiter als eine leuchtend gelbe Bikinihose. Auf ihrem flachen Bauch glänzt auffällig ein goldenes Nabelpiercing, eine kleine Kugel. Dichtes pechschwarzes Haar umrahmt in einer frechen Kurzhaarfrisur ein ebenmäßig schönes Gesicht mit vollen Lippen und einer perfekt geschwungenen Nase. Ihr Augen werden von einer dunklen Sonnenbrille verdeckt. Hatte die Tochter unseres Bürgermeisters früher nicht langes brünettes Haar?, denke ich mir verwirrt.
Um irgendetwas zu tun, räuspere ich mich laut. Sehr laut. Endlich scheint sie Notiz von uns zu nehmen, zieht sich die Stöpsel aus den Ohren und legt sie auf ihr Badetuch. Geschmeidig wie eine Katze erhebt sie sich von der Pritsche und geht lässig auf uns zu. Direkt vorm Schorsch und mir kommt sie zum Stehen und nimmt die Sonnenbrille ab. Hellblaue Augen strahlen mich an.
»Schau an, der Herr Aigner. Immer noch so fesch wie vor fünf Jahren. Und der Herr Baumgartner, immer noch … so groß.« Sie strahlt mich an, während ihr der Schalk regelrecht aus den Augen blitzt.
»Also, Fräulein Bachler … äh, Klara«, räuspere ich mich etwas verlegen und bemühe mich, meinen Blick nicht auf ihren nackten Oberkörper zu richten.
»Claire, lieber Raphi, die Klara habe ich Gott sei Dank hinter mir gelassen. Ich darf doch Raphi sagen, oder? Mittlerweile bin ich erwachsen und muss dich daher auch nicht mehr siezen.« Kokett drückt sie den Rücken durch und die eindrucksvolle Brust raus, wie ich aus dem Augenwinkel heraus wahrnehmen kann. Krampfhaft konzentriere ich mich auf ihre Augen, tiefer traue ich mich hier in aller Öffentlichkeit nicht zu schauen.
Dann reiße ich mich am Riemen und richte einen strengen Blick auf sie. »Also, Klara, äh, Claire, ich wäre dir verbunden, wenn du obenrum was anziehen könntest. Du weißt, das ist ein Familienbad, es gibt Baderegeln, und die Leute hier sind … äh, nun ja …« Ich stocke und komme mir selten dämlich vor. Aber einer muss schließlich reden. Der Schorsch bringt wie üblich den Mund nicht auf, der Bademeister kratzt sich immer noch nervös am Ohr, und die Koppelrieder Frauen haben, gänzlich solidarisch mit der Mitzi, allesamt abwartend ihre Arme verschränkt.
»Also, Sheriff, ich kenne die Baderegeln hier schon, seit ich lesen kann. Da gibt es keine einzige Stelle, an der geschrieben steht, dass man ein Bikinioberteil tragen muss.« Fragend blicke ich zum Bademeister, der hilflos mit den Schultern zuckt, die Augen ungeniert auf ihren blanken Busen geheftet.
»Nun ja, um des lieben Friedens willen würde ich dich freundlich darum bitten, den Leuten hier den Gefallen zu tun und –«
»Die Leute sind mir wurscht«, unterbricht sie mich, lässt uns alle einfach stehen und geht langsam zum Fünf-Meter-Turm. Sagte ich, sie »geht«? Die Bachler Klara schreitet vor sich hin und wiegt dabei die Hüften wie am Laufsteg, denke ich mir irritiert. Es geht gar nicht anders, man muss auf die zwei prallen, tief gebräunten Backen, nur getrennt von einem gelben schmalen Band, schauen, während sie bedächtig die Leiter des Sprungturms hochklettert.
»I ruaf jetzt den Alfons an, der soll seinen Gschrappen an die Ohrwascheln da rausziehen! Net amoi auf die Polizei kann man sich mehr verlassen«, schnaubt die Mitzi wütend, macht auf ihren weißen Gesundheitsschlapfen kehrt und verlässt das Areal um das Sprungbecken mit energischen Schritten. Dicht gefolgt vom erzürnten Koppelrieder Hausfrauenverein.
Bedauernd hebe ich beide Hände, während der Lois sich mittlerweile am spärlich behaarten Kopf anstelle des Ohrs kratzt und der Schorsch wie hypnotisiert auf den Sprungturm starrt.
Die Klara ist nämlich oben angekommen, geht zum Ende des Bretts und hüpft; aber nicht ins Wasser. Sie springt sich sozusagen ein, und der Busen rührt sich dabei kaum einen Millimeter vom Fleck. Dann reißt sie endlich die Arme in die Höhe und springt elegant kopfüber ins Wasser.
Ein paar Sekunden später taucht sie im Becken vor uns auf und zwinkert mir zu. »Ist dir etwa heiß geworden, Sheriff?« Direkt vor meinen Füßen stemmt sie sich mit beiden Händen an den Beckenrand und zieht sich hoch. Mit Schwung schüttelt sie sich das Haar aus, spritzt dabei mein Hemd nass und baut sich dann knapp vor mir auf. Sicherheitshalber trete ich einen Schritt zurück, denn alle Blicke rundherum sind neugierig auf mich gerichtet. Ein paar junge Burschen klatschen und johlen wie blöd.
Mir reicht’s jetzt mit dem Theater. Ich schnappe mir das nächstbeste Badetuch, das auf der Holzbank hinter uns liegt, und hänge es ihr so über die Schultern, dass es den gesamten Oberkörper verdeckt. »So, junge Dame, genug Show für heute veranstaltet. Zieh dir gefälligst was Vernünftiges an oder geh nach Haus.«
Aber die Bürgermeistertochter grinst nur keck, kommt einen Schritt auf mich zu und streicht mir mit den gepflegten langen Nägeln ihrer schlanken Finger sanft über die Wange. »Nur weil du mich so nett drum bittest, Sheriff. Ich habe sowieso genug von dem Saftladen hier«, sagt sie, geht gut gelaunt zur Pritsche zurück, zieht sich ein enges weißes Shirt über den prallen Busen und schlüpft trotz der nassen Badehose in schwarze Shorts. Fröhlich summend packt sie ihr Badezeug zusammen und verlässt das Freibad. Nicht ohne mir davor provokant eine Kusshand zu schicken. Weg ist sie, und der Geräuschpegel steigt endlich wieder auf den Normalzustand an.
Mein Polizist hat nichts Besseres zu tun, als ihr immer noch mit offenem Mund hinterherzustarren, wohingegen sich unser Bademeister erleichtert mit der Hand den Schweiß von der Stirn wischt. »Gott sei Dank ist die endlich weg.«
»War das notwendig, Raphi?« Wie aus dem Nichts taucht meine Freundin, die Marie, in ihrem schwarzen Badeanzug neben mir auf, verschränkt die Arme und fixiert mich streng aus zusammengekniffenen Augen. »Musstest du so eine billige Show abziehen? Wo dein Sohn auch hier im Freibad ist?«
Ich? Wie bitte?, denke ich mir unschuldig.
Der Günther drückt mir eine Bierflasche in die Hand. Natürlich Rieglerbräu aus der Wirtshausbrauerei meiner Freundin, was sonst? Nachdem wir saftige Steaks, Unmengen von Salaten und abschließend den besten Kirschkuchen der Welt verspeist haben, betrachte ich wohlwollend die kleine Truppe am Tischtennistisch. Die liebe Gerti mit ihrer Engelsgeduld spielt schon zum dritten Mal ein Match mit meinem Buben, der ganz offensichtlich so gar kein Talent zum Pingpongspieler hat. Aber das stört ihn nicht, fröhlich kichernd trifft er höchstens einen von zehn Bällen.
Neben den beiden hockt die Marie im Gras, ihre langen blonden Locken hinter die Ohren geklemmt, und dreht versonnen ein Weißweinglas in der Hand. Ich befürchte, sie schmollt immer noch ein wenig wegen dieses dummen Vorfalls im Freibad. Da muss ich mir wohl heute Nacht ganz was Besonderes einfallen lassen, grinse ich in mich hinein.
Der Günther interpretiert das wohl anders. »Sag, Aigner. Vorhin im Supermarkt hab i den Badewaschl troffen, und der hat mir erzählt, dass heut a Mordsaufruhr wegen der Bürgermeistertochter im Freibad g’wesen ist. Leider hätt die Polizei dem freizügigen Auftritt a Ende g’macht, hat er g’moant.« Er grinst anzüglich und prostet mir mit der Flasche zu.
»Dem kann ich nur zustimmen, die Bachler Klara hat sich ziemlich herausgemacht. So ein Fahrgestell habe ich überhaupt noch nie mit eigenen Augen gesehen«, grinse ich zurück.
»Wem sagst du das«, lacht er herzlich, sodass sein Bauch, der über die alten Bermudashorts hängt, wackelt, »mir hat’s letztens a die Guck rausg’haut, als i beim Sägewerk war. Das kloane dicke Bachlermensch hat sich im wahrsten Sinne des Wortes zum Supermodel g’mausert.« Der Bachler senior ist nicht nur unser Bürgermeister, er besitzt auch ein großes Sägewerk am Ortsrand. Er ist wohl einer der reichsten, aber auch einer der knausrigsten Koppelrieder.
»Supermodel?« Zwei schmale Hände legen sich besitzergreifend auf meine Schultern. Die Marie ist hinter mir aufgetaucht.
»Sondermodell hab i g’moant. Autos, woaßt«, antwortet unser Gastgeber schlagfertig, »wir haben uns grad über Sportwagen unterhalten.«
»Es gab heute einen Verkehrsunfall mit einem nagelneuen Porsche Panamera. Fünfhundert PS hatte das Ding«, füge ich rasch hinzu und muss dabei nicht einmal lügen.
»Aha«, entgegnet meine Freundin und nimmt auf der Bank neben mir Platz, »und ich dachte schon, ihr unterhaltet euch über die junge Frau, die heute Nachmittag so einen Aufruhr im Freibad verursacht hat.«
»Die Nackerte im Bad?« Endlich gesellt sich auch die Gerti zu uns, weil sie klugerweise meinem Sohn den Tischtennistisch auf einer Seite hochgeklappt hat, damit er allein üben kann. Selbst ihre Geduld hat Grenzen. »Die Klara ist seit a paar Wochen wieder bei uns in Koppelried.« Sie schenkt sich auch ein Glas Wein ein und prostet uns zu. »Wie i am Nachmittag die Steaks vom Metzger abg’holt hab, hat mir unsere Fleischhauerin erzählt, dass die Bachlers ganz stolz auf ihre fesche ältere Tochter sind. Koa Wunder, die jüngere, die Vroni, die ist wirklich a schiache Heugeigen. Schau net so, Marie, i woaß, so was sagt man net. Aber es ist ja wahr, a Schönheit ist sie net grad. Die schaut doch aus wie ein unfertiger Bub.«
Während meine Freundin künstlich empört den Kopf schüttelt, grinse ich in meine Bierflasche. Bachlers jüngere Tochter Veronika ist beinahe so groß wie ich und enorm dünn. Aber das Schlimmste ist die unglaublich breite Nase, die aus ihrem Gesicht ragt. Unverkennbar ein unseliges Erbstück ihres Vaters, an dem man die beiden im Ort schon von Weitem erkennen kann.
»Die Kranz Anni, die Nachbarin von den Bachlers, war auch vorhin beim Metzger«, fährt unsere Gastgeberin unbeirrt fort. »Sie hat uns erzählt, dass die Klara für einen Doktor in Salzburg als Sprechstundenhilfe arbeitet und vorübergehend in Koppelried bleibt. Die wird den Mannsbildern im Ort noch gehörig den Kopf verdrehen, das sag i euch.«
»Hat die Tochter unseres Bürgermeisters nicht in München Medizin studiert?« Auch meine Freundin ist neugierig, ich merke es ihr an der Nasenspitze an.
»Ja, anfangs schon. Aber die Anni sagt, das Mädel sei unglaublich faul g’wesen. Der Bachler beschwert sich immer, dass er das viele Geld fürs Studium beim Fenster rausg’worfen hat, weil sie damit oafach von heut auf morgen aufg’hört hat. Kennst ihn eh, unsern Bürgermoaster, wenn der überhaupt amoi an Groschen lockermacht, dann hoaßt das was. Aber jetzt ist er trotzdem so richtig stolz auf seine fesche Klara, weil die Nasen-Vroni könnt er eh net herzeigen. Schau mich net so an, Marie, das hab net i g’sagt, sondern der Bachler selbst. Alle Leute im Ort nennen das Mädel so, zumindest hinter vorg’haltener Hand.« Die Gerti macht eine kurze Pause, weil sie nach ihrer heiß geliebten Zigarettenpackung auf dem Tisch greift. Nachdem sie sich eine davon angezündet hat, betrachtet sie schmunzelnd ihren Mann. »Da hat der steinreiche Kerl zwoa Töchter, und beide können sich keine eigene Wohnung leisten, weil der Vater nix springen lasst. Net einmal seine Frau, die Herta, kann da was ausrichten. Die muss selbst beim Alfons um jeden Cent bitten und betteln.« Genussvoll nimmt unsere Gastgeberin einen tiefen Zug aus ihrer Zigarette und bläst den Rauch von uns weg. »Aber i verrat euch was, wir zwoa, oder besser g’sagt der Günther, kriegen die Klara fast jeden Tag bei unserem neuen Nachbarn zum Sehen. Besonders mein armer Ehemann, weil der arbeitet seit zwoa Wochen am Dach von der Sauna und kriegt’s und kriegt’s net fertig. Gell, Günther?« Sie zwinkert ihrem Mann neckisch zu und deutet dann mit der brennenden Zigarette auf die noch unfertige Outdoor-Sauna, die im gepflegten Garten der Schwaigers nahe der Hecke zum einzigen Nachbargrundstück aufgestellt wurde. Unsere beiden Gastgeber wohnen weiter draußen am Ortsrand.
»So a Schmarrn, die Gerti übertreibt schon wieder«, wehrt ihr Mann sofort ab, aber läuft dabei im Gesicht rot an. »Ihr wissts ja, in das große Architektenhaus bei uns gegenüber ist vor a paar Monaten der Lanner eingezogen. Und vom Dach der Sauna sieht man halt oafach weit über die Hecken in den großen Garten hinein. Da kann i gar nix dagegen machen.«
»Besonders dann net, wenn sich die Klara halb nackert am Pool rekelt, gell, Günther?«, stichelt seine Frau. »Die Klara wohnt nämlich seit Neuestem beim Lanner.«
»Der Lanner«, stöhnt meine Freundin auf und verdreht dabei ihre schönen blauen Augen.
Beim neuen Nachbarn unserer Gastgeber handelt es sich nämlich um den frischgebackenen Koppelrieder Notar Dr. Siegfried Lanner. Nachdem der alte Lechner sich nach über vierzig Jahren in den wohlverdienten Ruhestand begeben hat, kam er als Nachfolger aus der Stadt Salzburg in den Ort. Leider hat er weder die Güte noch den grundanständigen Charakter seines Vorgängers, wie ich schon so manches Mal habe feststellen müssen. Neben seinem Beruf ist er nämlich glühendes Parteimitglied der AHP, der Alternativen Heimatpartei. Mit dieser Truppe habe ich nichts am Hut, sie ist mir zu weit rechts orientiert. Leider finden sich auch in unserem kleinen Ort immer mehr Anhänger, und der Lanner konnte bei den Wahlen im Frühjahr sogar in den Gemeinderat einziehen, obwohl der Mann nicht mal ein Koppelrieder, sondern nur ein »Zuagroaster« ist.
Als Lokalpolitiker fühlt er sich berufen, seinen Wählerstamm zu erweitern, und organisiert ein von seiner Partei gesponsertes neues Bierzelt für unser Volksfest, das am Wochenende stattfinden wird. Unser altes Zelt wurde nämlich im letzten Jahr durch einen Sommersturm komplett zerstört. In dieser Angelegenheit hat er sich allerdings mit der Senior-Rieglerwirtin Erni angelegt. Denn seit ich denken kann, versorgt ausschließlich das Rieglerbräu die Volksfestbesucher mit Bier und deftiger Kost. Aber der Lanner hat mit einer großen Salzburger Stadtbrauerei einen Vertrag für ein neues Leihzelt samt Bereitstellung des Bierkontingents abgeschlossen und somit die beiden Rieglerwirtinnen, also die Erni und meine Marie, um die Einnahmen vom Volksfest gebracht. Seit Tagen hat Letztere mit ihm verhandelt, um wenigstens die Speisen ausrichten zu können. Als sie sich dann endlich mit dem Mann hat einigen können, hat wiederum die Seniorwirtin auf stur geschaltet: entweder Bier und Speisen oder gar nix.
»Oh Gott. Ich kann den Namen Lanner schon nicht mehr hören«, grinst meine Freundin. »Die liebe Erni hat ihn erst vorgestern aus dem Wirtshaus rausgeschmissen. Eigentlich wollte ich zwischen den beiden vermitteln, aber sie hat sich wieder mal so in Rage geredet, dass ich mich sogar schützend vor ihn stellen hab müssen, sonst hätte er sich eine saftige Ohrfeige von ihr eingefangen.«
»Welch melodische Stimme vernehmen meine Ohren? Einen Moment«, hören wir den Lanner auch schon vom Nachbargarten her. Keine Sekunde später lugt er über die halbhohe Hecke. »Dachte ich es mir doch, das kann nur das glockenhelle Lachen unserer schönen Rieglerwirtin sein. Entschuldigt die Störung, Frau Marie, Gerti, aber ich konnte nicht widerstehen und musste einfach über den Zaun schauen.« Der Kerl wirft den Kopf in den Nacken, ohne dass sich seine kunstvolle Föhnfrisur dabei auch nur im Geringsten bewegt.
»Magst a Glaserl mit uns trinken, Sigi?«, ruft der Günther ihm zu, um sich gleich darauf zwei vernichtende Blicke einzufangen. Einen von seiner Frau, einen weiteren von meiner Freundin.
»Aber gerne doch, es dauert nur eine Minute, und ich bin bei euch.« Und schon ist der Nachbar nicht mehr zu sehen.
»Zuerst nachdenken und dann reden, Günther. Die arme Marie muss den lästigen Kerl ständig im Wirtshaus aushalten und jetzt auch noch bei uns. Also ist wohl leider Schluss mit der Gemütlichkeit«, seufzt die Gerti, zündet sich die nächste Zigarette an und wendet sich nach dem ersten tiefen Zug an meine Freundin. »Ich hoffe, der verdirbt uns net den Abend. Aber wenigstens ist er schön zum Anschauen, der Lanner, gell?«
»Das stimmt. Fesch ist der Mann schon«, bestätigt die Marie und zwinkert mir keck zu. Ist wohl ihre Retourkutsche für die Szene im Freibad heute Nachmittag, denke ich mir grinsend.
»Was ihr Weiber immer mit dem habts«, schüttelt der Günther verständnislos den Kopf. »Der mit seinem wallenden Haupthaar und dem ganzen Modeschnickschnack-Glumpert. So a eitler Geck –«
»Ich habe uns ein hervorragendes Tröpferl mitgebracht«, wird er auch schon vom Lanner selbst unterbrochen, der bereits an der Gartentür der Schwaigers steht. »Ein Riesling Smaragd Singerriedel, perfekt gekühlt. Echt österreichischer Wein und zweifellos einer der besten der Welt. Für unsere schöne Frau Wirtin ist mir nichts zu teuer.« Während der Lanner mit dem Knie umständlich gegen die Gartentür der Schwaigers drückt, balanciert er mit der linken Hand vier langstielige Weißweingläser und hält in der rechten eine Flasche Wein, umwickelt mit einer Kühlmanschette, wie eine Trophäe in die Höhe. Großen Schrittes eilt er zu unserem Tisch heran und stellt alles ab. »Natürlich samt perfekt gekühlter Gläser aus meinem Weinschrank, damit der edle Tropfen seine Temperatur halten kann. Idealtemperatur neun bis maximal zwölf Grad. Alles andere wäre eine unverzeihliche Sünde bei diesem Rebensaft aus der schönen Wachau. Unter zweihundert Euro kommt man nicht an eine Flasche.« Stolz schaut er sich in der Runde um und wartet vergeblich auf Beifall. Ich stöhne innerlich auf, der Lanner ist einer der größten Angeber, die ich kenne.
»Aber geh, Sigi. Bei uns brauchst net so einituschen«, meint unsere Gastgeberin streng, greift aber bereitwillig nach dem ersten vom Lanner eingeschenkten Glas. »Aber fesch bist du heut wieder beinand, das muss i schon sagen.«
»Vielen Dank für das Kompliment, liebe Gerti«, dreht er sich eitel einmal um die Achse, damit wir ihn in seinem Outfit bewundern können. Der Mann trägt eine schmale weiße Hose aus einem dünnen Sommerstoff, ein Hemd in hellem Rosaton, um das ich in jedem Geschäft sofort einen Riesenbogen machen würde, und ein top gebügeltes hellgraues Leinensakko mit einem Stecktuch in derselben unmöglichen Farbe wie das Hemd. An den Füßen, natürlich ohne Socken, hat er weiche hellgraue Lederschuhe, die ziemlich teuer aussehen.
»Ich habe in Salzburg eine junge Modedesignerin entdeckt, der absolute Hammer, sag ich dir, Gerti. Ich kann euch gerne die Adresse geben. Es wäre wohl nicht das Verkehrteste, eure Männer mal von Grund auf neu einzukleiden«, schlägt der Mann vor, während er den Günther und mich herablassend mustert. Wir beide sitzen nämlich in gemütlichen, aber schon etwas ausgebeulten Bermudas und T-Shirts, die schon zahlreiche Sommer erlebt haben, am Gartentisch der Familie Schwaiger. Zu meiner Verteidigung kann ich anführen, dass ich nicht wie der Günther Schlapfen samt Tennissocken an den Füßen trage, sondern immerhin Flipflops, wenn auch billige aus Plastik.
»Den Raphi kannst du nur unter Androhung von Waffengewalt zum Shoppen mitschleppen, freiwillig betritt der niemals ein Modegeschäft«, lacht die Marie, und die Gerti stimmt mit ein.
»Dafür hab ich halt andere Qualitäten.« Mit leicht anzüglichem Grinsen lege ich den Arm um die Hüfte meiner Freundin.
Bevor ich sie an mich ranziehen kann, drückt uns der Lanner auch schon jedem ein eiskaltes Glas Wein in die Hand, zuerst natürlich der Dame, der er dabei tief in die Augen schaut. »Ja, so sind s’ halt, die einfachen Leute. Muss es auch geben, damit wir anderen glänzen können, nicht wahr, Frau Doktor?« Ich habe wohl vergessen zu erwähnen, dass meine Freundin erst seit letztem Sommer Wirtin ist. Nach einer rekordverdächtig kurzen Ehe mit dem verstorbenen Rieglerwirt hat sie dessen Wirtshaus samt Brauerei geerbt. Davor hat sie jahrelang ihre eigene Werbeagentur geleitet.
»Aber Spaß beiseite, lasst uns doch auf die schönste Wirtin von ganz Salzburg trinken. Liebe Frau Marie, wenn Sie mir endlich das Du-Wort gestatten würden, dann hätte ich jetzt ein wunderbares Angebot für Sie. Eines, das unter Garantie auch die energische Frau Erni glücklich machen wird«, sagt der Lanner gut gelaunt und zwinkert dabei meiner Freundin unverschämt zu. »Meine Partei steht sowieso hundertprozentig hinter mir. Also konnte ich mit der Stadtbrauerei einen perfekten Deal aushandeln, denn der Geschäftsführer war mir noch einen Gefallen schuldig. Fifty-fifty, das Geschäft wird gerecht zwischen dem Rieglerbräu und der Stadtbrauerei geteilt, obwohl die das Bierzelt zur Verfügung stellt. Die Hälfte des berechneten Bierbedarfs darf also vom Rieglerbräu verkauft werden, für die Speisen kann ebenfalls das Rieglerbräu sorgen. Im Gegenzug muss die Frau Erni nur bereit sein, ihr Servierpersonal zu teilen. Na, ist das ein Deal?«
Freitag
Die Terrassentür wurde einfach aufgehebelt, sehr wahrscheinlich mit einem einfachen Schraubenzieher. An der Tür kann man sonst kaum Spuren einer Beschädigung entdecken. Dafür herrscht im Haus das reinste Chaos. Schränke und Schubladen sind geöffnet, der Inhalt liegt überall verstreut herum. Bilder und Deko wurden achtlos auf den Boden geworfen, wovon die Scherben auf dem Boden zeugen.
Die Villa und die kostbaren Möbel sind bereits sehr alt, aber stilvoll und gut in Schuss. Alles hier passt perfekt zum alten Lechner, unserem mittlerweile im Ruhestand befindlichen Notar.
Er steht mit traurigem Gesicht neben mir. »Herr Aigner, ich kann Ihnen beim besten Willen nicht sagen, wann genau das passiert sein könnte. Wenn ich mich recht erinnere, war ich vor etwa vier Wochen das letzte Mal im Haus, um nach dem Rechten zu sehen. Leider dürfte ich wie üblich vergessen haben, die Alarmanlage zu aktivieren. Ich komme mit diesem neumodischen Zeug einfach nicht zurecht. Nun, seit ich im Ort wohne, Sie wissen ja, Frau Annette, also meine ehemalige Sekretärin und ich … also wir –« Der Mann stockt, es ist ihm offensichtlich etwas peinlich. Wahrscheinlich muss er sich erst daran gewöhnen, dass er jetzt eine neue Liebe an seiner Seite hat, nachdem seine Frau an Krebs verstorben ist. Aber ich kann es ihm gut nachfühlen. Denn obwohl meine Frau Sabine bereits seit über sechs Jahren tot ist, geht es mir mit der Marie manchmal ähnlich.
»Verstehe ich sehr gut«, nicke ich ihm aufmunternd zu.
Also fährt er fort: »Hier erinnert mich alles an meine verstorbene Gattin, und das ist nicht gut für Annette und mich.« Gedankenverloren streicht er sanft über die verstaubte Mahagoniplatte des Esstischs.
Ich räuspere mich. »Entschuldigen Sie, Herr Dr. Lechner, dürfte ich Sie bitten, vorerst nichts anzufassen? Es wird noch ein bisserl dauern, bis die Spurensicherung aus der Stadt da ist.« Der Hochgatterer Fritz und sein kriminaltechnisches Labor aus Salzburg sind zurzeit etwas überlastet. Vor allem aufgrund der vielen Einbrüche in den Ortschaften rund um die Stadt herrscht bei den Kollegen Hochbetrieb.
Erschrocken zieht der alte Notar seine Hand zurück. »Pardon, das hatte ich völlig vergessen. Wissen Sie, die alten Möbel bedeuten mir viel, und ich bin froh, dass wenigstens sie noch unversehrt sind.«
Mein Kollege, Bezirksinspektor Herbert Lederer, schaut sich eben im Obergeschoss um, während Gruppeninspektor Schorsch Baumgartner draußen nach Fahrzeugspuren sucht. Leider häufen sich die Einbrüche im Moment nicht nur rund um Salzburg, sondern vor allem auch in meiner kleinen Gemeinde. Als übereinstimmendes Ergebnis wurden Reifenspuren immer desselben Lieferwagenmodells einer bestimmten Fahrzeugklasse sichergestellt.
»Konnten Sie sich schon einen Gesamteindruck verschaffen, Herr Dr. Lechner? Wissen Sie bereits, was Ihnen fehlt?«, frage ich den alten Mann und öffne die Notizfunktion auf meinem neuen Diensthandy, um das Wichtigste mitzuschreiben. Ich finde diese Dinger viel praktischer als das ewige Herumschleppen eines kleinen Notizblocks.
»Leider habe ich in diesem Chaos noch keinen richtigen Überblick. Aber der Schmuck meiner Frau wurde mit Sicherheit entwendet, was mich persönlich sehr schmerzt. Den wollte ich meiner Schwiegertochter schenken, hätte ich das doch nur längst getan.« Traurig lässt er den Kopf hängen.
»Chef, im Schlafzimmer oben ist ein aufgebrochener Wandtresor, der komplett leer g’räumt ist.« Polternd kommt der Herbert die dunkle Holztreppe nach unten, wobei die Stufen laut unter seinem Gewicht ächzen.
»Du meine Güte, den habe ich in der Aufregung ganz vergessen.« Der Notar schlägt sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. »Aber darin war nicht viel von Wert. Zwei- oder dreitausend Euro, mehr nicht … Oh mein Gott!« Erschrocken dreht sich der Mann zu mir. »Herr Aigner, meine Autoschlüssel und die Papiere.« Plötzlich bleich im Gesicht, läuft er für sein Alter unglaublich schnell in den Garten, sodass ich Mühe habe, ihn einzuholen.
Mit Schwung reißt er die Seitentür zu der alten Doppelgarage auf und verschwindet dahinter. Dann höre ich ihn nur mehr laut aufschreien.
Als ich eintrete, kauert der Notar wie ein Häufchen Elend auf dem Boden und streicht traurig mit der Hand über die blanken Fliesen. »Mein Adenauer«, jammert er, und ich ziehe ihn behutsam wieder in die Senkrechte. »Nein, das darf nicht wahr sein. Mein 300er SL Gullwing.« Er rauft sich mit den Händen seine immer noch üppige graue Mähne und schaut sich verloren in der leeren Garage um.
»Ihren Oldtimer? Den hatten Sie hier verwahrt?«, frage ich ihn verzagt und erstaunt zugleich. Jeder im Ort kennt seinen Mercedes mit den Flügeltüren, obwohl der alte Notar nur alle paar Jahre mit dem edlen Gefährt vorsichtig eine Runde durch Koppelried dreht. Ich schaue mich kurz um und entdecke nirgends eine Alarmanlage. Ich kann es kaum glauben, dass dieser sonst so umsichtige Mann seinen Oldtimer ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen in einer Hausgarage abgestellt hat.
Nervös holt er sein Handy aus der Brusttasche und wischt mit zittrigen Fingern darauf herum, bis er es mir unglücklich vor die Nase hält. Der Gegenstand, den ich auf dem Bildschirm sehe, ist mir wohlbekannt: ein alter cremeweißer Mercedes, die Flügeltüren geöffnet, man kann gut die wunderschönen alten Ledersitze erkennen. »Es war das Lieblingsstück meines Vaters, 300 SL Coupe, Gullwing«, sagt er mit weinerlicher Stimme. »Ein Sondermodell in Elfenbein mit blauem Leder, eines der allerletzten fahrtüchtigen Modelle mit Rudge-Zentralverschluss-Felgen. Ich lasse ihn jährlich um teures Geld von einem Könner warten. Mein Vater hat sich den Wagen im Jahr 1956 um dreißigtausend Mark aus Deutschland geholt. Das war damals unglaublich viel Geld, und er musste dafür sein gesamtes Erspartes aufwenden.«
»Wie viel ist der denn heute wert? So überschlagsmäßig?«, frage ich etwas zerknirscht, weil ich von seinem Verlust nun wohl selbst mitgenommen bin.
»Herr Aigner, um ehrlich zu sein, ich weiß es gar nicht genau. Ich vermute, dass der Wagen in Sammlerkreisen vielleicht eine Million Euro einbringen könnte, wenn nicht bereits mehr. Ich hoffe, Sie finden ihn wieder. Mein Sohn wird mir niemals verzeihen, dass ich dieses edle Stück nicht schon längst bei einer professionellen Sicherheitsfirma eingelagert habe.«
Mit dem gesamten Team, Gruppeninspektor Heinz Rohrmoser, Bezirksinspektor Herbert Lederer und dem Schorsch, stehe ich an der Pinnwand in unserem kleinen Besprechungsraum. Auf dem dunkelblauen Stoff habe ich einen Ortsplan angebracht und die Adressen der Häuser, in die bereits eingebrochen wurde, mit einem Pin mit rotem Kopf gekennzeichnet. Die sechste Nadel mussten wir heute in die Adresse der Villa des Notars stecken. Bei allen Einbruchsobjekten handelt es sich um große Gebäude eher am Ortsrand. Bevorzugt steigen die Täter in leer stehende Häuser ein, und davon gibt es in unserem kleinen Ort mittlerweile viele, die leider nur wenige Monate im Jahr als Feriendomizil bewohnt sind. Ein Paradies für Einbrecher.
Ferienhäuser in unserem Ort sind beliebt, weil Bürgermeister Bachler den Tourismus enorm angekurbelt hat. Nicht nur ein Wellnesshotel wurde angesiedelt, sondern die Wander- und Radwege zum nahen Nockstein, Klausberg und Gaisberg wurden auch attraktiver gestaltet und gemeinsam mit dem Salzburger Tourismusverband beworben. Ein kleiner, aber professioneller Mountainbike-Park und eine künstliche Eislaufbahn locken sommers wie winters immer mehr Touristen an.
Etwas entmutigt lasse ich den Kopf hängen. Gemeinsam mit unseren Kollegen aus Eugendorf haben wir schon vor einiger Zeit eine Sonderstreife eingerichtet, die mehrmals am Tag und vor allem in der Nacht die verschiedenen Straßen und die einzeln verstreuten Häuser der umliegenden kleinen Siedlungsgebiete kontrolliert. Allerdings bisher erfolglos, denn unsere beiden Inspektionen haben viel zu wenig Personal für eine flächendeckend wirksame Aktion.
»Vielleicht haben die Täter diesmal einen Fehler gemacht«, versuche ich trotzdem, wenigstens meine Männer zu motivieren. »Das Diebesgut, das die Einbrecher bisher mitgehen haben lassen, lässt sich problemlos an den Mann, sprich an den Hehler bringen. Aber für einen Oldtimer von diesem Wert braucht es Beziehungen zu professionellen Autoschiebern. Das stemmen kleine Diebesbanden niemals. Wahrscheinlich findet man für so ein teures Stück auch nicht so schnell einen Käufer.«
»Da muss i dich enttäuschen, Chef«, meint der Heinz grinsend, dabei ist sein Überbiss deutlich zu erkennen. »I hab vorhin mit den Kollegen vom LKA Salzburg telefoniert. Die haben mir g’sagt, dass es viele potenzielle Käufer für so ein Gustostückerl gibt. Illegal logischerweise. Das Auto lassen die sich mit speziell dafür ausgestatteten Lkws abholen, die mit Spezialfolie verklebt sind, damit man eventuell angebrachte GPS-Tracker net orten kann. Aber vielleicht sind die noch net so weit gekommen und mussten das teure Wagerl erst amoi irgendwo zwischenlagern. Unerkannt kannst du mit dem Ding sicher nicht durch Österreich gondeln.«
»Keine schlechte Idee, Heinz«, lobe ich ihn, »wir sollten gleich mal bei der alten Fabrik vorbeischauen. Die große Halle wäre gut dafür geeignet, was meint ihr?« Ende der 1970er wurde am Stadtrand, keinen Kilometer von der Notarsvilla entfernt, der Betrieb einer kleinen Kammgarnfabrik eingestellt. Der Eigentümer hatte auf Textilproduktion in Tschechien umgesattelt, das Gebäude auf seinem Grundstück aber nie einreißen lassen. Mittlerweile ist die Fabrik zwar verwahrlost, aber noch immer nicht einsturzgefährdet.
Trotzdem werden wir den Fall wohl oder übel an die Experten im Landeskriminalamt abgeben müssen, die arbeiten in Autoschieber-Fällen eng mit Interpol zusammen.
»Chef?« Die Gerti steckt den Kopf zur Tür herein. »Der Weber. Der randaliert und tobt schon wieder, die Nachbarin hat grad bei mir ang’rufen. Kannst bitte schnell dorthin fahren, das kleine Mäderl ist sicher auch daheim, es sind ja Schulferien.« Sichtlich besorgt runzelt sie die Stirn. Der Weber ist rabiat, wenn er betrunken ist.
Also zögere ich nicht, greife nach meiner Polizeikappe auf dem Tisch, schicke den Schorsch und den Herbert auf Kontrollfahrt zur verlassenen Fabrik und bedeute dem Heinz, mit mir mitzukommen.
Gemeinsam brausen wir zu den Gemeindebauten. Die Adresse der Familie ist uns seit Langem wohlbekannt. Leider.
Noch bevor wir an die Tür klopfen, hören wir den brutalen Kerl schon lautstark herumbrüllen.
»Polizei!«, rufe ich. »Öffnen Sie sofort die Tür, Weber!«
Nichts tut sich, der Mann brüllt einfach weiter. Mein Kollege und ich schauen uns betreten an, die Frau in der Wohnung wimmert leise.
»Weber, machen Sie auf, sonst müssen wir uns gewaltsam Zutritt verschaffen! Wir gehen davon aus, dass sich Ihre Frau und Ihre Tochter in einer Notlage befinden! Weber! Verdammt!«, schreie ich, so laut ich kann. Mein Kollege greift sicherheitshalber schon nach seiner Glock im Holster.
Stille. Auf einmal ist es komplett ruhig in der Wohnung. »Weber! Kruzifix noch mal!«, brülle ich noch lauter. »Öffnen Sie endlich!« Dabei taxiere ich die Wohnungstür genauer, ein billiges Modell, das sich nach innen öffnen lässt. Die kann ich sicher problemlos eintreten.
Aber das braucht es nicht, denn jemand dreht den Schlüssel im Schloss, und keine Sekunde später taucht Inge Weber vor unseren Augen auf. Ihr kurzer Haarschopf steht weit nach hinten ab, ganz offensichtlich wurde kräftig daran gerissen. Über ihrem rechten, vom Weinen verquollenen Auge macht sich ein Veilchen breit.
»Grüß Gott, Frau Weber. Sollen wir einen Krankenwagen rufen? Wo ist Ihre Tochter?«, frage ich sie leise. Hektisch wandert ihr Blick vom Heinz zu mir, aber sie antwortet nicht.
»Wir kommen jetzt rein. Gut so?«
Sie schluchzt auf und macht zaghaft einen Schritt zur Seite. Ich schreite voran, und mein Kollege geht knapp hinter mir; wir haben beide unsere Hände an der Dienstwaffe. Man weiß ja nie. Am Küchentisch, auf dem sich eine beachtliche Menge leerer Bierflaschen stapelt, wippt ihr Mann mit einer brennenden Zigarette im Mundwinkel auf einem Stuhl hin und her. Bekleidet nur mit einer weißen Rippunterhose.
»Ihre Tochter ist okay?«, frage ich die lädierte Frau noch mal, die zaghaft hinter uns die Küche betritt. Wieder nickt sie nur.
»Schleichtsss euch, Scheisssbullen! Das isss meine Wohnung, ihr habtsss da nigsss verloren«, lallt uns der Weber entgegen, versucht vergeblich, die Zigarette im übervollen Aschenbecher auszudrücken, nimmt einen langen Schluck aus der Bierflasche in seiner Hand, die er danach mit einem Ruck auf den Tisch knallt, und rülpst lautstark.
Ich trete zu ihm hin und beuge mich zu dem besoffenen Kerl hinunter. Sein penetrant nach Alkohol stinkender Atem schlägt mir ins Gesicht, und ich muss mich zusammenreißen, damit ich nicht zurückweiche. »Weber, halt die Goschen, sonst nehme ich dich sofort mit, verstanden«, brumme ich ihn an.
Dann wende ich mich an seine mit Sicherheit bessere Hälfte, aber leider kenne ich das Spiel schon. Es ist aussichtslos. »Wollen Sie Anzeige erstatten, Frau Weber?«
Betreten senkt sie den Blick. »Nein, bitte, der Hermann hat sich eh schon wieder beruhigt. Er hat uns nix getan, es ist alles in Ordnung, Herr Aigner.«
»Und dein Auge, Inge?« Mein Kollege runzelt die Stirn. »Geh, sei doch g’scheit. Du darfst dir so was nimmer g’fallen lassen.«
»Nein, bitte, Heinz.« Sie wehrt mit den Händen ab. »Der Hermann hat nix getan, ich bin vorhin nur g’stolpert, wie ich von der Arbeit heimkommen bin. Das Küchenkastl war leider offen …«
Hinter uns bewegt sich etwas, und ich drehe mich um. In der Ecke am Fußboden kauert die kleine Tochter der Webers und schaut mich aus großen Augen an. Ganz eindeutig hat die Kleine Angst. Zumindest äußerlich wirkt sie unversehrt, stelle ich vorerst erleichtert fest.
Ich gehe rüber zu ihr und hocke mich vor sie hin. »Hat dir der Papa was getan, Chantal?« Das arme Kind kennt mich schon, schielt angsterfüllt zum Vater und schüttelt dann wortlos den Kopf. »Sollen wir dich zur Oma bringen?«
Das habe ich die letzten beiden Male mangels Alternative auch gemacht. Frau Webers Mutter wohnt nur ein paar Straßen weiter und ist eigentlich eine sehr nette Frau, aber wohl auch machtlos gegen den betrunkenen Tyrannen. Ihre einzige Tochter hat mit dem Weber leider einen grandiosen sozialen Abstieg hingelegt.
Die Kleine schaut noch mal zu ihrem Vater und wagt es nicht, sich zu rühren. Ich seufze und schicke die Frau mit dem Kind nach unten zum Streifenwagen.
Als die beiden die Wohnung verlassen haben, fauche ich den betrunkenen Ehemann an. »Weber, wenn ich noch ein einziges Mal zu euch kommen muss, dann nehme ich dich in Gewahrsam, und du musst in die Haftzelle. Egal, was deine Frau sagt, das ist mir dann wurscht. Hast du das kapiert?«
Der Mann grinst mich rotzfrech an und will nach der letzten vollen Bierflasche auf dem Küchentisch greifen. Flink schnappe ich sie mir und schupfe sie dem Heinz zu. Der öffnet das Ding gekonnt an der Kante der Arbeitsplatte und schüttet den gesamten Inhalt in den Abfluss der Spüle.
»Sssag, spinnssst denn du, du Trottel? Dasss war mein letztesss«, will der Weber kurz aufbegehren und springt vom Stuhl auf. Dabei schwankt er und muss sich auf dem Tisch abstützen.
Wütend gehe ich näher an ihn ran und stoppe nur etwa fünf Zentimeter vor ihm. Der kleine, stämmige Kerl weicht erschrocken zurück und lässt sich wieder auf den Stuhl fallen. »Hast du es endlich kapiert? Oder soll ich dich gleich mitnehmen?«, blaffe ich ihn an.
Betroffen schaut er vom Heinz zu mir. »I wollt dasss net – i hab sssie ja ssso gern, meine Ssswei, i hab sss’ beide ssso gern –« Dabei quetscht er ein paar Krokodilstränen hervor.
»Hör endlich mit dem Saufen auf, Hermann.« Mein Kollege mustert den Mann angewidert. »Früher mal, da warst du ganz in Ordnung. Und jetzt? Schau nur, was aus dir g’worden ist, ein feiger Frauenschläger.« Der Weber senkt betroffen den Kopf, und wir verlassen die Wohnung. Mehr können wir leider nicht tun. Schon rein rechtlich sind uns die Hände gebunden.
Beim Streifenwagen nehme ich die Frau zur Seite, deren Veilchen am Auge bereits in allen Farben zu blühen beginnt. »Frau Weber, beim nächsten Mal nehme ich Ihren Mann mit, egal, was Sie uns an Ausreden auftischen, haben Sie verstanden? Denken Sie doch auch mal an Ihr Kind. Was wollen Sie denn machen, wenn der im Suff beginnt, auch Ihre Tochter zu schlagen?«, versuche ich ihr ins Gewissen zu reden.
Aber sie schaut mich nur unglücklich an, ihre Stimme klingt hysterisch. »Der Hermann würde der Chantal nie was antun. Niemals, die ist sein Ein und Alles.«
»Glauben Sie denn, er tut Ihrer Tochter nichts damit an, wenn er Sie vor den Augen der Kleinen windelweich prügelt? Das Kind ist doch wie gelähmt vor Angst, das sieht doch ein Blinder«, antworte ich mit bitterem Ton in der Stimme.
Mein Kollege hat das Mädchen bereits in den Wagen verfrachtet, wo es sich mit blassem Gesicht unglücklich an einem Stofftier festkrallt.
»Bitte, Herr Aigner, der Hermann war net immer so. Das ist die Arbeitslosigkeit, hint’ und vorn fehlt uns das Geld. Er kriegt einfach keinen Job, egal, wie der sich bemüht.« Chantals offensichtlich unbelehrbare Mutter wirft mir einen flehenden Blick zu.
»Dann gewöhnen Sie ihm erst mal das Trinken ab, so wird das mit einem Job garantiert auch in Zukunft nichts.« Dieser Frau ist einfach nicht zu helfen.
»Wie denn, Herr Aigner? Wenn ich nur wüsst, wie«, bricht sie in Tränen aus.
Ich seufze und helfe ihr in den Wagen. Dann bringen wir die beiden zur Oma. Wenigstens die Chantal freut sich, weil sie mit einem Polizeiauto mitfahren darf. Obwohl ihre Mutter neben ihr auf der Rückbank immer noch leise schluchzt. Aber an diesen Anblick ist das Kind wohl längst gewöhnt.
Nachdem wir die beiden bei der geschockten älteren Frau abgegeben haben, machen wir uns auf den Rückweg in die Inspektion. Ich überlasse meinem Kollegen das Steuer und nehme auf dem Beifahrersitz Platz. Da wir durch die Dreißigerzone gondeln, platziere ich den Arm lässig im offenen Fenster. Wie sollte es anders sein, an der einzigen Ampel im Ort müssen wir halten.
»Na, so was! Schau an, unser fescher Dorfsheriff.« Neben mir auf dem Gehsteig kommt eine junge Frau zu stehen und beugt sich zu mir herunter. Es ist die Bachler Klara. Braun gebrannt in weiten Shorts und einem bauchfreien T-Shirt, das so kurz ist, dass man am perfekten Brustansatz gar nicht vorbeischauen kann. »Was für eine nette Überraschung. Sehe ich dich heute auf dem Volksfest? Reservierst du mir einen Tanz, Sheriff?« Sie spitzt kokett die Lippen, und zu meinem Glück schaltet die Ampel auf Grün.
»Mal sehen.« Lässig winke ich ihr zum Abschied kurz zu und bedeute dem Heinz, der mit offenem Mund zu ihr rüberstarrt, weiterzufahren.
Langsam lässt mein Polizist den Wagen über die Kreuzung rollen und verkündet dabei voller Stolz: »Stell dir vor, diese Wahnsinnsbraut hab i gestern Abend beim Straubinger getroffen. I war mit dem Schorsch am Abend auf a paar Bier. Die jungen Burschen im Lokal sind um die Klara herumscharwenzelt, das kannst du dir gar net vorstellen. Aber sie hat sich zu uns an die Bar g’stellt, weil sie mich kennt. Woaßt, ihre Mutter ist die Firmgodi von unserer kloan Bettina. Dem Schorsch sind fast die Guck rausg’fallen.« Er schnalzt mit der Zunge.
Der Straubinger betreibt am Ortsrand einen kleinen Nachtclub mit lauter Musik, interessant vor allem für die Dorfjugend, die gern zum Tanzen hingeht.
»Chef, i muss dir was erzählen, aber sag’s net weiter, gell. Schon gar net dem Schorsch. Also, die Klara hat schon a ordentliches Spitzerl g’habt und auf Teifi kimm aussa mit ihm g’flirtet. Woaßt eh, i selber tu ja nur schauen, weil sonst hätt i die liebe Not dahoam. Auf amoi hat das Mädel den Schorsch abg’schmust, koane zehn Sekunden, aber der arme Kerl war ganz hin und weg. Dann ist der depperte Lanner zur Tür reinkommen, und sie ist sofort fröhlich zu dem rüberg’wechselt. Der arme Schorsch war völlig perplex.«
Aha, denke ich mir. Deshalb hat uns der Lanner gestern in Gertis Garten zu meinem Glück schon nach etwa einer Stunde wieder verlassen. Er meinte, er hätte noch einen Termin.
Mein Polizist macht eine Pause, weil er den Streifenwagen vor der Inspektion parken muss. Nachdem er den Zündschlüssel abgezogen hat, löst er den Gurt, bleibt aber sitzen. »Also hab i den armen Kerl lieber hoambracht. Woaßt, i kann mich wirklich net erinnern, dass unser Schorsch jemals in aller Öffentlichkeit g’schmust hätt, net amoi mit der Brennerin. Aber der war spitz wie Nachbars Lumpi, wennst verstehst, was i moan«, zwinkert er mir zweideutig zu.
Eigentlich hatte unser Kollege nur ein einziges Mal in seinem Leben eine Freundin. Vor einigen Jahren war er etwa ein halbes Jahr mit der gut zehn Jahre älteren Brenner Rosl liiert, die ihn aber nach kurzer Zeit wieder abserviert hat. Schon verständlich, weil der Schorsch nicht gerade kommunikativ ist und immer noch bei seiner Mutter wohnt. Dort braucht er nämlich nicht zu reden, weil die Baumgartnerin kann das für zwei.
»Unser Kollege und die fesche Bachlertochter?« Ungläubig schüttle ich den Kopf.
Der Heinz öffnet die Fahrertür. »Kaum zu glauben, gell. Aber die Klara hat das natürlich überhaupt net ernst g’moant, für sie war das nur a Hetz. A junges Dirndl halt.«
»Jetzt mach doch endlich, Raphi!«, kommandiert die Gabi mich wie üblich herum. Meine Schwester ist eine angesehene Person in Koppelried, eine VIP sozusagen. Seit Ewigkeiten organisiert sie als Pfarramtssekretärin nicht nur die Pfarrei und alle zugehörigen Schäfchen, sondern auch unseren Pfarrer. Nachdem meine Frau Sabine kurz nach Felix’ Geburt bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, hat sie bei mir ebenso die Zügel in die Hand genommen und mich und meinen Buben kurzerhand zurück ins Elternhaus nach Koppelried verfrachtet. In die kleine Wohnung unterhalb der ihren im Obergeschoss. Meine persönliche Einbuße bestand darin, dass ich vom vielversprechenden Kriminaler in der Stadt Salzburg auf provinziellen Inspektionskommandanten umsatteln musste, um besser für meinen Buben da sein zu können.
Seufzend stecke ich das weiße Trachtenhemd in den Bund der knielangen Hirschledernen, die schon mein Vater in jungen Jahren getragen hat, und zupfe die ärmellose graue Trachtenweste über dem weißen Kurzarmhemd zurecht.
Meine Schwester montiert inzwischen die Hosenträger auf Felix’ kurze Trachtenlederhose. Im Gegensatz zu mir liebt mein Sohn seine Lederne. Bei jeder Gelegenheit schlüpft er in das widerstandsfähige Kleidungsstück. Allerdings muss er zum heutigen Anlass anstelle seines geliebten Spiderman-T-Shirts ein kariertes Trachtenhemd tragen. Was ihm wiederum nicht so behagt.
Ich ziehe die langen weißen Trachtenstutzen über die Waden und schlurfe missmutig vom Wohnzimmer in den Flur. Um mich als trachtige Witzfigur verkleidet in voller Größe im Wandspiegel betrachten zu können, muss ich allerdings zuvor die sperrige Fünfundzwanzig-Liter-Millibidschn etwas zur Seite schieben. Ein wahres Unding, das die Gabi in einem ihrer Dekorationsanfälle gemeinsam mit meinem Buben bemalt und zum Schirm- und Krimskramsständer umfunktioniert hat.
Gott sei Dank zwingt mich meine Schwester nur einmal im Jahr dazu, Tracht zu tragen, nämlich auf dem Koppelrieder Volksfest. Sonst wehre ich mich erfolgreich dagegen, da ich mir in Lederhosen immer furchtbar verkleidet vorkomme. Rasch greife ich nach meinen hellbraunen Sneakers und hoffe, dass sie es nicht bemerkt. Solche klobigen Trachtenschuhe wie die von meinem Vater kommen mir nicht an die Füße.
»Raphi! Auf keinen Fall die Turnschuhe, zieh die Haferlschuhe vom Papa an, die passen doch so super dazu!«, ruft mir die Gabi, die wie üblich ihre Augen überall hat, warnend aus meinem Wohnzimmer zu. »Apropos, wo bleibt denn der Andi mit ihm?« Sie wirft einen kurzen Blick auf ihre riesige Armbanduhr, steckt den letzten Träger fest und gibt meinem Sohn einen sanften Klaps auf den Lederhosen-Hintern. »Geh, bring deinem bockigen Vater die Haferlschuhe vom Opa. Die sind noch oben bei mir im Schuhschrank, ganz rechts.« Schadenfroh kichernd flitzt der Felix los und läuft über die knarrende Treppe ins obere Stockwerk in Gabis Wohnung, um gleich darauf mit den alten Latschen wieder vor mir zu stehen. »Papa, krieg ich heute Geld fürs Autodrom? Der Manuel sagt, man kriegt zehn Jetons zum Preis von acht.« Er hält mir zappelnd die Schuhe hin. Auf dem Koppelrieder Volksfest, das jährlich auf der großen, leer stehenden Wiese neben dem Friedhof stattfindet, werden die Kinder und Jugendlichen mit einem Autodrom, einem Ringelspiel und einem Tagada für das ultimative Rüttelerlebnis bespaßt.
»Nicht mal einen Cent, du Verräter«, ziehe ich den kleinen Kerl auf.
Enttäuscht starrt er auf die großen Trachtenschuhe, die er unschlüssig in seinen kleinen Händen hält.
»Dafür kriegst du genug Geld von mir. Damit kannst du auch deine Freunde einladen.« Fesch gewandet in ihrem knielangen Flachgauer Festtagsdirndl aus dunkler Seide mit dunkelroter Schürze, kommt meine Schwester in den Flur und streckt mir neckisch die Zunge entgegen. Woraufhin mir mein Bub triumphierend die alten Schuhe in die Hände drückt. »Hier, Papa. Ich habe die meinigen auch brav angezogen und nicht blöd herumgezickt.«
»Herumgezickt?«, wiederhole ich ungläubig, mir scheint, mein Nachwuchs schaut zu viele Influencer-Videos auf YouTube. Da werde ich wohl mal regulierend auf seinem Handy eingreifen müssen.
Zufrieden grinst die Gabi übers ganze Gesicht und deutet wortlos mit ihren langen roten Fingernägeln auf meine Sneakers. Seufzend schlüpfe ich aus den bequemen Sportschuhen und quetsche meine Füße in die uralten Haferlschuhe aus hellbraunem Rauleder.
Da geht schwungvoll die Haustür auf, und mein bester Freund Andi poltert herein, den Schorsch und unseren Vater im Schlepptau. Die beiden Baumgartner-Brüder stecken brav wie ich in Lederhosen, der alte Aigner natürlich in seinem sündteuren, aber sehr eleganten Trachtenanzug samt Salzburger Trachtenhut.
Ehe wir es uns versehen, gibt der Andi meiner Schwester einen dicken Schmatz auf die Wange. »Entschuldige, Schatzl, aber der Franz hat im Seniorenheim seinen Hut net gleich g’funden. Wir haben beim Suchen helfen müssen.«
»Weil das Mitzerl mir immer alles verlegt. I find nia was, wenn die zum Putzen da war«, rechtfertigt sich der Vater sofort vor seiner Tochter, während ihr Freund einen Schritt zurückgeht und sie ausgiebig bewundert.
»Fesch, Schatzl, das neue Dirndl steht dir ausgezeichnet – und die Frisur erst.« Meine Schwester hat ihr langes schwarzes Haar gekonnt zu einer Trachten-Haarkrone geflochten und schaut wirklich apart damit aus. Das fällt sogar mir als Bruder auf.





























