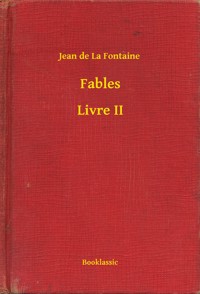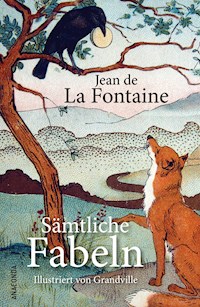
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wer kennt sie nicht aus seiner Schulzeit, die sprechenden Tiere der Fabeln La Fontaines? Anders als die antiken Fabeln, sind die Texte des Franzosen prägnant, amüsant und leicht lesbar. La Fontaine verzichtet auf den belehrenden Duktus der antiken Vorbilder. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern durch Witz und Ironie führt er die Leser zum richtigen moralischen Urteil. Das macht Fabeln wie »Der Rabe und der Fuchs«, »Die Grille und die Ameise« oder »Stadtratte und Landratte« auch noch am diesjährigen 400. Geburtstag des Autors zum unterhaltsamen und zeitlosen Lesegenuss für Groß und Klein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jean de La Fontaine
Sämtliche Fabeln
Mit den Illustrationen von Grandville
Aus dem Französischen von Ernst Dohm und Gustav Fabricius
Anaconda
Titel der französischen Originalausgabe: Fables (Paris 1668–1694). Die deutsche Übersetzung von Ernst Dohm erschien zuerst 1877. Die Zeichnungen von Grandville entstanden 1837. Text und Illustrationen folgen hier der Ausgabe München: Artemis Verlag 1978. Orthographie und Interpunktion wurden auf neue Rechtschreibung umgestellt.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-641-27915-8V001
© 2021 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen derPenguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenAlle Rechte vorbehalten.Umschlagmotiv: »Der Rabe und der Fuchs«, Illustration eines unbekanntenKünstlers in einer französischen Ausgabe der Fabeln Jean de La Fontainesvon 1900, Universal History Archive / UIG / Bridgeman ImagesUmschlaggestaltung: Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bad HonnefSatz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhauswww.anacondaverlag.de
Vorrede
Die Nachsicht, mit welcher man einige meiner Fabeln aufgenommen, lässt mich hoffen, dass auch diese Sammlung sich derselben Gunst erfreuen werde. Zwar hat einer unserer Meister der Beredsamkeit den Plan, die Fabeln in Verse zu bringen, missbilligt; er meinte, ihr hauptsächlichster Schmuck sei, keinen zu haben; auch fürchtete er, dass der Zwang der poetischen Form, verbunden mit der strengen Knappheit unserer Sprache, mir mannigfache Verlegenheit bereiten und bei den meisten jener Erzählungen die Kürze beeinträchtigen würde, welche man sehr wohl als ihr eigentliches Wesen bezeichnen darf, da sie ohne dieselbe notwendig etwas Ermüdendes haben müssten. Diese Meinung spricht für ihn als einen Mann von ausgezeichnetem Geschmack; nur möchte ich, dass er die Saiten etwas weniger straff zöge und zugäbe, die lakonischen Grazien und die französischen Musen ständen einander nicht gar so feindlich gegenüber, dass sie nicht auch oft vereint denselben Weg gehen könnten.
Überdies habe ich mich bei diesem Unternehmen nur auf das Beispiel – ich will nicht sagen, der Alten, denn das würde für mich nichts beweisen, sondern auf das der Neueren gestützt. Zu allen Zeiten und bei allen Völkern, bei welchen die Dichtkunst Pflege fand, hat der Parnass dies als sein Recht in Anspruch genommen. Kaum hatten die Fabeln, welche dem Äsop zugeschrieben werden, das Licht des Tages erblickt, als Sokrates es angemessen fand, sie in das Gewand der Musen zu kleiden. Was Plato darüber berichtet, ist so anmutig, dass ich nicht umhinkann, seine Erzählung als einen Schmuck dieser Vorrede hier mitzuteilen. Er erzählt, dass, als Sokrates zum Tode verurteilt war, die Vollstreckung dieses Urteils wegen irgendwelcher gerade in diese Zeit fallender Feste vertagt wurde. Am Morgen seines Todes besuchte ihn Kebes. Sokrates sagte ihm, während des Schlummers hätten die Götter ihm wiederholt verkündet, er solle vor seinem Tode sich der Musik befleißigen. Anfangs habe er nicht verstanden, was dieser Traum bedeuten solle; denn da die Musik den Menschen nicht besser mache, wozu sich mit ihr beschäftigen? Es müsse ein Geheimnis dahinter verborgen sein, und dies umso mehr, da die Götter nicht abließen, ihm immer dieselbe Eingebung zu senden. Sie war ihm auch während eines jener festlichen Tage gekommen, und zwar so lebhaft, dass, als er darüber nachsann, was wohl der Himmel von ihm verlangen könne, er auf den Gedanken verfiel, Musik und Dichtkunst seien so nahe verwandt, dass es sich möglicherweise um die Letztere handle. Es gibt keine gute Dichtung ohne Harmonie; allein es gibt auch keine ohne Erdichtung, und Sokrates war nicht imstande, etwas anderes als die Wahrheit zu sagen. Endlich hatte er einen Mittelweg gefunden, und zwar den: Fabeln zu wählen, die etwas Wahres enthielten, wie die des Äsop. Diese in Verse zu bringen, war das Werk der letzten Augenblicke seines Lebens.
Sokrates ist nicht der Einzige, der die Dichtkunst und unsere Fabeln als Schwestern angesehen hat. Phädrus hat Zeugnis abgelegt, dass er diese Auffassung teile, und die Trefflichkeit seines Werkes gibt uns einen Maßstab für die Beurteilung desjenigen, welches der Fürst aller Weltweisen in Angriff genommen. Nach Phädrus hat Avienus denselben Gegenstand behandelt. Zuletzt sind ihm die Neueren gefolgt, und wir haben die Beispiele hierfür nicht nur bei fremden Nationen, sondern auch bei uns selbst zu suchen. Allerdings ist die Sprache der Zeit, in welcher unsere Landsleute jene Versuche machten, so verschieden von unserer heutigen, dass wir auch sie nur als Fremde betrachten dürfen. Dieser Umstand hat mich nicht irregemacht an meinem Unternehmen; ich habe im Gegenteil mir mit der Hoffnung geschmeichelt, dass, wenn ich diese Bahn nicht mit Erfolg einschlagen sollte, man mir wenigstens den Ruhm zugestehen würde, dieselbe eröffnet zu haben.
Vielleicht erweckt meine Arbeit in anderen die Lust, das Unternehmen weiter fortzuführen. Der Stoff ist so wenig erschöpft, dass vielmehr die Zahl der noch in dichterische Form zu bringenden Fabeln größer ist als die der bereits von mir bearbeiteten. Freilich habe ich mir die Besten ausgesucht, d. h. diejenigen, welche mir als die Besten erschienen; aber abgesehen davon, dass ich mich in meiner Wahl getäuscht haben kann, wird es nicht allzu schwierig sein, den von mir ausgewählten noch eine fernere Reihe hinzuzufügen; und ist diese Reihe weniger lang, so wird sie zweifellos desto mehr Beifall finden. Wie es auch komme, immerhin wird man sich mir zu einigem Dank verpflichtet fühlen: Mag meine Kühnheit von Glück gekrönt und ich nicht allzu weit von dem richtigen Wege abgewichen oder mag mein einziges Verdienst das sein, dass ich andere angeregt habe, es besser zu machen.
Absicht und Plan meines Werkes glaube ich hinreichend gerechtfertigt zu haben; über die Ausführung wird das Publikum Richter sein. Man wird hier weder die Ebenmäßigkeit noch die außerordentliche Kürze finden, welche an Phädrus am meisten gepriesen werden; das sind Vorzüge, denen meine Kräfte nicht gewachsen sind. Da es mir unmöglich war, ihm hierin nachzueifern, glaubte ich zum Ersatz dafür meinem Werk einen heitreren Anstrich geben zu müssen, als er dem seinen verliehen. Nicht als ob ich ihn tadelte, innerhalb jener Grenzen geblieben zu sein; die lateinische Sprache erforderte es so, und wenn man ihn mit Verständnis und Aufmerksamkeit liest, wird man in diesem Schriftsteller den wahren Charakter und das wahre Genie des Terenz wiederfinden. Die Einfachheit ist prächtig bei diesen großen Männern; ich, dem die vollendete Durchbildung der Sprache nicht wie jenen zu Gebote steht, vermag nicht dieselbe auf gleiche Höhe zu erheben. Es galt also, einen Ersatz dafür zu suchen; und dies habe ich umso kühner getan, da Quintilian sagt, dass man eine Erzählung nie heiter genug halten könne. Es handelt sich hier nicht darum, diese Meinung weiter zu begründen; es genügt, dass Quintilian sie ausspricht. Dennoch lag mir die Erwägung nahe, dass, da diese Fabeln aller Welt bekannt sind, ich nichts erreichte, wenn es mir nicht gelänge, durch einige Zutaten ihnen einen neuen und frischen Reiz zu geben. Das verlangt man heutzutage: Was gefallen soll, muss neu und heiter sein. Unter Heiterkeit verstehe ich nicht das, was Lachen erregt, sondern jenen Zauber der Liebenswürdigkeit und Anmut, welchen man allen, selbst den ernstesten Gegenständen verleihen kann.
Doch nicht allein nach der Form, welche ich diesem Werke gegeben, darf man den Wert desselben bemessen, sondern nach seinem Nutzen und seinem Inhalt; denn gibt es auf dem Gebiete geistiger Schöpfung etwas Preisenswertes, das sich nicht in der Gestalt der Fabel vorfände? Es liegt in ihr etwas so Göttliches, dass im Altertum viele den größten Teil dieser Fabeln dem Sokrates zuschrieben; sie erwählten zum Vater derselben denjenigen Sterblichen, der im innigsten Verkehr mit den Göttern stand. Ich weiß nicht, warum sie nicht dieselben Fabeln geradewegs dem Himmel entstammt und ihren Schutz und ihre Leitung einem besondern Gotte zuerteilt sein ließen, wie die Kunst der Dichtung und der Rede. Was ich hier sage, ist nichts weniger als grundlos; denn, wenn ich das Heiligste, das wir besitzen, mit den Verirrungen des Heidentums zusammenstellen darf, so sehen wir, dass die Wahrheit zu den Menschen durch Gleichnisse gesprochen hat. Und was ist das Gleichnis anderes als die Fabel, d. h. ein erdichtetes Beispiel, welches sich umso leichter und wirksamer einprägt, je gemeinverständlicher und den gewöhnlichen Anschauungen verwandter es ist? Wer uns vorschlüge, nur die Meister und Lehrer der Weisheit nachzuahmen, gäbe uns einen Entschuldigungsgrund an die Hand; es gibt keinen, wenn Bienen und Ameisen fähig sind, dasselbe zu tun, was man von uns verlangt.
Aus diesen Gründen hat Plato den Homer aus seiner Republik verbannt und dem Äsop einen bevorzugten Ehrenplatz in derselben angewiesen. Er wünscht, dass die Kinder diese Fabeln mit der Muttermilch einsaugen; er empfiehlt den Ammen, ihnen dieselben beizubringen; denn man könne sich nicht früh genug an Weisheit und Tugend gewöhnen. Um nicht später genötigt zu sein, unsere Sitten und Gewohnheiten zu verbessern, sollen wir daran arbeiten, ihnen eine gute Richtung zu geben zu einer Zeit, in welcher sie noch weder gut noch böse sind. Und wo fände man für diesen Zweck ein besseres und wirksameres Mittel als in jenen Fabeln? Man erzähle einem Kinde, dass Crassus, als er gegen die Parther zog, sich in ihr Land hineinwagte, ohne zu bedenken, wie er wieder herauskommen sollte, und dass dies, trotz aller seiner Anstrengungen, einen Rückzug zu finden, ihm und seinem Heere den Untergang brachte. Man erzähle demselben Kinde, dass der Fuchs und der Ziegenbock in einen Brunnen hinabstiegen, um ihren Durst zu löschen; dass der Fuchs sich der Schultern und der Hörner seines Gefährten als einer Leiter bediente und so wieder herauskam, dass der Bock dagegen darin bleiben musste, weil er nicht ebenso klug und vorsichtig gewesen; und wie man folglich bei jeder Sache das Ende bedenken müsse. Ich frage, welches dieser beiden Beispiele dem Kinde mehr Eindruck machen wird. Wird es sich nicht an das Letztere halten, als an dasjenige, welches dem geringen Umfang seines Verständnisses am meisten entspricht und die mindesten Anforderungen an dasselbe macht? Man wende mir nicht ein, die Gedanken der Kindheit seien schon ohnehin kindisch genug, sodass man sie nicht noch auf neue Kindereien hinzulenken brauche. Diese Kindereien sind nur scheinbar Kindereien; denn im Grunde haben sie einen sehr ernsten Sinn. Und wie wir durch Erklärung des Punktes, der Linie, der Fläche und ähnlicher ganz geläufiger Grundbegriffe schließlich zu Kenntnissen gelangen, die uns in den Stand setzen, Himmel und Erde zu messen: Ganz ebenso werden durch die Schlüsse und Folgerungen, die man aus diesen Fabeln zieht, unser Urteilsvermögen und unsere Sitten und wir für das wahrhaft Große empfänglich gemacht und befähigt.
Sie sind nicht nur moralisch, sondern auch auf anderen Gebieten belehrend: Es kommen in ihnen die Eigentümlichkeiten und die verschiedenen Charaktere der Tiere zum Ausdruck und infolgedessen auch die unseren, da wir der Inbegriff alles Guten und Bösen sind, das in den nicht vernunftbegabten Geschöpfen sich uns darstellt. Als Prometheus den Menschen bilden wollte, nahm er die vorherrschende Eigenschaft eines jeden Tieres; aus diesen so verschieden gearteten Stücken fügte er unsere Gattung zusammen und schuf er jenes Werk, das wir Mikrokosmos nennen. So sind diese Fabeln ein Gemälde, auf welchem jeder von uns sich abgebildet findet. Was sie uns darstellen, befestigt die älteren Leute in den Kenntnissen, welche das Leben ihnen gewährt hat, und lehrt die Kinder dasjenige, was zu wissen ihnen nottut. Die letzteren, als neue Ankömmlinge in der Welt, kennen die Bewohner derselben nicht; sie kennen sich selber nicht. Diese Unwissenheit soll man ihnen möglichst bald benehmen; man muss sie lehren, was ein Löwe, was ein Fuchs ist usw. und warum man mitunter einen Menschen mit diesem Fuchs oder mit jenem Löwen vergleicht. Das ist das Ziel, auf welches diese Fabeln hinarbeiten; die ersten Anschauungen und Vorstellungen von allen jenen Dingen gehen aus ihnen hervor.
Ich habe das bei Vorreden übliche Maß bereits überschritten, und doch habe ich über die Haltung meines Werkes noch nicht Rechenschaft gegeben.
Die Gleichnisfabel besteht aus zwei Teilen, deren einen man den Körper nennen könnte, während der andere die Seele darstellt. Die eigentliche Fabel ist der Körper, die Seele ist die Moral. Aristoteles will in der Fabel als handelnde Personen nur die Tiere zulassen; Menschen und Pflanzen schließt er von ihr aus. Diese Vorschrift ist weniger von der Notwendigkeit als von einem gewissen Gefühl für das Passende und Schickliche geboten; auch hat weder Äsop noch Phädrus noch irgendein anderer Fabeldichter sich streng an dieselbe gehalten, ganz im Gegensatz zu der »Moral«, welche kein Einziger unbeachtet lässt. Habe ich dieselbe hier und da anzuführen unterlassen, so ist dies nur an solchen Stellen geschehen, wo ihre Erwähnung dem Schönheitssinn widerstrebt hätte oder wo es dem Leser leicht ist, sie zu ergänzen. In Frankreich handelt es sich nur darum, dass etwas gefalle; das ist die große, um es geradeheraus zu sagen, die einzige Regel. Ich habe es daher nicht gerade für ein Verbrechen gehalten, mich über das Althergebrachte hinwegzusetzen, wo dasselbe nur dadurch, dass man ihm Gewalt antat, aufrechtzuerhalten gewesen wäre. Zu Äsops Zeiten wurde die Fabel ganz einfach erzählt, und darauf folgte, immer von ihr getrennt, die Moral. Dann kam Phädrus, der sich dieser Regel nicht unterwarf: Er verleiht der Erzählung mehr Zierlichkeit und Schmuck und verlegt die Moral bisweilen vom Ende an den Anfang. Sollte es durchaus notwendig sein, ihr einen Platz anzuweisen, so fehle ich gegen diese Vorschrift nur, um eine andere zu befolgen, welche nicht minder wichtig ist und die Horaz uns gibt. Dieser Schriftsteller will nicht, dass ein Dichter sich hartnäckig auf etwas versteife, was der Anlage seines Geistes und der Beschaffenheit seines Stoffes zuwider ist. Niemals – so behauptet er – wird ein Mensch, der nach Erfolg strebt, dergleichen durchsetzen wollen; sieht er von irgendeiner Sache ein, dass es ihm nicht gelingen will, etwas Gutes aus ihr zu machen, so gibt er sie auf.
… Et quae
Desperat tractata nitescere posse relinquit.
Dies habe auch ich mit der Moral in einigen Fällen getan, in denen ich mir von derselben keinen besonders guten Erfolg versprechen konnte.
Jean de la Fontaine
Erstes Buch
Die Grille und die Ameise
Grillchen, das den Sommer lang
Zirpt’ und sang,
Litt, da nun der Winter droht’,
Harte Zeit und bittre Not:
Nicht das kleinste Würmchen nur,
Und von Fliegen keine Spur!
Und vor Hunger weinend leise
Schlich’s zur Nachbarin Ameise;
Fleht’ sie an, in ihrer Not
Ihr zu leihn ein Körnlein Brot,
Bis der Sommer wiederkehre.
»Glaub mir« – sprach’s –, »auf Grillen-Ehre,
Vor dem Erntemond noch zahl
Zins ich dir und Kapital.« –
Ämschen, die, wie manche lieben
Leute, das Verleihen hasst,
Fragt die Borgerin: »Was hast
Du im Sommer denn getrieben?« –
»Tag und Nacht hab ich ergetzt
Durch mein Singen alle Leut.« –
»Durch dein Singen? – Sehr erfreut!
Weißt du was? Dann – tanze jetzt!«
Der Rabe und der Fuchs
Im Schnabel einen Käse haltend, hockt
Auf einem Baumast Meister Rabe.
Von dieses Käses Duft herbeigelockt,
Spricht Meister Fuchs, der schlaue Knabe:
»Ah! Herr von Rabe, guten Tag!
Wie nett ihr seid und von wie feinem Schlag!
Entspricht dem glänzenden Gefieder
Nun auch der Wohlklang eurer Lieder,
Dann seid der Phönix ihr in diesem Waldrevier.«
Dem Raben hüpft das Herz vor Lust. Der Stimme Zier
Zu künden, tut mit stolzem Sinn
Er weit den Schnabel auf; da – fällt der Käse hin.
Der Fuchs nimmt ihn und spricht: »Mein Freundchen,
denkt an mich!
Ein jeder Schmeichler mästet sich
Vom Fette des, der willig auf ihn hört.
Die Lehr ist zweifellos wohl – einen Käse wert!«
Der Rabe, scham- und reuevoll,
Schwört – etwas spät –, dass niemand ihn mehr fangen soll.
Der Frosch, der dem Stier an Größe gleichen wollte
Ein Frosch sah einstmals einen Stier,
Des Wuchs ihm ungemein gefallen.
Kaum größer als ein Ei, war doch voll Neid das Tier;
Er reckt und bläht sich auf mit seinen Kräften allen,
Dem feisten Rind an Größe gleich zu sein.
Drauf spricht er: »Schau, mein Brüderlein,
Ist’s nun genug? Bin ich so groß wie du?« – »O nein!« –
»Jetzt aber?« – »Nein!« – »Doch nun?« – »Wie du dich
auch abmattst,
Du wirst mir nimmer gleich!« – Das arme kleine Vieh
Bläht sich und bläht sich, bis es – platzt.
Wie viele gibt’s, die nur nach eitler Größe dürsten!
Der Bürgersmann tät’s gern dem hohen Adel gleich,
Das kleinste Fürstentum spielt Königreich,
Und jedes Gräflein spielt den Fürsten.
Die beiden Esel
Zwei Esel gehn des Wegs; nur Hafer schleppte der,
Doch jener trug viel Geld zum Amt der Steuern,
Und stolz sich brüstend ob der goldnen Last, der teuern,
Gäb er um keinen Preis die blanke Bürde her.
Er trabt gewicht’gen Schritts einher,
Hell lässt er tönen sein Geläute.
Da plötzlich naht des Feindes Heer,
Und da nach Gold nur ihr Begehr,
Wirft auf das Steuer-Lasttier sich die ganze Meute
Und nimmt es mit als gute Beute.
Freund Langohr leistet Gegenwehr;
Doch schwer verwundet sinkt er hin und seufzt im Sterben:
»Das also ist mein Lohn? O gleisnerische Pracht!
Der schlechten Hafer trug, entrinnt jetzt dem Verderben,
Und ich, ich sink in Todes Nacht!«
Da spricht zu ihm sein Freund, der gute:
»Nicht stets sind Würd und Amt ein Glück, das glaube mir!
Freund, wärest du, wie ich, ein armes Müllertier,
Lägst du nicht hier in deinem Blute.«
Der Wolf und der Hund
Ein Wolf, der nichts als Knochen war und Haut –
Dank guter Wacht der Schäferhunde –
Traf eine Dogge einst, die, stark und wohlgebaut,
Glänzenden Fells und feist, just jagte in der Runde.
»Ha!« –, dachte Meister Isegrim –
»Die so zum Frühstück, wär nicht schlimm!«
Doch stand bevor ein Kampf, ein heißer,
Und unser Hofhund hatte Beißer,
Gemacht zu harter Gegenwehr.
Drum kommt der Wolf ganz freundlich her
Und spricht ihn an, so ganz von ungefähr,
Bewundernd seines Leibes Fülle.
»Die, lieber Herr, ist’s euer Wille« –
Erwiderte der Hund –, »blüht euch so gut wie mir!
Verlasst dies wilde Waldrevier;
Seht eure Vettern, ohne Zweifel
Nur dürft’ge Schlucker, arme Teufel,
Sie lungern hier umher, verhungert, nackt und bloß!
Hier füttert keiner euch, ihr lebt nur – mit Verlaub –
Vom schlechtesten Geschäft, dem Raub.
Drum folgt mir, und euch winkt – glaubt nur – ein besser Los.« –
»Was« – sprach der Wolf –, »hab ich dafür zu leisten?« –
»Fast nichts!« –, so sagt der Hund. – »Man überlässt die Jagd
Den Menschen, denen sie behagt,
Schmeichelt der Dienerschaft, doch seinem Herrn am meisten.
Dafür erhält die nicht verspeisten
Tischreste man zum Lohn, oft Bissen leckrer Art,
Hühner- und Taubenknöchlein zart,
Manch andrer Wohltat zu geschweigen!« –
Schon träumt der Wolf gerührt vom Glück der Zukunft, und
Ein Tränlein will dem Aug entsteigen;
Da plötzlich sieht er, dass am Halse kahl der Hund.
»Was ist das?« –, fragt er. – »Nichts!« – »Wie? Nichts?« –
»Hat nichts zu sagen!« –
»Und doch?« – »Es drückte wohl das Halsband hier mich wund,
Woran die Kette hängt, die wir mitunter tragen.« –
»Die Kette?« –, fragt der Wolf. – »Also bist du nicht frei?« –
»Nicht immer; doch was ist daran gelegen?« –
»So viel, dass ich dein Glück, all deine Schwelgerei
Verachte! Bötst du meinetwegen
Um den Preis mir ’nen Schatz, sieh, ich verschmäht ihn doch!«
Sprach’s, lief zum Wald zurück flugs und – läuft heute noch.
Kalb, Ziege, Schaf im Bund mit dem Löwen
Kalb, Zieg und Schaf, im Bund mit einem stolzen Leun,
Als Gründer bildeten in grauer Vorzeit Tagen
Genossenschaftlich sie einen Handelsverein,
Gewinn sowie Verlust zu gleichem Teil zu tragen.
Auf dem Gebiet der Geiß fing einst ein Hirsch sich ein.
Zu den Genossen schickt die biedre Zieg in Eile;
Sie kommen, und der Leu, indem er um sich blickt,
Spricht: »Wir sind vier, drum geht die Beut auch in vier Teile.«
Zerlegend drauf den Hirsch nach Jägerart geschickt,
Nimmt er das erste Stück für sich, und mit Behagen
Spricht er: »Das kommt mir zu, weil ich, euch zum Gewinn,
Als Leu der Tiere König bin;
Dagegen ist wohl nichts zu sagen!
Von Rechtes wegen fällt mir zu das zweite Stück;
Dies Recht, des Stärkern Recht heißt’s in der Politik.
Als Tapferstem wird mir das dritte wohl gebühren!
Wagt einer jetzt von euch, das vierte zu berühren,
So würg ich ihn im Augenblick.«
Der Quersack
Einst sprach der Vater Zeus: »An meines Thrones Stufen
Erscheine, was da lebt; und wer sich an Gestalt
Und Wesen zu Beschwer berechtigt und berufen
Vermeint, der red ohn Hinterhalt!
Wo’s geht, bin ich zu helfen willig.
Du, Affe, sprich zuerst! Schau dir, wie recht und billig,
Die Tiere alle an, vergleich ihr Angesicht
Und ihre Formen mit den deinen.
Bist du zufrieden?« – »Ich?« –, sprach er – »Warum denn nicht?
Ich hab vier Füße doch wie jene, sollt ich meinen!
Und mit Vergnügen stets hab ich mein Bild beschaut.
Allein mein Bruder Bär ist gar zu plump gebaut,
Und keinem Maler sollt er je zu sitzen wagen!« –
Der Bär tritt vor – man glaubt, er wolle sich beklagen;
Doch weit gefehlt! Hört nur, wie seinen Wuchs er rühmt!
Jedoch der Elefant – so schmäht er unverblümt –
Hätt das am Ohr zu viel, was ihm am Schwanze fehlte;
Unförmig, massenhaft, sei er der Schönheit bar!
Der Elefant, der sonst sogar
Ein kluges Tier, erschien doch heut als Tor und schmälte,
Dass für sein Maul, das nicht gering,
Der Walfisch sich zu dick erwiese!
Der Ameis schien die Milb ein gar zu winzig Ding,
Dagegen wär sie selbst ein Riese!
Zeus schickt sie alle heim, die sich so mild und lind
Selbstlobend kritisiert. Wir Menschen aber sind
Der Toren törichtste, da alle wir im Leben,
Für andre luchsäugig, für uns stets maulwurfblind,
Uns selber alles, doch dem Nächsten nichts vergeben.
Nie gleichen Blicks hast dein du wie des andern acht.
Es schuf des höchsten Schöpfers Macht
Als Lumpenvolk uns all, heut wie in frühern Tagen:
Quer auf die Schulter legt’ er uns den Bettelsack,
Drin unsrer Sünden Last wir auf dem Rücken tragen,
Doch vorn, uns sichtbar stets, der fremden Fehler Pack.
Die Schwalbe und die kleinen Vögel
War einst ’ne Schwalbe, die auf Reisen
Gar viel gelernt. Wer viel und mancherlei gesehn,
Wird auch so manches wohl verstehn.
Sie sah von ferne schon die leichtste Brise kreisen,
Und eh zum Sturmwind die erwuchs,
Verkündet sie’s den Schiffern flugs.
Da nun die Jahreszeit kam, wo der Hanf gesät wird,
Sah einen Landmann sie, der ihn in Furchen streut.
»Das missfällt mir!« –, sprach sie. »Ihr Vöglein, seid gescheut!
Ihr dauert mich; denn ich, ich geh, bevor’s zu spät wird,
Weit fort und berge mich da, wo ich sicher bin.
Doch ihr – seht ihr die Hand dort hin und her ihn schwingen?
Glaubt mir: ’s ist nicht mehr lange hin,
Dann wird, was jetzt sie streut, euch, ach! Verderben bringen.
Da wird zu eurem Fang manch Netz gar meisterlich
Gelegt und mancher Dohnenstrich;
Man stellt euch nach, man legt euch Schlingen.
Dann kommt die Zeit der schweren Not,
Wo euch Gefängnis oder Tod,
Der Käfig oder Bratspieß droht.
Drum rat ich euch, jetzt wegzufressen
Den Samen. Folgt mir und seid klug!«
Die Vöglein höhnten sie vermessen,
Sie hatten Futters ja genug!
Man sah das Hanffeld grün sich färben.
Da sprach die Schwalbe: »Schnell! Reißt, Halm für Halm, jetzt ab
Das Gras, das jener Same gab;
Sonst bringt es sicher euch Verderben.« –
»Unglücksprophet!« –, schrien sie – »Geschwätzter Phrasenheld!
Ein schöner Rat, um uns zu retten!
Da tausend Mann wir nötig hätten,
Jetzt kahl zu mähn dies ganze Feld!«
Als nun der Hanf in Samen schoss,
Da rief die Schwalb: »O weh!« –, und schüttelte das Haupt.
»Das böse Kraut! Wie schnell es spross!
Doch ihr, die ihr bisher noch nimmer mir geglaubt,
Merkt jetzt euch dies: Seht ihr die Fluren
Voll Stoppeln, hat der Mensch sein Feld
Fertig für dieses Jahr bestellt
Und folgt als Feind er euren Spuren,
Stellt Fallen er und Netze fein
Den armen kleinen Vögelein,
Dann hütet euch umherzufliegen!
Dann bleibt zu Haus, vielmehr verlasst dann diesen Ort,
Wie Kranich, Schnepf und Storch auf ihren Wanderzügen.
Ach, leider könnt ihr ja nicht fort,
Nicht über Land und Meer, wie wir, zum Flug euch rüsten
Nach fremden Weltteils fernen Küsten!
Drum, glaubt mir, ist für euch die einz’ge Rettung noch,
Euch still zu bergen in ein sichres Mauerloch.« –
Die Vöglein, statt der weisen Kunde
Zu lauschen, fingen an zu schwatzen, Oh und Ach,
Wie der Trojaner Volk, als mit Prophetenmunde
Kassandra einst zu ihnen sprach.
Wie jenen dort, ging’s jetzt den Kleinen:
Manch Vöglein seufzte, das in Sklaverei geriet.
Wir glauben stets nur, was wir meinen,
Und sehn den Schaden erst, wenn er uns selbst geschieht.
Stadtratte und Landratte
Stadträttlein lud einst zum Feste
Und zu Tisch, auf hoch und fein
Fette Ortolanen-Reste,
Landrättlein gar höfisch ein.
Auf dem türk’schen fein gewebten
Teppich stand das Mahl bereit,
Und die beiden Freunde lebten
Lustig und in Herrlichkeit.
Man genoss in vollen Zügen,
Köstlich mundete der Schmaus;
Plötzlich, mitten im Vergnügen,
Wurden sie gestört – o Graus!
Klang es nicht, als ob was krachte? –
Hei, wie Stadträttlein in Hast
Gleich sich aus dem Staube machte!
Schleunigst folgt ihm nach der Gast.
Blinder Lärm nur war’s. Es wandern
Beide wieder in den Saal,
Und Stadträttlein spricht zum andern:
»Setzen jetzt wir fort das Mahl!«
»Danke sehr!« –, spricht jenes – »Morgen
Komm zu mir aufs Land hinaus.
Kann dir freilich nicht besorgen
Dort so königlichen Schmaus.
Einfach nur, doch unbeneidet,
Voller Sicherheit bewusst,
Speis ich dort. Pfui solcher Lust,
Die durch Furcht mir wird verleidet!«
Der Wolf und das Lamm
Des Stärkern Recht ist stets das beste Recht gewesen –
Ihr sollt’s in dieser Fabel lesen.
Ein Lamm löscht’ einst an Baches Rand
Den Durst in dessen klarer Welle.
Ein Wolf, ganz nüchtern noch, kommt an dieselbe Stelle,
Des gier’ger Sinn nach guter Beute stand.
»Wie kannst du meinen Trank zu trüben dich erfrechen?« –,
Begann der Wüterich zu sprechen –
»Die Unverschämtheit sollst du büßen, und sogleich!« –
»Eu’r Hoheit brauchte« – sagt das Lamm, vor Schrecken bleich –
»Darum sich so nicht aufzuregen!
Wollt doch nur gütigst überlegen,
Dass an dem Platz, den ich erwählt,
Von Euch gezählt,
Ich zwanzig Schritt stromabwärts stehe;
Dass folglich Euren Trank – seht Euch den Ort nur an –
Ich ganz unmöglich trüben kann.« –
»Du trübst ihn dennoch!« –, spricht der Wilde. »Wie ich sehe,
Bist du’s auch, der auf mich geschimpft im vor’gen Jahr!« –
»Wie? Ich, geschimpft, da ich noch nicht geboren war?
Noch säugt die Mutter mich; fragt nach im Stalle.«
»Dein Bruder war’s in diesem Falle!« –
»Den hab ich nicht.« – »Dann war’s dein Vetter! Und
Ihr hetzt mich und verfolgt mich alle,
Ihr, euer Hirt und euer Hund.
Ja, rächen muss ich mich, wie alle sagen!« –
Er packt’s, zum Walde schleppt er’s drauf,
Und ohne nach dem Recht zu fragen,
Frisst er das arme Lämmlein auf.
Der Mensch und sein Ebenbild
FÜR DEN HERZOG DE LA ROCHEFOUCAULD
Es war einmal ein Mann, der, in sich selbst verliebt,
Sich für den Schönsten hielt, den alle Lande trügen;
Den Spiegel scheltend, dass entstellt sein Bild er gibt,
Fand er sein Glück darin, sich selber zu belügen.
Um ihn zu heilen, sorgt ein günstiges Geschick,
Dass stets er, wo auch weilt sein Blick,
Der Damen stummen und geheimen Rat muss schauen:
Spiegel in Stub und Saal, Spiegel, ob nah, ob fern,
Spiegel in Taschen feiner Herrn,
Spiegel im Gürtel schöner Frauen.
Was tut unser Narziss? Er tut sich selbst in Bann
Und birgt am stillsten Ort sich, den er finden kann,
Wohin kein Spiegel wirft sein trügerisch Gebilde.
Doch durch der Einsamkeit verlassenstes Gefilde
Rieselt ein klarer Silberbach.
Er schaut sich selbst darin, und zürnend ruft er: »Ach,
Ein eitel Trugbild ist’s, das mir den Ort verleidet!«
Er gibt sich alle Müh, ihm aus dem Weg zu gehn;
Allein der Bach ist gar so schön,
Dass er nur ungern von ihm scheidet.
Was die Moral der Fabel sei?
Zu allen red ich; das Sichselbstbetrügen,
Ein Übel ist’s, von dem kein Sterblicher ganz frei:
Dein Herz, es ist der Narr, geneigt, sich zu belügen;
Der Spiegel, den als falsch zu schelten wir geneigt,
Des Nächsten Torheit ist’s, die wir an uns vermissen.
Der Bach, der unser Bild uns zeigt,
Du kennst ihn wohl, man nennt ihn – das Gewissen.
Der vielköpfige und der vielschwänzige Drache
Einst pries vor der Höflinge Schar
Der türk’sche Gesandt’, der in Wien beglaubigt war,
Des eignen Landes Macht vor der des Deutschen Reiches.
Ein Deutscher sprach: »Trotz des Vergleiches
Wisst: Unsres Kaisers Banner trug
Schon mancher Mann, selbst stark genug,
Tät’s not, auf eigne Hand ein Heer zum Kampf zu rüsten.«
Des Sultans Pascha, fein und klug,
Erwidert’: »Als ob wir nicht wüssten,
Was jeder Kurfürst an Soldaten stellen kann!
Das mahnt mich unwillkürlich an
Etwas, das ich erlebt, mag’s wunderbar auch klingen.
Ich stand an sichrem Ort, da sah durch einen Hag
Die hundert Häupter ich der Hydra plötzlich dringen.
Mein Blut erstarrt – so etwas mag
Zur Furcht den Tapfersten wohl bringen!
Doch blind war meine Furcht; denn ob der Köpfe Zahl
Drang durch die Hecke nicht einmal,
Geschweige bis zu mir, der Leib des Ungeheuers.
Noch dacht ich dieses Abenteuers,
Da seh ein zweites Tier, ein vielgeschweiftes, ich,
Das bohrt sein Drachenhaupt, sein einz’ges, durch die Hecken;
Zum zweiten Male fühlt ich mich
Von Angst erfasst und starrem Schrecken.
Haupt, Leib und jeder Schweif – eins brach dem andern Bahn,
So ward der Fortschritt leicht dem Tier, dem ungeheuren.
Seht, ganz so scheint’s mir angetan
Mit unsrem Reich und mit dem Euren.«
Die Diebe und der Esel
Zwei Diebe prügelten um einen Esel sich,
Den sie geraubt; der wollt behalten ihn, verkaufen
Wollt ihn der andre. Jämmerlich
Zerbleut das edle Paar sich drum in blut’gem Raufen.
Ein dritter Spitzbub kommt zum Ort,
Der führt den Meister Langohr fort.
Manch armes Land ist wohl dem Esel zu vergleichen,
Und mancher Fürst aus fernen Reichen,
Wie aus der Walachei, Ungarn und der Türkei,
Den Dieben. Statt der zwei sind’s manchmal drei –
Zu häufig nur ist diese Sorte heute!
Doch von dem Kleeblatt fällt oft keinem zu die Beute;
Ein vierter Räuber kommt, ganz jener wert, und – schnapp!
Jagt er das Langohr ihnen ab.
Wie Simonides von den Göttern beschützt ward
Drei Dinge gibt’s, die nie man hoch genug kann preisen:
Gott, die Geliebt’ und seinen Herrn.
Malherbe sagt’s einmal, und ich bekenn mich gern
Zu diesem Ausspruch unsres Weisen.
Wohl kitzelt feines Lob und nimmt die Herzen ein,
Oft ist der Schönen Gunst der Preis für Schmeichelein.
Hört, welch ein Preis dafür von Göttern zu gewinnen.
Simonides fiel’s einstmals ein,
’nes Fechters Lob im Lied zu singen. Beim Beginnen
Fand er zu trocken gleich, zu arm den Gegenstand;
Des Ringers Sippe war fast gänzlich unbekannt,
Ein braver Ehrenmann sein Vater, er ein schlichter
Und dürft’ger Stoff für einen Dichter.
Anfangs sprach der Poet von seinem Helden zwar
Und lobte, was an ihm nur irgend war zu loben;
Bald aber schweift’ er ab, und zu dem Zwillingspaar
Kastor und Pollux hat er schwungvoll sich erhoben.
Er preist die beiden als der Ringer Ruhm und Hort,
Zählt ihre Kämpfe auf, bezeichnet jeden Ort,
Wo jemals sie gestrahlt im Glanze hellsten Lichtes.
Der beiden Lob – mit einem Wort,
Zwei Drittel füllt es des Gedichtes.
Bedungen hatten ein Talent als Preis die zwei;
Jetzt kommt der Biedermann herbei,
Zahlt ihm ein Drittel nur und sagt ihm frank und frei,
Es würden ihm den Rest Kastor und Pollux zahlen.
»Halt dich nur an die zwei, die hell am Himmel strahlen!
Allein, dass du nicht meinst, ich sei
Dir gram – besuche mich zu Tisch. Gut sollst du speisen;
Auch die Gesellschaft ist nicht schlecht,
’s ist meine Sippe – ist dir’s recht,
So wolle mir die Ehr erweisen.«
Simonides sagt zu; vielleicht befürchtet er,
Außer dem Geld auch noch die Ehre dranzugeben.
Er kommt; man speist, man lässt ihn leben,
Und froh und munter geht es her.
Da meldet ihm ein Sklav, es hätten an der Pforte
Zwei Männer augenblicks zu sprechen ihn begehrt;
Er eilt hinaus, doch bleibt am Orte
Die Sippe schmausend ungestört.
Das Götterzwillingspaar, die er im Lied gepriesen,
Sie sind’s, sie bringen ihm die Mahnung jetzt als Lohn:
Forteilen mög er schnell aus diesen
Unsel’gen Hallen, die mit nahem Einsturz drohn.
Bald war erfüllt die Schreckenskunde:
Ein Pfeiler wankt, einstürzt das Dach,
Das ungestützte, schlägt zugrunde
All’ Ess- und Trinkgerät und mit furchtbarem Krach
Die Schenken selbst im Festgemach.
Noch mehr: Als Rache für die Götter, die geschmähten,
Und den betrogenen Poeten
Zerschmettert beide Bein ein Balken dem Athleten.
Teils wund, teils arg verstümmelt gar
Kehrt heim der Gäste ganze Schar.
Fama verbreitete die Mär auf ihren Reisen;
Nun doppelt alle Welt, ihm Achtung zu beweisen,
Den Sold des Dichters, der der Götter Liebling war,
Und jedermann aus höhern Kreisen
Ließ jetzt durch ihn für Honorar
In Versen seine Ahnen preisen.
Was lehrt die Fabel uns? – Zuerst, mein ich, dass man
Das Lob der Himmlischen zu weit nie treiben kann;
Ferner, dass mit dem Schmerz und ähnlich ernsten Sachen
Melpomene versteht manch gut Geschäft zu machen;
Endlich, dass unsre Kunst man schätz ohn Unterlass.
Die Großen ehren sich, wenn uns sie Gunst erweisen;
Einst hört’ als Freund’ und Brüder preisen
Man den Olymp und den Parnass.
Der Tod und der Unglückliche
Stets rief in seiner Not ein armer Mann
Den Tod als Retter an.
»Tod!« –, rief er – »wie so schön erscheinst du dem Elenden!
Komm, eilig komm herbei, mein grausam Los zu enden!« –
Der Tod vernimmt’s und ist dienstfertig gleich am Ort,
Klopft an die Tür, tritt ein, und, kaum lässt er sich schauen –
»Was seh ich?« –, ruft der Mann. »Bringt dieses Scheusal fort!
Wie grässlich ist er! Angst und Grauen
Macht mir sein Anblick! Höre mich,
Komm näher nicht, o Tod! O Tod, entferne dich!«
Mäcenas war ein Mann von Ehre,
Und dieser sagte einst: »Nähmt meine Mannheit ihr,
Ja, wenn ein Krüppel ich ohn Arm’ und Beine wäre,
Nur leben will ich ja! Lasst nur das Leben mir!«
Komm nimmermehr, o Tod! – so fleht man stets zu dir.
Diesen Gegenstand hat Äsop auf andere Weise behandelt, wie die folgende Fabel zeigen wird. Ich habe diese aus einem Grunde geschrieben, der mich zwang, die Sache so allgemein zu halten. Doch jemand ließ mich wissen, dass ich weit besser getan hätte, bei meinem Original zu bleiben, und dass ich mir eine der schönsten Stellen im Äsop hätte entgehen lassen. So war ich gehalten, zu ihm zurückzukehren. Wir können nicht über die Alten hinausgehen: Sie haben uns für unser Teil nur den Ruhm gelassen, ihnen nachzueifern. Gleichwohl stelle ich meine Fabel neben die des Äsop, nicht, weil sie es verdiente, doch weil die Worte des Mäcenas, die ich eingebracht habe, so schön und so treffend sind, dass ich nicht glaubte, sie weglassen zu müssen.
Der Tod und der Holzfäller
Ein armer Arbeitsmann, mit Reisig schwer belastet,
Von seines Bündels und der Jahre Last gedrückt,
Geht schwanken Schritts fürbass, tief seufzend und gebückt;
Sein Hüttlein hätt er gern erreicht, bevor er rastet.
Jetzt kann er nicht mehr fort, und tränenfeuchten Blicks,
Die Bündel ablegend, denkt er seines Missgeschicks.
Was bot an Freuden ihm bisher sein ganzes Leben?
Kann’s einen Ärmern wohl als ihn auf Erden geben?
Oft keinen Bissen Brot und nimmer Ruh noch Rast,
Weib, Kind, der Steuern und der Einquartierung Last,
Frondienst und Gläub’ger ohn Erbarmen –
Des Jammers vollstes Bild zeigt alles dies dem Armen.
Er ruft den Tod herbei; der ist auch gleich zur Stell
Und fragt, womit er dienen sollte.
»Ach, bitte« – spricht er –, »hilf mir schnell
Dies Holz aufladen! Das ist alles, was ich wollte!«
Tod heilt alle Erdennot;
Aber Leben ist nicht minder
Schön, und: »Besser Not als Tod« –
Denken alle Menschenkinder.
Der Mann zwischen zwei Lebensaltern und zwei Lebensgefährtinnen
Einer in dem unbequemen
Alter, wo vom Lebensherbst,
Dunkles Haupt, du grau dich färbst,
Dachte dran, ein Weib zu nehmen.
Sein Geldsack war sehr schwer,
Und daher
Auch manche Frau bemüht, ihm zu gefallen;
Doch just darum beeilt’ sich unser Freund nicht sehr –
Gut wählen ist das Wichtigste von allen.
Zwei Witwen freuten sich am meisten seiner Gunst,
’ne junge und ’ne etwas mehr betagte;
Doch die verbesserte durch Kunst,
Was schon der Zahn der Zeit benagte.
Es schwatzt und lacht das Witwenpaar,
Ist stets bemüht, ihn zu ergetzen;
Sie kämmen manchmal ihn sogar,
Um ihm den Kopf zurechtzusetzen.
Die Ältre raubt dann stets ihm etwas dunkles Haar,
So viel davon noch übrig war –
Viel gleicher dünkt sie sich dadurch dem alten Schatze.
Die Junge zieht mit Fleiß ihm aus das weiße Haar;
Und beide treiben’s so, dass unsres Graukopfs Glatze
Bald gänzlich kahl – da wird ihm erst sein Standpunkt klar.
»Viel Dank, ihr Schönen, euch!« –, spricht er. »Wie gut auch
immer
Ich von euch geschoren bin,
Hab ich doch davon Gewinn;
Denn an Heirat denk ich nimmer.
Welche ich nähm, stets ging’s, wollt ich nicht ew’gen Zank,
Nach ihrem, nicht nach meinem Kopfe.
’nen Kahlkopf fasst man nicht beim Schopfe!
Für diese Lehre nehmt, ihr Schönen, meinen Dank.«
Der Fuchs und der Storch
Gevatter Fuchs hat einst in Kosten sich gestürzt
Und den Gevatter Storch zum Mittagbrot gebeten.
Nicht allzu üppig war das Mahl und reich gewürzt;
Denn statt der Austern und Lampreten
Gab’s klare Brühe nur – viel ging bei ihm nicht drauf.
In flacher Schüssel ward die Brühe aufgetragen;
Indes Langschnabel Storch kein bisschen in den Magen
Bekam, schleckt’ Reineke, der Schelm, das Ganze auf.
Doch etwas später lädt der Storch, aus Rache
Für diesen Streich, den Fuchs zum Mahl auf seinem Dache.
»Gern!« –, spricht Herr Reineke – »da ich nach gutem Brauch
Mit Freunden nie Umstände mache.«
Die Stunde kommt; es eilt der list’ge Gauch
Nach seines Gastfreunds hohem Neste,
Lobt seine Höflichkeit aufs Beste,
Findet das Mahl auch schon bereit,
Hat Hunger – diesen hat ein Fuchs zu jeder Zeit –
Und schnüffelnd atmet er des Bratens Wohlgerüche,
Des leckern, die so süß ihm duften aus der Küche.
Man trägt ihn auf, doch – welche Pein! –
In Krügen eingepresst, langhalsigen und engen;
Leicht durch die Mündung geht des Storches Schnabel ein,
Umsonst sucht Reineke die Schnauze durchzuzwängen.
Hungrig geht er nach Haus und mit gesenktem Haupt,
Klemmt ein den Schwanz, als hätt ein Huhn den Fuchs geraubt,
Und lässt vor Scham sich lang nicht sehen.
Ihr Schelme, merkt euch das und glaubt:
Ganz ebenso wird’s euch ergehen.
Das Kind und der Schulmeister
Die Fabel hier und ihre Spitze zielt
Auf jene Narren, die stets Reden halten.
Ein Knäblein, das am Seine-Ufer spielt’,
Fiel in den Fluss. Des Himmels gnädig Walten
Fügt’, dass ein alter Weidenbaum, der hart
Am Ufer stand, des Kindes Rettung ward.
Indes das Kind den Weidenzweig mit Bangen
Erfasst, kommt ein Schulmeisterlein gegangen.
Das Kind schreit: »Hilfe! Hilf! Ich muss vergehn!« –
Auf sein Geschrei bleibt der Magister stehn,
Und mit dem Pathos eines Advokaten
Schilt er den Kleinen: »Seht den Fratzen doch,
Wohin durch seine Dummheit er geraten!
Um solchen Schelm soll man sich kümmern noch!
Die armen Eltern, deren Pflicht im Leben,
Auf solch Gesindel immer achtzugeben!
Sie haben wahrlich einen schweren Stand!« –
Sprach’s, setzte drauf den Kleinen an das Land.
Viel gibt’s der Art, wenn auch mit andrem Namen:
Der Schwätzer, Splitterrichter, der Pedant,
Die wohl ihr Bild erkannt in diesem Rahmen –
Unzählbar sind sie wie des Meeres Sand,
Gesegnet hat der Schöpfer ihren Samen.
Die Sorte denkt nur stets zuerst daran,
Der Rede Künste zu entfalten.
Erst rette, Freund, mich aus der Not, und dann,
Dann magst du deine Rede halten!
Das Huhn und die Perle
Hühnchen fand an einem Ort
Eine Perl und trug sofort
Sie zum Juwelier hinüber:
»Glaube, sie hat hohen Preis,
Doch das kleinste Körnchen Mais
Wäre mir bei Weitem lieber.«
Eine Handschrift inhaltreich
Erbt’ ein Dummkopf, bringt sogleich
Sie zum Antiquar hinüber:
»Wertvoll, hör ich, soll sie sein,
Doch der kleinste Talerschein
Wäre mir bei Weitem lieber.«
Die Hornissen und die Bienen
Am Werk erkennt den Meister man.
Ein Honigzellchen war einst herrenlos; Hornissen
Hatten es an sich gerissen,
Bienen machten Anspruch dran.
Vor eine Wespe kam der Streit, die sollt ihn schlichten;
Allein es ward ihr schwer, nach Fug und Recht zu richten.
Die Zeugen sagten, dass sie um die Zelle her
Geflügeltes Getier, das braun und länglich wär
Und summte, oft bemerkt. Das sprach wohl für die Bienen;
Allein was half’s, da die Kennzeichen ungefähr
Auch den Hornissen günstig schienen?
Die Wespe wusste nun erst recht nicht hin und her,
Und sie beschloss, aufs Neu die Sache aufzuklären,
’ne Schar Ameisen noch zu hören.
Umsonst! Denn alles blieb, wie’s war.
»Auf diese Art wird’s nimmer klar!« –
Sprach eine Biene, eine weise –
»Sechs Monde schleppt sich schon der Streit im alten Gleise,
Und wir sind weiter um kein Haar.
Will sich der Richter nicht beeilen –
’s ist höchste Zeit! – verdirbt der Honig uns einstweilen;
Am Ende frisst der Bär ihn gar!
Erproben drum wir jetzt, ohn Advokatenpfiffe
Und Krimskrams der Juristenkniffe,
Nur durch die Arbeit unsre Kraft!
Dann wird sich’s zeigen, wer von uns den süßen Saft
In schöne Zellen weiß zu legen.« –
Durch der Hornissen Weigrung war
Gar bald ihr Unrecht sonnenklar;
Der Bienen Schar gewann den Streit von Rechtes wegen.
O würde jeder Streit doch nur auf diese Art
Entschieden und, wie man im Morgenlande richtet,
Nach dem Buchstaben nicht, nein, nach Vernunft geschlichtet!
Was würd an Kosten dann gespart,
Statt dass mit endlosen Prozessen
Man jetzt uns zur Verzweiflung treibt!
Wozu? Die Auster wird vom Richter aufgegessen,
Indes für uns die Schale bleibt.
Die Eiche und das Schilfrohr
Die Eiche sprach zum Schilf: »Du hast,
So scheint mir, guten Grund, mit der Natur zu grollen:
Zaunköniglein ist dir schon eine schwere Last;
Der Windhauch, der in leisem Schmollen
Des Baches Stirn unmerklich fast
Kräuselt, zwingt dich, den Kopf zu neigen,
Indes mein Scheitel trotzt der heißen Sonne Glut,
Gleich hoher Alpen Firn, und nicht des Sturmes Wut
Vermag mein stolzes Haupt zu beugen.
Was dir schon rauer Nord, scheint linder Zephir mir.
Ja, ständst du wenigstens, gedeckt von meinem Laube,
In meiner Nachbarschaft! Dann, glaube,
Gern meinen Schutz gewährt ich dir,
Du würdest nicht dem Sturm zum Raube.
So aber stehst am feuchten Saum
Des Reichs der Winde du in preisgegebnem Raum.
Sehr ungerecht an dir hat die Natur gehandelt!« –
»Das Mitleid« – sagt das Rohr –, »das plötzlich dich anwandelt,
Von gutem Herzen zeugt’s; doch sorge nicht um mich!
Glaub, minder drohet mir als dir der Winde Toben;
Ich bieg, ich breche nicht. Bis heut zwar hieltst du dich
Und standst, wie furchtbar sie auch schnoben,
Fest, ungebeugt an deinem Ort.
Doch warten wir es ab!« – Kaum sprach es dieses Wort,
Da, sieh, am Horizont in schwarzer Wolke zeigt sich
Und rast heran ein Sturmesaar,
Der Schrecken schrecklichster, den je der Nord gebar.
Fest steht der Baum, das Schilfrohr neigt sich.
Der Sturm verdoppelt seine Wut
Und tobt, bis er entwurzelt fällte
Den, dessen stolzes Haupt dem Himmel sich gesellte,
Und dessen Fuß ganz nah dem Reich der Toten ruht.
Zweites Buch
Gegen die Krittler
Gefiel’s Kalliope, mir die Gaben zu verleihen,
Die ihren Freunden sonst sie zur Verfügung stellt,
Den Lügen des Äsop wollt mein Talent ich weihen;
Denn Lüg und Poesie sind freundlich stets gesellt.
Mich wollte der Parnass mit solcher Gunst nicht schmücken,
Die diesen Dichtungen verliehe höhern Glanz.
Kühn zwar ist das Bemühn, doch nicht unmöglich ganz –
Ich wage den Versuch, mag’s Bessern besser glücken.
Ausstattete bisher gar neu und wundersam
Mit Red und Gegenred ich kühnlich Wolf und Lamm;
Noch mehr: Es wandelten bei mir, wie ihr gelesen,
Sich Bäum und Pflanzen um in sprachbegabte Wesen.
Wer, frag ich, leugnete hier eines Zaubers Spur?
»Ja« – hör ich unsre Krittler sagen –,
»Wes du dich rühmest als Bravour,
Sind ein paar Kindermärchen nur!« –
So wollt Geschichtliches ihr aus der Vorzeit Tagen,
Und zwar in höherm Stil? Hört zu: »Der Troer Heer
Hatt in zehnjähr’gem Kampf um ihrer Festung Türme
Die Griechen mürb gemacht, die trotz der tapfern Wehr,
Trotz aller Schlachten, aller Stürme
Noch immer nicht zerstört die Stadt voll Glanz und Pracht;
Da barg ein hölzern Ross – Minerva hat’s erdacht –
Ein seltnes Kunstwerk ohnegleichen,
Den listigen Ulyss’ in seinen breiten Weichen,
Den tapfern Diomed, des Ajax stürm’sche Kraft,
Nebst ihrer ganzen Ritterschaft,
Die heimlich der Koloss nach Troja führt, die Blüten
Der Stadt preisgebend samt den Göttern ihrem Wüten –
’ne Kriegslist, unerhört und wirkungsreich genug,
Um der Erfinder Müh zu lohnen« –
»Halt ein! Halt ein!« –, so ruft jetzt ein Herr Superklug –
»Der Satz ist gar zu lang, man muss den Atem schonen!
Und dann, dein hölzern Ross zumeist
Und deine ›Helden lobebären‹
Sind doch noch weit seltsamre Mären,
Als wenn ob seiner Stimm ein Fuchs den Raben preist.
Auch will der hohe Stil dich nicht besonders kleiden.« –
Gut! Stimmen wir den Ton herab: »In Liebesleiden
Denkt Amaryllis an Alkipp, und ihre Pein
Sahn ihre Schäflein, wähnt sie, und ihr Hund allein.
Tircis, die sie erschaut, bleibt hinterm Busche stehen
Und hört die Schäferin zum linden Zephir flehen,
Dass ihre Liebesklagen hold
Er hin zum Liebsten tragen sollt – – –«
»Halt! Diesen Reim lass ich nicht gelten!« –
Ruft plötzlich mein Herr Mäkelbold –
»Verfehlt muss seine Form ich schelten
Und etwas dürftig den Gehalt.
Die beiden Verse nimm zurück, sie umzugießen!« –
Verdammter Krittler! Schweigst du bald?
Soll meine Fabel ich nicht schließen?
Schlimm wär es, wollt so peinlichen
Urteilen sich ein Dichter fügen.
Unselig sind die Kleinlichen:
Sie finden nirgends ein Genügen.
Der Rat der Ratten
Ein Kater namens Rodilard
Wütet’ so grimmig unterm Volk der Ratten,
Dass keine fast gesehn mehr ward,
So viele sandt hinab er in das Reich der Schatten.
Der kleine Rest wagt sich, von Angst und Schrecken matt,
Nicht aus dem Loch und isst sich kaum zur Hälfte satt.
Als einstmals nun der Held auf fernem Dache war,
Galantem Liebesdienst zu frönen,
Da, während er sich bass ergötzt mit seiner Schönen,
Versammelt heimlich sich zum Rat der Ratten Schar,
Was in der Not man wohl beginne!
Der Obmann rät sogleich, begabt mit klugem Sinne,
Dass eine Schelle man befest’ge jedenfalls,
Und zwar in größter Eil, an Rodilardus’ Hals,
Sodass, wollt auf die Jagd er ziehen,
Man schon von fern ihn hört und Zeit hat zu entfliehen.
Dass dies das einz’ge Mittel sei,
Darin trat jedermann des Obmanns Meinung bei;
’nen bessern Weg zum Heil wusst keiner anzufangen.
Allein wie bindet man die Schell ihm um?
Der spricht: »Ich sollt es tun? Nein, ich bin nicht so dumm!«
Ein andrer: »Ich kann’s nicht!« Ohn eine Tat zu wagen,
Trennt man sich. – Der Versammlungen gar viel
Sah ich, wie diese, ohne Zweck und Ziel,
Nicht nur von Ratten, nein, von weisen Magistraten,
Selbst von geschulten Diplomaten.
Handelt sich’s nur um weisen Rat?
An Ratsherrn wird es nie gebrechen.
Doch gilt’s entschlossener frischer Tat –
Ja, Freund, dann ist kein Mensch zu sprechen!
Der Affe als Richter zwischen Wolf und Fuchs
Einst klagt’ ein Wolf, man habe ihn beraubt;
Den Nachbar Fuchs, ’nen Herrn von schlechtem Lebenswandel,
Klagt’ er des Diebstahls an, an den er selbst nicht glaubt’.
Es führten vor des Affen Haupt
In eigener Person die zwei Partein den Handel.
Seit Affendenken saß noch nicht
In so verzwicktem Fall Frau Themis zu Gericht.
Der arme Schiedsmann schwitzt’ auf seinem Richterstuhle;
Doch durch ihr Schreien hin und her
Mit Schwur und Gegenschwur sah er,
Dass alle beid aus guter Schule.
Er sprach: »Ich kenn euch zwei viel besser, als ihr glaubt,
Und straf euch beide unverhohlen;
Du, Wölflein, klagst, obgleich dir niemand was geraubt,
Du aber, Füchslein, hast trotz alledem gestohlen.«
Der Richter dachte sich: Wenn aufs Geratewohl
Man einen Schurken straft, so tut man immer wohl.
Einige Personen von gutem Geschmack hielten dafür, dass die Unmöglichkeit und der Widerspruch im Urteil dieses Affen unterdrückt werden müssten; doch habe ich mich seiner nur nach dem Vorbild des Phädrus bedient; und in ihm gerade, dünkt mich, liegt der ganze Witz.
Die beiden Stiere und der Frosch
Zwei Stiere stritten einst um eine junge Kuh
Und auch der Oberherrschaft wegen.
Ein armes Fröschlein seufzt’ dazu.
»Was geht’s dich an?« –, hat der Kollegen
Ihn einer fragend angequakt.
»Siehst du« – sprach jener drauf behände –,
»Denn nicht des leid’gen Streites Ende?
Der eine muss hier fort. Vom anderen verjagt,
Beraubt der Herrschaft und des Eigentums an diesen
Ob ihrer fetten Weid ihm werten blühnden Wiesen,
Wird er nach unsrem Schilf sein Reich verlegen und
Jagt dann mit plumpem Tritt uns in des Wassers Grund,
Erst den, dann den! Der Streit, der zwischen jenen beiden
Um die Frau Kuh entbrannt – wir müssen drunter leiden!«
Er hatte recht: Der eine Stier
Barg sich in ihres Schilfes Grunde,
Zu ihrem Leid; das plumpe Tier
Zertrat an zwanzig jede Stunde.
Ja, ja! Man sieht es allezeit:
Der Großen Torheit bringt den Kleinen bittres Leid.
Die Fledermaus und die zwei Wiesel
Einst kam ’ne Fledermaus höchst unvorsicht’gerweise
In eines Wiesels Nest; kaum hatt sie Zeit zu ruhn,
Als jenes, das schon längst ergrimmt war auf die Mäuse,
Herbeieilt’, um sie abzutun.
»Wie?« –, sprach’s zu ihr – »Du wagst vor mir hier zu erscheinen,
Du, deren ganz Geschlecht nur Schaden tut dem meinen!
Bist du nicht eine Maus? Wohl hab ich dich erkannt;
Verleugn’ es nicht, du bist’s! Dass ich kein Wiesel wäre!«
»Verzeiht!« –, sprach zitternd die – »Auf Ehre,
Das ist wahrhaftig nicht mein Stand.
Ich, eine Maus? Das kann nur ein Verleumder sagen!
Ein Vogel bin ich unbedingt.
Sieh nur die Flügel, die mich tragen –
Hoch leb, was in die Luft sich schwingt!«
Sie sprach so gut, dass man ihr glaubte
Und dass das Wiesel ihr erlaubte,
Frei fortzuflattern aus dem Nest.
Nicht lang, und Jungfer Leichtsinn klebte
Bei einem andern Wiesel fest,
Das mit den Vögeln just in Fehd und Feindschaft lebte,
Sodass zum zweiten Mal nun in Gefahr sie schwebte.
Die lange Schnauze streckt der Hausherr lüstern vor,
Der, als ’nen Vogel, sie zu leckrem Fraß erkor;
Doch sie verteidigt sich und spricht gar treu und bieder:
»Ein Vogel, ich? Seht her! Nein, das ist nicht mein Fall!
Was macht den Vogel? Das Gefieder!
Maus bin ich. – Hoch die Ratzen all!
Der Teufel hol die Katzen all!« –
So hat durch schlaues Antwortgeben
Zweimal gerettet sie ihr Leben.
Manch Kluger macht’s wie sie: Wenn die Gefahr ihm nah,
Schlägt er ein Schnippchen ihr, wechselt die Farb ein wenig,
Und, je nachdem, ruft er: Hurra
Der Republik! Hurra dem König!