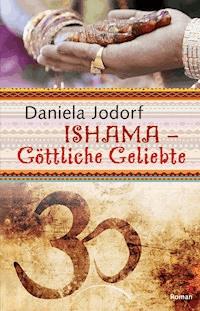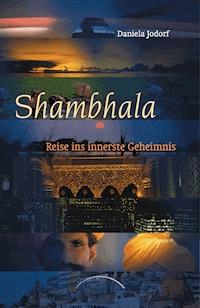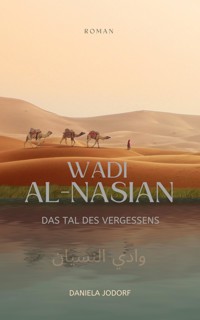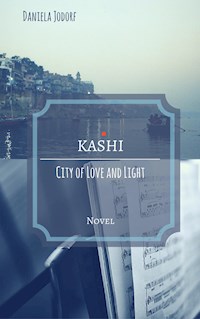Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: advaitamedia
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
"Wer bin ich?" wird Saraswati Ingenhoven eines Tages – einem plötzlichen Erwachen gleich – gezwungen sich zu fragen. "Wer bin ich und was will ich wirklich?" Die Deutsche fürchtet die Fragen, die sie bestürmen und fühlt gleichzeitig, dass sie sie beantworten muss. Da trifft sie auf den indischen Dichter Arun Gopal bei seiner ersten Lesung in Hamburg, der sich selbst und seinem Publikum dieselben Fragen stellt. Für einen magischen Moment heben sich die Schleier der Täuschung, die Saraswatis Bewusstsein bisher umgaben, weil Arun Gopal absolut aufrichtig über seine tiefe Sehnsucht nach der göttlichen Liebe und seine Suche nach dem göttlichen Selbst spricht. Saraswati spürt, dass Arun viel tiefer und viel inniger mit dem Leben verbunden ist als sie es jemals war und er weckt ihre Erinnerung an ihre frühe Kindheit in Indien. Die Fragen werden so dringend, dass sie nach Indien reist. Aruns Großeltern nehmen sie herzlich auf und Saraswati lernt wissbegierig und leicht, was es bedeutet, dem Fluss des Lebens bedingungslos zu vertrauen und ihm zu erlauben Verleugnetes und Verdrängtes ans Tageslicht zu bringen. Kurze Zeit nach ihr kehrt auch Arun in seine Heimat zurück, weil neue Fragen seinen Geist bestürmen und auch er nach Antworten verlangt. So begeben sie sich gemeinsam auf die Suche nach ihren Wurzeln. Trotz großer Ängste und tödlicher Gefahren sind sie bereit, der Wahrheit über eine sie verbindende Vergangenheit zu begegnen. Viele lange gefürchtete Einsichten in die Verstrickungen ihrer beider Familien verlieren den Schrecken, als Saraswati und Arun erkennen, dass alles, was sie erleben, in direktem Zusammenhang mit ihnen selbst steht. Unerschrocken gehen sie ihren Weg, den Weg der bedingungslosen Selbsterforschung und Hingabe an die Liebe, die Nicht-Dualität. Alle äußeren Ereignisse führen sie dabei immer näher zum innersten Selbst, das das Göttliche im Menschen ist. Dieser Entwicklungsroman, der schon in der dritten Auflage erscheint, ist in wesentlichen Teilen autobiografisch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniela Jodorf Saraswati – Der Fluss des Lebens Originalausgabe:
©advaitaMedia – Weisheit aus der Stille
Am Gutspark 1
D-23996 Saunstorf
www.advaitamedia.com
[email protected] ©2008 advaitaMedia GmbH
Lektorat: Hendrik Bönisch, Bielefeld Cover: Christoph Konradi, Saunstorf Satz: Frank Ziesing, Bielefeld
4. Auflage 2014
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-936718-11-9
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen und sonstige, auch elektronische Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte Wiedergabe sowie des auszugsweisen Nachdrucks vorbehalten.
Einführung
Magische Momente
„Wer bin ich?“ …
Wird Saraswati Ingenhoven eines Tages – einem plötzlichen Erwachen gleich – gezwungen sich zu fragen. „Wer bin ich und was will ich wirklich?“ Die Deutsche fürchtet die Fragen, die sie bestürmen und fühlt gleichzeitig, dass sie sie beantworten muss.
Da trifft sie auf den indischen Dichter Arun Gopal bei seiner ersten Lesung in Hamburg, der sich selbst und seinem Publikum dieselben Fragen stellt. Für einen magischen Moment heben sich die Schleier der Täuschung, die Saraswatis Bewusstsein bisher umgaben, weil Arun Gopal absolut aufrichtig über seine tiefe Sehnsucht nach der göttlichen Liebe und seine Suche nach dem göttlichen Selbst spricht. Saraswati spürt, dass Arun viel tiefer und viel inniger mit dem Leben verbunden ist als sie es jemals war und er weckt ihre Erinnerung an ihre frühe Kindheit in Indien. Arun stammt aus Chennai, der Stadt, in der auch sie geboren wurde. Und er verließ seine Heimat im selben Jahr als Saraswati nach Deutschland zurückkehrte …
Saraswati weiß, dass sie von ihren Eltern keine Antwort auf ihre Fragen zu erwarten hat. Doch inzwischen sind die Fragen so dringend, dass sie selbst nach Indien reist. Aruns Großeltern nehmen sie herzlich auf und Saraswati lernt wissbegierig und leicht, was es bedeutet, dem Fluss des Lebens bedingungslos zu vertrauen und ihm zu erlauben Verleugnetes und Verdrängtes ans Tageslicht zu bringen. Kurze Zeit nach ihr kehrt auch Arun in seine Heimat zurück, weil neue Fragen seinen Geist bestürmen und auch er nach Antworten verlangt. So begeben sie sich gemeinsam auf die Suche nach ihren Wurzeln. Trotz großer Ängste und tödlicher Gefahren sind sie bereit, der Wahrheit über eine sie verbindende Vergangenheit zu begegnen. Viele lange gefürchtete Einsichten in die Verstrickungen ihrer beider Familien verlieren den Schrecken, als Saraswati und Arun erkennen, dass alles, was sie erleben, in direktem Zusammenhang mit ihnen selbst steht. Schritt für Schritt lernen sie ihre eigenen Projektionen zurückzunehmen und fremde Projektionen abzulehnen.
Unerschrocken gehen sie ihren Weg, den Weg der bedingungslosen Selbsterforschung und Hingabe an die Liebe, die Nicht-Dualität. Alle äußeren Ereignisse führen sie dabei immer näher zum innersten Selbst, das das Göttliche im Menschen ist.
„Wer bin ich?“
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Epilog
Das OM-Symbol
Das OM-Symbol besteht aus drei Kurven, einem Halbkreis und einem Punkt und ist ein geschlossenes Ganzes. Es deutet auf die drei Bewusstseinszustände Wachen, Träumen und Tiefschlaf sowie auf das Höchste Bewusstsein turiya, den „vierten“ Zustand.
Prolog „Mache Dich nackt und tauche tief ein in den reinigenden Strom jenseits der Steine der Selbstkontrolle an den Ufern des gottestrunkenen Flusses, durch den die Wasser der Wahrheit fließen, über die die Wellen des Mitgefühls tanzen! Nur dann wird Deine Seele von den Wirkungen der manifesten Welt gereinigt werden.“
Swami Niranjanananda Saraswati
„Der, der dieses ganze All ständig als ein Spiel des All-Bewusstseins wahrnimmt, ist ohne Zweifel tatsächlich selbstverwirklicht, er wird in diesem Körper befreit.“
Vasuguptacharya
„Frei von Stolz und Täuschung, siegreich über das Übel der Verhaftung, stets im Selbst weilend, nachdem ihre Wünsche vollständig verschwunden sind und sie frei sind von den Gegensatzpaaren, wie Freude und Schmerz, erreichen die Ungetäuschten das ewige Ziel.“
Bhagavad Gita, Kapitel 15, Vers 5
Erstes Kapitel
Der Polizist ließ sie nicht aus den Augen. Er sprach mit leiser Stimme und bemühte sich, freundlich zu sein, doch seine Ungeduld war spürbar und sein Versuch, sie zu verbergen, machte sie nur drängender.
Vor etwa zwei Stunden hatte sie entdeckt, dass ihr Portemonnaie fehlte. Sie war mit Freunden in einer Bar gewesen. Als sie bezahlen wollte, war ihre Geldbörse nicht mehr da. Der Schock war ihr wie ein eiskalter Blitz in die Glieder gefahren. Einer ihrer Freunde hatte ihre Erregung bemerkt: „Sara? Was ist los?“
„Mein Portemonnaie ist weg!“
„Du wirst es sicherlich zu Hause vergessen haben“, wiegelte ihr Bekannter desinteressiert ab.
Sie sah ihre Freunde an und konnte Mitleid und Häme in ihren Blicken lesen. Sie hatte nicht glauben wollen, was sie sah. Ihre Gleichgültigkeit und ihre Schadenfreude hatten sie tief verletzt.
„Lasst mich bitte raus!“, hatte sie verzweifelt und wütend gezischt. Die anderen waren aufgestanden, um sie durchzulassen, doch niemand war ihr nach draußen gefolgt.
Auf der Straße hatte sie kurz überlegt, was in ihrem Portemonnaie gewesen war: Führerschein, Fahrzeugpapiere, Versicherungs- und Kreditkarten. Nur wenig Bargeld.
Entschlossen, ihre Wertsachen noch nicht verloren zu geben, hatte sie wütend jeden Mülleimer im Umkreis von einem Kilometer durchwühlt. Erst zwei Stunden später war sie bereit gewesen, aufzugeben. Erschütterter, als durch den Verlust ihrer Geldbörse gerechtfertigt, war sie die Stufen zur nächsten Polizeiwache hinaufgeklettert.
Auf dem Revier begegnete man ihr erneut mit Unverständnis. Der diensthabende Wachtmeister, der ihre Anzeige protokollierte, stolperte bereits über ihren Vornamen: „Saraswati? Wie schreibt man denn das?“
Sofort spürte sie ihre eigene Abneigung gegen ihren Namen. Sie spürte Ablehnung, aber auch Unsicherheit. Seitdem ihre Ausweispapiere fehlten, fühlte sie sich eigenartig unsicher und identitätslos, fast so, als wisse sie nicht mehr, wer sie wirklich war. Dennoch buchstabierte sie ruhig: „S-A-R-A-S-W-A-T-I! Saraswati.“
Der Polizist tippte ungelenk und übervorsichtig mit zwei Fingern. Unsicher wiederholte er: „Saraswati. Richtig?“
„Ja“, bestätigte sie erleichtert.
„Und weiter?“
„Ingenhoven!“
„Was ist denn das für ein Name?“, fragte der Polizist überkritisch.
Es war immer das Gleiche. Jeder wunderte sich über ihren Namen. Immer war sie gezwungen, ihn zu erklären, und manchmal – so wie heute – hatte sie das Gefühl, sich für ihren Namen sogar rechtfertigen zu müssen.
„Bin ich hier, um mich für meinen Namen zu rechtfertigen oder um eine Anzeige aufzugeben?!“, entfuhr es ihr.
Der Beamte zuckte zusammen und wurde kreidebleich. Die Folge ihres Wutausbruches war ein endloses Verhör, bei dem Saraswati sich wie der Dieb und nicht wie die Bestohlene fühlte. Sie wunderte sich darüber, wie sie bloß so in die Defensive geraten konnte.
Als sie so weit waren, dass Saraswati endlich ihre Unterschrift unter das Protokoll setzen sollte, graute der Morgen. Wachtmeister Leibholz bot ihr zaghaft einen Kaffee an und sie war nun sogar bereit, ihn über die Bedeutung ihres Namens aufzuklären.
„Der Name Saraswati stammt aus Indien. Dort gibt es eine Göttin Saraswati – die Göttin der Weisheit und der Inspiration. Saraswati ist die Schutzgöttin aller Schüler und aller Lernenden und sie gilt als Muse der Künstler. Sie ist eine Tochter von Brahma, dem Schöpfergott des hinduistischen Pantheons.
Saraswati wird auch mit dem Wasserelement in Verbindung gebracht, denn neben den beiden bekannten großen indischen Flüssen, Ganges und Yamuna, soll es noch einen dritten, heiligen unterirdischen Fluss geben, der an einem bestimmten Punkt, der Triveni, die anderen beiden Flüsse kreuzt. Dort findet in regelmäßigen Abständen das Heilige Fest der Kumbha Mela statt. Dieser Fluss wird der Legende nach Saraswati genannt. Vor Tausenden von Jahren soll er sogar einmal überirdisch geflossen sein.
Die Göttin Saraswati trägt auf allen Abbildungen eine Veena, ein Saiteninstrument und ein Buch. Sie reitet auf einem Schwan, der in Indien als mystisches Tier gilt und besondere spirituelle Fähigkeiten besitzt. Saraswati bezaubert durch ihre Musik und verkörpert vollkommene Weisheit. Sie kann im Buch des Lebens, das sie in den Händen hält, lesen. Sie kennt Vergangenheit und Zukunft.“
Wachtmeister Leibholz war müde. Aber das war nicht der Grund für sein Schweigen. Die Geschichte dieser jungen Frau berührte ihn tiefer, als sie beide es zu Beginn ihrer Begegnung für möglich gehalten hätten. Irgendetwas an ihr war so anders als an allen anderen Menschen, die ihm bisher begegnet waren. Sie wirkte so verletzlich und so zart. Leise und fast ehrfürchtig fragte er: „Und warum haben Ihre Eltern Sie so genannt?“
„Mein Vater hat Anfang der 1970er Jahre in Indien gearbeitet. Ich bin dort geboren.“
„Sind Sie sicher, dass das alles ist?“
Natürlich war das alles. Ihr Vater hatte diese schwärmerische Gefühlsduselei für „seine indische Heimat“ – wie er es nannte – entwickelt. Und sie hatte darunter gelitten … ein Leben lang. Zumindest so lange, bis sie endlich auf die Idee gekommen war, sich Sara statt Saraswati zu nennen. Damals war sie dreizehn gewesen.
„Das ist alles!“, versicherte sie bestimmt.
„Es fällt mir schwer, zu glauben, dass Eltern ihrem Kind so einen außergewöhnlich bedeutungsvollen Namen geben, ohne bestimmte Vorstellungen damit zu verbinden. Aber wenn Sie es sagen …“
Ein Kollege von Wachtmeister Leibholz brachte sie kurz darauf heim. Sie saß nachdenklich schweigend auf der Rückbank des Streifenwagens und fragte sich, wieso es ihr so schwer gefallen war, über ihren Namen zu sprechen. Fast hatte sie sich nicht an ihn erinnert. Für einen winzigen Moment hatte sie das Gefühl gehabt, nicht zu wissen, wer sie war. Ihr eigener Name war ihr vollkommen absurd vorgekommen. Auch die Bemerkung des Wachtmeisters, ihre Eltern könnten sich bei der Namensgebung etwas gedacht haben, beunruhigte sie. Wieso hieß sie wirklich Saraswati und wieso hatte sie sich das nie zuvor gefragt?
Als der Streifenwagen sie gegen halb sechs vor ihrer Haustür absetzte, war es endgültig hell. Sie fühlte sich körperlich müde, doch geistig aufgekratzt. Sie zog die Schuhe aus und lief ziellos durch die Straßen, bis hinunter zur Elbe. Dort ließ sie sich in den gelben Sand fallen und schloss die Augen. „Saraswati Ingenhoven?“ Immer wieder hallte ihr Name durch ihren Kopf wie ein seltsames Echo, das jemand aus weiter Ferne wie eine Frage zu rufen schien. Je mehr sie versuchte, zu erfassen, wer oder was Saraswati Ingenhoven war, desto weniger gelang es ihr. Das, was bisher immer klar, eindeutig und greifbar gewesen war, wirkte plötzlich diffus und unfassbar. Mit der konkreten Betrachtung begann es sich aufzulösen, als wäre es nicht wirklich existent. Energisch schüttelte Saraswati den Kopf, um das beängstigende Gefühl der Identitätslosigkeit zu vertreiben.
Ihre Identität in Form der verloren gegangenen Geldbörse fand sich schnell wieder. Schon am Nachmittag rief die neue Schicht der Polizeiwache an und informierte sie sachlich, dass ihre Brieftasche wieder aufgetaucht wäre. Man bestellte sie sofort zur Abholung ein. Während sie noch die kleinste Tasche akribisch nach ihren Papieren, die sie heute für wertvoller denn je hielt, durchforstete, verhielt sich der diensthabende Beamte recht mitteilsam: „Da haben Sie aber Glück gehabt! Einer jungen Frau ist heute Nacht das Gleiche passiert wie Ihnen. Sie hat alle Mülleimer in der Nähe des Tatorts durchwühlt und Ihr Portemonnaie gefunden statt das eigene!“ Sara hörte nur mit einem Ohr zu. „Manchmal geschehen schon seltsame Dinge …“, sinnierte der Polizist.
Etwas in der Stimme des Polizeibeamten ließ sie plötzlich aufhorchen. Sie klang mit einem Mal so anders, irgendwie hohl, eigenartig autoritär und bedeutungsvoll. Er betonte mehr als nötig, dass einer anderen Frau das Gleiche passiert sei.
„Können Sie mir die Adresse der Finderin geben. Ich würde mich gerne erkenntlich zeigen“, fragte sie deshalb.
Der junge Polizist errötete. „Das darf ich leider nicht. Datenschutz!“
Sie nickte scheinbar verständnisvoll und dachte: „Spießige Bürokratie!“
„Wie soll ich dem Finder seinen rechtmäßigen Lohn zukommen lassen, wenn Sie mir nicht sagen dürfen, wo ich ihn finde?“, fragte sie. Sie wusste, dass es nicht fair war, den armen Beamten so zu bedrängen. Er tat wirklich nur seine Pflicht. Dennoch wagte sie einen letzten bittenden Blick. Der Polizist ließ daraufhin gespielt achtlos einen kleinen Zettel auf den Boden fallen und blickte sie dann unsicher an. Er drehte sich um und verließ den Raum. Sie bückte sich eilig nach dem Zettel, steckte ihn in die Hosentasche und ging. Erst auf der Straße las sie ihn. Eine Natascha Richter hatte ihr Portemonnaie gefunden.
Zwei Tage später saß sie Natascha Richter persönlich gegenüber. Sie hatte sie angerufen, um sich bei ihr zu bedanken. Natascha hatte aufgebracht und zugleich heiter von ihren Erfahrungen auf der Polizeiwache berichtet. Sie war noch schlechter behandelt worden als Saraswati. Denn sie hatte den begründeten Anfangsverdacht der Beamten erregt, weil sie Saraswatis Brieftasche ausgerechnet aus dem einen Mülleimer der Hamburger Innenstadt gefischt haben wollte, in den Saraswati nicht selbst geschaut hatte. Beide hatten bei der lebendigen Vorstellung, wie Natascha mit einem nach Müll stinkenden Portemonnaie auf dem Polizeirevier Rede und Antwort stehen musste, gelacht. Und plötzlich hatte Natascha sie zu einem Kaffee eingeladen.
Schon nach wenigen Minuten versanken sie in ein tiefes Gespräch. Die Welt, die sie umgab, Kellner, andere Gäste, Musik und fremde Stimmen, Zigarettenrauch und Kaffeeduft, trat völlig in den Hintergrund. Natascha war nur ein Jahr älter als Saraswati. Sie arbeitete als Lektorin in einem kleinen Hamburger Verlag, der ausschließlich sehr individuelle Autoren unter Vertrag hatte. Abfällig nannte Natascha sie „die jungen Wilden“. Witzig und eloquent schilderte sie ihre verrücktesten Begegnungen mit pubertierenden Popliteraten, die sie oft den letzten Nerv kosteten. Es gefiel Saraswati, wie offen Natascha mit ihr sprach. Sie wirkte hochintelligent und extrem energiegeladen.
Beim Abschied fragte Natascha: „Hast du Lust, dir am Mittwoch einen der jungen Wilden anzusehen. Wir veranstalten eine Lesung in der Buchhandlung Fresendorf.“
„Wer wird denn lesen? Ist er bekannt?“, fragte Saraswati begeistert.
Natascha wirkte plötzlich nachdenklich und still. Viel leiser als vorher sagte sie: „Lass dich überraschen …“
Zweites Kapitel
Saraswati arbeitete unkonzentriert. Sie suchte noch immer verzweifelt nach Ideen für die neue Kampagne, die am Freitag fertig sein sollte. Seit Wochen grübelte sie nun Tag und Nacht über ein geeignetes Konzept für den größten und wichtigsten Kunden der Agentur.
Klaus, ihr Agenturleiter, machte jeden Tag mehr Druck. Ständig sprach er über die Zahlen des vergangenen und die hoffnungslosen Prognosen für das kommende Jahr. Jeder wusste, dass die Umsätze zurückgingen und dass es der Werbebranche zurzeit nicht gut ging. Deshalb vergrub Saraswati, sobald sie Klaus auch nur von Weitem kommen sah, den Kopf noch tiefer als gewöhnlich hinter dem Bildschirm ihres Computers. Doch ihre müden Augen starrten nur hilflos ins Leere. Das Produkt, für das sie eine intelligente Werbebotschaft erarbeiten sollte, sagte ihr nichts. Sie hatte das Gefühl, dass es niemand brauchte. Sie erschrak über sich selbst, als sie bemerkte, dass sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben die Frage stellte, ob ihre Arbeit sinnvoll und nützlich war. Warb sie am Ende für Produkte, die vollkommen überflüssig waren? War Werbung an sich eine sinnlose Angelegenheit?
Erschöpft schleppte sie sich auf die Toilette und ließ eiskaltes Wasser über ihre pochenden Handgelenke laufen. Kritisch betrachtete sie ihr Spiegelbild. „Wer zum Teufel bist du?“, fragte sie sich wieder. Sie sah ein attraktives junges Gesicht. Lange, dunkelblonde Haare fielen weich und fließend über ihre Schultern. Einige Sommersprossen machten ihr Gesicht frech und lebendig. Grüne Augen blitzen heiter und fröhlich der Müdigkeit zum Trotz, die sie lähmte.
„Ich wirke jünger als fünfunddreißig“, dachte sie.
Das kalte Wasser erfrischte sie. Aber es hatte nicht die Kraft, den Schrecken des Erwachens von ihr zu nehmen. Irgendetwas hatte sie von der Identifikation mit ihrer Aufgabe gelöst. Sie ging nicht mehr in ihr auf. Sie liebte ihre Arbeit nicht mehr … Angst befiel sie, als sie bemerkte, dass es ihr unmöglich war, der Frage auszuweichen, ob sie bereit war, einer Arbeit nachzugehen, die sie plötzlich als sinnlos betrachtete.
Sie zwang sich zurück an ihren Arbeitsplatz. Susanne kam aufgeregt in ihr Büro gelaufen und verkündete stolz, dass sie „Es“ gefunden habe, das magische „Es“, das jeder suchte und alle finden wollten. Saraswati betrachtete Susannes Ideen und fand sie naiv und nichtssagend. Nervös wie sie war, traf sie nicht den nötigen einfühlsamen Ton, um Susanne ihre Ansicht schonend beizubringen. Susanne nahm die harsche Kritik persönlich und rannte aufgelöst aus ihrem Büro. Saraswati fühlte sich schuldig und ärgerte sich über ihren Mangel an Feingefühl und Selbstkontrolle. Verzweifelt suchte sie nach einer Entschuldigung für ihre unberechenbare Gereiztheit. Wieder kam sie auf die Idee, dass ihr verlorenes Portemonnaie an allem schuld war. Seit es gestohlen worden war, fühlte sie sich so seltsam, dass sie sich selber fremd war. Zuerst betraf dieses Gefühl nur ihren Namen und jetzt auch noch ihren Job …
Saraswati kämpfte gegen die wachsende Verzweiflung. Sie schob den Feierabend immer weiter auf. Erst um elf verließ sie das Büro. Einige Kollegen saßen noch immer an ihren Schreibtischen. Das war in den letzten Tagen vor einem Abgabetermin üblich. Sie kannte viele Kreative, die gerne spät arbeiteten. Kreativität schien in der Werbebranche ein merkwürdiger Geisteszustand zu sein, der erst in einem physischen und psychischen Ausnahmezustand die größten und besten Früchte hervorbrachte. Sie hatte dieses Phänomen schon oft beobachtet. Und sie glaubte, dass viele Kollegen gerade diesen Nervenkitzel regelrecht brauchten. Er war so etwas wie eine sozial anerkannte Droge. Wieso hatte sie diese Verhaltensweise nie in Frage gestellt? Wollte und konnte sie überhaupt unter ständigem Erfolgsdruck arbeiten? Hatte sie dasselbe Verständnis von Kreativität? Wollte sie so leben?
Klaus erhöhte den Druck weiter. Am nächsten Morgen rief er alle zu einem Meeting zusammen, in dem er mit der Kündigung der Verantwortlichen drohte, falls die Kampagne den Kunden nicht zufriedenstellen sollte. Saraswati wusste, dass insbesondere sie gemeint war. Sie ärgerte sich über Klaus. Jeder wusste, dass Angst nur zwei Reaktionen zuließ: Kampf oder Flucht. Wie sollte diese Drohung den kreativen Fluss anregen? Doch sie hatte nicht den Mut, Klaus ihre Meinung zu sagen. Sie spürte, dass sie nicht die Kraft hatte, sie mit der nötigen Sicherheit zu vertreten.
Saraswati war um acht mit Natascha verabredet. Die Buchhandlung Fresendorf war nicht weit von der Agentur entfernt. An der Kasse hing ein Schild: Ausverkauft. Enttäuscht erwähnte Saraswati, dass sie eine Bekannte von Natascha Richter sei. „Warum sagen Sie das denn nicht gleich?“, fragte die Dame hinter dem Tresen. „Frau Richter hat eine Karte für Sie hinterlegt. Viel Vergnügen!“
Saraswati schob sich durch die wartende Menge zu einem freien Platz in der Mitte einer der vorderen Reihen. Das Publikum machte einen überraschend intellektuellen Eindruck auf sie. Viel zu intellektuell für die sprachlichen Eskapaden eines „jungen Wilden“. Noch bevor Saraswati von ihrem Nachbarn etwas über den jungen Künstler erfragen konnte, ging ein nervöses Räuspern durch den Raum und Natascha trat vor die Menge. Sie wirkte hübscher, als Saraswati sie in Erinnerung hatte – schlanker, größer und weniger burschikos.
„Herzlich willkommen zu unserer heutigen Lesung. Ich begrüße Sie im Namen der Buchhandlung Fresendorf, des Verlages Bohlenau und unseres jungen Künstlers, der sich Ihnen gleich persönlich vorstellen wird. Wir danken Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen und das offenkundige Interesse, das aus Ihren Gesichtern spricht.
Viele von Ihnen kennen unsere Reihe, in der wir jungen, oft recht extravaganten Autoren, die Möglichkeit gegeben haben, ihre Werke publik zu machen. Ich glaube, jeder von uns war überrascht zu sehen, dass sich diese jungen Künstler rasend schnell ein eigenes Genre erschlossen haben, das heute den bezeichnenden Titel „Popliteratur“ trägt. Diese jungen Autoren haben im wahrsten Sinne des Wortes Zeitgeschichte geschrieben. Aber wie es mit der Zeit heute nun einmal so ist: Sie läuft schneller, als wir denken können. Auf der letzten Buchmesse zeigte sich, dass Popliteratur heute schon wieder überholt ist. Viele, die ihre prominentesten Vertreter in den letzten Jahren als genial, wortgewandt und einfallsreich gelobt haben, nennen sie heute einfallslos, überheblich und arrogant. So durften wir, die wir Literatur entdecken und vermarkten, erleben, wie Mode entsteht und wieder vergeht.
Diese Entwicklung haben wir nun zum Anlass genommen, nach neuen jungen Autoren zu suchen, die wieder weniger Pop und mehr Literatur machen. Ich kann Ihnen sagen: Es gibt derlei viele. Was lange als melancholisch, verträumt und weltfremd galt, findet heute wieder großen Anklang.
So sind wir auf einen jungen Mann gestoßen, den wir vor drei oder vier Jahren mit Sicherheit abgelehnt hätten, der aber heute ein vielversprechendes Talent ist.
Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Arun Gopal und lassen Sie sich in seine Welt entführen. Eine Welt, die mit Sicherheit eine andere Welt ist, als die, die Sie zu kennen glauben …!“
Die letzten Huster verstummten und es herrschte angespanntes Schweigen in dem prall gefüllten Leseraum. Es schien ewig zu dauern, bis Arun Gopal den Raum betrat. Sein Name kam Saraswati eigenartig bekannt vor, fast als dränge er aus einer fernen Zeit aus tiefer Erinnerung an ihr Bewusstsein. Gespannter als der Rest der Menge richtete sie ihre Augen auf das Rednerpult, an dem gerade noch Natascha gestanden hatte. Erst nahm sie ihn kaum wahr, so leicht und geschmeidig bewegte er sich. Aber kurz darauf war er so präsent, dass er ihre Wahrnehmung vollkommen gefangen nahm. Er schien auf wundersame Weise den ganzen Raum auszufüllen. Arun war jung, etwa ihr Alter, und er war Inder. Groß und schlank stand er vor der Menge und wirkte in keiner Weise von ihr beeindruckt. Lässig nahm er nun das Mikrofon aus der Halterung am Rednerpult und hielt es behutsam in der linken Hand, locker gehalten von Daumen, Zeigefinger und Ringfinger, eine Geste, die eine Spur zu anmutig und zu weich für einen Mann war, dadurch aber umso faszinierender wirkte.
Ein schüchternes Lächeln zog über Aruns Gesicht. Auch dieses Lächeln war ihr keineswegs fremd. Ohne Akzent richtete der junge Autor sich distanziert und doch freundlich an die gespannte Hörerschaft: „Ich schließe mich dem herzlichen Willkommen, das Natascha Richter auch in meinem Namen ausgesprochen hat, gerne an. Ich muss gestehen, dass mir die Vorschusslorbeeren, die ich eben über mich hören durfte, gefallen. Doch gleichzeitig verängstigen sie mich. Nichts ist schwerer, als hohen Erwartungen gerecht zu werden. Deshalb möchte ich auch keine weiteren erklärenden Worte hinzufügen. Sie sollten meine Gedichte hören und sich selbst Ihr Urteil bilden.“
Er kokettierte nicht. Er meinte, was er sagte. Arun Gopal steckte das Mikro zurück in seine Halterung, schlug langsam und fast zärtlich ein Buch auf, das auf dem Rednerpult für ihn bereitlag, und begann stehend zu lesen.
Seine Stimme kam aus einer Tiefe, die Saraswati fremd erschien. Seine Worte fingen ihre Aufmerksamkeit mühelos ein. Sie versuchte, ihren Sinn zu erfassen, vergebens. Sie waren so leicht und schwerelos, dass sie förmlich durch ihr Bewusstsein hindurchschwebten. Erst als sie einige Minuten dem ruhigen, stetigen Fluss seiner Worte verwirrt gefolgt war, begriff sie, dass sie anders hören musste, als sie es gewohnt war. Sie durfte nicht denken, während sie Aruns Worten folgte. Sie musste sie unmittelbar erleben.
„Der Augenblick
Du rätst mir,
im Augenblick zu leben,
das sagenumwobene Hier und Jetzt zu suchen.
Du rätst mir,
mich fallen zu lassen,
mich mutig in deine geliebten Arme zu werfen,
mich dir ganz hinzugeben.
Du versprichst mir,
mich mit dem Leben und deiner Liebe zu belohnen.
Ich nehme all meinen Mut zusammen,
suche immerfort die Ewigkeit in diesem Augenblick.
Doch wie oft entschwindet er mir,
wie oft ist er nichts als eine Fata Morgana,
die ich zu sehen glaube,
doch als ich nach ihr greifen will,
entpuppt sie sich als Illusion …“
Ihr Körper spannte sich unter den Worten, die aus Aruns Mund an ihr Bewusstsein drangen. Verächtlich dachte sie: „Indischer Kitsch!“ Und doch wusste sie, dass dies nur eine Abwehrreaktion war, dass sie keinen Kitsch hörte, kein sentimentales Gefasel. Sie ahnte, dass Arun Gopal etwas Besonderes war und dass seine poetischen Worte eine Wahrheit in sich bargen, die ihr erschreckend fremd war. Sie beobachtete ihn kritisch. Völlig unbeteiligt, ohne Scham und ohne Stolz las er die Worte, die keiner der in dem Raum Anwesenden zu denken gewagt hätte. Absolut natürlich trug er vor, was keiner der hier Anwesenden auch nur begreifen konnte. So sehr Saraswati sich auch bemühte, die Bedeutung der gelesenen Worte zu erfassen, desto mehr begriff sie, dass sie es nicht konnte, dass sie es vielleicht niemals können würde. Traurigkeit über so viel Unvermögen mischte sich mit der Freude, die das Gehörte irgendwo in ihr auslöste. Fast hatte sie das Gefühl, als spräche Arun nur zu ihr.
„… Du rätst mir,
mich von allen Vorstellungen zu lösen,
meinem Gefühl zu folgen,
dem elektrisierenden Prickeln,
das es nur auf dem Punkte der höchsten
Konzentration der Energie und des Bewusstseins gibt.
Oftmals glaubte ich bereits,
diesen Punkt, wo Endlichkeit und Unendlichkeit einander begegnen,
gefunden zu haben,
aber dann,
als ich mich darüber freute,
das scheinbar Unmögliche möglich gemacht zu haben,
brach die Energie in sich zusammen
und mein Bewusstsein verdunkelte sich erneut –
ich verlor den Augenblick.
Du rätst mir,
ihn nicht zu suchen
und ihn nicht festhalten zu wollen.
Du befiehlst mir,
mich von der Vergangenheit ebenso zu lösen wie von der Zukunft.
Ich treibe wie ein kleines Floß in einem See von unendlicher Weite,
einem See, der keine Ufer mehr hat,
denn ich habe das Ufer der Vergangenheit
und das Ufer der Zukunft in mir ausgelöscht
und mich der allgegenwärtigen Gegenwart verschrieben.
Aber den Augenblick habe ich noch immer nicht gefunden.
Der See ist zu groß.
Ich habe Angst, in diesem Meer der Unendlichkeit
die Orientierung zu verlieren.
Ich habe Angst, für immer und ewig dort,
in der Mitte eines Sees ohne Anfang und Ende,
herumzutreiben – ohne Sinn.
Du sagst,
der Sinn liegt in der gänzlichen Hingabe,
in meinem Vertrauen,
das nur aus der Selbstaufgabe entstehen kann.
Dies sei die letzte Prüfung.
Du sagst,
du freust dich,
dass ich begriffen habe,
was Vergangenheit und Zukunft eigentlich sind:
Projektionen unseres Geistes,
die uns von der Wahrheit fortführen.
Ich kann mich heute nicht mit dir freuen,
denn ich weiß,
dass ich das,
was ich eigentlich suche,
noch nicht gefunden habe.
Du lachst mich aus.
Nennst mich –
wie immer –
einen Narren,
weil ich noch immer suche
und nicht verstanden habe,
dass ich mich allein mit der Tätigkeit des Suchens
in die Zukunft hineinbegebe,
wo ich doch in der Gegenwart sein wollte.
Wieder rätst du mir, alles aufzugeben,
alle Wünsche, alle Hoffnungen, alle Begierden,
alle Ängste, jegliche Trauer und Wut.
Du sagst,
wenn du alles durchlebt hast,
das Hängen an der Vergangenheit
und das Streben in die Zukunft,
dann kannst du die Fäden loslassen,
mit denen du dich an das Alte und an das Erträumte bindest.
Dann erst bist du frei für die Erfahrung der Gegenwart.
Der Augenblick schenkt dir die Freiheit.
Der Augenblick ist die Verwirklichung der Wahrheit.
Erst wenn du in der Gegenwart,
an dem Punkt,
der eigentlich nichts
und doch alles ist,
angekommen bist,
dann erst wirst du mein wahres Wesen erkennen.
Ich spüre nun,
was Hingabe bedeuten könnte.
Es könnte eine Kapitulation sein.
Meine Kapitulation.
Mein Ich ergibt sich vor einer höheren Macht,
die es erst heute sehen kann.
Lieber möchte ich die Hingabe jedoch als Akt der Liebe sehen:
Ich gebe mich Dir hin, dem einzigen Geliebten,
den ich jemals hatte.
In jedem Menschen, den ich begehrte,
sah ich dich,
deine Schönheit,
deine überfließende Liebe,
deine Fülle,
deine Reinheit
und deine Unschuld.
Die Weisen sagen,
du hättest die Welt aus einem Akt der Liebe geschaffen,
dein Wesen sei Liebe,
aber du brauchtest den,
der dich liebt,
um die Liebe erleben zu können,
um die Wiedervereinigung,
die Aufhebung der illusorischen Trennung,
zu erfahren.
Endlich erkenne ich die Magie des Augenblicks.
In dieser Sekunde sehe ich,
dass ich lebe,
um dich wahrhaft zu lieben,
dass ich lebe,
um mich dir hinzugeben,
weil du der Sinn meines Lebens bist.
Du bist mein Sinngeber.
Mit meiner Hingabe an dich erfüllt sich im kleinen der Sinn,
der die Welt erfüllt,
das, was die Welt am Leben hält.
Das Rad von Leben, Tod und Wiedergeburt hört auf,
sich zu drehen,
weil der Motor des Strebens,
der es in Bewegung hielt,
an seinen Ursprung zurückgekehrt ist
und nun die Bewegung nicht mehr braucht.
Ich wollte den Augenblick finden,
die unendliche Gegenwart.
Ich habe ihn gefunden,
aber er ist nicht das,
was ich zu finden erwartete.
Dennoch bin ich nicht enttäuscht,
im Gegenteil,
ich bin beglückt.
Ich hoffte,
die Stille und Weite des Nichts zu finden,
die Ruhe und den Frieden des Seins,
jenseits der Spaltungen und Kämpfe.
Aber ich fand mehr,
viel mehr, als ich zu träumen wagte.
Die Zukunft,
die ich für mich erträumt hatte,
war kleiner als das Geschenk der verwirklichten Gegenwart.
Ich fand die Liebe.
Ich fand meinen Geliebten.
Ich fand mich selbst.
Ich fand den Sinn.
Ich fand Erfüllung.“
Aruns Stimme war während des Lesens beständig klangvoller und ruhiger geworden. Als sie verstummte, schienen die Zuhörer förmlich zu erschrecken. Saraswati fühlte sich, als stünde sie nackt, einsam und ohne Schutz im eiskalten Regen. Dieser Fremde sprach über dieselben Dinge, die ihr erst gestern bewusst geworden waren. Er sprach von echtem Leben, von Sinnhaftigkeit und er sprach von Liebe … Die Menge wirkte verzaubert und von hilflosem Staunen erfüllt. Saraswati warf einen kurzen Blick auf Natascha, die das Ergebnis ihres Überraschungscoups sichtlich genoss. Das hatte niemand von ihr und von ihrem Verlag erwartet.
Die Zuhörer blickten wie versteinert nach vorn. Keiner wagte zu atmen, geschweige denn zu klatschen. Saraswati empfand die Stille als zu angespannt. Nervös rutschte sie auf ihrem Sitz hin und her und wagte es, durch ungeniertes Klatschen die Menschen um sie herum aus ihrer Starre zu befreien. Nach und nach fielen alle erleichtert in den Applaus ein.
Saraswati dachte an Walt Whitman, an William Blake und den Perser Rumi. Niemals hätte sie es für möglich gehalten, dass es in der heutigen Zeit Menschen, junge Menschen ihres Alters, gab, die ähnlich dachten, die ähnlich schrieben und die suchten oder sogar gefunden hatten, was all diese Dichter gemeinsam beschrieben: das Göttliche, das Eine, die Liebe.
Arun gab bereitwillig und noch immer beinahe teilnahmslos weitere Kostproben seiner nachdenklichen Verse. Mit jedem Wort zog er sein Publikum tiefer hinein in die Welt seiner Fragen und der eindeutigen Antworten, die er bereits gefunden haben musste. Vielleicht erklärte das seine eigenartige Gelassenheit, die er aus einer Quelle schöpfen musste, zu der nur wenige Menschen Zugang hatten. Die Zeit verging schnell, viel zu schnell. Schon las Arun die abschließenden Verse, die er „Himmel und Erde“ genannt hatte: „Es gibt Momente,
Momente, in denen sich Himmel und Erde berühren,
Momente, in denen alles eins ist,
in denen alles voller Freude ist,
in denen wir uns nichts mehr wünschen,
denn all unsere Wünsche sind bereits erfüllt,
durch den Moment,
der uns verändert,
verändert hat,
verändern wird …
Wenn Himmel und Erde sich berühren,
ist alles möglich.
Dann geschehen Wunder.
Gedanke wird zur Wirklichkeit.
Geist wandelt sich in Materie
und die Materie beeinflusst den Geist.
Wenn Himmel und Erde sich berühren,
bist du heil.
Du kennst keine Krankheit mehr,
keinen Tod,
keine Angst,
keine Unsicherheit,
kein Leiden
und kein unerfülltes Verlangen.
Wenn Himmel und Erde sich berühren,
hört die Welt auf, sich zu drehen,
denn sie hat ihren geheimen Sinn erfüllt:
dir zu zeigen,
wo das Tor ist,
durch das du auf Erden in den Himmel schreiten kannst.
Wenn Himmel und Erde sich berühren,
wirst du dich fragen,
warum du immer dachtest,
dass die Erde das Einzige sei,
das jemals für dich von Wert sein kann.
Erschrocken wirst du nicht mehr verstehen,
warum du den Tod mehr fürchtetest als die Geburt.
Du wirst dich fragen,
warum du alles besitzen wolltest,
wo du es doch mit deinem Verlangen nur zerstörtest.
Wenn Himmel und Erde sich berühren,
werden sich die Gegensätze vereinigen.
Dann wird nichts mehr unmöglich sein.
Du wirst die Schatten der ungeklärten Vergangenheit
hinter dir lassen.
Du wirst endlich bereit sein,
das Licht zu sehen und zu leben.
Du wirst über dich lachen können,
wo du dich vorher viel zu ernst nahmst.
Wenn Himmel und Erde sich berühren,
wirst du vor Freude tanzen,
denn du bist in einem einzigen Augenblick zu dir selbst geworden.
Wo du einstmals klein, einsam und ohne Kraft warst,
hast du nun die Macht,
durch einen bloßen Gedanken
neue Welten entstehen
und vergehen zu lassen
und besitzt die Weisheit,
diese Macht zum Wohle des Ganzen zu nutzen.
Wenn Himmel und Erde sich berühren,
bist du erwacht.
Du wirst erkennen,
dass Himmel und Erde niemals getrennt waren.
Du wirst sehen,
dass du es warst, der Himmel und Erde voneinander getrennt
und somit das Leid erschaffen hat.
Du wirst erleben,
dass das Leid dein Lehrmeister war,
der dich lehrte, Himmel und Erde,
die von Anbeginn zusammengehörten,
wieder zu vereinen,
zusammenwachsen zu lassen,
was zusammengehört.
Wenn Himmel und Erde sich berühren,
wirst du erleben,
dass du Zauberkraft hast.
Glücklich wirst du lächeln
und erkennen,
dass du glaubtest, Opfer der Umstände zu sein,
während du sie schon immer selbst geschaffen hast
und doch niemals der Handelnde warst.
Wenn Himmel und Erde sich berühren,
wirst du göttlich sein …“
Ungläubiges Raunen ging durch die Menge. Saraswati grinste innerlich, wie es ihre Angewohnheit war, wenn sie Menschen und ihre Reaktionen mit gewissem inneren Abstand beobachtete. Sie war diesem Inder plötzlich dankbar für die Offenheit, mit der er sprach. Ihr war wohl bewusst, wie verletzlich und angreifbar er sich mit seinen Einsichten bezüglich des Lebens und des Wesens des Göttlichen machte. Aber auch das schien ihn nicht zu kümmern. Er beschrieb seine Gotteserfahrung, als sei sie die natürlichste Sache der Welt. Und vielleicht war sie das auch. Vielleicht hatten nur die Unwissenden sie zu einer Art „Geheimnis“ gemacht.
Natascha war an Aruns Pult getreten und hatte das Mikrofon an sich genommen. Sie war mit dem Erfolg der Lesung sichtlich zufrieden und nickte ihrer Entdeckung beifällig zu. Arun nahm das Lob bescheiden zur Kenntnis. Als der Beifall, der diesmal völlig ungehemmt losbrandete, langsam wieder zur Ruhe kam, ergriff Natascha erneut das Wort: „Alles, was ich noch erklärend hinzufügen könnte, klingt schal angesichts der beeindruckenden Worte dieses jungen Mannes. Danke, dass Sie für uns gelesen haben, Arun, und danke für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren.“
Die Zuhörer sprangen fast gleichzeitig auf. Manche liefen fort, andere sangen Lobeshymnen, wieder andere palaverten in kritischen, lautstarken Disputen. Offensichtlich waren nicht wenige der Anwesenden mit dem eben Gehörten überfordert. Die Worte des jungen Inders hatten sie beflügelt, ihnen eine eigenartige Kraft geschenkt, die sich nun in allgemeiner betriebsamer Unruhe und unkontrollierter Emotionalität äußerte. Viele versuchten, Aruns Worte intellektuell zu erfassen, aber dies bewies lediglich, wie wenig sie verstanden hatten.
Nur in einem waren sich alle einig: Arun Gopal war ein besonderes Talent. Der stand mit einem Mal fast schüchtern neben Natascha und wirkte abwesend und viel kleiner als bei seinem Auftritt. Der ganze Rummel um seine Person und seine sogenannte Begabung war ihm nun sichtlich unangenehm. Er sah aus, als wolle er sich am liebsten unsichtbar machen. Fast tat er Saraswati leid.
Viele kauften sein Buch mit dem Titel „Ein-sichten“ an der nun wiedereröffneten Kasse und rannten aufgeregt zu ihm, um es signieren zu lassen. Saraswati beobachtete Arun dabei, wie er einen schwarzen Füller aus der Hosentasche zog und jedes Buch liebevoll entgegennahm und mit lockerem Federschwung signierte. Nun wirkte er wieder kraftvoller und selbstsicherer. Fragen über literarische Vorbilder und seinen Werdegang beantwortete er nur kurz und knapp. Es schien, als sei er bemüht, eine eiserne Trennung zwischen sich und dem jungen Autor zu ziehen. Er schlüpfte äußerst wandlungsfähig von einer Rolle in die andere. Das war wohl die beste Beschreibung für Arun. Er war ein Schauspieler, der sehr genau wusste, wann und wie er welche Rolle zu spielen hatte. Nur wer sehr genau beobachtete, konnte sehen, dass er zu keiner Zeit von einer seiner Rollen überwältigt wurde.
Sekunden später stand Natascha neben Saraswati und gratulierte sich selbst zu ihrem Erfolg. Saraswati tat ihr lächelnd den Gefallen und lobte ihr geniales Lektorengespür. Gleich darauf war Natascha schon wieder fort bei dem nächsten Ehepaar, das seiner Begeisterung über Arun Gopals Verse wortgewaltig Ausdruck verlieh. Saraswati bemerkte, dass Natascha jedes lobende Wort über ihren Schützling als persönliche Anerkennung aufnahm.
Sie zog sich in eine stille Ecke zurück und beobachtete einen Journalisten, der Bilder von der Veranstaltung machte. Er trat an Arun heran, um ihm einige persönliche Fragen zu stellen. Sofort war Natascha an Aruns Seite und bellte den Journalisten an: „Sie haben die Pressemappe erhalten, also wissen Sie, was Sie zu schreiben haben!“
Offensichtlich war Arun mit Nataschas schroffer Art nicht einverstanden, aber er war diplomatisch genug, nicht einzugreifen. Er atmete tief durch und schluckte leicht sichtbar.
Kurz hatte Saraswati das Gefühl, als sei er zu nachgiebig mit Natascha. Er ließ sich die Führung von ihr aus der Hand nehmen. Sie wusste nicht, ob das seine gelassene Unnahbarkeit war oder ein Mangel an Durchsetzungskraft.
Wenig später rief Natascha aufgeregt und eine Spur zu laut quer durch den Raum: „Saraswati, du kommst doch mit auf den Empfang?“
Aruns Augen suchten aufmerksam nach ihr. Saraswati lächelte und ging den beiden entgegen. Sie wollte wenigstens höflich sein. „Hallo, ich bin Saraswati Ingenhoven. Ich freue mich, Sie kennen zu lernen, Herr Gopal.“
Arun lächelte verstehend. Ihm war nicht entgangen, dass Nataschas Verhalten auch ihr ein wenig zu aufdringlich war. „Arun Gopal.“
Saraswati nahm wahr, wie außergewöhnlich wohl sie sich in seiner Gegenwart fühlte. Angenehme Stille breitete sich in ihr aus. Sie fühlte sich entspannt, getragen und verstanden. Sie hatte nicht das Bedürfnis, sein Werk zu loben. Sie wollte gar nicht mit ihm reden. Sie war damit zufrieden, in seiner Gegenwart zu sein. Und ihr war, als wäre es schon immer so gewesen.
Natascha saß zwischen Arun und Saraswati im Wagen, der sie in ein nahe gelegenes Hotel brachte und bombardierte Arun mit ihrer ersten Bewertung der Zuhörerreaktionen.
„Wir haben mehr Exemplare Ihres Buches verkauft, als auf jeder anderen Premiere davor. Es ist vielleicht zu früh, von einem großartigen Erfolg zu sprechen, aber ich glaube, wir können zumindest sagen, dass wir im Rennen sind …“
Sie lächelte Beifall heischend. Arun nickte kurz. Natascha erwartete offensichtlich mehr Begeisterung von ihm. Enttäuscht von seiner indifferenten Reaktion führte sie ihre euphorischen Selbstgespräche fort bis sie endlich das Hotel erreichten.
Auch hier hielt Saraswati sich absichtlich ein wenig abseits des Hauptgeschehens und suchte das Gespräch mit Leuten, die sich in Literaturkreisen besser auskannten als sie. Ein Literaturkritiker erklärte ihr, dass Arun tatsächlich eine besondere Entdeckung sei. Man dürfe aber die wirkliche Botschaft nicht vergessen, die er seinen Lesern mitteilen wolle. Nichts wäre für einen Künstler wie Arun schädlicher, als ihn misszuverstehen oder ihn zu verheizen.
Das Wort „verheizen“ ging Saraswati den ganzen Abend nicht mehr aus dem Kopf. In jedem weiteren Gespräch, das sie führte, versuchte sie zu ergründen, ob einer Aruns Worte wirklich begriffen hatte. Die meisten schienen noch weniger verstanden zu haben als sie.
Arun hielt sich tapfer. Er trug nun eine undurchsichtige Maske, die jede seiner Stimmungen schluckte. Für viele musste er arrogant und unnahbar wirken. Saraswati glaubte jedoch, eine Spur von Verletzlichkeit zu erkennen.
Arun begegnete ihr am Buffet wieder. Auch er entspannte in ihrer Gegenwart sichtlich. Sein Verhalten veränderte sich völlig. War er vorher distanziert und unpersönlich gewesen, wurde er plötzlich sehr persönlich. „Saraswati ist ein ungewöhnlicher Name für ein deutsches Mädchen.“ Sie lächelte über den Ausdruck „deutsches Mädchen“. „Ich bin in Indien geboren.“
„Die Göttin Saraswati spielt eine wichtige Rolle im hinduistischen Pantheon und der vedischen Philosophie. Wo in Indien sind Sie zur Welt gekommen?“
Die Formulierung kam ihr eigenartig vor. Einsilbig erklärte sie: „In Chennai!“
Bildete sie sich das ein, oder weiteten sich seine Augen in Erstaunen? Sie tat so, als hätte sie es nicht bemerkt.
„Mein Vater hat mehrere Jahre dort gearbeitet“, erklärte sie. „Und Sie? Sie sprechen akzentfrei Deutsch. Leben Sie schon lange hier?
„Ich bin als Kind nach Deutschland gekommen. Meine Mutter wollte Indien damals unbedingt verlassen.“
Sie registrierte sofort, dass er nur von seiner Mutter sprach. Was war mit seinem Vater?
„Leben Sie gerne hier?“, fragte sie interessiert.
„Ja und nein. Ich glaube, dass mich etwas Besonderes mit Deutschland verbindet. Ich habe kein großes Heimweh nach Indien, wenn Sie das meinen. Aber es ist schon ein seltsames Gefühl, immer zu wissen, dass man eigentlich aus einer anderen Kultur stammt. Ich bin irgendwie wurzellos. Das gibt mir jedoch eine gewisse Distanz zu den Dingen des alltäglichen Lebens und die Freiheit, Dinge zu tun und zu sagen, die andere Menschen nicht tun und äußern können. Stellen Sie sich nur einmal vor, ich hieße Torsten Seidel und schriebe, was ich schreibe …“
Saraswati war sich nicht sicher, ob diese Distanz, von der er sprach, nicht seine ganz persönliche Eigenart war.
Da entdeckte Natascha sie und war augenblicklich an Aruns Seite, um ihn zu einem „wichtigen“ Gespräch fortzuziehen. Er ließ es widerstandslos geschehen und rief Saraswati über die Schulter zu: „Ich hoffe, wir haben noch einmal die Gelegenheit, uns in Ruhe zu unterhalten.“
Natürlich bot der Abend ihnen nicht die Gelegenheit. Der Zeiger der Uhr war schon weit hinter die Zwölf gerückt, als Saraswati zum ersten Mal wieder an ihre eigenen kreativen Verpflichtungen dachte und heimlich verschwand.
Drittes Kapitel
Die Gewissheit, dass ihr heute etwas Geniales einfallen würde, trieb sie früh ins Büro. Noch bevor die anderen müde, angespannt und lustlos eintrudelten, standen ihre Texte. Es war plötzlich ganz einfach gewesen. Einfacher als jemals zuvor. Und noch etwas war anders. Sie wusste heute, wie sie es anstellen musste: Sie musste so texten wie sie Arun gestern Abend zugehört hatte. Es war weniger ein Tun, ein Machen, ein Bewirken, als ein Finden, ein Erkennen – fast so, als sei die Idee schon immer vorhanden gewesen. Vielleicht, so dachte sie, waren ihr die entscheidenden Ideen immer auf diese Weise gekommen. Sie hatte es bloß nicht bemerkt. Wie hatte Arun noch gleich gesagt? „Du rätst mir, mich von allen Vorstellungen zu lösen und allein meinem Gefühl zu folgen …; du rätst mir, ihn nicht zu suchen und ihn nicht festhalten zu wollen …“
Und obwohl Arun gestern Abend von Gott, von der göttlichen Gegenwart gesprochen hatte, wusste Saraswati instinktiv, dass er mit seinen Worten so etwas wie das Wesen der Kreativität beschrieben hatte. Saraswati erkannte sich selbst nicht wieder an diesem Morgen. Ihre eigenen Gedanken kamen ihr fremd und eigenartig weise vor. Sie klangen seltsam metaphysisch. Und sie erfüllten sie mit einem Gefühl der Freude und der Lebendigkeit. Saraswati gefiel diese neue Art des Denkens. Es stand in völligem Gegensatz zu dem Gefühl der Leere und der Sinnlosigkeit, mit dem sie sich in den letzten Tagen herumgeschlagen hatte.
Sie fing Klaus gleich an der Kaffeemaschine ab. „Morgen Klaus, du siehst fürchterlich aus!“
Er spürte ihr echtes Mitgefühl und lächelte: „Du bist die Einzige, die das heute zu mir sagen darf, Sara!“ Schon etwas lockerer, legte er den freien Arm um sie. „Was gibt es, mein Dirn?“
„Ich glaub, ich hab's!“
„Was? Und das sagst du so, als würdest du mir erzählen, was du heute zum Frühstück gegessen hast?“
Es kam ihr wirklich nicht spektakulärer vor.
„Zeig her!“, rief Klaus aufgeregt.
Kurz darauf breitete sie die Idee für die Texte zu den verschiedenen Kampagnen auf ihrem Schreibtisch aus. Die Idee war nicht völlig neu, aber sie war durchaus tragfähig. Durch alle Texte zog sich ein gemeinsamer roter Faden und doch waren die Texte je nach Medium, in dem sie erscheinen sollten, unterschiedlich gestaltet. Der Grundtenor lautete: „Kommunikation ist das Mittel zur Vereinigung zweier Meinungen. Vereinigung braucht Verbindung. Wir verbinden Welten – weltweit.“Aruns Worte hatten sie inspiriert.
„Das ist es! – Das ist es wirklich! Es gibt keinen anderen Slogan. Warum sind wir nicht eher darauf gekommen? Es ist so einfach!“, rief Klaus erleichtert.
Kurze Zeit später saß das gesamte Team im Konferenzraum zum Briefing. Saraswati stellte kurz und sachlich das Konzept vor. Die meisten nickten zustimmend.
Sobald sie zurück in ihrem Büro war, fühlte sie sich wieder leer und müde. Erfolg machte nur so lange Spaß, wie man ihn sich selbst zuschrieb. Heute Morgen hatte sie aber eindeutig und unabweisbar erlebt, dass sie diesem Erfolg mehr im Wege stand, als ihn zu bewirken. Zum ersten Mal in ihrer Karriere hatte sie bewusst erlebt, wie Ideen entstanden. Sie hatte sie nicht gemacht. Es kam ihr ehrlicher vor, zu sagen, sie habe sie geschenkt bekommen. Stolz war eine völlig unangebrachte Reaktion auf die Früchte ihrer Arbeit. Sie glaubte zu begreifen, wie seltsam Arun Gopal sich gestern gefühlt haben musste, als alle Welt ihn und sein Talent gefeiert hatte, obwohl er längst wusste, dass alle Worte und alle Einsichten, die er zu Papier gebracht hatte, gar nicht sein Verdienst waren.
Das Telefon klingelte. Natascha war am anderen Ende der Leitung. „Na, war das nicht großartig gestern?“, fragte sie noch völlig erfolgstrunken.
„Du hast einen sehr ungewöhnlichen Fisch an Land gezogen“, lobte Saraswati sie erneut.
„Ist er nicht fantastisch? So sensibel und trotzdem so männlich.“
Saraswati war bewusst, dass Natascha Arun so erlebte und ihn deshalb begehrenswert fand. Sie wunderte sich darüber, wie man Arun Gopal so betrachten konnte. Sein sehr individuelles Verhalten hatte auf sie ganz anders gewirkt.
„Hast du schon die Zeitung gelesen? Wir haben die besten Kritiken!“
Saraswati grinste über Nataschas Euphorie.
„Ich begleite Arun ab morgen auf den ersten Etappen seiner Lesereise. Hast du Lust heute Abend noch feiern zu gehen? In den nächsten Wochen werde ich viel unterwegs sein!“
Sie verabredeten sich für den Abend in einem neuen Club in den Fleeten.
Saraswati schaffte es erst spät in den Club. Die Ausarbeitung der Texte, der Layouts und der Präsentation hatte viel Zeit in Anspruch genommen. Sie fand Natascha in einem Pulk von Freunden an der Theke. Sie tranken Margaritas und grölten. Saraswati fühlte sich nicht wohl. Doch es war zu spät wieder umzudrehen. „Hey, Saraswati! Da bist du ja endlich.“ Natascha hatte sie schon entdeckt. Plötzlich sah sie sich von Nataschas Freunden umringt und jeder wollte wissen, warum sie so komisch hieß – nur die Bedeutung ihres Namens interessierte hier keinen. Saraswati begann zu schwitzen und spürte ein vertrautes unangenehmes Ziehen in Schultern und Nacken, das sie immer dann empfand, wenn Menschen sich in ihrer Gegenwart zu grob und zu extrovertiert verhielten. Unwirsch warf sie ein oder zwei bissige Bemerkungen in die wogende Menge um Natascha, um klarzumachen, dass sie nicht in der Stimmung für rüde Späße war. Gleichzeitig wünschte sie sich sehnlichst zurück zum gestrigen Abend und zu der angenehmen Gesellschaft von Arun Gopal.
Jemand drückte ihr eine Margarita in die Hand. Sie nahm sie widerwillig entgegen und versuchte, sich möglichst rasch an die Seite der etwa fünfzehn Mann starken Gruppe zu drängen, um weiteren zwanghaften Gesprächen zu entgehen. Natascha bemerkte ihren Fluchtversuch und folgte ihr aufgeregt auf sie einredend. Sie fühlte sich eigenartig von Natascha verleugnet und benutzt.
Wenig später lockerte sich plötzlich der eiserne Griff, mit dem Natascha sie unerbittlich gefangen hielt. Zuerst begriff Saraswati nicht recht, weshalb. Aber dann sah sie den Grund: Arun war gekommen. In der Sekunde, als Natascha das Interesse an ihr verlor, verlor es auch die Gruppe. Erleichtert nahm sie einen Schluck ihrer Margarita und beobachtete interessiert, wie Arun sich der tobenden Menge stellte. Sie musste lächelnd zugeben, dass er sich besser schlug als sie. Selbst wenn er Natascha und ihre Freunde unangenehm fand, so ließ er es sie nicht merken. Er stellte sich gelassen und ohne Missmut allen Fragen.
Saraswati hatte genug gesehen. Sie ging allein auf die Tanzfläche und tanzte. Plötzlich spürte sie eine leichte Berührung an ihrer Schulter. Jemand drehte sie zu sich herum.
„Schön, dass Sie auch da sind“, sagte Arun sichtlich bewegt. Seine Augen funkelten vor Freude. Sie lächelte scheu. Er beugte sich vor und flüsterte in ihr Ohr. „Was halten Sie davon, wenn wir beide hier abhauen?“
Draußen vor der Tür atmeten sie erleichtert auf. Saraswati fand als Erste die Sprache wieder.
„Das war furchtbar! Ich verstehe gar nicht, was mit Natascha los ist!“
Arun zeigte Verständnis. „Sie genießt ihren Erfolg!“
„Aber es ist nicht ihr Erfolg, Arun. Es ist Ihr Erfolg.“
„Ist er das?“
Da war es wieder, dieses eigenartige Gefühl der Distanziertheit, das er vermittelte, so als gehörten ihm die Dinge nicht. Es faszinierte sie. Arun faszinierte sie. Heute verstand sie ihn besser als gestern Abend und doch wusste sie, dass seine Art des Erlebens eine ganz andere als die ihr vertraute war.
Sie schlenderten kreuz und quer durch die Fleete. Obwohl die letzten Tage anstrengend und kräftezehrend gewesen waren, fühlte Saraswati sich wach und frisch. Sie genoss Aruns angenehme Nähe. Er vermittelte ihr ein Gefühl von Sorglosigkeit und Einfachheit.
In einer alten Kneipe, die noch nicht der Modernisierung zum Opfer gefallen war, tranken sie einen heißen Tee. Während Saraswati langsam und vorsichtig die ersten heißen Schlucke ihres Tees schlürfte, ließ Arun sie nicht aus den Augen. Sie hatte fast den Eindruck als betrachte er sie liebevoll. Erst als sie die Tasse wieder sicher abgestellt hatte, sah er nachdenklich fort.
Es war leicht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Sie hatte ihn gefragt, was sein Name bedeutete. Es war ihr wichtig erschienen, vielleicht weil sie aus eigener Erfahrung wusste, dass indische Namen immer bedeutungsvoll waren.
„Der hebräische Name Aaron bedeutet ›der Erleuchtete‹. Der indische Name Arun bedeutet ›Sonne‹. Damit kann sowohl die äußere Sonne gemeint sein, als auch die innere. In jedem Fall meint Sonne Lebenskraft, das Licht, das Leben erst möglich macht. Sie steht für Aktivität und Tatkraft. Sie ist ein männliches Symbol, das zu seiner Ergänzung immer des Mondes, des Weiblichen, Hingebungsvollen, Reflektierenden, bedarf. Gopal ist ein anderer Name für Lord Krishna, das Göttliche, Allgegenwärtige, das Namen- und Zeitlose, die eine Wahrheit, jenseits der Dinge.“
Saraswati hörte ihm staunend zu. Erklärte nicht sein bloßer Name bereits, warum Arun schrieb, was er schrieb? Es war ein eigenartiges, erhebendes Gefühl, dass ihre beiden Namen Gottheiten symbolisierten. Sie verbanden sie auf unerklärliche Weise mit dem Archetypischen und hoben sie über sich selbst hinaus. Zum ersten Mal betrachtete sie ihren eigenen Namen statt mit Ablehnung und Widerwillen mit Neugier und Interesse.
Arun erzählte, wie er als Dreijähriger nach Deutschland gekommen war. Nach dem Tod seines Vaters sei das Leben in Indien fürchterlich gewesen. Als Witwe hätte seine Mutter keinerlei Rechte gehabt. Selbst die Tatsache, dass sie aus einer wohlhabenden und angesehenen Familie stammte, änderte daran nichts. Alle hätten ihr damals, in den 1970er Jahren, geraten, Indien zu verlassen und nach London zu ziehen. Dort gab es eine große indische Exilgemeinde. Aruns Familie hatte viele Verwandte und Bekannte in London, bei denen sie mit offenen Armen aufgenommen worden wären.
„Aber Mutter weigerte sich standhaft. Sie sagte: ›Wenn ich gehe, dann gehe ich nach Deutschland.‹ Keiner verstand sie und alle glaubten, sie würde unter dem Tod meines Vaters so sehr leiden, dass sie keine klare und vernünftige Entscheidung treffen könnte. Ich glaube, dass sie sehr genau wusste, was sie tat. Sie wollte es nur niemandem erklären.“
„Auch Ihnen nicht?“
„Nein, auch mir nicht. Sie nahm mich mit nach München, kaufte dort ein kleines Haus etwas außerhalb der Stadt, lernte in kürzester Zeit Deutsch, fand einen Job. Es fehlte uns an nichts. Mein Vater hatte uns ein beträchtliches Vermögen hinterlassen. Bald hatte ich Chennai, meine Heimatstadt …“
Deshalb hatte er neulich so erstaunt ausgesehen, als sie von ihrem Geburtsort gesprochen hatte. Ihr Herz klopfte aufgeregt. „Sie sind in Chennai geboren?“
„Ja.“
„Wann?“
„1972.“
„Ich bin auch in Chennai geboren!“
Eine Spur zu unbeteiligt erwiderte er: „Ja, ich erinnere mich. Wann?“
„1971.“
„Und wann sind Sie fortgegangen?“
„Ich glaube, ich muss vier gewesen sein, als wir nach Deutschland zurückgingen … Mein älterer Bruder war damals neun … Ja, ich war vier, also 1975.“
„1975? Mutter und ich sind Ende 1975 nach München gezogen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es Winter war. Ich sah zum ersten Mal Schnee …“
Aruns nächste Frage ließ ihr keine Zeit, über die Bedeutung seiner Worte nachzudenken. „Wo haben Sie in Deutschland gelebt?“
„In Hamburg. Mein Vater arbeitete für ein Teekontor.“
Sie redeten und redeten, bis Arun bemerkte, dass es langsam hell wurde. Mit großen, noch immer hellwachen Augen fragte er: „Wie spät ist es eigentlich?“
Sie sah auf die Uhr. „Schon halb sechs! Ich muss unbedingt nach Hause, duschen und dann in die Agentur. Wir haben heute eine wichtige Präsentation.“
„Für mich wird es auch Zeit. Ich muss noch packen.“
Sie nahmen gemeinsam ein Taxi, das Arun zuerst an seinem Hotel absetzte. Sie wusste nicht, was sie zu ihm sagen sollte, als er sie erwartungsvoll anblickte, während das Taxi vor dem Hotel zum Halten kam. Er sah aus, als wolle er sie nicht gehen lassen. Doch er sagte nichts. Leise drückte er seinen Wunsch nach einem Wiedersehen aus: „Wann sehen wir uns wieder?“
Ein wenig zu unverbindlich erwiderte sie: „Wir bleiben in Kontakt. Natascha wird sich sicher regelmäßig bei mir melden. Viel Glück!“
Ohne ein weiteres Wort sprang Arun aus dem Wagen, als müsse er sich gewaltsam von ihr losreißen. Saraswati sah ihm nachdenklich nach. Ihr Leben fühlte sich anders an, seit sie ihn kannte.
Die Präsentation lief gut. Der Mobiltelefonhersteller, ein neuer Zusammenschluss mehrerer europäischer Anbieter, den das Kartellamt noch gerade so bewilligt hatte, reagierte begeistert. Klaus lobte sein Team: „Ohne euren Einsatz hätten wir das niemals geschafft. Ihr habt Übermenschliches geleistet.“
Saraswati erinnerte sich noch zu gut an seine erst kürzlich ausgesprochene Kündigungsdrohung. Was war das für eine Art und Weise, mit seinen Mitarbeitern umzugehen, fragte sie sich. Sie versuchte, sich einzureden, dass Klaus allein aus Hilflosigkeit so rigoros gewesen war. Doch sie spürte, dass sie sich nur selbst beruhigen wollte. Sie hatte Klaus’ wahres Gesicht gesehen. Sie wusste nun, dass er niemals Verständnis für eine Schaffenskrise haben würde.
So früh wie möglich verließ Saraswati das Büro. Sie hatte plötzlich andere Dinge im Kopf. Sie dachte an ihre ersten Lebensjahre in Chennai und den eigenartigen Zufall, dass Arun Gopal nur ein Jahr nach ihr in derselben Stadt geboren und zur gleichen Zeit wie sie nach Deutschland gezogen war. Die blasse Erinnerung an ihre ersten vier Lebensjahre in Indien erwachte zu neuem Leben. Saraswati spürte den Funken einer eigenartigen Faszination, den der Gedanke an Chennai in ihr zum Glühen brachte. Ihr war, als wäre diese Zeit in ihrem Leben von einer großen Freude und tief empfundenem Glück erfüllt. Sie wusste nicht, ob diese Erinnerung wirklich war oder ob sie auf Wunschdenken beruhte. Sie wusste so wenig über diese Zeit in ihrem Leben. Viel zu wenig.
Gierig verschlang Saraswati jede Rezension über Aruns „Ein-sichten“ in der Literaturbeilage jeder Zeitung, die ihr in die Hände fiel. Er schien eine bisher ungeahnte Sehnsucht nach Emotionalität und dem unverfälschten Ausdruck der eigenen Gefühle zu repräsentieren und wurde von der Kritik in kürzester Zeit zu dem Mann hochgepuscht, der dem sinnlosen Leben wieder einen Sinn gab. Verwundert nahm Saraswati immer wieder zur Kenntnis, dass die wenigsten Kritiker auf das eigentliche Thema von Aruns Versen eingingen – die sehnsuchtsvolle Suche nach Gott. Sie beschrieben Arun oberflächlich, wie Natascha es getan hatte: sensibel und doch männlich.
Arun befand sich nun schon seit vier Wochen auf seiner Lesereise. Stadt um Stadt wurde das Programm erweitert, und wenn Saraswati ab und an mit Natascha, die inzwischen nicht mehr von seiner Seite wich, telefonierte, klang diese zwar noch immer euphorisch, aber langsam mischte sich Müdigkeit unter die Aufgeregtheit, mit der sie die Reaktionen der Leser und der Zuhörer auf den abendlichen Lesungen wiedergab. Mit Arun selbst sprach Saraswati nur ein oder zwei Mal. Er war einsilbig, sehr in sich zurückgezogen. Sie glaubte fast, dass er unter dem ganzen Rummel um seine Person litt. Er wollte keine Anerkennung. Er wollte den Leuten etwas zeigen, das sie nicht sehen konnten. Beunruhigt fragte Saraswati sich, ob er nun einsehen musste, dass er das mit bloßen Worten nicht konnte.
Einmal machte sie gegenüber Natascha eine besorgte Andeutung.
„Ach was, Saraswati, du spinnst. Arun ist genauso glücklich wie ich!“
Saraswati kämpfte weiter gegen ihren Job. Der Termindruck machte ihr immer stärker zu schaffen, die Themenkreise der neuen Aufträge interessierten sie noch weniger als die endlich abgeschlossene Mobilfonkampagne. Mattigkeit und Trägheit entließen sie nicht mehr aus ihrem eisernen Griff. Täglich fühlte sie sich lustloser, unkonzentrierter und ausgebrannter. Sie verließ die Agentur jeden Abend pünktlicher. Sie war unfähig, sich zu motivieren. Sie sah kein Ziel mehr.
Vielleicht lag es auch daran, dass sie jede freie Minute über alten Fotos aus ihrer Kindheit hing: Bilder von dem Haus in Chennai, von Siya, ihrer Kinderfrau, von Peter, ihrem Bruder, der glücklich in einem wilden Garten tobte. Es ließ sich nicht verleugnen: Eine geheime, lange verhüllte Sehnsucht war in ihr erwacht. Zuerst dachte sie, es sei die Sehnsucht nach der Einfachheit und Unbeschwertheit der Kindheit, die sie in ihren lähmenden Bann zog, zu einem Zeitpunkt, an dem sie begann, über das, was sie in der Gegenwart tat, intensiver und kritischer nachzudenken. Aber je mehr sie ihr plötzlich erwachtes Interesse für die indischen Anfänge ihres Lebens als Spinnerei und Gefühlsduselei abtat, desto intensiver wurde der Sog, den die Vergangenheit auf ihre Gedanken und Gefühle ausübte. Das plötzliche Erwachen der Erinnerung musste mehr als bloße Nostalgie, Regression oder Flucht vor wachsender Verantwortung sein.
Wohin auch immer sie ging, sie stieß auf Indisches. Jedes Einrichtungshaus in Hamburg hatte sich auf hinterhältige Art und Weise mit ihrer inneren Stimme gegen sie verbündet. Täglich fiel ihr Blick in unzähligen neuen Einrichtungsgeschäften auf Teetische, Teakholzmöbel und Maharadscha-Zelte. Kolonialstil war der letzte Schrei in Hamburg. Selbst die Dekorationen der Boutiquen schmückten sich schamlos im kolonialen Stil mit bunten Stoffen und indischen Accessoires. Von einem Tag auf den anderen wurde Saraswatis zuvor ruhiges Leben zu einer Art Spießrutenlauf. Mitten in Hamburg lief sie vor Indien davon. Auch wenn sie sich große Mühe gab, ihrer Vergangenheit auszuweichen, diese holte sie fast immer und überall ein.
Deshalb meldete sie sich am Wochenende bei ihren Eltern, die an der See lebten, zu einem Besuch an.
Saraswati sah sie ausgesprochen selten. Der Kontakt beschränkte sich auf wenige Pflichtbesuche ihrerseits und gelegentliche, wortkarge Telefonate. Ihre Eltern hatten eine sehr eigenartige Beziehung zu ihren Kindern. Seit Saraswati denken konnte, hatten sie sich aus allem, was ihr wichtig gewesen war, herausgehalten. Nicht dass sie ihre Kinder nicht geliebt hätten, … Freiheit war Liebe für sie. Sie hatten nie versucht, ihre Kinder in ihre Welt zu zwingen. Aber sie hatten auch nie versucht, sie in ihre Welt mit einzubeziehen oder an ihrer Welt teilhaben zu lassen. Und gerade das, dieses Gefühl der Gemeinsamkeit und Verbundenheit, hatte Saraswati unsagbar vermisst. Sie war frei gewesen, ihre eigene Welt zu finden. Zu frei. Wie oft hatte sie sich nach emotionaler Anteilnahme gesehnt. Selbst disziplinäre Maßnahmen hatten ihre Eltern nur selten ergriffen. Peter und sie waren nicht die Kinder ihrer Eltern, eher deren Freunde, vielleicht sogar nur gute, entfernte Bekannte. Sie waren immer wie Erwachsene behandelt worden.
Nun saß sie mit ihrer Mutter im Garten und wusste einfach nicht, wie sie das Gespräch unbefangen auf ihr dringendes Anliegen bringen sollte. Zu gut erinnerte sie sich daran, wie sie immer, wenn sie nach Indien gefragt hatte, dieselbe Antwort erhalten hatte: „Ach Kind, das liegt doch so lange zurück. Wer will von diesen vergangenen Zeiten denn heute noch sprechen? Du bist jung, du musst in der Gegenwart leben!“
Saraswati wagte es trotzdem. Gerade hatte sie noch von ihrem Job in der Agentur gesprochen, da wechselte sie von einer Sekunde auf die andere das Thema in der Hoffnung, dass ein Überraschungsangriff am besten geeignet wäre, ihre utopischen Hoffnungen zu erfüllen. Zuerst sah es auch so aus. Der scharfe Blick ihrer Mutter wurde weicher und wanderte für einen winzigen Moment in die innere Ferne der Erinnerung. Als sie es bemerkte, schlug sie die Tür zur Vergangenheit energisch und eiskalt zu. Saraswati fröstelte. Die Stimme ihrer Mutter klang distanziert, kalt und beherrscht: „Ach Kind, Indien? Das ist so lange her. Ich kann mich kaum daran erinnern.“
Saraswati spürte Tränen in ihren Augen und auch sie sah in die Ferne, hinaus auf das Meer am Ende des Gartens, damit ihre Mutter ihre Tränen der Enttäuschung und der wütenden Ohnmacht nicht sah. Leise flehte sie: „Mutter, bitte, es ist wichtig!“ Das hatte sie noch nie getan.
„Da gibt es nichts zu erzählen!“, entgegnete ihre Mutter emotionslos.
Die Tür blieb verschlossen. Selbst wenn ihre Mutter ihren Schmerz bemerkte, sie ließ sich nicht davon berühren.
Sie versuchte einen anderen Weg. „Was ist mit meinem Namen? Warum habt ihr mich Saraswati genannt?“
„Das weißt du doch! Weil uns der Name gefiel und weil dein Vater Indien so liebte!“
Aufregung und Verzweiflung ließen ihre Stimme lauter werden. „Warum seid ihr aus Chennai fortgegangen, wenn ihr euch dort so wohlgefühlt habt?“