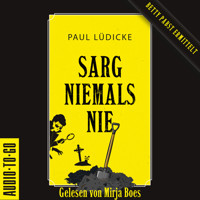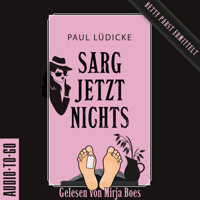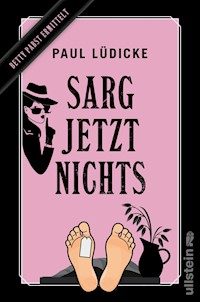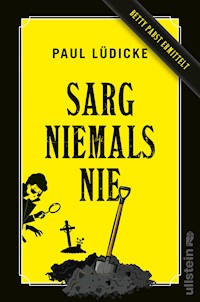
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Diese Familie liebt alle, die sie unter die Erde bringen darf "Bestattungen Pabst - nur das Beste für die letzte Ruhe" lautet das Motto des Familienunternehmens in Bielefeld-Jöllenbeck. Leider laufen die Geschäfte immer schlechter, seit im Ort ein Beerdigungs-Discounter eröffnet hat. Da kommt ihnen eine aufwendige Yoga-Bestattung inklusive fliegender Tauben gerade recht. Die Leiterin des benachbarten Esoterik-Instituts ist trotz Schamanismus und Reiki plötzlich verstorben. Betty Pabst, Assistenzärztin an der Charité und auf Heimaturlaub, ist sich mit einem Blick auf die Leiche sicher: Das war kein natürlicher Tod! Doch warum will keiner auf sie hören? Betty hat bald einen furchtbaren Verdacht: Ist vielleicht ihre ganze Familie in den Mord verwickelt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Sarg niemals nie
Der Autor
PAUL LÜDICKE stammt aus Bielefeld und hat jeden Witz über diese Stadt, genauer gesagt: den einen, den es gibt, schon tausendmal gehört. Auch deswegen ist er ausgebrochen und hat als Stangentänzer, Bienenzüchter, Einsiedler, Doppelagent und Ornithologe gearbeitet. Paul Lüdicke lebt heute unter einem Pseudonym in einer anderen Stadt, hat zwei Kinder und verdient sein Geld damit, dass er Drehbücher schreibt.
Das Buch
»Hier, zwischen den Särgen, umgeben von Holzduft, hatte Betty sich immer am wohlsten gefühlt. Hier war zu Hause, hier war ihre Heimat, hier hatte sie eine glückliche Kindheit verlebt, hatte zwischen, unter und in den Särgen gespielt. Hatte ihre Puppen und Stofftiere auf die edle Seide gesetzt und war mit ihnen nach Übersee gerudert, hier waren Särge Indianerzelte, Rennautos, Geheimverstecke und Schatzkisten gewesen. Ihre Eltern hatten das immer geduldet. Nur wenn Betty ihre Puppen danach nicht weggeräumt hatte, und ihr Vater irgendwelchen Angehörigen einen Sarg vorführen wollte, war es manchmal problematisch geworden.«
Paul Lüdicke
Sarg niemals nie
Betty Pabst ermittelt
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
ISBN 978-3-8437-2609-2Originalausgabe im Ullstein Paperback© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021E-Book Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Prolog
Inka lag ausgestreckt auf dem moosigen Gras, das gebräunte Gesicht im letzten warmen Sonnenstrahl des Tages. Es war das Ende des Sommers. Um Inka herum lagen ein paar Birnen, die vom Baum gefallen waren, gelbe Tupfen auf dem noch satten Grün. Ein Vogel landete auf dem Gras und pickte nach der blau-schwarzen Frucht der Mahonie, die neben Inkas linkem Arm lag. Inka regte sich nicht. Die Idylle war beeindruckend. Der Garten sah aus wie ein verwunschenes Paradies, in seiner überquellenden Pracht, mit seinen bunten Farben, seinem explodierenden Wildwuchs.
Aber bald würde all seine Pracht schwinden. Wenn der Herbst und dann der Winter kam. Gestern hatte Inka ihren Workshop-Teilnehmern noch ein ähnliches Bild vor Augen geführt. Sie hatte sie darauf aufmerksam gemacht, dass alles schwindet, alles vergeht, alles seinen Lauf nimmt. Und doch machen wir den Fehler, dass wir uns an die Illusion klammern, es würde bleiben, wie es ist. Bitte bleib, ändere dich nicht. Es sei denn, wir waren in einer Krisensituation, dann wünschen wir uns, es möge sich alles so schnell wie möglich ändern. Jetzt. Sofort!
Aber man kann die Zeit nicht schneller drehen, sosehr man sich das auch wünscht. Man kann nur warten. Man kann das Bestehende akzeptieren oder nicht, man kann damit ringen, sich dem Unvermeidlichen zu stellen, aber das Einzige, was hilft, das Einzige, was uns wirklich weiterbringt im Leben, das Einzige, was uns Halt, Struktur und dadurch auch die nötige Gelassenheit gibt, ist, einen Atemzug nach dem nächsten zu nehmen. Ein. Aus. Ein. Aus.
Das Leben bejahen. Es annehmen. Solange es da ist.
Denn auch das blühende, übersprudelnde Leben in Inkas Garten wusste nicht, dass es bald weder blühen noch leben würde. Die Bienen wussten nicht, dass sie bald sterben würden, während sie jetzt noch eifrig um die Blütenstauden schwirrten und Pollen sammelten, als gäbe es kein Morgen, als gäbe es keinen drohenden Herbst und dann den Winter und seine Kälte, die ihnen bald das Leben nehmen würde. Und die Äpfel, die jetzt noch am Baum hingen, wussten nicht, dass sie bald herunterfallen, braune matschige Stellen bekommen und alsbald von irgendwelchen Insekten und Vögeln aufgefressen werden würden, um dann, als Kot, irgendwann zum Dünger zu werden. Der ewige Kreislauf des Lebens. Und sie befanden sich in diesem ewigen Kreislauf des Lebens, ihre Seminarteilnehmer und auch Inka selbst.
In Inkas Kleid aus hellem marokkanischen Stoff fuhr jetzt ein Windhauch, hob es leicht hoch, ein luftiger, poetischer Schleier über dem Boden. Eine letzte Sommerbrise. Alles war Idylle.
Als hinten im Seminarhaus die Tür aufging und Samuel heraustrat, hielt er für einen Moment inne. Er sog die warme, feuchte Luft des Tages ein, registrierte den leicht dumpfen Geruch, ohne zu werten, und reckte seinen schlanken, sehnigen Körper in den Sonnenstrahl, der von den Fenstern des alten Hauses hinter ihm gespiegelt wurde. Einen kurzen Moment stand er da, mit beiden Beinen fest auf dem Boden, den Rücken gestrafft und gerade, die Schultern heruntergezogen, die Hände auf Höhe der Hüften etwas abgespreizt. Tadasana. Die Bergstellung. Für einen kurzen Moment war Samuel eins mit sich, mit der Natur, mit der Welt, mit dem Moment. Dann löste er sich, nahm den Korb von der Brüstung der Terrasse und ging damit hinunter in den Garten. Samuel brauchte Fenchelgrün, Bohnenkraut und Lauch für die Quinoapfanne heute Abend. Er ging um das weiße Christophskraut herum, an der Lampionblume neben dem Zen-Steingarten entlang, hinten durch zu den Gemüsebeeten bei den Obstbäumen. Er pfiff vergnügt ein leises Mantra, als er seine nackten Füße auf das ungemähte Gras setzte, völlig im Moment versunken. Als er um den großen Feuerdorn bog, sah er Inka auf dem Boden liegen.
Samuel ließ den Korb fallen. Er stürzte zu Inka, sah ihr völlig deformiertes Gesicht.
Und schrie.
1
Betty Pabst saß in einem überfüllten ICE aus Berlin. Und egal, wie sehr sie sich anstrengte, auf Höhe Hannover-Garbsen kamen ihr die Tränen. Dumme, überflüssige, widerspenstige Scheißtränen, die sich Betty schnell von den Wangen wischte, bevor der nervige Sechsjährige ihr gegenüber am Tisch darauf aufmerksam wurde. Er hatte die ganze Zeit über ein Rechenspiel machen müssen, weil ihm seine Mutter erst danach das Handy geben würde, da hatten auch sein Tobsuchtsanfall in Wolfsburg, der Schreikrampf in Gardelegen und die Krokodilstränen in Stendal nichts geholfen. Betty hatte sich bislang wenig Gedanken über Konsequenz und Erziehungsmethoden von Kindern gemacht, sie hatte schließlich keine. Und wenn sie den Sechsjährigen ihr gegenüber noch länger aushalten müsste, würde sie auch nie welche bekommen, so viel war mal sicher. Betty wünschte sich nur zweierlei. Erstens, dass diese bescheuerte, völlig verkrampfte Mutter dieses grenzdebilen Bengels etwas weniger konsequent wäre. Und dass der Idiot endlich dahinterkommen würde, wie viel elf minus acht war! Dann hätte er die Aufgaben fertig, würde das Handy bekommen, und es würde endlich Ruhe geben. Und er würde auch aufhören, Betty anzustarren. Und dabei – unfassbar – popelte er.
Betty war froh, dass sich die Kinderfrage noch nicht gestellt hatte, erstens war sie erst siebenundzwanzig und viel, viel zu jung. Und zweitens zweifelte sie daran, dass Sean der Richtige dafür war. Vor zwei Monaten waren ihre Tage ausgeblieben, und sie hatte es Sean nach der Vorspeise in diesem kleinen französischen Restaurant am Zionskirchplatz gesagt, ganz belanglos, nebenbei. Im gleichen Moment hatte sie sehen können, wie er innerhalb von Sekunden alle Fenster und Türen des Restaurants abcheckte. Fluchtreflexe eines in die Enge getriebenen Tieres. Betty hatte bemerkt, wie Sean sich versteifte, wie ihm der Schweiß ausbrach, er angespannt ihrem Blick auswich, und sie konnte förmlich hinter seiner Stirn den Gedanken hämmern sehen: Wie komme ich hier nur raus?
Die Vorstellung, dass Sean aufgesprungen wäre und sich kopfüber einfach durch die Fensterscheibe des Restaurants gestürzt hätte, amüsierte Betty kurz, als der Zug in Garbsen wieder losfuhr. Es lag weniger an seinem überraschenden Stunt als an der Vorstellung, dass Seans Gesicht von Glas und Scherben zerschnitten und er draußen auf dem Gehsteig blutig zusammenbrechen und elendig verrecken würde.
Aber damals war Sean leider nicht gesprungen, sondern sitzen geblieben. Irgendwann hatte sich die Stimmung gebessert, als sie über Sean gesprochen hatten, seine abgesagte Ausstellung, seinen unfähigen Alkoholiker-Galeristen und dann über dieses Projekt, das er mit dieser Portugiesin machen wollte, you know, it’s real. Deep. A deep connection.
A deep connection für den Arsch, dachte Betty jetzt wütend. Warum verhielt sie sich bei Sean immer so bescheuert? Da war sie immer das kleine, neunjährige Mädchen, das rot wurde und verschämt auf den Boden starrte. Betty hasste sich dafür.
Auch dafür, dass sie ihre Probleme wieder mal ausgespart hatten. Betty ging nämlich nach drei Monaten im neuen Job schon auf dem Zahnfleisch. Diese fürchterlichen Zwölfstundentage in der Nephrologie machten sie einfach fertig. Sean fand ohnehin, dass sie es ruhiger angehen müsste, keiner verlangte, dass sie perfekt sei, das wäre eh eine überholte Vorstellung. Und überhaupt: Status- und Konkurrenzdenken, das seien Konzepte, die er ablehnte. Aber Sean konnte einfach nicht nachvollziehen, wie groß Bettys Angst war, einen Fehler zu machen. Sie war schließlich keine Gärtnerin oder ein kanadischer Exilkünstler wie er. Ein Fehler von ihr könnte Menschenleben kosten! Und deswegen recherchierte Betty alles doppelt und dreifach nach, sprach sich oft mit dem Oberarzt ab und war die Erste morgens in dem zugigen, trostlosen Arztzimmer mit dem widerlichen Kapselkaffee, und abends die Letzte. Betty brauchte einfach diese Extrazeit, um ihre Arztbriefe zu schreiben, weil sie sich ja den ganzen Tag mit Patienten beschäftigen musste.
Sean war wenig amüsiert gewesen, als er feststellte, wie Bettys erste Assistenzärztinnenstelle auch sein Leben beeinflusste. Sean führte ein Leben ohne feste Struktur, er war manchmal nachts wach und schlief von mittags bis abends, gerade so wie es passte. Sean war es gewohnt, dass Betty verfügbar war. Er hatte oft schlechte Laune gehabt.
Und genau deswegen waren sie an dem Abend auch essen gegangen. Um was gemeinsam zu unternehmen. Endlich wieder. Und natürlich hatten sie später in der Nacht Sex gehabt. Es war, wie immer, markerschütternd gut gewesen, lang ausdauernd und toll. Vor allem für Sean.
Eigentlich ging es immer nur um Sean, wie Betty jetzt bitter feststellte. In allem.
Aber das Fiese war, Betty vermisste ihn trotzdem, als sie jetzt aus dem Zugfenster starrte und die Landschaft an sich vorbeiziehen sah. Trotz aller Probleme, die sie miteinander hatten. Trotz des Ungleichgewichts zwischen ihnen, was Betty immer bewusster wurde.
Aber vielleicht war die Pause, die sie und Sean gerade machten, der richtige Schritt? Etwas Ruhe reinbringen, ein bisschen Abstand. Cooldown, wie Sean sagte. Seit einer Woche gab es den Cooldown. Eine Woche, in der Betty nicht viel geschlafen hatte. Sondern sich den Kopf wundgewälzt hatte, also innerlich. Eine Woche, in der sie sich zermürbt hatte mit den Gedanken, wie es mit ihr und Sean weitergehen würde, welche Ziele sie hatten, wie viel Gemeinsamkeit, kurz: Was es war, das mit ihnen.
Betty hatte noch nie gehört, dass Paare, die eine Beziehungspause machten, wieder zusammenkamen. Selbst wenn man der Pause einen fancy Titel wie Cooldown gab.
»Mama, die Frau weint.«
Betty zuckte erschrocken zusammen, wischte sich schnell übers Gesicht und schüttelte empört den Kopf. Die Mutter gegenüber fixierte sie ausdruckslos. Der Sechsjährige starrte Betty an und bekräftigte noch mal. »Die heult.«
»Die sitzt dir gegenüber und hört, was du sagst. Und außerdem stimmt das nicht«, zischte Betty etwas patzig zurück.
»Stimmt wohl.«
»Ja und wenn? Ich weine. Und weißt du, warum?« Betty funkelte den Idioten wütend an. »Weil du das nicht hinkriegst: elf minus acht! Das ist DREI! DREI! Das kann doch nicht so schwer sein, echt.«
»Ich muss ja wohl sehr bitten …«, sagte die Mutter.
»Nee, ICH muss mal sehr bitten. Und zwar, dass Sie Ihrem Kind endlich mal das Handy geben! Seit zwei Stunden terrorisiert der uns alle hier.«
In Bielefeld stieg Betty aus dem Zug und wuchtete den schweren Rucksack mühsam auf ihren Rücken. Es war noch eine sehr lange Fahrt von Garbsen nach Bielefeld gewesen, fünfzig Minuten, die sich hinzogen wie Monate, weil am Ende der gesamte Waggon sich gegen Betty verschworen hatte. Irgendwie hatte sich die Diskussion hochgeschaukelt. Und dass Betty »Waldorfschulschlampe« zu der Mutter gesagt hatte, war wirklich nicht nötig gewesen. Sie hatte gar nichts gegen Waldorfschüler. Überhaupt nichts. Sie konnten so lange ihren Namen tanzen, wie sie wollten, Hauptsache, Betty musste nicht mitmachen. Sie war einfach müde. Erschöpft. Völlig durch den Wind. Und deswegen leicht reizbar. Und noch mal, sie hatte wirklich nichts gegen Waldorfschüler.
Betty sah sich auf dem Bahnsteig in Bielefeld um, ihre Mutter war nirgends zu sehen. Sie seufzte und schaute auf ihr Handy. Vielleicht hatte ihre Mutter eine Nachricht geschrieben? Doch eigentlich wollte Betty nur schauen, ob Sean sich gemeldet hatte. Aber er hatte nicht angerufen, hatte keine Nachricht geschickt. Funkstille hin und her, aber als Betty vorgestern diese Leiche in der Pathologie gesehen hatte und für einen schlimmen, schrecklichen, verzweifelten Moment dachte, es wäre Sean, so ähnlich war der Tote ihm in Statur, Gesichtsform und Haarfarbe gewesen, da hatte Betty ihn einfach anrufen müssen. Der Schock war zu groß gewesen.
Doch Sean rief nicht mal zurück! Klar, sie hatten »Pause«. Aber Betty vermutete, dass er die Zeit nicht dafür nutzte, sich mit seinen Wünschen, Vorstellungen und der Frage, was Betty ihm bedeutete, zu beschäftigen, sondern mit dieser Portugiesin. Fuck!
Betty schleppte ihren Rucksack die kleine Bahnhofstreppe hoch, denn wie immer streikte die Rolltreppe. Die kleine Bahnhofshalle hatte Betty nach ein paar Sekunden durchquert, unfassbar, wie stark dieses Gefühl von Heimat sie plötzlich erfasste, wie altbekannt hier alles war, wie schön und einengend gleichermaßen. Betty war hin- und hergerissen, als sie endlich auf den halbrunden Vorplatz trat, sich umsah und tief einatmete. Bielefeld. Könnte schlechter sein.
Könnte aber auch sehr, sehr viel besser sein.
Es hupte. Betty drehte den Kopf und sah, wie der lange schwarze Bestatterwagen ihrer Eltern die Einfahrt zu den Parkspuren blockierte und sich dahinter eine wütende Schlange gebildet hatte. Betty erkannte ihre Mutter hinter dem Steuer, die trotz des Hupkonzerts keine Anstalten machte, weiterzufahren, sondern ihr freudig zuwinkte.
Betty schenkte den wütenden Autofahrern ein beruhigendes Lächeln und öffnete schnell die hintere Klappe der verlängerten Mercedes-Limousine. Sie warf ihren Rucksack auf die Ladefläche, wo normalerweise die Särge standen. Dann ließ sie sich auf den Beifahrersitz fallen. Ihre Mutter Ella gab ihr einen liebevollen Kuss auf die Wange.
»Kindchen.«
»Du hast eine neue Frisur«, stellte Betty erstaunt fest. Ella trug die Haare noch ein wenig kürzer als sonst. Und wenn sie sich nicht täuschte, war da eine leicht lila Färbung im Pony, oder war das das einfallende Licht?
»Schick, oder? Jetzt sag nichts Falsches.«
Bevor Betty sich eine Lüge überlegen konnte, hämmerte es laut an die Scheibe auf der Fahrerseite. Ella wandte sich dem Taxifahrer zu, der sich wütend und entnervt neben der Fahrertür aufgebaut hatte, und warf ihm einen kühlen Blick zu.
»Verschwinden Sie endlich, Sie versperren …«
»Nur mit der Ruhe, da landen Sie schnell genug«, sagte Ella und deutete nach hinten.
Dann gab Ella Gas. Die schwarze Mercedes-Limousine bretterte über das Kopfsteinpflaster. Sie ernteten überraschte Blicke der Passanten. Ein Bestatterwagen mit der Geschwindigkeit? Während sie einem weiteren Taxi die Vorfahrt nahm, drehte Ella den Kopf zu ihrer Tochter.
»Und, wie ist es?«
»Super«, log Betty. »Besser wär’s noch, wenn du auf die Straße sehen würdest.«
»Wie lange kannst du denn bleiben?«
»Ein paar Tage.« Betty hatte sich krankschreiben lassen. Urlaub hätte sie in ihrer Anfangszeit noch nicht bekommen. Aber sie musste einfach raus!
Ella wandte den prüfenden Blick nicht von ihr ab.
»Dünn biste geworden.«
Betty seufzte. Anscheinend war sie mit ihrer Lüge nicht durchgekommen. Ihre Mutter war eine Detektivin. Ein Spürhund. Ein Trüffelschwein. Sie hatte einen Röntgenblick. Es war entsetzlich.
»Ich habe Wurstebrei geholt«, erklärte Ella und schaute endlich wieder nach vorne. Rechtzeitig vor der großen Kreuzung, wo die Ampel jetzt auf Rot sprang. Ella fuhr trotzdem drüber. »Upps«, sagte sie.
Wurstebrei war eine westfälische Spezialität, die genauso appetitlich aussah, wie der Name klang. Aber auch wenn man den offizielleren Namen Stippgrütze verwendete, es blieb immer noch eine graue unansehnliche Masse aus Gerstengrütze und Fleisch, zum Großteil Innereien, die auf dem Teller mit Kartoffeln und eingelegten Gurken wirklich nicht appetitlich aussah. Man musste schon damit aufgewachsen sein, um das zu mögen. Und Betty hatte es früher geliebt. Aber das war früher gewesen. Sie war lange davon weg. Sie hatte sich verändert. Ihr Vater Jochen würde es anders formulieren: Berlin versaut den Charakter. Er war nie damit einverstanden gewesen, dass sie zum Studieren weggegangen war.
»Hm, das ist nett, aber ich wollte eigentlich nicht mehr so viel Fleisch essen .«
»Jetzt hör schon auf, Bettina. Es gibt Wurstebrei. Und Opa freut sich auch schon.«
»Wie geht’s ihm?«
»Ach, lass uns doch erst mal ankommen.«
2
Betty betrat hinter ihrer Mutter das Bestattungsinstitut. Als sie ihre Füße auf den dicken hellen Teppich setzte, war sofort der Geruch ihrer Kindheit wieder da: der nach warmem, weichem Holz, luftig leicht und dennoch erdig. Der Holzgeruch kam von den Kiefern und Eichen, von den schweren, großen Särgen, die hier links und rechts aufgereiht waren. Die meisten waren glatt poliert, das Holz versiegelt unter einem Klarlack, aber doch setzte sich der Holzduft deutlich durch. Genau wie der Geruch der Leichen später, aber dann hatten die Toten und die Särge längst das Institut verlassen.
Als Betty ihrer Mutter durch das Ladengeschäft folgte, stellte sie wieder mal fest, wie hell und wohlig die ganze Atmosphäre hier war. Die Kunden sollten sich beruhigen, wenn sie hereinkamen, trotz des Schicksalsschlags, den sie gerade erlitten hatten. Sie wurden durch die dezente Klarheit des aufgeräumten, wirklich warm wirkenden Geschäfts sofort an die Hand genommen, ihnen wurde sozusagen die Schulter getätschelt, ein freundliches Lächeln geschenkt, und schon bald versiegten die Tränen, ging ihr Puls herunter. Das funktionierte auch bei Betty. Immer noch. Und gerade jetzt konnte sie Ruhe gut gebrauchen. Sie wollte sich nicht mehr anstrengen. Ihr Kopf war wund gedacht.
Ella war völlig immun gegen die beruhigende Wirkung des Instituts. Sie schimpfte über den Nachbarn, Herrn Stute, der seinen Wagen wieder mal völlig falsch vor dem Haus geparkt hatte. Herr Stute war ein miesepetriger ehemaliger Miele-Ingenieur.
»Der säuft wie ein Loch. Es klirrt jedes Mal hinten im Kofferraum, wenn der seinen Audi aus der Garagenausfahrt setzt. Altglas, weißt du? Kein Wunder, dass der nicht mehr einparken kann. Und manchmal kommt der gar nicht mehr rein in die Garage. Da kriegt der den Bogen nicht.«
»Deine Kurventechnik ist auch nicht so viel besser, Mama.«
»Aber ich bin wenigstens keine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer.«
»Bist du dir da sicher?«
Ella warf ihr einen Blick zu. »Und wann machst du noch mal den Führerschein?«
Betty zuckte die Schultern. Es gab nichts auf der Welt, was sie so wenig interessierte wie der Führerschein. Makramee vielleicht. Oder irgendwelche Tonfunde in irgendwelchen Wüsten von irgendwelchen toten Azteken.
»In Berlin braucht man keinen Führerschein. Glaub mir, die Stadt ist die Hölle für Autofahrer. Es gibt keine Parkplätze und nur Stau, und dafür kommst du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln …«
»Aber das hier ist Bielefeld-Jöllenbeck, und das einzige öffentliche Verkehrsmittel kommt einmal die Stunde, falls du dich erinnerst.«
»Stimmt. Aber ich hatte gedacht, der gesellschaftliche Wandel macht auch vor Jöllenbeck nicht halt. Wollten die das nicht längst umstrukturieren, Klimawende, nachhaltig und so …«
Ein schräger Blick ihrer Mutter. »Das einzig Nachhaltige hier ist das.« Sie deutete auf das Holz der Särge.
Hier, zwischen den Särgen, umgeben von dem Holzduft, hier hatte Betty sich immer am wohlsten gefühlt. Hier war zu Hause, hier war ihre Heimat, hier hatte sie eine glückliche Kindheit verlebt. Hier hatte sie gespielt, zwischen, unter und in den Särgen. Hatte ihre Puppen und Stofftiere auf die edle Seide in den Särgen gesetzt und war mit ihnen nach Übersee gerudert. Hier waren Särge Indianerzelte, Rennautos, Geheimverstecke und Schatzkisten gewesen. Ihre Eltern hatten das immer geduldet. Nur wenn Betty ihre Puppen danach nicht weggeräumt hatte und Jochen irgendwelchen Angehörigen einen Sarg vorführen wollte, war es problematisch geworden. Wenn ihr Vater Jochen vor den rot geweinten Augen der Angehörigen erst mal eine Stoffpuppe aus dem Sarg fischte, konnte das durchaus ein Schmunzeln hervorrufen. Ein dringend benötigtes Schmunzeln mitunter, was die Situation auflockerte und zeigte, wie nah Sterben und Tod beieinanderlagen.
Aber was, wenn der Tote ein Kind gewesen war? Wenn Jochen den erschütterten Eltern, die gar nicht wussten, wohin mit sich und ihrer Trauer und ihrem Schmerz, für den es gar keine Worte gab, wenn er ihnen einen Sarg präsentierte, in dem unter dem geöffneten Deckel plötzlich eine Puppe zum Vorschein kam?
Betty hatte sich früh daran gewöhnen müssen, ohne Taschengeld auszukommen.
»Wo ist Papa?«
»Unten im Keller, denke ich. Geh runter. Er freut sich. Ich setz schon mal die Kartoffeln auf.«
Betty ließ ihren Rucksack im Treppenhaus fallen. Sie würde ihn später hochtragen, in ihr altes Kinderzimmer. Würde später ihrem Bruder Maxi Hallo sagen. Und Opa Richard. Aber jetzt stieg Betty die Treppe hinunter zum Keller, in dem sich die Kühlfächer befanden und daneben der gekachelte Raum, in dem die Leichen gewaschen wurden.
Als Betty den Kopf durch die Tür streckte, sah sie ihren Vater über einer Leiche stehen. Jochen war gerade dabei, die Tote wieder herzurichten. Betty schenkte der Leiche keinen Blick, sie war es von Kindheit an gewöhnt gewesen, dass hier tote Menschen lagen. Sie hatte genug weiße und blasse und zusammenfallende Menschen gesehen, hatte genug Haut gesehen, die ehemals braun und jetzt nur noch grau wirkte, hatte sich nie darüber gewundert, wie klein Menschen plötzlich wirkten, wenn sie tot waren. Es war einfach normal gewesen für Betty. Die Toten waren einfach da. Unten im Keller. Einige Klassenkameradinnen hatten eine Schweinemast im Hof, andere eine Backstube im Erdgeschoss. Bei Betty waren es eben Leichen. Es hatte sie nie gestört.
Bis zur Pubertät natürlich. Da war es die Hölle gewesen. Da war einem alles peinlich gewesen. Ein verunglücktes Lächeln. Eine unmodische Klamotte. Ein dummer Witz, den die anderen nicht verstanden hatten. Welches Mädchen hatte nicht dieses unwohle, unsichere Gefühl gehabt, dass die eigenen Brüste zu klein waren, dass sie niemals wachsen würden, und dass gleichzeitig jeder Blick der Jungs, der Mitschüler nur auf diesen einen Körperteil fixiert war, sodass man am liebsten eine Ganzkörperverhüllung getragen hätte. Eine Burka oder so was.
Und dann hatte man auch noch Leichen im Keller?
Betty hatte sich damals so gewünscht, dass ihre Eltern etwas Normales machten. Warum nicht Bäcker? Warum nicht Steuerberater? Warum nicht Miele-Ingenieur? Notfalls? Alles war besser als Bestatter. Dieses entsetzliche Gefühl der Peinlichkeit hatte Betty ein paar Jahre lang begleitet, aber mittlerweile hatte sie es überwunden.
Betty freute sich, ihren Vater zu sehen, als sie jetzt zu ihm trat.
Jochen hatte sie bemerkt, sah von der Toten auf, und als er Betty erkannte, strahlte er. Ein breites, warmes Lächeln erschien auf dem runden Bestattergesicht mit den warmen braunen Augen. Er hatte einen Schweißfilm auf der Stirn, wie immer, und hob jetzt die Hände in den Plastikhandschuhen und spreizte sie zur Seite, damit er Betty nicht damit berührte, während er ihr einen Kuss auf die Stirn gab.
»Bettina, wie schön.«
Betty mochte es eigentlich nicht, dass ihre Eltern Bettina zu ihr sagten. Sie hatte die Bettina in sich abgelegt. War groß, war erwachsen, war eine Großstädterin geworden. Aber im Moment war ein »Bettina« eigentlich ganz schön, es war so unspektakulär, so geerdet. Normal. Genau das, was Betty gerade brauchte.
»Schön, dass du da bist.«
»Find ich auch.«
»Wie kommen wir denn eigentlich zu der Ehre? Es ist doch ganz außer der Reihe?«, fragte Jochen, während er sich der Leiche wieder zuwandte.
»Ach, ich musste mal raus. Ausschlafen, weißt du. Der Job in der Klinik … puh. Es ist echt hart.«
Jochen lächelte. »Du hättest Bestatterin werden können.«
»Ach, Papa.« Ein ewiges Thema zwischen den beiden. Jochen sagte es nur noch aus Scherz, aber er konnte einfach nicht begreifen, dass Betty nicht in seine Fußstapfen treten wollte. Dabei musste er doch eigentlich wissen, wie schwierig und enervierend das sein konnte. Schließlich war da ja auch noch Opa Richard, von dem Jochen das Institut übernommen hatte.
»Wer ist das?«, fragte Betty, um abzulenken, und nickte zu der Toten hinüber, von der sie nur schräg den Kopfansatz hinter Jochen sehen konnte.
»Inka Binder-Manke. Du kennst sie, erinnerst du dich?«
Betty warf einen erstaunten Blick zu der vierzigjährigen Frau hinüber, die da auf der Liege lag. Betty trat heran. Natürlich kannte sie Inka, obwohl sie mit ihrem grotesk geschwollenen Gesicht und der blauen Hautverfärbung auf den ersten Blick kaum zu erkennen war.
»Sie hat mir Flötenunterricht gegeben, als ich acht oder so war.«
»Richtig.«
»Nee, falsch. Das war ein Fehler. Flöte ist ein Scheißinstrument.«
»Wie gut, dass du dann Klavier gelernt hast.«
»Wie fies, dass ihr mich dazu gezwungen habt.«
»Klavierspielen schult das mathematische Denken.«
»Nachhilfe auch.«
Blicke zwischen Jochen und Betty. Wie oft hatten sie diese Diskussion schon geführt? Es lief immer auf eins hinaus:
»Nicht jeder hat ein musikalisches Talent, Papa. Schon gar kein so großes wie du.« Und das stimmte. Jochen hatte eine beachtliche Stimme und hätte eine große, womöglich eine Weltkarriere machen können, wenn nicht, tja, wenn er sich nicht dem väterlichen Diktat gebeugt hätte und Bestatter geworden wäre.
»Das stimmt. Leider.« Jochen lächelte milde geschmeichelt in sich hinein.
»Wie schlägt sich Maxi?« Auch Bettys jüngerer Bruder war zum Klavierunterricht gezwungen worden. Und auch er musste sein Taschengeld dadurch verdienen, dass er bei den Trauergottesdiensten und manchmal auch in der Trauerhalle die Orgel spielte.
»Besser als du.«
»Das kann ja jeder. Schlechter sein als ich, das wäre schwer.«
Jochen grinste wieder und stupste Betty ein bisschen mit seiner Schulter an. Fast ein Gefühlsausbruch für den sonst so trockenen Westfalen.
Betty sah auf die Tote herunter. Inka Binder-Manke hatte früher noch keinen Doppelnamen getragen, sie war, als sie Betty Flötenunterricht gegeben hatte, eine Anfang zwanzigjährige, leicht versponnene und, wie sich Betty jetzt erinnerte, stark gläubige Frau gewesen. Inka hatte etwas ätherisch gewirkt mit ihren langen blonden, leicht gelockten Haaren, eine schmale Frau, die schüchtern und in sich gekehrt gewesen war. Und die es definitiv nicht verstanden hatte, eine renitente Achtjährige, die eigentlich Rodeoreiterin oder Sternenkriegerin werden wollte, für das Flötenspiel zu begeistern. Sofern man das überhaupt konnte.
Die tote Inka auf der Liege wirkte nicht mehr ätherisch, ihr Körper war zwar immer noch schmal und schlank, aber ihr Gesicht war prall und aufgedunsen wie das eines osteuropäischen Arbeiters nach einer Zwölfstundenschicht in einem Fleischzerlegebetrieb, nach der dritten Flasche Wodka. Inkas Augen waren völlig zugeschwollen, ihre gesamte linke Gesichtshälfte aufgebläht. Und völlig deformiert.
»Was ist denn mit der passiert?«, wunderte sich Betty. Obwohl sie schon begann, die klinischen Zeichen für sich zusammenzusetzen.
»Ein anaphylaktischer Schock, sagt Dr. Wittmann.«