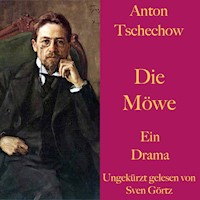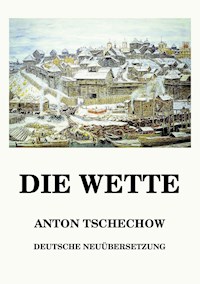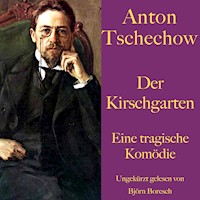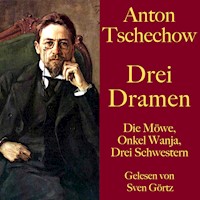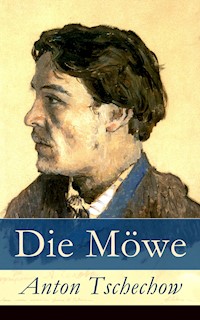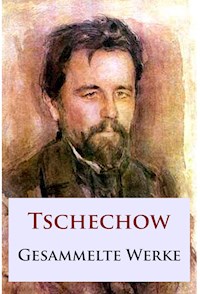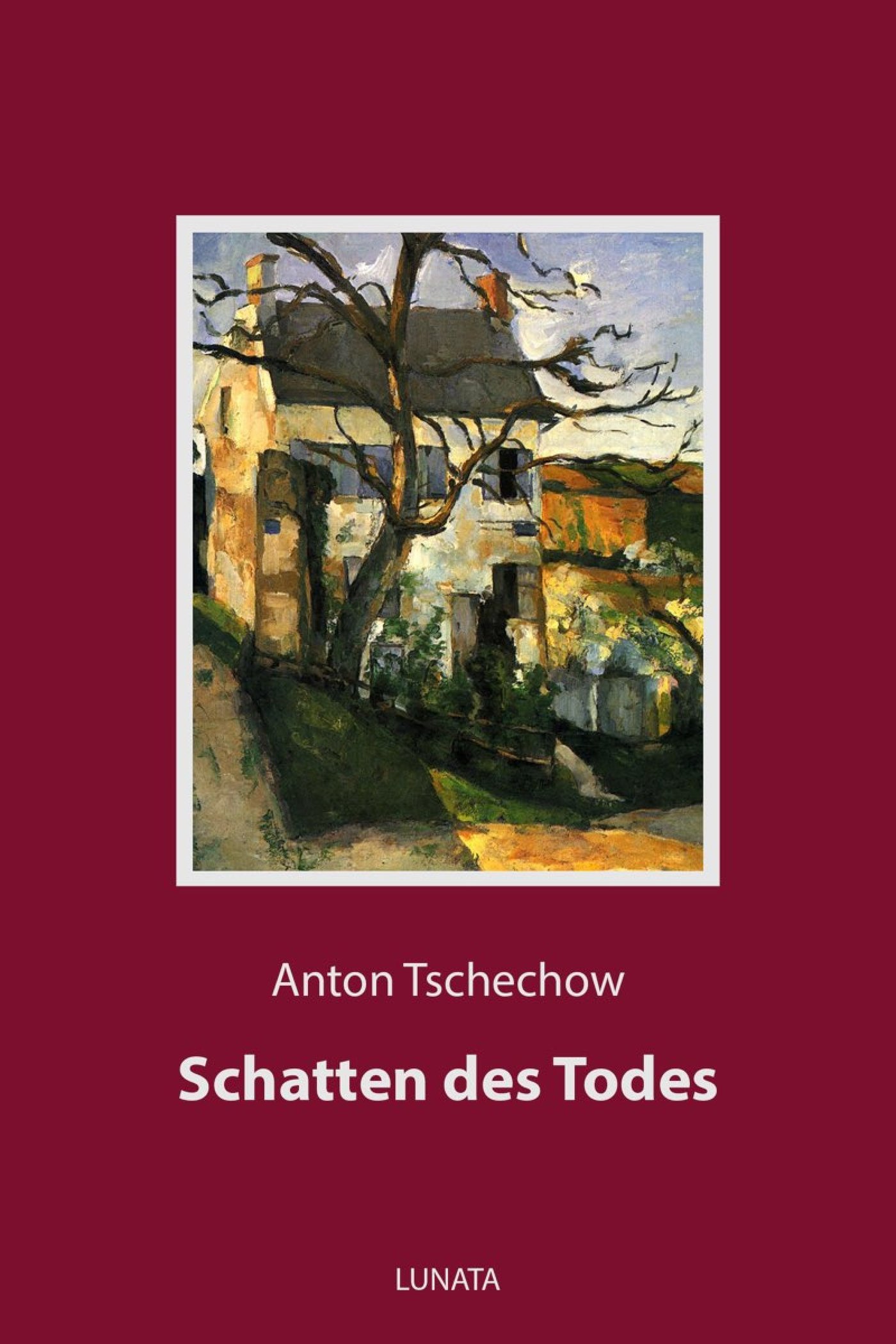
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anton Tschechow, bekannt vor allem durch seine Bühnenstücke und Kurzgeschichten, zählt zu den bedeutendsten russischen Schriftstellern des 19. Jahrhunderts. ›Schatten des Todes‹ stellt einen der wenigen Versuche dar, sich der längeren Erzählform zu widmen. Er beschreibt den grauen Alltag des tristen Provinzdaseins, Schicksale, die kaum weniger berühren als die großer Gestalten der Literaturgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LUNATA
Schatten des Todes
Anton Tschechow
Schatten des Todes
© 1919 Anton Tschechow
Aus dem Russischen von Korfiz Holm
Umschlagbild: Paul Cézanne La Maison Rondest
© Lunata Berlin 2020
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Über den Autor
1
Es lebt da irgendwo in Russland ein verdienter Gelehrter, ein gewisser Professor, Geheimer Rat und Ritter Nikolai Stepanowitsch Soundso; er hat so viele russische und ausländische Orden, daß die Studenten, wenn er sie einmal anlegen muß, einen frommen Schauer fühlen, wie vor der reliquienbehängten Wand des Allerheiligsten. Sein Verkehr ist der vornehmste; wenigstens hat es in den letzten fünfundzwanzig, dreißig Jahren keinen berühmten Gelehrten gegeben, mit dem er nicht intim bekannt gewesen wäre. Heutzutage gibt's keine Freunde mehr für ihn, aber wenn man rückwärts schaut, endet die lange Liste seiner bedeutenden Intimen mit Namen, wie Pirogow, Kawjelin und Nekrassow, dem Dichter. Sie alle haben ihn ihrer aufrichtigen und warmen Freundschaft gewürdigt. Er ist korrespondierendes Mitglied sämtlicher russischer und dreier ausländischer Universitäten. Und so weiter, und so weiter. Dies alles, und vieles andere, was man noch anführen könnte, macht meinen sogenannten »Namen« aus.
Dieser Name ist populär. In Russland kennt ihn jeder einigermaßen gebildete Mensch, und auf den ausländischen Lehrstühlen wird er mit den Epitheta: »der berühmte und verehrte« genannt. Er gehört zu der kleinen Zahl von glücklichen Namen, über die man nicht schimpfen oder hämisch reden kann, ohne beim Publikum und der Presse in den Ruf eines Menschen von schlechtem Geschmack zu kommen. Und so muß es auch wohl sein. Denn eng mit meinem Namen verknüpft ist das Bild eines berühmten Mannes, der hochbegabt und der Allgemeinheit unzweifelhaft nützlich ist. Ich bin arbeitsam und ausdauernd wie ein Kamel, und das ist eine große Sache; und ich habe Talent, das ist eine noch größere Sache. Und außerdem bin ich ein wohlerzogener, bescheidener und anständiger Mensch. Ich habe meine Nase nie in die Literatur oder die Politik gesteckt, ich habe mir nie durch Polemiken mit Ignoranten Popularität zu erwerben versucht, ich habe nie Reden gehalten, weder bei Festessen, noch bei den Beerdigungen meiner Kollegen... Überhaupt trägt mein wissenschaftlicher Name keinen Flecken, und niemand kann ihm etwas nachsagen. Er ist glücklich.
Der Träger dieses Namens nun, das heißt, ich, ich bin ein Mann von zweiundsechzig Jahren mit einer Glatze, falschen Zähnen und einem unheilbaren Tick. So glänzend und schön mein Name ist, so finster und häßlich bin ich selbst. Mein Kopf und meine Hände zittern vor Schwäche; mein Hals hat Ähnlichkeit mit dem einer Bassgeige, was Turgenjew auch von einer seiner Heldinnen behauptet; meine Brust ist eingefallen, mein Rücken schmal. Wenn ich spreche oder vortrage, zieht sich mein Mund schief; wenn ich lächle, bedeckt sich mein ganzes Gesicht mit greisenhaften Runzeln. Nichts Besonderes ist an meiner traurigen Gestalt; höchstens, wenn ich mal wieder an meinem Tick leide, zeigt sich in meinem Äußeren ein ganz merkwürdiger Zug, bei dem wohl jeder, der mich zu Gesicht bekommt, unwillkürlich den grausamen Gedanken fassen muß: »Na, der da macht's auch nicht mehr lange!«
Die Art meines Vortrags ist nach wie vor nicht übel; wie früher vermag ich die Aufmerksamkeit meiner Hörer noch durch zwei Stunden zu fesseln. Mein Feuer, der gute Stil, in dem ich meine Auseinandersetzungen gebe, und mein Humor verdecken die Mängel meines Organs fast vollständig. Meine Stimme nämlich ist trocken, scharf und singend, wie das Zirpen einer Heuschrecke. Aber mit dem Schreiben geht es schlecht. Der Teil des Gehirns, der die schriftstellerische Tätigkeit regiert, hat mir den Dienst gekündigt. Mein Gedächtnis hat nachgelassen, meinen Gedanken fehlt es an der nötigen Folgerichtigkeit, und wenn ich sie auf dem Papier darlegen will, kommt es mir regelmäßig so vor, als hätte ich das Gefühl für ihren organischen Zusammenhang verloren. Mein Satzbau ist eintönig, die Ausdrucksweise dürftig und ängstlich. Häufig schreibe ich nicht, was ich schreiben will; und wenn ich zum Schluß komme, weiß ich den Anfang nicht mehr. Oft vergesse ich die gewöhnlichsten Worte, und stets muß ich eine Menge Energie verschwenden, damit ich keine überflüssigen Phrasen und unnützen Einleitungen in meine Briefe hineinbringe. Das alles ist ein klarer Beweis für den Niedergang meiner Verstandestätigkeit. Und, das ist interessant: je einfacher der Brief, desto qualvoller die Anstrengung. Bei einem wissenschaftlichen Aufsatz fühle ich mich viel freier und klüger als bei einem Gratulationsschreiben oder einer kurzen Benachrichtigung. Und dann noch eins: es fällt mir viel leichter, deutsch oder englisch zu schreiben, als russisch.
Was meine jetzige Lebensweise betrifft, so muß ich vor allen Dingen die Schlaflosigkeit erwähnen, unter der ich in letzter Zeit leide. Wenn mich einer fragen würde: was ist heute das hauptsächlichste und wichtigste Merkmal deiner Existenz? Ich müßte antworten: die Schlaflosigkeit. Wie in früheren Zeiten ziehe ich mich gewohnheitsgemäß Punkt zwölf Uhr aus und lege mich ins Bett. Ich schlafe bald ein, aber um zwei bin ich wieder wach, und zwar mit einem Gefühl, als hätte ich überhaupt nicht geschlafen. Ich muß aufstehen und die Lampe anzünden. Eine Stunde lang, oder zwei, wandere ich aus einer Zimmerecke in die andere und betrachte mir die Bilder und Photographien, die ich längst auswendig kenne. Habe ich genug vom Gehen, dann setze ich mich an meinen Tisch. Ich sitze, ohne mich zu rühren, denke an nichts und fühle keinen Wunsch; wenn gerade ein Buch vor mir liegt, ziehe ich es mechanisch zu mir heran und lese ohne jedes Interesse. So habe ich vor kurzem in einer Nacht mechanisch einen ganzen Roman mit dem sonderbaren Titel »Was die Schwalbe sang« durchgelesen. Oder ich zwinge mich, um meine Aufmerksamkeit wach zu halten, und zähle bis tausend, oder stelle mir das Gesicht irgendeines Kollegen vor und fange an, mich zu besinnen, in welchem Jahr und unter welchen Umständen er berufen worden ist. Dann liebe ich es auch, auf Geräusche zu horchen. Bald sagt, zwei Zimmer von meinem entfernt, meine Tochter Lisa etwas im Schlaf, dann geht meine Frau mit einem Licht durch das Wohnzimmer und läßt ganz sicher die Streichholzschachtel fallen, dann kracht es im Schrank von der Ofenwärme, oder die Flamme der Lampe fängt auf einmal zu singen an – und all diese Laute regen mich auf, ich weiß nicht warum.
Nachts nicht schlafen, heißt: sich jede Minute eingestehen, daß man nicht normal ist, und darum warte ich mit Ungeduld auf den Morgen und den Tag, wo ich ein Recht habe, nicht zu schlafen. Eine lange, qualvolle Zeit geht hin, bevor der Hahn unten auf dem Hofe kräht. Das ist mein erster froher Bote. Sobald er kräht, weiß ich doch, daß in einer Stunde da unten der Portier erwacht und unter wütendem Gehuste, wozu, weiß ich nicht, die Treppe heraufsteigt. Und dann wird die Luft hinter den Fensterscheiben langsam bleicher und bleicher, auf der Straße werden Stimmen laut...
Mein Tag fängt damit an, daß meine Frau hereinkommt. Sie ist in der Nachtjacke, noch nicht frisiert, aber schon gewaschen, und riecht nach Blumen-Eau-de-Cologne. Sie macht ein Gesicht, als käme sie ganz zufällig, und sagt jeden Tag dasselbe:
»Pardon, ich wollte nur einen Augenblick... Hast du wieder nicht geschlafen?«
Dann bläst sie die Lampe aus, setzt sich an den Tisch und fängt zu sprechen an. Ich bin kein Prophet, aber ich weiß im voraus, wovon die Rede sein wird. Gewöhnlich fällt ihr nach einigen sehr besorgten Anfragen wegen meines Gesundheitszustandes auf einmal unser Sohn ein, der in Warschau Offizier ist. Kurz nach dem zwanzigsten schicken wir ihm jeden Monat fünfzig Rubel – und das ist im wesentlichen auch das Thema unserer Unterhaltung.
»Natürlich, leicht fällt's uns nicht,« seufzt meine Frau, »aber bevor er sich endgültig auf seine eigenen Füße gestellt hat, ist es wohl doch unsere Pflicht, ihm zu helfen. Der Junge ist in der Fremde, seine Gage ist klein... Übrigens, wenn du meinst, können wir ihm nächsten Monat statt fünfzig bloß vierzig schicken. Wie denkst du darüber?«
Die tägliche Erfahrung hätte meine Frau zu der Überzeugung bringen können, daß unsere Ausgaben nicht kleiner werden, wenn wir recht oft von ihnen sprechen, aber meine Frau gibt nichts auf die Erfahrung und erzählt jeden geschlagenen Morgen von unserem Offizier, und daß das Brot, Gott sei Dank, billiger geworden wäre, aber der Zucker dafür um zwei Kopeken aufgeschlagen wäre – und das alles in einem Ton, als wenn sie mir eine große Neuigkeit mitteilte.
Ich höre zu, sage: ja, ja, und mich überkommen, wahrscheinlich, weil ich die Nacht nicht geschlafen habe, sonderbare, überflüssige Gedanken. Ich sehe meine Frau an und wundere mich wie ein kleines Kind. Zweifelnd frage ich mich: ist diese alte, sehr dicke, plumpe Frau mit dem stumpfen Ausdruck der kleinlichsten Sorge und Angst um das Stückchen Brot, mit dem Blick, der von den ewigen Gedanken an Schulden und Not umflort ist, ist diese Frau, die nur von den vielen Ausgaben sprechen und nur bei Preisrückgängen lächeln kann – war das wirklich einmal meine schlanke Warja, die ich so leidenschaftlich liebte, weil ihr Verstand so gut und klar, ihre Seele so rein war, weil sie so schön war und soviel Verständnis für meine Wissenschaft hatte, wie Desdemona für Othellos Ruhm? Ist diese Frau da wirklich meine Warja, die mir vor Jahren meinen Sohn gebar?
Ich bohre meine Blicke angestrengt in das Gesicht der aufgedunsenen schwerfälligen alten Frau, ich suche meine Warja in ihr, aber von ehemals ist nur die Besorgtheit um mein Befinden geblieben, ja, und noch die Manier, meine Gage »unsere« Gage zu nennen, meine Mütze – »unsere« Mütze. Mir tut es weh, wenn ich sie ansehe, und um sie wenigstens ein wenig zu trösten, lasse ich sie reden, was sie mag. Ich schweige sogar, wenn sie ungerechte Urteile über Menschen fällt oder mir den Kopf wäscht, weil ich keine Praxis ausübe und keine Lehrbücher schreibe.
Das Ende unserer Unterredung ist auch immer das gleiche. Meiner Frau fällt es auf einmal ein, daß ich noch keinen Tee getrunken habe, und sie erschrickt sehr.
»Aber ich sitze hier!« sagte sie und steht auf, »und der Samowar steht längst auf dem Tisch! Und ich schwatze hier! Was das nur mit meinem Gedächtnis ist, lieber Gott!« Sie geht eilend und bleibt an der Tür stehen, um zu sagen: »Jegor hat seit fünf Monaten keinen Lohn bekommen. Weißt du das? Man sollte der Dienerschaft den Lohn immer regelmäßig zahlen, wie oft hab' ich das schon gesagt! Jeden Monat zehn Rubel herzugeben ist viel leichter, als dann auf einmal fünfzig Rubel für fünf Monate!«
Und wenn sie die Tür geöffnet hat, macht sie noch einmal halt und sagt:
»Um keinen tut's mir mehr leid, als um unsere arme Lisa. Das Mädel studiert auf dem Konservatorium, sie bewegt sich immer in der besten Gesellschaft, aber angezogen ist sie, weiß der liebe Gott, wie. Ein Wintermantel, daß man sich schämen muß, damit auf die Straße zu gehen. Wäre sie noch irgendeine beliebige, dann wär' es kein Unglück, aber jeder Mensch weiß doch, daß sie die Tochter des berühmten Professors und Geheimrats ist!«
Und wenn sie mir so meinen Namen und meinen Titel vorgeworfen hat, geht sie endlich. So fängt mein Tag an. Und was weiter kommt, ist auch nicht viel schöner.
Wenn ich Tee trinke, erscheint meine Tochter Lisa, in Mantel und Hut und mit der Notenmappe, schon ganz auf dem Sprung, ins Konservatorium zu gehen. Sie ist zweiundzwanzig, sieht aber jünger aus, ist recht hübsch und hat eine gewisse Ähnlichkeit mit meiner Frau in ihren jungen Jahren. Sie küßt mich zärtlich auf die Schläfe und die Hand und sagt: »Morgen, Papachen, geht's dir gut?«
In ihrer Kindheit schwärmte sie für Gefrorenes, und ich mußte oft mit ihr in die Konditorei gehen. Das Gefrorene war für sie der Maßstab alles Schönen. Wenn sie mir etwas Angenehmes sagen wollte, sagte sie: »Papa, du bist Vanille.« Einen von ihren Fingern nannte sie »Pistazien«, den zweiten »Vanille«, den dritten »Himbeer« und so weiter. Wenn sie mich morgens begrüßen kam, pflegte ich sie auf mein Knie zu heben und ihre Fingerchen der Reihe nach abzuküssen und dazu zu sagen:
»Vanille ... Pistazien ... Zitronen ...«
Und jetzt, nach alter Gewohnheit küsse ich Lisas Finger und brummele »Pistazien ... Vanille ... Zitronen ...«, aber es kommt ganz anders heraus. Ich bin kalt dabei, wie das Gefrorene, und ich geniere mich. Wenn meine Tochter hereinkommt, und ihre Lippen meine Schläfe berühren, erzittere ich, als ob mich eine Biene in die Schläfe stechen wollte, lächle gezwungen und wende mein Gesicht ab. Seitdem ich an der Schlaflosigkeit leide, ist in meinem Hirn die Frage festgenagelt: meine Tochter sieht so oft, wie ich, der alte Mann, der berühmte Mann, qualvoll erröten muß, weil ich meinem Diener Geld schulde; sie sieht, wie oft mich die Sorge um lumpige Schulden zwingt, meine Arbeit liegen zu lassen und stundenlang aus einer Ecke in die andere zu gehen und darüber nachzugrübeln. Warum ist sie nicht ein einziges Mal heimlich, daß es die Mutter nicht hörte, zu mir gekommen und hat mir ins Ohr geflüstert: »Vater, hier ist meine Uhr, meine Armbänder, meine Ohrringe, meine Kleider ... Versetze alles, du brauchst Geld...?« Und sie sieht doch, wie wir, ich und ihre Mutter, aus einem falschen Gefühl heraus uns bemühen, unsere Armut vor den Leuten zu verheimlichen, warum kann sie nicht auf dieses kostspielige Vergnügen, auf diesen Musikunterricht, verzichten? Ich würde es ja nicht annehmen, weder ihre Uhr, noch ihre Armbänder, noch ihre Opfer, Gott soll mich bewahren – ich brauche das nicht.
Da fällt mir denn auch mein Sohn ein, der Warschauer Offizier. Er ist ein gescheiter, anständiger, solider Mensch. Aber was kann mir das helfen? Ich denke mir, wenn ich einen alten Vater hätte, und ich wüßte, daß Minuten kämen, wo er sich seiner Armut schämte, ich würde meinen Offiziersposten irgendeinem anderen überlassen und mich als Arbeiter verdingen. Derartige Gedanken über meine Kinder vergiften mich. Was sollen sie? Ein böses Gefühl gegen ganz gewöhnliche Leute hegen, weil sie keine Helden sind, das kann nur ein beschränkter oder bösartiger Mensch. Aber genug davon.