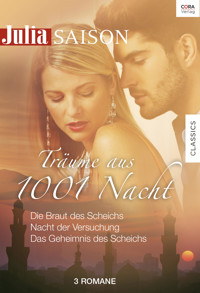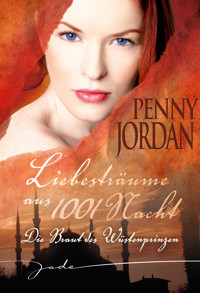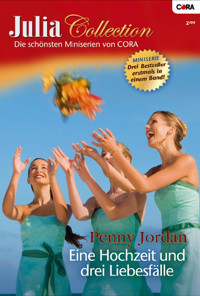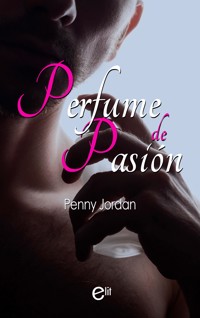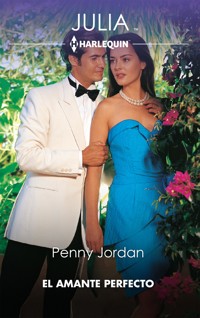6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihr ganzes Leben lang hat Sage damit verbracht, vor der Vergangenheit zu fliehen: vor ihrer Mutter, mit der sie nichts als Hass verband, vor ihrem Vater, der sich nie für sie interessierte, vor ihrer eigenen unerfüllten Liebe. Doch als ein Schicksalsschlag sie nach Hause zurückbringt und sie das Tagebuch ihrer Mutter findet, erfährt sie von deren ungestillten Sehnsüchten. Indem sie das dunkle Geheimnis ihrer Familie Stück für Stück zusammensetzt, wird Sage mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert - und mit der einen, der einzigartigen Liebe, die niemals enden soll …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 815
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Penny Jordan
Schattenjahre
Roman
Aus dem Amerikanischen von
Vera Möbius
Alle Rechte, einschließlich das der vollständigen oder auszugsweisen Vervielfältigung, des Ab- oder Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten und bedürfen in jedem Fall der Zustimmung des Verlages.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich
MIRA® TASCHENBÜCHER
erscheinen in der Harlequin Enterprises GmbH,
Valentinskamp 24, 20354 Hamburg
Geschäftsführer: Thomas Beckmann
Copyright © 2012 by MIRA Taschenbuch
in der Harlequin Enterprises GmbH
Titel der nordamerikanischen Originalausgabe:
Hidden Years
Copyright © 1990 by Penny Jordan
erschienen bei: Worldwide Books, London
Published by arrangement with
HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner gmbh, Köln
Umschlaggestaltung: pecher und soiron, Köln
Redaktion: Mareike Müller
Titelabbildung: pecher und soiron GmbH, Köln
Autorenfoto: © by Harlequin Enterprises S.A., Schweiz
ISBN (eBook, EPUB) 978-3-86278-596-4
www.mira-taschenbuch.de
Werden Sie Fan von MIRA Taschenbuch auf Facebook!
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
INHALT
PROLOG
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
PROLOG
Nach den Gesetzen der Logik hätte der Unfall niemals passieren dürfen.
Eine stille Seitenstraße – zumindest still nach den hektischen Londoner Maßstäben; ein klarer, heller Frühlingsmorgen; ein Taxifahrer, voller Stolz auf seine unfallfreie Vergangenheit; eine schlanke, elegante Frau, die um zehn Jahre jünger aussah; keiner der Beteiligten wirkte verwundbar. Und doch schien das Schicksal entschieden zu haben, was geschehen musste. Vor den Augen des Taxichauffeurs überquerte die Frau die Straße, dann blieb ihr hoher Absatz am Gehsteigrand hängen. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte, nicht in die relative Sicherheit des Gehsteigs, sondern auf die Straße, vor das Taxi, dessen Fahrer sich stets an alle Verkehrsregeln hielt, der sich nie so arrogant und gefährlich benahm wie zahlreiche Taxichauffeure in aller Welt.
Er sah die Frau fallen und bremste instinktiv – aber zu spät. Das schreckliche Geräusch, als der zarte Körper der Frau gegen das Auto prallte, würde ihn bis ans Lebensende begleiten. Sein Fahrgast, ein Geschäftsmann um die fünfzig im Nadelstreifenanzug, wurde durch den Zusammenstoß vom Sitz hochgeschleudert. Leute rannten aus den gepflegten Häusern zu beiden Seiten der Straße.
Irgendjemand musste einen Krankenwagen gerufen haben, denn der Taxifahrer hörte die klagende Sirene, die ein Trauerlied zu singen schien … Er ertrug es kaum, die Frau anzusehen, denn er bezweifelte, dass sie noch lebte. Unglücklich stand er am Straßenrand, als die Ambulanz erschien und die Profis ihre Arbeit begannen.
„Sie lebt noch“, hörte er jemanden sagen und stellte sich die Menschen vor, die in diesem Moment noch nicht wussten, welch eine Tragödie ihr Leben zu überschatten drohte. Irgendwo hatte die Frau doch sicher Verwandte und Freunde.
Ihre Mutter, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt, lag in einer Klinik, dem Tode nah. Unglaublich, dachte Sage leicht benommen. Ihre unverwundbare, allgegenwärtige, unbesiegbare Mutter …
Vage, irreale Gedanken schwirrten ihr durch den Kopf – Erinnerungen, Ängste, Gefühle. Der Porsche, den sie sich selbst zum dreißigsten Geburtstag geschenkt hatte, meisterte den dichten Verkehr. Seltsamerweise wurde ihre Fahrtüchtigkeit vom Aufruhr in ihrem Innern nicht beeinträchtigt.
Ihr Magen verkrampfte sich wie so oft während ihrer Kindheit und Jugend. Eine beklemmende Mischung aus Besorgnis, Kummer und Zorn erfasste sie. Wie konnte die Mutter ihr so etwas antun und es wagen, in das Leben einzudringen, das die Tochter sich aufgebaut hatte, und deren Unabhängigkeit zu gefährden?
Sage war kein Kind mehr, sondern erwachsen. Warum wurde sie jetzt von den alten, viel zu vertrauten Gefühlen erfüllt, von Wut, Gewissensbissen und Angst?
Das Krankenhaus lag nicht weit entfernt, deshalb hatte man vermutlich sie verständigt, nicht Faye. Und dann fiel ihr ein, dass sie die engste Blutsverwandte ihrer Mutter war. Ein Schauer rann ihr über den Rücken. Wenn die Mutter im Sterben lag … Jahrelang hatte sie sich eingeredet, nichts für die Frau zu empfinden, von der sie zur Welt gebracht worden war. Verrat und Täuschungsmanöver – damit hatte die Mutter verhindert, dass jemals andere Emotionen zwischen ihnen existieren konnten als Hass. Und deshalb fand sie es doppelt schlimm, jetzt diesen Schmerz zu verspüren, diese Angst.
Sie stellte den Wagen auf dem Parkplatz der Klinik ab, stieg rasch und ungeduldig aus. Eine typische Löwin – so hatte Liz Danvers ihr zweites Kind einmal beschrieben: temperamentvoll, ungestüm, ungeduldig, unbeherrscht und intelligent.
Das war vor fast zwanzig Jahren gewesen. Seit damals hatte die Zeit alle rauen Kanten von Sages Persönlichkeit abgeschliffen, die harten Seiten eines Wesens gemildert, das schwächeren Leuten oft zu rau erschien. Jetzt, mit dreißig, vermochte sie jene Energien zu kontrollieren, die ihre ruhigere, viel haltungsbewusstere Mutter hinter einen Wall aus distanzierter Würde getrieben hatten. Mit dem Versuch, diesen Wall niederzureißen, den verborgenen Kern von Liz’ Persönlichkeit zu erforschen, hatte Sage vergeblich einen Teil ihrer Jugend vergeudet. Nur eins wusste sie seit Langem – sie war nicht das Kind, das die Mutter sich wünschte.
Natürlich nicht – sie konnte niemals ein anderer David sein. Sie vermisste ihren Bruder immer noch, seine klugen Ratschläge, seine Liebe, sein Verständnis. Alle hatten ihn geliebt, mit gutem Grund. Seine Güte und Selbstlosigkeit waren tatsächlich liebenswert gewesen. Sie hatte ihn nie beneidet, nie den Eindruck gewonnen, die Mutter würde sie mehr lieben, wäre er nicht da gewesen. Also konnte die Kluft zwischen Liz und ihrer Tochter nicht mit Sages Eifersucht auf den bevorzugten Bruder erklärt werden.
Früher hatte es wehgetan, dieses Wissen, dass irgendetwas an ihr die Liebe der Mutter, die allem und jedem galt, in Abneigung, sogar Feindschaft verwandelte. Später hatte Sage gelernt, das zu akzeptieren, die schmerzliche Vergangenheit zu begraben. Sie vermied jeden überflüssigen Kontakt mit der Mutter, fuhr nur noch selten heim nach Cottingdean.
Cottingdean, das Haus, der Garten, das Dorf – alles die Domäne der Mutter, alles vom Willen der Mutter geschaffen und instand gehalten. Die Welt der Mutter.
Cottingdean – wie sehr hatte Sage während der Kindheit diesen Ort gehasst, der ihrer Mutter so viel abverlangte. All ihren Neid und ihre Abneigung hatte sie darauf konzentriert. Damals noch unfähig, die Barriere zwischen sich selbst und Liz zu analysieren, hatte sie geglaubt, Cottingdean trüge die Schuld an der schrecklichen Situation, weil das Anwesen der Mutter mehr bedeutete als die Tochter.
Vielleicht stimmte es. Warum auch nicht, dachte sie jetzt zynisch. Sicher hatte Cottingdean der Mutter all die darin investierte Zeit und Hingabe vergolten, so wie die Tochter es nicht vermochte.
Cottingdean, David und der Vater waren das Wichtigste in Liz’ Leben gewesen, und Sage hatte stets darunter gelitten, abseits zu stehen – eine Außenseiterin zu sein, ein Eindringling.
Sie stieß die Tafelglastür auf, ging zum Empfang der Klinik und nannte ihren Namen. Eine junge Krankenschwester blickte nervös auf eine Liste, bevor sie erklärte. „Ihre Mutter liegt auf der Intensivstation. Wenn Sie hier warten könnten – der Arzt würde gern mit Ihnen sprechen.“
Schon vor langer Zeit hatte Sage gelernt, sich zu beherrschen. Und so verriet ihre Miene nichts von ihren Gefühlen, als sie der Schwester dankte und auf einer Bank Platz nahm. War die Mutter schon tot? Wollte der Arzt deshalb zum Empfang kommen? Unerwünschte Emotionen stiegen in ihr auf, eine Panik, die sie drängte, sich gehen zu lassen und wie ein Kind zu weinen. Nein, noch nicht, dachte sie, es gibt zu vieles, was ich noch wissen möchte – zu vieles, was gesagt werden muss …
Das war lächerlich angesichts der Tatsache, dass Sage und ihre Mutter längst alles gesagt hatten, worauf es ankam. Sie selbst hatte vielleicht zu viel in Worte gefasst, zu viel enthüllt, war zu tief verletzt worden.
So ausdruckslos ihr Gesicht auch blieb, irgendetwas an ihr verriet den inneren Aufruhr. Das dunkelrote Haar schien vor Vitalität und Energie zu sprühen, die grünen Augen – von wem sie die geerbt hatte, wusste niemand – wirkten so veränderlich wie die tiefen Seen im Norden unter dem Frühlingshimmel. Gelegentlich warf die junge Schwester einen Blick auf Sage und beneidete sie. Sie selbst war klein, hübsch und ein bisschen rundlich. Niemals konnte sie die Ausstrahlung dieser eleganten Frau erreichen, diese Schönheit, die weder mit Jugend noch mit modischem Chic zusammenhing, sondern nur mit den klassischen Zügen, der Augen- und Haarfarbe, den Bewegungen, die in magnetischer Weise Aufmerksamkeit erregten.
Irgendwo in diesem großen anonymen Gebäude liegt meine Mutter, dachte Sage, so unfassbar mir das auch vorkommt. Liz war ihr stets unsterblich erschienen, ein Angelpunkt, um den so viele Schicksale kreisten. Auch das Leben der Tochter, bis sie rebelliert und sich losgerissen hatte, um ein eigenständiger Mensch zu werden. Ja, die Mutter hatte immer unzerstörbar und unverletzlich gewirkt, ein unabänderlicher Teil des Universums. Die perfekte Ehefrau, die perfekte Mutter, die perfekte Chefin – ein Vorbild für so viele Leute, die diesem Beispiel verzweifelt nacheiferten. Und sie hatte dies alles trotz der Hindernisse erreicht, die sich der Generation Sages niemals entgegenstellen würden. Liz war ihrer Zeit um dreißig Jahre voraus gewesen. Sie heiratete einen todkranken Mann und erhielt ihn über fünfundzwanzig Jahre am Leben, übernahm ein allmählich verfallendes Landgut und verwandelte es in ein florierendes Unternehmen. Nur ein zielstrebiger, entschlossener Mensch mit Visionen konnte ein solches Wunder vollbringen.
Lag darin die Wurzel der Abneigung zwischen Sage und ihrer Mutter? War sie neidisch auf Liz’ Talente gewesen, auf deren Leistungen? Maskierte sie dieses Gefühl, indem sie sich einredete, es sei ihr gutes Recht, so zu empfinden, die Mutter trage die Schuld an der Situation, nicht sie selbst?
„Miss Danvers?“
Sie zuckte zusammen, als sie die ungeduldige Männerstimme hörte. An männliche Aufmerksamkeit gewöhnt, fand sie die routinierte Professionalität des Arztes verwirrend. Sie selbst sah in ihrer mysteriösen Sinnlichkeit, die so viele Männer anlockte, eine fragwürdige Qualität. Denn sie entfachte nur Begierde, nicht Liebe. Bitterkeit regte sich in ihr – eine alte Wunde, die nie verheilt war. Um diese Emotion zu verdrängen, fragte sie betont kühl: „Meine Mutter …?“
„Vorerst lebt sie noch“, unterbrach er sie. Jetzt musterte er sie etwas genauer – ein großer, schlanker Mann, höchstens sieben Jahre älter als sie, aber in seinem Beruf vorzeitig gereift, offenbar begabt und intelligent. Aber im Moment wirkte er vor allem erschöpft und unduldsam. Angst verscheuchte Sages instinktives Mitleid, als er fortfuhr: „Bei der Einlieferung war sie bewusstlos. Wir haben noch keine Ahnung, ob sie schwere innere Verletzungen erlitten hat.“
„Keine Ahnung …“, Sage schüttelte verständnislos den Kopf. „Aber …“
„Wir waren viel zu sehr damit beschäftigt, sie am Leben zu erhalten. Deshalb konnten wir bisher nur oberflächliche Untersuchungen durchführen. Sie ist eine starke Frau, sonst wäre sie längst tot. Im Augenblick ist sie bei Bewusstsein. Sie hat nach Ihnen gefragt. Deshalb wollte ich Sie sprechen. Ernsthaft gefährdete Patienten reagieren äußerst sensitiv auf Anzeichen von Kummer oder Furcht bei ihren Besuchern – insbesondere bei nahen Verwandten.“
Sie hob erstaunt die Brauen. „Meine Mutter hat nach mir gefragt?“
„Ja“, bestätigte er und runzelte die Stirn. „Es war verdammt schwer, Sie aufzuspüren.“
Die Mutter hatte nach ihr gefragt. Sage verstand das nicht. Warum? Man sollte meinen, sie hätte nach Faye verlangt, Davids Witwe, oder Camilla, der Enkelin. Aber niemals nach ihrer Tochter. „Meine Schwägerin …“, begann sie, um ihre Gedanken in Worte zu fassen, doch der Arzt hob brüsk und abwehrend die Hand.
„Sie wurde benachrichtigt, aber vorläufig darf Ihre Mutter nur in äußerst begrenztem Umfang Besuch empfangen. Anscheinend hat sie etwas auf dem Herzen – etwas, das sie bedrückt. Bei einer so schwer verletzten Patientin müssen wir alles tun, was ihre Genesungschancen verbessert. Deshalb möchte ich Ihnen eine wichtige Anweisung geben. So geringfügig oder unerklärlich es Ihnen auch erscheinen mag, was Ihre Mutter sagen wird – versuchen Sie, sie zu trösten und zu besänftigen. Sie muss inneren Frieden finden.“
Sein Blick verriet ernsthafte Zweifel an Sages Fähigkeit, diese Forderung zu erfüllen – Zweifel, die sie teilte.
„Wenn Sie mir folgen würden …“ Er führte sie einen schmalen, leeren Korridor hinab, und es amüsierte sie ein wenig, weil er einen größeren Abstand hielt als nötig. Schüchterte sie ihn ein? Er wäre nicht der erste Mann gewesen, der so auf ihre Gegenwart reagierte. All die netten Männer, bei denen sie vielleicht kein Glück, aber zumindest Zufriedenheit hätte finden können, waren ihr mit dieser seltsamen Vorsicht begegnet. Natürlich lag es an ihrem Aussehen. Sie konnten nicht hinter die Fassade schauen, hinter die gefährliche Sinnlichkeit. Und sie glaubten, Sage würde niemals Zärtlichkeit brauchen, keine Schwächen verzeihen. Das stimmte natürlich nicht. Sie selbst war viel zu verwundbar, um die Achillesferse anderer zu verdammen. Und was die Zärtlichkeit betraf … Sie lächelte bitter. Nur sie allein wusste, wie oft sie sich nach diesem Heilmittel gesehnt hatte.
„Hier entlang“, sagte der Arzt. Sie erreichten die Intensivstation. Sage erschauerte, als er die Tür öffnete. Das instinktive Bedürfnis, kehrtzumachen und davonzulaufen, verlangsamte beinahe ihre Schritte.
Hinter irgendeiner dieser geschlossenen Türen lag die Mutter. Hatte sie wirklich nach ihr verlangt? Das war unfassbar – ein Schock, der Sages Schutzschild erschütterte. Dieser Schild wappnete sie, seit der Schmerz über Liz’ Verrat die widerstrebende, qualvolle Liebe vernichtet hatte.
Ein neuer Schauer ließ sie frösteln, als sie an das fremdartige Bild dachte, das der Arzt von ihrer Mutter gezeichnet hatte. Ein schwerverletzter, leidender Mensch musste doch nach demjenigen fragen, den er am meisten liebte. Und seit Sage denken konnte, wusste sie, dass die Liebe der Mutter – so freizügig und hemmungslos an andere verschenkt – der Tochter aus irgendwelchen Gründen nie gegolten hatte.
Pflichtgefühl, Fürsorge, Verantwortungsbewusstsein – das alles war Sage zuteil geworden, unter dem Tarnmantel vorgeblicher Mutterliebe. Aber sie hatte schon früh gelernt, zwischen Realität und Schein zu unterscheiden und die unüberwindliche Barriere gespürt.
Als sie an der Tür zögerte, wandte sich der Arzt ungeduldig zu ihr.
„Sind Sie auch ganz sicher, dass sie mich sehen will?“, flüsterte sie.
Er beobachtete, wie sich diese selbstsichere, schöne Frau, die eine so betörende erotische Ausstrahlung besaß, in ein nervöses Kind verwandelte. Die gefährliche Anziehungskraft einer solchen Frau bewog ihn, brüsker als beabsichtigt zu erwidern: „Oh, Sie haben nichts zu befürchten. Ihre Mutter hat nur innere Verletzungen davongetragen. Äußerlich …“
Sage starrte ihn an. Glaubte er wirklich, sie wäre so schwach, so eigensüchtig, dass sie vor dem Anblick der Patientin zurückschreckte? Doch ihr Ärger verflog sofort. Sie durfte ihm nichts übel nehmen, denn er wusste nichts von der komplizierten Mutter-Tochter-Beziehung. Die war ihr selber rätselhaft. Sie stieß die Tür auf und betrat einen kleinen Raum voller medizinischer Apparate mit vier Betten.
Nur ein Bett war belegt. Wie winzig die Mutter zwischen all den Geräten wirkte … Eine Kappe verbarg das ehemals natürlich blonde und jetzt diskret getönte Haar. Die bleiche Haut hätte einer Frau von Ende vierzig gehören können, keiner sechzigjährigen. Sages Blick streifte die Schläuche, an die ihre Mutter angeschlossen war, nur mit einem kurzen Blick und konzentrierte sich dann auf vertrautere, weniger beängstigende Aspekte.
Die Patientin atmete keuchend und mühsam, doch die Augen hatten sich nicht verändert – kühl, klar, Augen, die alles sahen, alles zu wissen schienen, deren Grau lavendelblau schimmern oder eine dunkle Schieferfarbe annehmen konnte, je nach der Stimmungslage.
Jetzt runzelte Liz die Stirn, nicht auf jene kaum merkliche Art, die Sage kannte, die Enttäuschung über die Fehlschläge irgendwelcher Leute ausdrückte. Wie oft hatte dieses leichte Stirnrunzeln das Herz der Tochter zusammengekrampft …
Doch nun zeigten sich tiefere Furchen, fremdartige Schatten verdüsterten die Augen. „Sage …“
War es ein Instinkt, der sie veranlasste, sich neben das Bett zu setzen und die Hand der Verletzten zu ergreifen? „Ich bin hier, Mutter.“
Mutter – welch ein kaltes, leeres Wort, ohne echte Gefühle … Als kleines Kind hatte sie „Mummy“ gesagt. Der zehn Jahre ältere David hatte die liebevoll-spöttische Anrede „Ma“ bevorzugt. Aber ihm war viel mehr Freiheit gestattet, viel mehr Liebe geschenkt worden … Hör auf, ermahnte sie sich. Sie saß nicht hier, um über die Vergangenheit nachzugrübeln. Die war endgültig vorbei.
„Alles ist gut, Mutter. Bald wirst du wieder gesund.“
Sekundenlang leuchtete schwacher Hohn in den grauen Augen auf, als wollten sie die banalen Worte mit Verachtung strafen, und Sage fühlte sich wieder wie ein Kind. „Du musst etwas für mich tun“, erklärte Liz, der die Stimme kaum gehorchte. Ihre Tochter musste sich hinabbeugen, um sie zu verstehen. „Meine Tagebücher – im Schreibtisch, in Cottingdean. Lies sie …“ Ihre Lider schlossen sich. „Auch die anderen müssen sie lesen. Sorge dafür …“
Was redete die Mutter da? Welche Tagebücher meinte sie? Hatte der Unfall ihrem Gehirn geschadet? Unsicher starrte Sage die bleiche Frau an, die jetzt wieder die Augen öffnete. „Versprich es mir …“
Pflichtbewusst nickte Sage. „Natürlich, aber …“ Unfähig, sich zurückzuhalten, stieß sie hervor: „Wieso bittest du mich darum? Wieso nicht Faye? Sie steht dir viel näher.“
Wieder schienen die grauen Augen zu spotten. „Faye ist nicht so skrupellos wie du, nicht so diszipliniert und stark.“ Die Stimme sank zu einem kraftlosen Seufzen herab.
Sage fühlte den schwachen, unregelmäßigen Puls in der Hand verebben, die sie festhielt, und eine überwältigende Angst stieg in ihr auf. Sogar Liebe durchströmte sie. „Mutter – nein!“
Der Puls flackerte wieder. „Wenn du die Tagebücher liest, wirst du alles verstehen, Sage.“ Erschöpft schloss Liz die Augen und lag so still da, dass Sage sie schon für tot hielt. Der Arzt berührte ihren Arm, seine leisen Worte belehrten sie eines Besseren.
„Sie will, dass ich ihre Tagebücher lese“, flüsterte sie, viel zu verwirrt, um zu begreifen, was sie zu diesem Geständnis trieb.
„Viele Menschen denken über gewisse Dinge in ihrem Leben nach, wenn sie dem Tode nah sind.“
„Ich wusste nichts von diesen Tagebüchern.“ Sage sprach mehr mit sich selbst. „Und ich musste es ihr versprechen …“ Sie wusste, dass sie dieses Versprechen nicht brechen durfte, und sie fürchtete die Erkenntnisse, die sie bei der Lektüre der Aufzeichnungen gewinnen würde. Sollte der Schmerz, den sie vor so langer Zeit überwunden hatte, von Neuem erwachen? Als der Arzt sie aus dem Zimmer führte, warf sie einen letzten Blick auf die Mutter. „Wird sie …?“
Wird sie sterben, wollte sie fragen, obwohl ihr vor der Antwort graute, obwohl sie sich an einen Hoffnungsschimmer zu klammern versuchte – an den Glauben, innere Kraft zu finden, solange die Mutter lebte.
Oft hatte sie die Leute sagen hören, am schlimmsten seien Leid, Schuldgefühle und das Bewusstsein der Vergänglichkeit in jenem Augenblick, wo ein Erwachsener einen Elternteil verliere. Sages Vater war während ihrer Teenagerzeit gestorben. Für ihn war es eine Erlösung gewesen, und es hatte sie kaum berührt. Wegen seiner schlechten gesundheitlichen Verfassung hatte er niemals eine große Rolle in ihrer Entwicklung gespielt. Stets war er im Hintergrund geblieben – eine Person ohne klare Konturen, aber der Mittelpunkt im Leben seiner Frau.
Bis jetzt war Sage überzeugt gewesen, sie hätte vor fünfzehn Jahren aufgehört, die Mutter zu lieben, jenes Gefühl wäre von einem zu schwerwiegenden Verrat, von zu viel Leid vernichtet worden und es gäbe nur eine einzige Möglichkeit zu überleben – die Trennung, die Unabhängigkeit.
Deshalb hatte sie sich ein eigenes Leben aufgebaut, eine Karriere gemacht, die sie zwischen London, New York, Los Angeles, Rom und Paris hin und her führte, zu all den Orten, wo man Interesse an ihren Wandgemälden fand. Überall auf der Welt standen Häuser, deren Besitzer ihr Heim niemals in glamourösen Zeitschriften für Innenarchitektur abgebildet sehen wollten, aber Sages Kunstwerke als kostbare Dekoration betrachteten. Sie war gefragt, wurde hoch bezahlt und nahm nur Aufträge an, die ihr zusagten. Ihr Leben gehörte ihr allein. Zumindest war sie dieser Meinung gewesen.
Warum ich, hatte sie sich erkundigt und war von der Mutter nicht einmal in dieser extremen Situation geschont worden. Natürlich, die sanftmütige, feinfühlige Faye würde es niemals über sich bringen, die Tagebücher eines anderen Menschen anzurühren, in einem fremden Privatleben herumzuschnüffeln. Aber warum war es so wichtig, dass Sage diese Aufzeichnungen las? Warum bestand die Mutter darauf – womöglich in der Stunde ihres Todes?
Es gab nur einen einzigen Weg, das herauszufinden.
Sage würde nichts gewinnen, wenn sie hinauszögerte, was geschehen musste. Das erkannte sie, als sie das Krankenhaus verließ. Wie es der Zufall wollte, hatte sie soeben einen Auftrag ausgeführt und noch etwas Zeit bis zum nächsten. Also wurde sie von keiner dringenden Pflicht daran gehindert, ihr Versprechen zu erfüllen und sofort nach Cottingdean zu fahren, so gern sie diese Reise auch vor sich hergeschoben hätte.
Der Familiensitz lag am Rand eines idyllischen Dorfes in den Hügeln südöstlich von Bath. In dieser ländlichen Gemeinde hatte die Mutter, liebevoll und von allen geliebt, geschaltet und gewaltet. Sage war mit Cottingdean nie so eng verbunden gewesen wie ihre Angehörigen. Aus irgendeinem Grund hatte sie sich dort wie eine Gefangene gefühlt und nach weiteren Horizonten gestrebt.
Cottingdean … Faye und Camilla würden sie erwarten, mit angstvollen Fragen nach der Mutter bestürmen.
Welch eine Ironie, dass die Schwägerin genoss, was Sage stets verwehrt worden war – die Liebe der Mutter. Trotzdem konnte sie Faye nicht hassen.
Sie seufzte ein wenig, als sie nach Westen zur M4 fuhr. Arme Faye – das Leben war nicht freundlich zu ihr gewesen, und in ihrer Schwäche vermochte sie die Schicksalsschläge kaum zu ertragen.
Deutlich erinnerte sich Sage an den Tag, an dem Faye und David geheiratet hatten. Eine bleiche, zerbrechliche Braut, von inniger Liebe erfüllt … Das Glück war nur von kurzer Dauer gewesen. Ein tragischer, sinnloser Autounfall hatte David das Leben gekostet und Faye vor die Aufgabe gestellt, Camilla allein großzuziehen.
Sage war nicht überrascht gewesen, als ihre Mutter die Schwiegertochter aufgefordert hatte, mit dem Kind nach Cottingdean zu ziehen. Später hätte David das Landgut ohnehin geerbt. Faye nahm das Angebot an, das hübsche ehemalige Pfarrhaus im Dorf, von David für seine Familie erworben, wurde verkauft. Camilla, damals ein Jahr alt, hatte nie ein anderes Heim gekannt als das Domizil ihrer Großmutter.
Während Sage an ihre Nichte dachte, lächelte sie. Achtzehn Jahre alt, maßlos verwöhnt, von allen ihren Angehörigen … David hatte eine schmerzliche Lücke im Leben seiner Familie hinterlassen, aber auch ein Geschenk, das sie ein wenig tröstete.
Cottingdean würde eines Tages Camilla gehören, und die Großmutter hatte früh begonnen, die Enkelin in die Pflichten einzuführen, die sie später übernehmen sollte. Sage beneidete das Mädchen nicht um dieses Erbe, aber manchmal um das sonnige Gemüt, die Ausgeglichenheit, die Herzenswärme, die gewinnende Art.
Aber im Grunde war Camilla noch ein Kind und wusste nicht, welchen Zauber sie auf ihre Mitmenschen ausübte.
Wieder seufzte Sage. Ihre Nichte wäre am tiefsten getroffen, wenn die Mutter … Mit zitternden Fingern umklammerte sie das Lenkrad des Porsche. Noch immer konnte sie ihren Gedanken nicht gestatten, das Wort „Sterben“ zu formulieren, diese Möglichkeit zu akzeptieren – die Wahrscheinlichkeit, dass der Tod ihrer Mutter unabwendbar war.
In den geheimsten Tiefen ihres Herzens lag die Gewissheit, eine Weigerung, ihrer Mutter jenes Versprechen zu geben, hätte deren letzten schwachen Lebenspuls zerstört. Die gleiche Wirkung würde Sage erzielen, sollte sie ihr Wort brechen. Obwohl die Mutter es nicht erfahren würde – Sage hätte das Gefühl, den dünnen Lebensfaden eigenhändig zu zerschneiden, wenn sie vor der Lektüre dieser Tagebücher zurückschreckte.
Sie erschauerte und erkannte, so wie in gewissen anderen Augenblicken ihres Lebens, die Macht ihrer tief verwurzelten, manchmal verwirrenden Instinkte, die auf keiner logischen Grundlage beruhten.
Ihre schmalen Finger schlossen sich noch fester um das Lenkrad. Von der zarten Anmut ihrer Mutter hatte sie nichts geerbt, die war auf Camilla übergegangen. Sie selbst besaß keine einzige Eigenschaft der Mutter. Und doch war es ihr in jenen wenigen Minuten am Krankenbett so vorgekommen, als hätten sich ihre Seelen vereint, als nähme sie Liz’ Angst und Leid, Verzweiflung und Entschlossenheit in sich auf. Und sie hatte erkannt, wie wichtig es war, das Versprechen zu erfüllen.
Wusste die Mutter, dass sie sterben würde? Ein heftiger Schmerz brannte in Sages Brust. So etwas durfte sie nicht empfinden. Vor vielen Jahren hatte sie sich von Liz losgerissen. Sicher, sie hatte die Beziehung mit Lippenbekenntnissen aufrechterhalten, die Mutter pflichtbewusst an deren Geburtstag im Juni besucht, auch zu Weihnachten. Während des letzten Weihnachtsfestes war sie allerdings nicht in Cottingdean gewesen, sondern in der Karibik, um die Villa eines reichen Franzosen zu verschönern. Ein guter Entschuldigungsgrund, um der Familienfeier fernzubleiben, von der Mutter kommentarlos akzeptiert …
Sie bog von der Hauptstraße ab, folgte den vertrauten Straßenschildern und runzelte die Stirn angesichts des Verkehrs, der im Lauf der Jahre auch in dieser ländlichen Gegend immer dichter geworden war. Die schmale Fahrbahn eignete sich nicht für die riesigen achträdrigen Laster. Einen überholte sie, nur noch wenige Meilen vom Dorf entfernt, und atmete auf, als sie vom Dieselgestank erlöst war.
Nach dem eisigen Winter war der Frühling doppelt willkommen, der die Hecken am Straßenrand in frisches Grün hüllte. Im Dorf schien sich nichts verändert zu haben, und es amüsierte Sage, dass sie sich darüber freute. Warum – wo sie sich doch so verzweifelt bemüht hatte, von hier zu fliehen, vor dieser fast zu vollkommenen hübschen Idylle? Wieso fürchtete sie bei jeder Rückkehr die Möglichkeit irgendwelcher tiefgreifenden Veränderungen?
Wer immer den Bauplatz Cottingdean ausgesucht hatte – es war eine gute Wahl gewesen. Die Rückseite zu den Hügeln, die Vorderfront nach Süden gewandt, wurde das Haus von alten Eichen am Rand des Parks gegen den Ostwind abgeschirmt.
Der Erbauer war ein reicher Kaufmann aus der elisabethanischen Ära gewesen, der mit seiner Familie Bristol verlassen hatte, um sich in einer stillen, gesunden ländlichen Umgebung anzusiedeln. Spätere Generationen hatten dem Haus – in der traditionellen Form des Buchstaben E angelegt – mehrere Anbauten hinzugefügt. Aber die steinerne Fassade mit der massiven Eichentür und den alten Fenstermittelpfosten war stets gleich geblieben, aus Mangel an Geld oder an Initiative.
Die Auffahrt führte zur Hinterfront, in den Hof, den die Ställe und übrigen Nebengebäude einrahmten. Nichts dergleichen behinderte die Aussicht, die man an der Vorderseite genoss.
Sages Mutter behauptete, den besten Eindruck von Cottingdean gewinne man, wenn man sich zu Fuß nähere, auf der Brücke, die den Fluss überspannte, durch das Holztor in der Gartenmauer. Dann tauchte das Bauwerk zwischen den gestutzten Eiben auf, die den Weg zur Terrasse und zum Vordereingang säumten.
Bei Liz’ Ankunft in Cottingdean war der jetzt so berühmte, viel bewunderte Park ein Durcheinander aus Unkraut und nutzlosen Gemüsebeeten gewesen. Das konnte man sich kaum vorstellen, wenn man jetzt den glatten, leuchtend grünen Rasen mit den scheinbar willkürlich verteilten Bäumen sah, die Eibenhecken, die eine geheimnisvolle Atmosphäre erzeugten. Dies alles war Liz’ Werk und keineswegs, wie manche glaubten, dem Geld ihres Mannes und der harten Arbeit anderer Leute zu verdanken. Nein, zum Großteil hatte sie den Park eigenhändig umgestaltet.
Im Hof wurde Sage von Faye und Camilla, die sie von ihrer Ankunft benachrichtigt hatte, erwartet. Sobald sie aus dem Wagen stieg, eilten beide zu ihr. „Wie geht es Gran?“, riefen sie wie aus einem Mund.
„Ich habe mit dem Arzt gesprochen. Er weiß noch nicht, wie schwer ihre inneren Verletzungen sind. Wenn wir ihn heute Abend anrufen …“
„Wann dürfen wir sie besuchen?“, fragte Camilla eifrig.
„Der Arzt meinte, sie könne erst Besuch empfangen, wenn sich ihr Zustand mindestens achtundvierzig Stunden lang stabilisiert hat.“
„Aber du warst doch bei ihr“, wandte Camilla ein.
Sage legte einen Arm um die Schulter ihrer Nichte. Davids Tochter bedeutete ihnen allen sehr viel. „Nur weil sie mich sehen wollte. Der Doktor sorgte sich, weil sie etwas auf dem Herzen hatte …“
„Was?“
„Camilla, lass Sage erst mal ins Haus gehen und Platz nehmen, ehe du sie einem Kreuzverhör unterziehst“, ermahnte Faye ihre Tochter sanft. „Heutzutage ist es kein Vergnügen mehr, von London hierher zu fahren, in diesem dichten Verkehr … Ich weiß nicht, was du vorhast, Sage. Aber ich habe Jenny für alle Fälle gebeten, dein Zimmer herzurichten.“
„Ich bin mir noch nicht sicher.“ Sage folgte ihrer Schwägerin in die Halle und blieb kurz stehen, bis sich ihre Augen an das Halbdunkel in dem holzgetäfelten Raum gewöhnt hatten, der sich bis zum Hinterausgang erstreckte. Nach der Ankunft ihrer Mutter in Haus Cottingdean hatte man beinahe ein Jahr gebraucht, um den dicken Anstrich von den alten Paneelen zu entfernen. Nun schimmerte das Holz warm und matt, und sein Anblick weckte den Wunsch, es zu berühren.
„Ich habe Jenny beauftragt, den Tee im Wohnzimmer zu servieren.“ Faye öffnete eine Tür. „Hast du dir unterwegs Zeit für den Lunch genommen?“
Wortlos schüttelte Sage den Kopf. Sie verspürte nicht den geringsten Appetit.
Das Wohnzimmer lag an der Westseite. Es war in verschiedenen Gelb- und Blauschattierungen gehalten, ein sonniger Raum mit Möbeln aus verschiedenen Epochen, die so aussahen, als wären sie füreinander bestimmt – was auf ein weiteres Talent der Hausherrin hinwies.
In dem gemütlichen Zimmer dufteten spät erblühte Topfhyazinthen, deren Farbe haargenau das Lavendelblau des Teppichs wiederholte. Ein Kaminfeuer verstärkte die einladende Atmosphäre, schmiedeeiserne Gitter verbargen diskret die Zentralheizung. Faye und ihre Schwägerin setzten sich in Polstersessel.
„Erzähl uns von Gran“, verlangte Camilla und hockte sich zu Sages Füßen auf einen damastbezogenen Schemel. „Wie geht es ihr?“ Sie war ein hübsches Mädchen, blond wie ihre Mutter, aber viel vitaler. Die schönen Gesichtszüge und die grauen Augen hatte sie von der Großmutter geerbt. „Sie wird doch wieder gesund?“
Sage zögerte und begegnete Fayes Blick, über Camillas Kopf hinweg. „Ich hoffe es.“ Tröstend fügte sie hinzu: „Sie ist sehr stark. Und wenn jemand den Willen hat zu kämpfen, am Leben festzuhalten …“
„Wir wollten sie besuchen, aber eine Krankenschwester erklärte uns am Telefon, Gran habe nach dir verlangt.“ Camilla schaute Sage ebenso erwartungsvoll an wie ihre Mutter.
„Sie sagte, wir … wir alle sollten ihre Tagebücher lesen. Das musste ich ihr versprechen.“ Sage schnitt eine Grimasse. „Ich wusste gar nicht, dass sie Tagebuch führte.“
„Ich schon“, erwiderte Camilla. „Eines Nachts konnte ich nicht schlafen und kam herunter. Da saß Gran in der Bibliothek und schrieb. Sie erzählte mir, ihre Tagebücher würden sie begleiten, seit sie vierzehn gewesen sei, aber die ersten habe sie nicht aufbewahrt.“
Wie lächerlich, sich wegen einer solchen Kleinigkeit zurückgesetzt zu fühlen, dachte Sage.
„Die Bücher liegen in den Schubfächern des großen Schreibtisches, der mal Grandpa gehörte“, fuhr Camilla fort. „Nur Gran besitzt einen Schlüssel.“
„Den habe ich jetzt.“ Nur widerstrebend hatte Sage im Krankenhaus die Handtasche ihrer Mutter samt Inhalt entgegengenommen. Und sie empfand immer noch ein heftiges Unbehagen, weil sie nur zu gut wusste, warum ihr die persönlichen Sachen der Patientin ausgehändigt worden waren.
„Ich frage mich, warum wir die Tagebücher lesen sollen.“ Eine seltsame Besorgnis lag in Fayes Augen.
Prüfend musterte Sage ihre Schwägerin, an deren stille Gegenwart in Liz’ Schatten sie sich längst gewöhnt hatte. Wieder einmal überlegte sie, warum diese attraktive, mit ihren einundvierzig Jahren noch relativ junge Frau sich mit einem solchen Leben begnügte. Sicher, Faye hatte David vergöttert. Aber nun war er seit vielen Jahren tot, und offenbar hatte es nie einen anderen Mann für sie gegeben.
Warum gab sie sich mit ihrem Schicksal zufrieden? Wie Sage wusste, blieben manche Witwen allein, weil sie wegen ihrer schlechten Erinnerungen an die Ehe keine neuen Partnerschaften eingehen wollten. Aber Faye war sehr glücklich mit David gewesen. Warum vergrub sie sich hier mit ihrer Schwiegermutter und ihrer Tochter? Nach außen hin wirkte sie ruhig und gefasst wie immer – wenn auch nicht auf so kraftvolle Art kontrolliert wie Liz.
Fayes Selbstbeherrschung war eher ein Schutzschild, hinter dem sie sich vor der Welt versteckte. Jetzt flackerte es nervös in den sanften blauen Augen. Das blonde Haar – während der Ehe offen getragen – war zu einem klassischen Knoten zusammengesteckt. Das Make-up bestand aus dezentem Lidschatten, Wimperntusche und einem Hauch von Lippenstift.
Trotz ihrer Schönheit hatte Faye stets ihr Bestes getan, um möglichst unscheinbar zu wirken. Warum, fragte sich Sage und beobachtete sie verstohlen. Oder befassten sich ihre Gedanken nur mit der Schwägerin, um dem Grund ihres Besuchs in Cottingdean auszuweichen?
Während Faye und Camilla sie bedrückt anstarrten, fühlte sie sich verpflichtet, die beiden zu beruhigen. „Wahrscheinlich sollen wir die Tagebücher lesen, weil Mutter glaubt, dass nützliche Dinge darin stehen – etwas, das uns hilft, das Landgut bis zu ihrer Genesung zu verwalten.“
Faye runzelte die Stirn. „Henry kümmert sich um die Schafherde und um die Spinnerei, obwohl sein Enkel das alles offiziell übernommen hat.“
„Und wer soll die Versammlung der Bürgerinitiative gegen den Bau der neuen Straße leiten?“, fragte Camilla.
„Welche neue Straße meinst du?“, fragte Sage bestürzt.
„Sie soll zur neuen Schnellstraße westlich zum Dorf führen“, erklärte Faye, „direkt durchs Ackerland, nur wenige Meter von unserem Grundstück entfernt. Deine Mutter hat eine Protestaktion organisiert. Vor zwei Wochen fand die erste Sitzung der Gruppe statt. Natürlich wurde Liz zur Vorsitzenden der Initiative gewählt.“
Wie Sage sich verwundert eingestand, passte ihre Empörung über die geplanten Neuerungen überhaupt nicht zu den Gefühlen, die sie für Cottingdean und das Dorf hegte. Wie froh war sie damals gewesen, diesem Ort entronnen zu sein … Warum grollte sie jetzt den Leuten, die es wagten, die Landschaft durch eine Straße zu zerstören?
„Was sollen wir bloß ohne sie machen?“, klagte Faye.
Anscheinend war sie den Tränen nahe, und Sage atmete erleichtert auf, als sich die Tür öffnete und die Haushälterin den Teewagen hereinrollte.
Der Nachmittagstee galt als Institution in Cottingdean, seit Sages Eltern eingezogen waren. Ihr Vater, schon damals ein Invalide, hatte an Appetitlosigkeit gelitten. Mit der Tradition dieser Teestunde hatte die Mutter versucht, ihn zum Essen zu animieren.
Jenny und Charles Openshaw arbeiteten seit fünf Jahren als Haushälterin und Gärtner beziehungsweise Chauffeur – ein nettes, über fünfzigjähriges Ehepaar aus dem Norden Englands.
Von Anfang an hatte Sage die beiden gemocht. Jenny und Charles erfüllten ihre Pflichten, ohne jene Unterwürfigkeit zu zeigen, die manchen Dienstboten in ländlichen Gebieten immer noch anhaftete.
Nachdem Jenny verkündet hatte, in Sages altem Zimmer sei alles vorbereitet, erkundigte sie sich nach dem Befinden der Hausherrin.
Sage informierte sie und wusste, Jenny würde erraten, was ungesagt blieb, und im Gegensatz zu Faye und Camilla auch ahnen, wie gering Mrs Danvers’ Überlebenschancen waren.
„Oh, fast hätte ich es vergessen!“, rief Jenny zu Sage gewandt. „Kurz vor Ihrer Ankunft hat Mr Dimitrios angerufen.“
„Oh, Alexi …“ Sage seufzte. Sicher würde er wütend auf sie sein. Für diesen Abend war ein gemeinsames Dinner geplant gewesen. Vor der Abreise hatte sie eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter in seiner Wohnung hinterlassen, die Situation kurz erklärt und versprochen, sich wieder zu melden. Seit zwei Monaten bemühte er sich um sie – für ihn eine ungewöhnlich lange Zeit, die er für eine Frau opferte, ohne mit ihr zu schlafen. Darauf hatte er bei der letzten Begegnung nachdrücklich hingewiesen.
Es gab keinen Grund, warum sie ihm eine intimere Beziehung verweigern sollte. Er war groß, kräftig gebaut, mit markanten Gesichtszügen. Sage hatte ihn bei einem Job in Sydney kennengelernt. Er zählte zur neuen Generation griechischer Australier – reich, selbstsicher, ein amüsanter Macho. Seit zwei Jahren gab es keinen Liebhaber in ihrem Leben, und sie hatte vergessen, wie man sich fühlte, wenn man so aggressiv umworben wurde. Ja, sie war schon sehr lange allein – ausgerechnet sie, die stets Freude am Sex gefunden hatte.
Aber guter Sex war Mangelware. Oder vielleicht lag es daran, dass sie im Lauf der Jahre immer wählerischer wurde und nicht mehr dazu neigte, augenblicklichen Impulsen nachzugeben, wenn ihr ein Mann attraktiv erschien. Natürlich ließ ihr die Arbeit wenig Zeit für gesellschaftliche Aktivitäten oder Selbstanalysen, und das gefiel ihr. Sie hatte zu viele ermüdende, unproduktive Stunden verbracht, um nach dem Unmöglichen zu suchen, sich nach Dingen zu sehnen, die sie nicht erlangen konnte, und letzten Endes beschlossen, nichts mehr erzwingen zu wollen. Sie nahm das Leben so, wie es kam, einen Tag nach dem anderen, gewöhnte sich allmählich und schmerzhaft an diese neue Geisteshaltung, wie ein Mensch, der nach einer langen Lähmung wieder gehen lernt.
Ihre mangelnde Bestürzung über Alexis Groll schien anzudeuten, dass er bestenfalls lauwarme Begierde in ihr weckte. Sie lächelte Jenny an und teilte ihr mit, sie wisse noch nicht, wie lange sie in Cottingdean bleiben würde. Am nächsten Tag wollte sie nach London zurückfahren und ein paar Sachen aus ihrer Wohnung holen. Das hätte sie bereits nach dem Verlassen der Klinik tun sollen, aber da war sie nicht in der Stimmung gewesen, solche praktischen Dinge zu erledigen, und hatte sich nur auf die baldige Erfüllung ihres Versprechens konzentrieren können. Nun gab sie Liz recht, die oft genug behauptet hatte, ihre Tochter sei zu impulsiv und würde niemals innehalten, um nachzudenken, ehe sie handelte.
Nachdem Jenny aus dem Zimmer gegangen war, trank Sage ungeduldig ihren Tee und ignorierte die appetitlichen Sandwiches. Geistesabwesend gestand sie sich ein, dass sie etwas essen müsste, aber allein schon beim Gedanken daran wurde ihr übel. Das lag vermutlich an den Auswirkungen des Schocks. Doch da sie an ihren ausgezeichneten Gesundheitszustand gewöhnt war, verschwendete sie kaum Zeit mit solchen Überlegungen.
Faye bemerkte Sages Rastlosigkeit und stellte ihre Teetasse ab. „Möchte Liz wirklich, dass wir alle diese Tagebücher lesen?“, fragte sie unbehaglich.
„Ja, leider. Mir widerstrebt es genauso wie dir, Faye. Nun, es gibt Leute wie dich und mich, die es hassen, in so intimen Dingen wie fremden Tagebüchern herumzuschnüffeln. Und andere genießen es geradezu. Ich habe keine Ahnung, warum Mutter mir dieses Versprechen abgenommen hat. Jedenfalls muss ich es erfüllen …“ Sage verstummte. Sollte sie Faye die lächerliche Befürchtung anvertrauen, sie könnte den Tod ihrer Mutter herbeiführen, wenn sie ihr Wort brach? Besser nicht. Damit würde sie die Last der Verantwortung abschütteln und Fayes zarten Schultern aufbürden.
„Ich möchte sofort anfangen. Bringen wir’s so schnell wie möglich hinter uns. Heute Abend um acht rufen wir im Krankenhaus an. Vielleicht dürfen wir Mutter morgen besuchen. Wenn ich ein Tagebuch zu Ende gelesen habe, gebe ich’s dir, und du reichst es dann an Camilla weiter, sobald du damit fertig bist.“
„Wo willst du die Bücher lesen?“, erkundigte sich Faye nervös. „Hier – oder …?“
„In der Bibliothek. Charles soll dort Feuer im Kamin machen.“
Obwohl Sage wusste, wie sinnlos es war, die unangenehme Aufgabe hinauszuschieben, verursachte sie eine Verzögerung. Brauchte sie wirklich ein Kaminfeuer in der Bibliothek? Die Zentralheizung spendete genug Wärme. Dieser Einblick in die eigene Psyche verwirrte sie. Wovor fürchtete sie sich? Vor der Bestätigung, dass ihre Mutter sie nicht liebte? Hatte sie diesen Gefühlsmangel nicht schon vor vielen Jahren akzeptiert? Oder graute ihr davor, die andere, tiefere, immer noch schmerzhafte Wunde wieder aufzureißen – Berichte über jene Zeit zu lesen, die sie aus ihrem Gedächtnis verbannt hatte? Was jagte ihr solche Angst ein?
Nichts, sagte sie sich energisch. Es gab nichts zu befürchten – gar nichts. Sie griff nach ihrer kaffeebraunen Leinenjacke, die sie über eine Stuhllehne gelegt hatte, und nahm den Schlüsselbund der Mutter aus der Tasche.
„Die Tagebücher liegen in den Schubladen auf der linken Seite des Schreibtisches“, erklärte Camilla leise. Dann fragte sie unsicher, als spürte sie, was Sage erfolgreich zu verbergen glaubte: „Sollen wir – dich begleiten?“
Sages Miene wurde etwas sanfter, dann erwiderte sie mit leichtem Spott: „Ich werde nur Tagebücher lesen, Camilla – kein Werk über mittelalterliche Hexenkünste.“ Rasch stand sie auf und ging zur Tür, wo sie sich noch einmal umdrehte. „Dinner um halb neun – wie üblich?“
„Ja“, antwortete Faye, „aber das lässt sich ändern, wenn du es möchtest.“
Sage schüttelte den Kopf. „Bis acht lese ich die Tagebücher, dann rufen wir in der Klinik an.“
Sie schloss die Tür hinter sich und blieb eine Weile in der Halle stehen. Der Frühlingssonnenschein verlieh der Täfelung die Farbe dunklen Honigs, beleuchtete die hohen Zinnkrüge mit den Blumen, die riesige Steinhöhle des alten Kamins.
Die Bibliothek lag auf der anderen Seite der Halle, gegenüber dem Wohnzimmer. Sie starrte die Tür an, dann eilte sie in die Küche und bat Charles, Feuer im Kamin zu machen.
Während er sich darum kümmerte, stieg sie die Treppe hinauf. Anlässlich ihres achtzehnten Geburtstags war ihr Zimmer neu eingerichtet worden. Die Mutter hatte die Möbel und die Farben ausgesucht, als Überraschung, und – wie Sage zugeben musste – eine gute Wahl getroffen.
Statt zarter Pastelltöne – zu langweilig für Sages Geschmack – herrschten Farben vor, die sie liebte. Blau, Rot und Grün betonten die Schönheit der Wandtäfelung. Das große Vierpfostenbett bestand aus Holz, das dem Wald von Cottingdean entstammte. Ihr Name und ihr Geburtsdatum waren eingraviert, ebenso Porträts von den Haustieren ihrer Kindheit. Mit dem Entwurf dieses Betts hatte sich die Mutter viel Mühe gegeben und die Herstellung persönlich überwacht. Für jeden anderen Menschen wäre es eine Liebesgabe gewesen, aber Sage sah darin nur einen Ausdruck mütterlicher Pflichterfüllung. Die Tochter war achtzehn geworden, und deshalb hatte sie ein besonderes Geschenk erhalten müssen.
Im angrenzenden Bad, schlicht und reinweiß, wusch sich Sage die Hände, frischte ihr Make-up auf und bürstete ihr Haar. Freudlos lächelte sie in den Spiegel. Versuchte sie immer noch, den großen Augenblick hinauszuzögern? Warum? Sie kannte die Lebensgeschichte der Mutter genauso gut wie alle Dorfbewohner – eine makellose Biografie, einer Heiligen würdig.
Als junge Ehefrau war sie hierhergekommen, mit einem Mann, dessen Gesundheit der Krieg zerstört hatte. Sie waren einander in der Klinik begegnet, wo Liz als Aushilfskrankenschwester gearbeitet hatte, und nach der Hochzeit nach Cottingdean gezogen. Liz’ Mann hatte das Landgut von einem Vetter geerbt. Unermüdlich arbeitete sie, um das baufällige Haus zu renovieren und die vernachlässigte Schafzucht rentabel zu machen. Nun produzierte sie Schafwolle von hoher Qualität. Wie es ihr gelungen war, dieses Ziel zu erreichen und auch noch die heruntergewirtschaftete Spinnerei auf Vordermann zu bringen, hatte Sage nie erfahren. Zum ersten Mal regte sich Neugier in ihr.
Liz hatte dem Dorf zu Wohlstand verholfen, Cottingdean neues Leben eingehaucht. Jeder Einheimische kannte die Freuden und Kümmernisse ihres Schicksals und entsann sich, wie sie gekämpft hatte, um das Leben ihres Mannes zu verlängern. Alle wussten von der tiefen Trauer um den tödlich verunglückten Sohn, von der widerspenstigen, schwierigen Tochter …
Nein, es gab keine Geheimnisse in Liz’ Vergangenheit, keinen Grund, warum Sage diese innere Anspannung fühlte, diese Furcht, die sie zögern ließ, nach unten zu gehen, in die Bibliothek.
Trotzdem musste es geschehen. Sie hatte es versprochen. Seufzend stieg sie die Treppe hinab, stand sekundenlang reglos vor der Bibliothekstür, öffnete sie schließlich und trat ein.
Ein helles Feuer knisterte im Kamin, und irgendjemand – zweifellos Jenny – hatte ein Kaffeetablett bereitgestellt.
Dies war die Zufluchtstätte des Vaters gewesen. Hier hatte er im Rollstuhl gesessen und in den Garten hinausgeblickt. Sage und ihre Mutter hatten in diesem Raum die Abende verbracht … Hör auf, ermahnte sie sich. Du bist nicht hergekommen, um an längst verflossene Zeiten zu denken, sondern um die Tagebücher zu lesen.
Sie staunte selbst über die plötzliche Hoffnung, es möge ihr misslingen, die Schubladen aufzusperren. Aber sie schaffte es natürlich. Sie waren alt und schwer, ließen sich jedoch überraschend mühelos aufziehen. Der schwache Geruch von Moschus und Kräutern – Liz’ Parfum – wehte Sage entgegen.
Nun sah sie die Tagebücher – viel mehr als erwartet, methodisch nummeriert und datiert, als hätte die Mutter stets gewusst, eines Tages würde jemand diese Aufzeichnungen lesen – als hätte sie es geplant …
Aber warum? Nervös nahm Sage das erste Buch aus dem Schubfach und schlug es mit zitternden Händen auf. Die Wörter verschwammen vor ihren Augen. Sie wollte nicht, konnte nicht … Doch beinahe glaubte sie, die Willenskraft der Mutter zu spüren, deren Flüstern zu hören. „Du hast es versprochen.“
Hastig blinzelte sie, um klarer zu sehen, und las den ersten Satz.
„Heute lernte ich Kit kennen.“
Kit? Sage runzelte die Stirn und überprüfte das Datum. Die Mutter hatte begonnen, ein Tagebuch zu führen, als sie siebzehn gewesen war. Kurz nach dem achtzehnten Geburtstag hatte sie geheiratet. Wer war dieser Kit?
Nebelhafte, unbehagliche Empfindungen erwachten in Sages Brust, widerstrebend betrachtete sie die regelmäßigen Schriftzüge. Es kam ihr so vor, als stünde sie vor einem dunklen Tunnel, den sie nicht zu betreten wagte, obwohl sie wusste, dass sie sich dazu durchringen musste. Wovor fürchtete sie sich?
Sei nicht albern, sagte sie sich und las den ersten Satz ein zweites Mal. „Heute lernte ich Kit kennen.“
1. KAPITEL
Frühling 1945
„Heute lernte ich Kit kennen.“
Allein der Anblick dieser Worte machte Lizzie schwindlig vor Glück, obwohl sie unmöglich ausdrücken konnten, welche neue Gefühlswelt sich ihr eröffnet hatte.
Gestern war ihr Leben noch von den anstrengenden Pflichten einer Aushilfskrankenschwester geprägt worden – lange Arbeitsstunden, niedriges Gehalt, all die grässlichen Aufgaben, mit denen die richtigen Krankenschwestern ihre kostbare Zeit nicht vergeudeten … Sie wäre lieber in der Schule geblieben. Aber nachdem ihre Eltern bei einem der vielen Bombenangriffe auf London gestorben waren, musste sie sich den Wünschen der Großtante fügen und ihren Lebensunterhalt selbst verdienen.
Tante Vi wollte nicht unfreundlich sein, aber sie war nicht sentimental und nie verheiratet gewesen. Sie hatte keine Kinder und betonte ständig, sie habe ihre Großnichte nur aus Verantwortungsbewusstsein bei sich aufgenommen. Sie selbst hatte schon mit dreizehn arbeiten müssen, als Dienstmädchen im großen Herrschaftshaus. Dort war sie allmählich zu der geachteten Position von Lord und Lady Jevesons Haushälterin emporgestiegen.
Zunächst fand Lizzie es verwirrend, die unordentliche, aber gemütliche Atmosphäre in dem beengten Haus zu verlassen, wo sie mit ihren Eltern und Großeltern gelebt hatte, und aufs Land zu übersiedeln. Hier erschien ihr alles fremd, sie vermisste Ma und Pa ganz schrecklich. Jede Nacht weinte sie sich in den Schlaf und hatte Heimweh nach London.
Die Tante war das exakte Gegenteil von Ma und sprach auch ganz anders. Es hörte sich an, als steckte ihr Mund voller Nadeln und spitzer Steine. Sie zwang die Nichte, genauso zu reden, und korrigierte sie in einem fort, bis Lizzie sich kaum noch getraute, etwas zu sagen.
Das war vor vier Jahren gewesen. Nun wusste sie kaum noch, wie Ma und Pa ausgesehen hatten. Und die Erinnerung an das Elternhaus schien einem anderen Leben anzugehören. Inzwischen hatte sie sich an Tante Vis pingelige Art und die scharfe Stimme gewöhnt.
Erst gestern hatte eine neue Aushilfsschwester, die aus einem anderen Dorf stammte, über Lizzies akzentfreie Sprechweise gespottet und ihr vor Augen geführt, welch große Veränderung mit ihr vorgegangen war. Die ungeschickte, rebellische Dreizehnjährige, die damals auf Tante Vis Schwelle gestanden hatte, existierte nur noch in verschwommenen Erinnerungen.
Tante Vi wusste genau, wie man sich benahm, und ihre Großnichte durfte nicht mit den Manieren und der Sprechweise eines Küchenmädchens aufwachsen. Das hatte sie so oft erklärt, dass Lizzie es niemals vergessen würde.
Anfangs hasste Lizzie den Job im Krankenhaus, aber die kalte Entschlossenheit in Tante Vis Augen verschloss ihr den Mund, als sie bitten wollte, wieder eine Schule besuchen zu dürfen.
Schroff verkündete die Tante, sie könne es sich nicht leisten, ein großes, faules Mädchen zu beherbergen, das ihr die Butter vom Brot esse und keinen Penny nach Hause bringe. Außerdem fügte sie bissig hinzu, falls Lizzie es noch nicht bemerkt habe – ein Krieg sei ausgebrochen und jeder habe die Pflicht, dem Vaterland zu dienen. Die Oberschwester im Krankenhaus war ihre Freundin. Und ehe Lizzie wusste, wie ihr geschah, wurde sie in einem Wohnheim nicht weit von der Klinik einquartiert, in einem Schlafsaal, zusammen mit einem Dutzend anderer Mädchen. Alle mussten die gleiche anstrengende Arbeit verrichten. Aber im Gegensatz zu Lizzie verbrachten sie die Freizeit nicht allein, sondern in kichernden, aufgeregten Gruppen. An den Samstagabenden wetteiferten sie miteinander, um möglichst hübsch auszusehen, wenn sie die Tanzveranstaltungen in der Kaserne besuchten.
Sie machten sich lustig über Lizzie, weil sie eine Einzelgängerin war, ganz anders als ihre Kolleginnen. Die strenge Erziehung der Tante trug Früchte, vor allem die ständig wiederholte Warnung vor den schlimmen Dingen, die einem dummen Mädchen zustoßen würden, wenn es auf die Schmeicheleien von Jungs hörte. Die wollten alle nur „das eine“ und würden ein Mädchen in Schwierigkeiten bringen, wenn sie es nur anschauten.
Vom männlichen Geschlecht hielt Tante Vi nicht viel, und jede vernünftige Frau sollte ihm besser aus dem Weg gehen.
Sie selbst war in einer rauen Welt aufgewachsen, wo eine alleinstehende Frau, die es zur Haushälterin in der gehobenen Gesellschaftsschicht gebracht hatte, ein viel angenehmeres Leben als ihre verheirateten Schwestern führte. Die mussten sich oft um ein halbes Dutzend Kinder und ihre Ehemänner kümmern, die vielleicht gar keine Lust hatten, zu arbeiten und die Familie zu ernähren.
Männern durfte man nicht trauen, und Lizzie, die ein angeborenes Feingefühl besaß, schreckte jedes Mal zurück, wenn ein Junge ungeschickte Annäherungsversuche unternahm.
Während des Krieges wollten die jungen Männer ihre womöglich knapp bemessene Zeit nicht verschwenden, ebenso wenig die Mühe, die sie aufwenden müssten, um ein Mädchen geduldig zu umwerben. Es gab genug andere, die keinen Wert auf so ein Getue legten.
Die wenigen anderen Männer, mit denen Lizzie zusammenkam, waren die Patienten in der Klinik, zum Teil Schwerverletzte. In stillschweigender Übereinkunft entschied das Personal, für diese Leute könne man nichts mehr tun. Und so lagen sie in dem großen, kalten, halb verfallenen Gebäude, von jungen Frauen betreut, die ihr Mitleid längst überwunden und schon zu viele verstümmelte Körper gesehen, zu viele gequälte Seelen beobachtet hatten, um Trauer zu empfinden.
Für Lizzie war es anders. Beim Antritt in der Klinik hatte sie eine Ausbildung zur Krankenschwester erwogen. Aber ein Jahr später, angesichts der zahlreichen hoffnungslosen Fälle, der Bitterkeit in den Augen der Todgeweihten, des Zorns, den die zerstörte Zukunft in den Krüppeln weckte, wusste sie, dass ihr die innere Kraft für diesen Beruf fehlte.
Mit jedem vertrauten Patienten, den die hilflosen, der Belastung nicht gewachsenen Angehörigen nach Hause holten, und mit jedem Neuankömmling blutete Lizzies Herz noch schmerzhafter. Sie verstand, warum die anderen Mädchen Ablenkung von dem Trauma suchten, indem sie ihre freien Abende mit gesunden, fröhlichen Vertretern des männlichen Geschlechts verbrachten.
Die Amerikaner seien die besten, behaupteten sie einstimmig, großzügig und amüsant. Diese Soldaten waren am anderen Ende des Dorfs stationiert, und einige hatten ein paarmal versucht, sich mit Lizzie zu unterhalten, wenn sie dorthin ging, um ihren wöchentlichen Pflichtbrief an Tante Vi abzuschicken. Sie ignorierte solche Avancen, die lächelnden Gesichter, die dreisten Einladungen. Aber sie fragte sich wehmütig, wie es wohl wäre, jene große, überwältigende Liebe zu erleben, von der sie so oft in Romanen las.
Sie war eine Leseratte und Tagträumerin. Bevor sie in Tante Vis Obhut gekommen war, hatte sie kaum ein Buch angerührt. Aber um die Ausdrucksweise der Nichte zu verbessern, hatte die Tante ihr „lehrreiche“ Bücher gegeben.
Ein wunderbares Geschenk – eine Truhe voller Bücher, die den jetzt erwachsenen Kindern einer Vikarsgattin gehört hatten – ermöglichte es Lizzie zeitweise, der strengen Herrschaft ihrer Tante zu entfliehen, in eine bisher unbekannte Welt.
Bei dieser Lektüre erfuhr sie von Tristans und Isoldes Liebestragödie und träumte von Gefühlen, die nichts zu tun hatten mit den plumpen Zudringlichkeiten der jungen Männer in ihrem Bekanntenkreis. Solche Unverschämtheiten, ebenso die unwillkommenen Gespräche und Enthüllungen der anderen Mädchen im Schlafsaal, machten es Lizzie leicht, die Ermahnungen ihrer Tante zu beherzigen. Und so lief sie nicht Gefahr, in „Schwierigkeiten“ zu geraten.
Mit „Schwierigkeiten“ meinte Tante Vi schlicht und einfach Sex, ein Thema, das in ihrem Haus nur andeutungsweise erörtert wurde. Sex musste man ignorieren, als würde er gar nicht existieren. In ihrer Naivität glaubte Lizzie, alle Frauen würden die Ansichten ihrer Tante teilen, bis sie im Krankenhaus von ihren Kolleginnen eines Besseren belehrt wurde.
Bis jetzt hatte sie selbst nichts anderes empfunden als eine vage, sehnsüchtige Vermutung, ihr Leben wäre irgendwie unvollkommen, etwas Wichtiges würde darin fehlen. Niemals hatte sie die Möglichkeit in Betracht gezogen, mit einem Mann jene Intimitäten zu teilen, von denen die anderen Mädchen so freimütig und schockierend sprachen. Bis jetzt …
Träumerisch starrte sie in ihr Tagebuch. Nur auf Tante Vis Anordnung hin hatte sie begonnen, eins zu führen, und keineswegs, um ihm ihre geheimsten Gedanken anzuvertrauen. Anfangs schilderte sie nur die banalen Ereignisse jedes einzelnen Tages. Doch seit sie in der Klinik arbeitete, notierte sie auch Gedanken und Gefühle, zunächst allerdings nur in nebulöser Form.
Kit … Das Wunder dieser Begegnung verwirrte sie immer noch. Nervöse Freude jagte einen Schauer durch ihren Körper, wann immer sie diesen Namen wisperte.
Kit … Er war so anders, etwas ganz Besonderes, einfach atemberaubend.
Bei seinem Anblick hatte sie es sofort gewusst. Er wandte den Kopf zu ihr, lächelte sie an, und plötzlich war die Welt erfüllt von Wärme und Zauber. Hätte sie beschlossen, den armen Edward nicht zu besuchen, wäre Kit ihr vielleicht nie über den Weg gelaufen. Sie zitterte, als ihr bewusst wurde, wie knapp sie dieser Katastrophe entronnen war.
Seit vielen Monaten lag Edward Danvers in der Klinik, ein in der Normandie schwer verwundeter Major. Beide Beine zertrümmert und später amputiert, das Rückgrat verletzt … In der Klinik sollte er sich von seiner zweiten Operation erholen. Aber Lizzie wusste ebenso wie alle anderen, dass es sonst keinen Ort gab, wo er sich hätte aufhalten können. Seine Eltern waren tot, eine Ehefrau hatte er nicht.
Er schien keinen Lebenswillen mehr zu besitzen, und er unterschied sich von den anderen Patienten, haderte nicht mit seinem Schicksal und akzeptierte es still und ruhig – zumindest nach außen hin. Lizzie beobachtete, wie er sich allmählich von der Außenwelt zurückzog, so als wollte er sich zwingen, endlich zu sterben.
Über seine Gebrechen sprach er nicht. Nie klagte er wie die meisten anderen Krüppel über immer noch vorhandene fiktive Gliedmaßen. Offenbar hatte er sich an die Konsequenzen der Amputationen gewöhnt. Willig erlaubte er den Schwestern, ihn in den Rollstuhl zu setzen, damit Lizzie oder eine ihrer Kolleginnen ihn in den Garten schieben konnte. Sie mochte ihn, obwohl seine Gesellschaft die anderen Mädchen langweilte, weil er niemals lachte und scherzte.
Sein Schweigen störte Lizzie nicht. Sie wusste, wie gern er sich im Garten herumfahren ließ. Einmal erwähnte er, hier fühle er sich an den Garten erinnert, der zum Haus seiner Großeltern gehörte. Es hieß Haus Cottingdean, und er schien es zu lieben. Der Gedanke daran weckte offensichtlich Freude und Kummer gleichermaßen. Manchmal sah sie Tränen in seinen Augen, wenn er von diesem Haus erzählte. Wenn es ihm so viel bedeutete – warum wohnte er dann nicht dort? Aber sie war zu feinfühlig, um diese Frage zu stellen, spürte viel zu deutlich den Schmerz, den er vor den anderen verbarg.
Im Lauf der Monate erkannte sie, dass sie sich auf die Zusammenkünfte mit Edward zu freuen begann. Und sie war glücklich, wann immer sie ihm ein widerstrebendes Lächeln entlockte. So wie sie selbst las er gern. Als er erfuhr, inzwischen habe sie alle von der Vikarsgattin gespendeten Bücher mehrmals gelesen, erbot er sich, ihr welche zu leihen. Das lehnte sie ab, aus Angst, sie könnten im Schlafsaal beschädigt werden. Die anderen Mädchen würden die Bücher zwar nicht absichtlich ruinieren, gingen aber nicht allzu sorgfältig mit fremdem Eigentum um.
Mit der Zeit entwickelte sich eine zögerliche Freundschaft zwischen Lizzie und Edward. Oft besuchte sie ihn auch an ihren freien Tagen und brachte ihn in den Garten, wenn das Wetter es zuließ. Wenn nicht, las sie ihm etwas vor, denn sie wusste, wie sehr es ihn ermüdete, ein Buch in den Händen zu halten.
In ihren Briefen an die Tante erwähnte sie Edward nicht. Tante Vi würde diese Freundschaft missbilligen, da der Patient aus einer anderen Welt stammte, und sie fand es nicht richtig, wenn verschiedene Gesellschaftsschichten miteinander verkehrten. Daraus würden nur Probleme entstehen, hatte sie ihre Nichte gewarnt.
Nun schloss Lizzie sekundenlang die Augen, als ihr bewusst wurde, dass sie an jenem Donnerstag beinahe beschlossen hatte, ihre kostbare Freizeit nicht mit Edward zu verbringen. Sie war in einer seltsam rastlosen, unangenehmen Stimmung erwacht, erfüllt von einer vagen, fremdartigen Sehnsucht. Doch dann hatte sie gedacht, Edward würde sich auf den Garten freuen, wo der Rhododendron blühte. Hell schien die Sonne am klaren Himmel. Nein, es wäre unfair gewesen, den Freund im Stich zu lassen.
Und so verdrängte sie die rebellische Sehnsucht und duschte im kalten, schäbigen Badezimmer, das sie mit den anderen Mädchen teilte. Danach gönnte sie sich den Luxus, ihr Haar zu waschen. Sollte sie wagen, es schneiden zu lassen? Sie war die Einzige im Wohnheim, die eine altmodische Zopfkrone trug. Tante Vi bestand darauf. Wie würde sie mit der schulterlangen Pagenfrisur aussehen, die manche Kolleginnen trugen? Seufzend musterte sie im fleckigen Spiegel ihr ungeschminktes Gesicht.
Die anderen Mädchen benutzten Puder, Lippenstift und billiges Parfüm, das ihnen die amerikanischen Freunde schenkten. Sie drehten das Haar auf Lockenwickler, färbten die Wimpern mit Schuhwichse, und wenn sie so glücklich waren, ein Paar dieser begehrten Nylonstrümpfe zu besitzen, kürzten sie die Rocksäume und zeigten ihre Beine.
Lizzie zog die praktische Baumwollunterwäsche an, die blütenweiß leuchtete, weil sie – von Tante Vis strenger Erziehung getrieben – ihre kostbare Seifenration verwendete, um die Hemdchen und Höschen zu schrubben. Dabei gestand sie sich wehmütig ein, dass Lippenstift und modische Pagenfrisuren nicht für sie bestimmt waren. Hinter ihrem Rücken lachten die anderen Mädchen über sie, das wusste sie, ahmten ihre Sprechweise nach und machten sich über ihre Kleider lustig.
Die Garderobe, mit der sie aus London aufs Land gekommen war, passte ihr längst nicht mehr. Die sparsame Tante hatte Kleider aus einer Truhe, ein Geschenk ihrer ehemaligen Arbeitgeber, für die Nichte geändert und ihr gleichzeitig Nähunterricht erteilt. Dass der Rock, den Lizzie jetzt trug, früher Lady Jeveson gehört hatte, beeindruckte sie ebenso wenig, wie es den anderen Mädchen imponiert hätte – allerdings aus anderen Gründen. Die Kolleginnen hätten vor Lachen geschrien, wären sie informiert worden, dass die erste Besitzerin dieses Rocks, damals ein junges Mädchen, inzwischen Großmutter war.
Wie Tante Vi energisch erklärte, nutze sich ein qualitativ wertvoller Stoff niemals ab. Und die Nichte gab ihr seufzend recht, während sie über die schweren Tweedfalten strich. Schade, dass Lady Jeveson nicht die sanften Pastellfarben bevorzugt hatte, die viel besser zu mir passen würden, sondern dunkle Brauntöne, dachte Lizzie. Die Bluse war zwar aus Seide, aber das dumpfe Beige hob ihren zarten Teint genauso wenig hervor wie die braune Kaschmirstrickjacke.
Die anderen Mädchen gingen in bunten Sommerkleidern mit weit schwingenden Röcken aus, mit Dekolletés, die Tante Vi schockiert hätten. So etwas Gewagtes hätte Lizzie niemals angezogen, aber an diesem Morgen wünschte sie, die Bluse wäre grau wie ihre Augen, mit lavendelblauem Schimmer, und der Rock aus feiner, weicher Wolle, nicht aus diesem dicken, kratzigen Stoff, der bleischwer ihre schmalen Hüften umschloss.
Sie besaß keine Nylonstrümpfe. Entweder mussten ihre Beine nackt bleiben und den juckenden Tweedrock ertragen, oder sie schlüpfte in die Wollstrümpfe, die Tante Vi für sie gestrickt hatte, ein Weihnachtsgeschenk.
Lizzie wusste nicht, warum sie sich für bloße Beine entschied, welche eitle Anwandlung sie an diesem Morgen bewog, unvernünftig zu sein und die verhassten Wollstrümpfe im Schrank zu lassen, in denen ihre schlanken Fußknöchel so schrecklich dick wirkten.
Sie schwang sich auf ihr altes Fahrrad. Wenn die Mädchen Dienst hatten, aßen sie im Krankenhaus. Sie bekamen nicht das gleiche Essen wie die Patienten, sondern „Schweinefraß“, wie sie es erbost nannten. Mit Tante Vis Mahlzeiten konnte sich diese Kost gewiss nicht messen. Die knauserige Frau drehte zwar jeden Penny zweimal um, ehe sie ihn ausgab, war aber eine gute Köchin. Lizzie vermisste die appetitlichen Speisen, das frische Gemüse und Obst, die Lebensmittel, die ihre Tante stets irgendwelchen Farmersfrauen abschwatzte und für die sie nur wenig bezahlte.
Da Lizzie an diesem Morgen freihatte, konnte sie nicht im Krankenhaus frühstücken. Im Wohnheim durften die Mädchen kein Essen zubereiten. Also gab es zwei Möglichkeiten – sie musste unterwegs etwas kaufen oder ein teures, wenig schmackhaftes Frühstück im einzigen Café des Dorfes bestellen.
Während sie sich zwang, nicht an den Haferbrei ihrer Tante mit Farmer Hobsons dicker Sahne zu denken, beschloss sie störrisch, auf ein Frühstück zu verzichten. Alle Mädchen waren immer hungrig. Da sie hart arbeiten mussten, aßen sie stets alles auf, was sie bekamen, mochte es auch noch so grässlich schmecken. Die meisten waren dünn, und wegen ihres zarten Knochenbaus wirkte Lizzie besonders schlank. Ihre zierlichen Handgelenke und Fußknöchel sahen so aus, als könnten sie jeden Augenblick zerbrechen.
Während sie die Straßen entlangradelte, spürte sie den warmen Sonnenschein auf dem Kopf und roch den Duft des Spätfrühlings, der bereits den Sommer verhieß. Blonde Haarsträhnen lösten sich aus der Zopfkrone und kräuselten sich rings um das Gesicht. Anfangs hatten die anderen Mädchen nicht geglaubt, dass ihr Haar naturblond war, und behauptet, sie würde es färben.
Lizzie beschloss, nicht durch das Dorf zu fahren, sondern außen herum. Sie folgte einer schmalen Seitenstraße, die zum Hintereingang des Krankenhauses führte.
Vor dem Krieg war die Klinik ein Herrschaftshaus gewesen, die Seitenstraße hauptsächlich von