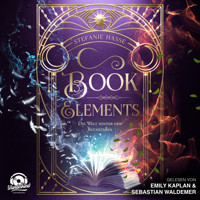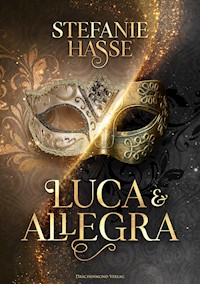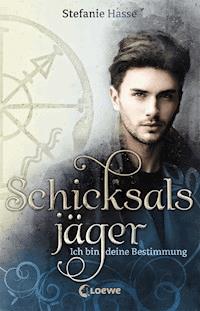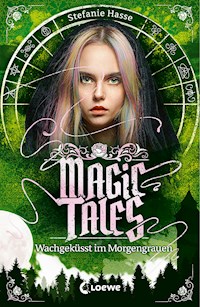Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine Romantasy-Geschichte zum Verlieben! Als erfolgreiche Buchbloggerin weiß Stefanie Hasse genau, was eine mitreißende Liebesgeschichte ausmacht: eine sympathische Protagonistin, ein prickelnder Love Interest (oder besser gleich zwei), eine Prise Humor und ein düsteres Geheimnis. Und wer würde nicht gern selbst einmal Schicksal spielen? Kiera war noch ein kleines Mädchen, als ihr ein unheimlicher Mann auf dem Jahrmarkt eine geheimnisvolle Münze zusteckte. Jahre später findet sie die Münze beim Aufräumen wieder und verletzt sich daran. Von da an steht Kieras Leben Kopf: An der Schule tauchen die geheimnisvollen Zwillingsbrüder Phoenix und Hayden auf. Und Phoenix – unfreundlich, überheblich, aber wahnsinnig attraktiv – behauptet, Kiera könne mit der Münze das Schicksal beeinflussen. Und daher dürfe er nun einen ganzen Mondmonat lang nicht mehr von ihrer Seite weichen ... "Schicksalsbringer - Ich bin deine Bestimmung" ist der erste von zwei Bänden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Titel
Widmung
Einleitung
Prolog
Kapitel 1 – »Wie fühlst du …
Kapitel 2 – Wo steckte nur …
Kapitel 3 – »Muss es denn …
Kapitel 4 – Ich bog gerade …
Kapitel 5 – Pünktlich zum Klingeln …
Kapitel 6 – Die Mittagspause verbrachten …
Kapitel 7 – Etwas außer Atem …
Kapitel 8 – Cody zog mich …
Kapitel 9 – Für einen einzigen …
Kapitel 10 – Am nächsten Morgen …
Kapitel 11 – Als sich jemand …
Kapitel 12 – Mom war doch …
Kapitel 13 – Cody presste mich …
Kapitel 14 – In der Nacht …
Kapitel 15 – Codys Arm packte …
Kapitel 16 – Ein Geräusch weckte …
Kapitel 17 – Die Stunde bei …
Kapitel 18 – Die Umgebung kühlte …
Kapitel 19 – Mit zusammengepresstem Kiefer …
Kapitel 20 – Seine Worte schwebten …
Kapitel 21 – Mom starrte auf …
Kapitel 22 – Ich war nicht …
Kapitel 23 – Gemeinsam betraten wir …
Kapitel 24 – Meine Beine gehorchten …
Kapitel 25 – »Es ist nur …
Kapitel 26 – Ich blinzelte mehrmals …
Kapitel 27 – Wir kamen sehr …
Kapitel 28 – Der Weg zu …
Kapitel 29 – Als Mr Andrews …
Kapitel 30 – »Und jetzt zeigst …
Kapitel 31 – »Wo ist das …
Kapitel 32 – Während wir wortlos …
Kapitel 33 – Die kurze Fahrt …
Kapitel 34 – Es fühlte sich …
Kapitel 35 – Ich fühlte mich …
Kapitel 36 – In der Küche …
Kapitel 37 – Phoenix und Hayden …
Kapitel 38 – Für einen Moment …
Kapitel 39 – Ein weiteres Mal …
Kapitel 40 – »Wir sollten damit …
Kapitel 41 – »Es war eine …
Kapitel 42 – Samstage waren wundervoll …
Kapitel 43 – Phoenix packte meine …
Kapitel 44 – »Fühlst du dich …
Kapitel 45 – »Was ist mit …
Kapitel 46 – »Was ist passiert …
Kapitel 47 – »Ichor«, sagte Hayden …
Kapitel 48 – Phoenix stöhnte erneut …
Kapitel 49 – Er hatte mich …
Kapitel 50 – Der Aufbau war …
Kapitel 51 – Nach dem Kaffee …
Kapitel 52 – Lange starrte ich …
Kapitel 53 – Mein Handy schlug …
Kapitel 54 – Im abgedunkelten Club …
Kapitel 55 – Nach einem kurzen …
Kapitel 56 – Irgendwo erklang ein …
Kapitel 57 – Ich rannte mitten …
Kapitel 58 – Die Zeit stand …
Kapitel 59 – Zitternd tippte ich …
Kapitel 60 – Kairos wartete einen …
Kapitel 61 – Ich rappelte mich …
Kapitel 62 – Nach der Stille …
Kapitel 63 – Die letzten Geräusche …
Kapitel 64 – Ich öffnete die …
Kapitel 65 – »Kiera!« …
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Weitere Infos
Impressum
Widmung
Für alle, die nicht an das Schicksal glauben.Lernt es erst einmal kennen …
Einleitung
O Fortuna
O Fortuna velut luna
statu variabilis,
semper crescis aut decrescis; vita detestabilis
nunc obdurat et tunc curat
ludo mentis aciem,
egestatem, potestatem dissolvit ut glaciem.
Sors immanis et inanis,
rota tu volubilis,
status malus vana salus semper dissolubilis,
obumbrata et velata
michi quoque niteris;
nunc per ludum dorsum nudum fero tui sceleris.
Sors salutis et virtutis
michi nunc contraria
est affectus et defectus semper in angaria.
Hac in hora sine mora
corde pulsum tangite;
quod per sortem sternit fortem, mecum omnes plangite!
(aus den Carmina Burana)
Prolog
»Dein Schicksal ist besiegelt.« Die Augen des weiß geschminkten Mannes funkelten unheimlich. Er war auf seinen Stelzen wie aus dem Nichts gekommen, auf das sechsjährige Mädchen zugelaufen und hatte sich wie ein Riese vor ihr aufgebaut. Der kindliche Schrei hing noch in der Luft, als er ihr verschmitzt zuzwinkerte, sich zu ihr hinabbeugte und in seiner erst leeren Handfläche ein Schokotaler auftauchte, den er ihr anschließend reichte. Sie traute sich zuerst nicht, etwas von einem Fremden anzunehmen, doch das Lächeln des Mannes war so vertraut, dass sie mutig nach dem goldenen Taler griff. Als er sich wieder zu voller Größe aufrichtete, legte er einen Finger auf seine Lippen und deutete auf Kieras Hosentasche. Sie verstand und steckte das Geschenk schnell ein, bevor ihre Mutter es entdecken konnte, die gerade angelaufen kam. Sie warf einen verunsicherten Blick auf den Stelzenmann, der ihr kurz zunickte, ehe er hinter dem Zelt der Wahrsagerin verschwand.
Nun kniete ihre Mutter sich hin und Kiera sah die Sorge in den sanften Augen, die sie aufmerksam musterten. »Hat der Mann dich erschreckt?«
Kiera schüttelte schnell den Kopf und genoss die Umarmung ihrer Mutter, sog den beruhigenden, vertrauten Geruch ein.
»Der Mann hat mir gestern auch schon Angst gemacht«, sagte sie, ehe sie Kiera vorschlug, mit dem alten großen Pferdekarussell zu fahren.
Später im Auto erinnerte sich Kiera wieder an den Schokotaler und zog ihn aus ihrer Tasche. Als sie die goldene Folie entfernen wollte, musste sie feststellen, dass es sich um keine Süßigkeit handelte, wie sie sie von den anderen Schaustellern bekommen hatte, sondern um eine richtige Münze! Kein Geld, wie sie es kannte, sondern schwerer, nicht ganz rund, ungefähr so groß, wie ihr kleiner Finger lang war. Ein kleines Loch am Rand lud dazu ein, einen Faden durchzuziehen und die Münze um den Hals zu hängen.
Während ihre Mutter das Auto in die Einfahrt lenkte, verbarg Kiera ihren Schatz schnell wieder in der Tasche. Sie sollte keine Dinge von Fremden annehmen. Aber selbst Kiera mit ihren sechs Jahren wusste einfach, dass diese Münze unermesslich wertvoll war. Sie konnte zaubern, daran glaubte Kiera ganz fest. Und so landete die Münze noch am selben Abend in ihrer Schatztruhe.
Er beobachtete, wie Kiera die Münze an sich nahm und ganz schnell vor neugierigen Blicken verbarg. Ein zufriedenes Lächeln schlich sich auf seine Lippen.
Fortunas Rad begann sich zu drehen.
Kapitel 1 – »Wie fühlst du …
»Wie fühlst du dich, Kiera?«, fragte mich Dr. Phyllis Yates wie bei wirklich jedem Termin, den ich bisher bei ihr gehabt hatte.
Ich unterdrückte ein Seufzen und sah mich wie immer im Raum um, nur um ihrem durchdringenden Blick nicht zu begegnen.
Ehe mich Mom überredet hatte, regelmäßig bei einer Therapeutin vorbeizuschauen, hatte ich mir solche Sprechzimmer anders vorgestellt, weniger … gemütlich. Aber genau das war es. Zwei Seiten des großen Raumes waren voller Fenster, die dazu einluden, den Blick in die Ferne schweifen und die Gedanken ziehen zu lassen. Die zwei Sessel, auf denen wir uns nun gegenübersaßen, befanden sich vor einer dieser Fensterfronten. Auf der anderen Seite stand ein kleiner Schreibtisch direkt neben der Tür. An den restlichen Wänden reihte sich Bücherregal an Bücherregal. Auch wenn überwiegend Fachliteratur darin stand, sorgten sie doch für eine wohlige Atmosphäre. Nach ein paar Minuten konnte ich nicht mehr länger wegsehen.
Dr. Yates sah mich erwartungsvoll an. Wie immer. Sie hoffte, dass ich endlich die Gefühlsregung zeigen würde, die meine Mutter erwartet hatte. Denn genau deshalb war ich hier. Mindestens einmal die Woche. Weil Mom sich sicher war, dass ich aufgrund der Trennung meiner Eltern einen psychischen Knacks bekommen würde. Wie ich es hasste, dass sie glaubte, mich besser zu kennen als ich mich selbst. Sie wollte über alles bestimmen, obwohl es um mein Leben ging. Ich liebte meine Mom, aber manche Entscheidungen sollten von mir getroffen werden und nicht von ihr. Ganz gleich, ob es um diese Therapie ging oder die College-Auswahl, über die wir diese Woche wieder diskutiert hatten. Mom schaffte es immer wieder, dass ich mich wie das kleine Mädchen fühlte, das sie wohl noch immer in mir sah. Ihre kleine Tochter, die keine Entscheidungen treffen konnte, ohne in Gefahr zu geraten.
Dr. Yates verfolgte jedes Zucken meiner Miene, sodass ich mich bloßgestellt fühlte und mich instinktiv weiter in den Sessel drückte. Dann wiederholte sie ihre Frage nach meinem Befinden.
»Wie immer«, sagte ich mit einem aufgesetzten Grinsen, es klang aber mehr wie eine Frage. Ich fand diese Termine so was von unnötig. Bei jedem einzelnen Besuch musste ich daran denken, wie Mom und ich zum ersten Mal hier gesessen hatten.
Dr. Yates hatte meine Mom lange gemustert, sich mit ihr unterhalten und versucht herauszufinden, was genau sie fürchtete – doch eigentlich war da nichts. Meine Eltern hatten ihre Trennung sorgfältig geplant und nichts überstürzt. Sie hatten sich auseinandergelebt, gingen dennoch freundlicher und liebevoller miteinander um als so manch anderes Paar. Ich war fast erwachsen und würde sowieso im Sommer aufs College gehen. Aber Mom hatte sicher zu viele Psycho-Ratgeber gelesen – und ich musste nun die Konsequenzen davon ertragen.
»Am Wochenende zieht ihr um, oder?«, hakte meine Therapeutin nach.
Ich nickte. »Ich habe schon fast alles gepackt.« Mein Zimmer bei Dad sah aus wie ein Lagerhaus.
»Und was fühlst du dabei? Hat sich für dich etwas verändert?« Sie sah mir fest in die Augen, während sie auf den großen Gefühlsausbruch wartete – der natürlich nicht kam. Er kam nie. Wir würden nur zwei Straßen weiterziehen, ich würde mein Zimmer bei Dad behalten, hin und wieder bei ihm vorbeischauen. Er würde morgens nur nicht mehr in der Küche sitzen.
»Ich fühle mich ein wenig … traurig?« Die beiden hätten mit dem Umzug auch noch bis zum Ende des Schuljahres warten können, fand ich. Wenn möglich, würde ich ein College irgendwo dort besuchen, wo es viel Sonne gab und selbst der Winter so warm war wie hier in Seattle der Sommer. Davon hatte ich immer geträumt.
»Das ist gut, Kiera. Du musst dir deine Gefühle eingestehen.« Ich hustete, um den Lachanfall zu unterdrücken. Ich war kein Mensch, der gern über Gefühle sprach. Das sollte besser niemand tun. Es hieß schließlich Gefühle, nicht Gerede. Darüber zu sprechen veränderte sie nicht. Aber Mom zuliebe – wegen dieses Gefühls – spielte ich mit und kam regelmäßig hierher. Und ich führte sogar das verlangte Tagebuch, wenn auch anders, als Mom es erwartet hatte.
Dr. Yates strich sich eine nicht vorhandene Strähne zurück in ihre perfekt hochgesteckten blonden Haare. Ich würde nicht sagen, dass ich einen Vorwurf in ihrem Blick sah, aber es war kurz davor.
»Ein solcher Umzug muss bei dir für ein Durcheinander an Emotionen sorgen, das ist weder ein Grund zu lachen noch ein Grund, sich zu schämen. Du wirst dein vergangenes Leben hinter dir lassen. Alles wird sich verändern.«
»Warum?« Die Frage war schneller raus, als ich denken konnte. »Ich meine, warum konnten sie nicht noch bis zum Sommer warten?«
»Es war einfach der richtige Moment, Kiera. An einem Wink des Schicksals kommt niemand vorbei.«
Ich runzelte die Stirn und stieß meinen Atem langsam aus. Dann ergab ich mich und nickte.
»Führst du deinen Blog noch? Ist etwas Besonderes vorgefallen?«
»Ja und nein«, antwortete ich knapp. Dr. Yates wusste, dass ich anstelle eines altmodischen Tagebuchs meine täglichen Erlebnisse in einem privaten Blog notierte und nicht in diesem kleinen Notizbüchlein, das nach dem ersten Termin hier bei Dr. Yates von Mom ganz unauffällig auf meinem Bett platziert worden war.
Ich hatte in diesem Moment die Kontrollsucht meiner Mom für so extrem befunden, dass sie mein Tagebuch vermutlich sogar lesen würde, nur um zu wissen, ob alles gut war. Daher hatte ich nur die Worte »Hi, Mom« hineingeschrieben und es unter meiner Matratze versteckt. Wenn Mom es je gelesen hatte, hatte sie es sich nicht anmerken lassen.
»In Ordnung. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder? Ich habe einen Termin am Dienstag für dich freigehalten, falls du …« Sie machte eine kurze Pause. »Deine Mutter hätte gern, dass wir über den Umzug sprechen.«
Nun musste ich doch die Augen verdrehen. Schon wieder eine Entscheidung, die Mom für mich getroffen hatte. Dr. Yates ignorierte es, stand auf und glättete für mich unsichtbare Falten auf ihrem grauen Bleistiftrock, zupfte die weiße Bluse zurecht und positionierte den Anhänger mit dem türkisfarbenen Stein wieder mittig auf ihrem Dekolleté.
Ich stand auch auf. Ganz ohne zu zupfen und zu glätten.
»Wir sehen uns, Kiera. Und falls etwas ist …«
»Dann kann ich Sie jederzeit anrufen, ich weiß.« Ich wunderte mich ja, dass Mom mir die Telefonnummer von Dr. Yates nicht irgendwo auf den Arm tätowiert hatte.
Sie nickte mir zu, lächelte mich dabei so ehrlich an, dass mich tatsächlich das Gefühl überkam, sie wäre immer für mich da. Vermutlich lernte man so etwas im Studium. Meine Stimmung hob sich sofort, wie immer, wenn mein Termin bei Dr. Yates vorüber war – und so verließ ich gut gelaunt die Praxis.
Zu meiner Überraschung stand Cody vor dem Gebäude und wartete auf mich. Für April untypisch war es knapp fünfzehn Grad warm – was mein bester Freund bereits für eine unerträgliche Hitze hielt und daher nur in einem schwarzen AC/DC-Bandshirt dastand. Der leichte Wind wehte ihm Strähnen seines halblangen blonden Haares ins Gesicht und er strich es mit sisyphosmäßigem Erfolg hinters Ohr. Er grinste mich breit an, die andere Hand in der Gürtelschlaufe seiner Jeans eingehakt.
»Hi, Prinzessin«, begrüßte er mich.
»Was tust du denn hier?«, fragte ich misstrauisch. Nicht, dass ich ihn nicht gerne sah – schließlich waren wir gemeinsam Haus an Haus aufgewachsen –, aber von Dr. Yates hatte er mich noch nie abgeholt.
»Ein wenig mehr Begeisterung hätte ich schon erwartet.« Er verzog mit gespielter Empörung das Gesicht. Doch da lag auch noch etwas anderes in seinem Blick, das ich auf die Schnelle nicht zuordnen konnte.
»Hallo, Cody! Wie toll, dass du mich abholst«, begrüßte ich ihn erneut und er grinste breit.
»Geht doch.«
Ich lachte kurz auf. »Wie komme ich zu der großen Ehre, dass der zukünftige Superstar mir sein Geleit anbietet?«
Ein Schatten huschte kurz über sein Gesicht. »Ich dachte mir, dass wir noch ein letztes Mal gemeinsam nach Hause gehen könnten.«
»Wir ziehen zwei Straßen weiter, Cody, nicht ans andere Ende der Stadt.«
»Es fühlt sich trotzdem falsch an.« Er verzog den Mund. »Was, wenn ich dich sehen will wie sonst immer?«
»Dann musst du deinen Hintern eben ein paar Meter weiter bewegen und nicht nur über den Zaun klettern«, unterbrach ich ihn, ehe er mich noch melancholisch werden ließ. Nur allzu oft hatte ich in den letzten Wochen daran gedacht, dass er bald nicht mehr ständig um mich sein würde.
Cody war so ein wichtiger Teil meines Lebens und ich war es gewohnt, dass er immer irgendwie in der Nähe war. Wir gingen gemeinsam zur Schule, spielten in derselben Band, wohnten direkt nebeneinander und Cody hatte früher mehr Zeit bei uns verbracht als bei sich zu Hause. Vor allem, nachdem seine Mutter gestorben war.
Vermutlich war das der schlimmste Punkt an dem Umzug – aber wie ich gesagt hatte, es waren nur zwei Straßen, die uns trennten, nicht die Welt. Und unsere besondere Freundschaft würde das aushalten, ich glaubte ganz fest daran.
Kapitel 2 – Wo steckte nur …
Wo steckte nur dieses verdammte Mikrofon? Der erste Tag nach dem Umzug fing ja wirklich gut an. Mein Blick flog über die zahlreichen Kisten, die sich in meinem Zimmer stapelten, so als würde plötzlich die Antwort auf einer von ihnen zu lesen sein. Natürlich suchte ich vergeblich und ließ mich seufzend auf mein quietschpink bezogenes Bett fallen.
Ich stöhnte auf. Das grelle Zeug war doch tatsächlich das Einzige gewesen, das wir in dem Kistenchaos, das Mom und ich unser neues Zuhause nannten, gefunden hatten. Zum Glück waren nicht auch noch Einhörner darauf oder gar Hello Kitty – Kätzchen. Zu meiner Schande musste ich gestehen, dass ich beides besessen hatte, doch das war lange her. Pink war nicht mehr annähernd meine Lieblingsfarbe. Mit siebzehn war ich eindeutig zu alt für so was. Sobald ich mein Probe-Mikro gefunden hatte, würde ich schleunigst nach einer weniger peinlichen Bettwäsche suchen.
Ich setzte mich auf – und unter mir knirschte es. Na toll. Ich schlug die pinkfarbene flauschige Decke zurück und zog einen kleinen Bilderrahmen hervor, dessen Glas nun einen Sprung hatte. Mein Blick blieb an dem Riss hängen und instinktiv presste ich meine Lippen zusammen. Das Glas trennte das Bild der glücklichen drei Personen an der Stelle, an der jetzt auch meine Familie zerrissen war: Auf der linken Seite des Fotos lächelte Dad mich strahlend an, Mom daneben sah aus, als wäre es der schönste Moment ihres Lebens. Auf Brusthöhe der beiden stand ich – mit mehr Zahnlücken als Zähnen im Mund und einem Leuchten in den Augen, wie es wohl nur Sechsjährige noch haben. Bevor die Schule und der »Ernst des Lebens« losgingen.
Ich sah lange auf das kleine Mädchen, mein damaliges Ich. Auf die dunklen Haare, die damals noch so fein gewesen waren, dass die zwei Zöpfe hinter den Ohren dünnen Pinseln glichen und nicht den dicken Pippi-Langstrumpf-Zöpfen, die ich mir so sehr gewünscht hatte. Meine Augen fixierten die sich spiegelnde Oberfläche der Glasscheibe und verglichen mein jetziges Ich mit der kleinen Kiera. Die großen blauen Augen waren geblieben, die Haare waren sogar noch dunkler geworden. Heute trug ich sie jedoch kürzer und gestuft, sodass sie morgens mit einmal Kopfschütteln unter Haarspray und kurzem Zurechtzupfen vorzeigbar aussahen, was für einen Morgenmuffel wie mich die einzig zumutbare Lösung darstellte. Ich stellte das Foto mit dem gesprungenen Glas auf meinen nagelneuen Nachtschrank und nahm mir vor, bald einen neuen Rahmen dafür zu kaufen.
Dann beugte ich mich wieder über die große Kiste, auf der ›Sonstiges‹ stand und in die ich gepackt hatte, was bei meiner Sortierung nicht in die anderen passte. Es gab nur leider sieben Kisten mit ›Sonstiges‹, zwei weitere mit Kleidung, fünf mit Büchern, die ich noch nicht in das neue Bücherregal gepackt hatte, eine mit CDs und seltsamerweise – trotz meiner akribischen Beschriftungsaktion – auch eine ohne Beschriftung, in der ebenfalls Kleidung war. Ich war mir sicher, dass das Mikrofon in einer ›Sonstiges‹-Kiste gelandet war. Wo auch sonst?
Während ich weiter in meinen Kisten nach meinem Mikrofon suchte, förderte ich zufällig meine uralte Schatzkiste zutage. Dort drin hatte ich alles versteckt, was ich als kleines Mädchen für außergewöhnlich gehalten hatte: gemusterte Steine, Deko-Kristalle, glitzerndes Papier, eine Pfauenfeder … Für mich waren das die wertvollsten Dinge, die ich mir hatte vorstellen können.
Ich öffnete die Kiste und all die wundervollen und spannenden Momente meines Lebens zogen in Bildern durch meinen Kopf. Jedes einzelne Stück verband ich mit Erlebnissen meiner Kindheit, die ich nicht missen wollte. In Gedanken versunken schob ich die kleinen weißen Steinchen hin und her, die mich an die vielen gemütlichen Vorlesestunden mit Mom und Dad erinnerten – ich hatte mich für den Fall des Falles vorbereiten wollen und schimmernde Kieselsteinchen gesammelt. Um wieder aus dem Wald zu finden.
Unter den Steinchen kam nun eine Münze zum Vorschein, die ich vor langer Zeit beim Besuch auf einem Jahrmarkt erhalten hatte. Bis heute hatte ich sie vor Mom und Dad versteckt. Jedoch sah die Münze bei Weitem nicht mehr so beeindruckend aus, wie ich sie in Erinnerung hatte. Sie funkelte nicht mehr, nicht einmal, wenn ich meine Handfläche im Licht hin und her kippte. Das Gold hatte seinen Glanz verloren wie so vieles andere in dieser Schatzkiste, doch die damit verbundenen Geschichten würde ich nie vergessen.
Ich schloss die Finger um die Münze und erinnerte mich an die antiken Karussells des Nostalgie-Jahrmarkts, die seltsamen Puppen mit Knopfaugen, das große Eis und diesen seltsamen Mann, der wie aus dem Nichts aufgetaucht war und mich erschreckt hatte.
Plötzlich spürte ich ein Brennen in meiner Handfläche. Ich hatte meine Hand zu fest um die Münze geballt und mich daran geschnitten! Fluchend und schimpfend schleuderte ich das Mistding in die Kiste zurück und betrachtete meine Handfläche. Es war kein Schnitt zu sehen und dennoch brannte es noch immer. Ich biss die Zähne zusammen und machte mich weiter auf die Suche nach meinem Mikrofon. Doch mir fiel nur lauter Mist in die Hände, den ich irgendwann in die noch nicht gelieferten Schränke räumen musste.
Jemand räusperte sich und ich zuckte zusammen.
»Das Ding hast du nicht wirklich immer noch.« Ich hob meinen Kopf und sah in Codys amüsiertes Gesicht, der eine alte Schneekugel von unserem Besuch in Disneyland schüttelte. Das würde ich mir nun ewig anhören müssen! Umständlich rappelte ich mich auf und sah ihn mit dem bedrohlichsten Blick an, den ich parat hatte. Was leider nicht die gewünschte Wirkung bei Cody erzielte. Er wagte es tatsächlich, mich auszulachen!
»Das habe ich tief unten in meinem Kleiderschrank gefunden«, versuchte ich zu erklären.
»Ja, klar. Gib’s zu: Du starrst das Ding täglich an und träumst davon, eine zarte Prinzessin zu sein.« Fehlte nur noch, dass er mir die Zunge rausstreckte.
»Immer noch besser als in einer Vitrine Figuren von Darth Vader und Luke Skywalker auszustellen«, forderte ich ihn mit vor der Brust verschränkten Armen heraus.
»Das ist ja wohl etwas ganz anderes«, verteidigte er sich. »Das sind Sammlerstücke.«
»Ja, ja. Du bist auch so ein Sammlerstück.« Ich nickte ernst, konnte mir ein Lachen aber nicht verkneifen.
»Und was ist das da?« Er deutete auf mein Bett. »Ich wusste nicht, dass du heimlich immer noch auf Pink stehst.« Seine braunen Augen blitzten auf, ehe er übertrieben das Gesicht verzog und einen gespielt ängstlichen Gesichtsausdruck aufsetzte.
»Irgendwie habe ich ein Déjà-vu … Muss ich Angst haben, dass du mich gleich zwingen wirst, mit Barbiepuppen zu spielen?« Er hob die Hände, als müsse er sich ergeben.
»Als hätte ich jemals mit Barbies gespielt!« Niemand kannte mich besser als Cody und er wusste genau, was wir mit den Barbiepuppen angestellt hatten, die man als Mädchen wohl immer von irgendwelchen Tanten geschenkt bekam – ob man sie wollte oder nicht. Eine Karriere als Friseur sollten wir uns beide jedenfalls aus dem Kopf schlagen.
»Stimmt, du warst noch nie das typische Mädchen«, grinste Cody mich endlich an. Doch dann wurde sein Blick nachdenklich, wie so oft, wenn er an unsere gemeinsame Kindheit – oder eher seine Kindheit – dachte. Seine Mutter starb kurz nach seinem vierten Geburtstag. Danach war sein Vater nicht mehr wiederzuerkennen gewesen. Er trank viel, war manchmal tagelang verschwunden und Cody bekam öfter bei uns etwas zu essen als bei sich zu Hause. Er hatte sogar ein eigenes Bettzeug bei uns gehabt und war sehr oft auf der Gästematratze in meinem Zimmer eingeschlafen. Seit er älter war, versorgte er sich selbst und kümmerte sich allein um den Haushalt. Seinem Vater konnte er dennoch nichts recht machen. Wenn er gute Tage hatte, ließ er Cody in Ruhe, wenn er jedoch schlechte Tage hatte, ließ er seine Laune immer an seinem Sohn aus – dem liebenswürdigsten Menschen, den ich kannte.
»Wer will schon eine Prinzessin sein, wenn er Rockstar sein kann?«, versuchte ich die Stimmung zu lockern und grinste Cody breit an. Er glitt aus seiner Nachdenklichkeit und lächelte. Seine Augen jedoch blieben traurig.
Manchmal machte ich mir Sorgen um Cody. Er steigerte sich in die Musiksache so sehr hinein, anstatt sich auf die Schule zu konzentrieren, auf den Abschluss und seine Zukunft. Cody war alles andere als dumm und könnte mit ein klein wenig Anstrengung sicher Stipendien für sämtliche Traumcolleges bekommen, doch er stellte die Schule immer hintenan. Er war wirklich ein richtig guter Musiker, spielte Gitarre wie ein junger Gott und sah auf der Bühne ganz annehmbar aus, was sicher nicht hinderlich war. Entfernt erinnerte er mich bei Auftritten immer an Kurt Cobain. Sogar seine charismatische Ausstrahlung war diesem ähnlich und die Melancholie, die er bei manchen Stücken ans Publikum weitergab, machte aus ihm etwas Besonderes.
Leider waren die Zeiten, in denen es ausreichte, gut zu spielen und zu singen, aber seit Jahren vorbei. Ohne gute Beziehungen und eine große Portion Glück, die man wohl schon immer haben musste, blieb es nur ein Hobby. Codys anvisiertes Ziel war zwar ein schöner Traum, aber nichts, auf das man sein restliches Leben aufbauen sollte. Doch mit solchen Aussagen stieß ich bei ihm auf taube Ohren. Die Musik half ihm in Momenten, in denen ihn seine Vergangenheit und der Tod seiner Mutter einholten, und nun setzte er alles daran, dass sie ihm den Rest seines Lebens eben nicht nur als Hobby erhalten blieb.
Da fiel mir mein Mikrofon wieder ein und ich beugte mich erneut über die Kiste, in der ich zuletzt gesucht hatte.
»Ich kann mein Mikro einfach nicht finden.«
»Ähm, das hast du doch im Proberaum gelassen, weil du es im Umzugschaos nicht verlieren wolltest.« Cody sah mich an, als zweifle er an meinem Verstand.
»Verdammt, du hast recht. Der Umzug war … chaotisch.« Chaotisch war eigentlich ein viel zu harmloser Ausdruck für einen Umzug mit einem halben Hausstand und ständigen Diskussionen zwischen Tür und Angel, was bei Dad bleiben sollte und was Mom mitnehmen würde. Trotz all der Planung kamen beim Packen Erinnerungsstücke zum Vorschein, die Mom und Dad behalten wollten.
Ich atmete geräuschvoll aus und Cody sah mich skeptisch an, ich schüttelte jedoch nur den Kopf und hielt jede weitere Erklärung zurück.
»Lass uns gehen.« Ich stand auf und klopfte mir den nicht vorhandenen Staub von der Jeans.
»Fahren wäre angebrachter. Wir wollen Xander und Jason ja nicht warten lassen.« Cody klimperte mit dem Schlüssel in seiner Hand und ich sprang auf.
Der Rest des Wochenendes verlief nicht weniger chaotisch, denn ohne Schränke konnte ich all meine Sachen nicht einräumen. So war ich jedes Mal viel zu lange auf der Suche nach Klamotten und war auch am Montag viel zu spät dran, als Cody mich zur Schule abholte.
An Frühstück war deshalb natürlich nicht mehr zu denken und so griff ich nach einer Packung Kekse für unterwegs. Nicht gerade das, was man unter gesundem Frühstück verstand, aber ich wollte niemandem meine Laune zumuten, wenn ich nichts im Magen hatte. Cody konnte ein Lied davon singen.
Mein Rucksack stand neben der Tür und Cody schnappte ihn, bevor ich zugreifen konnte. Mit Schlüssel und Keksen in der Hand versuchte ich, die Haustür zu öffnen, doch die neue Tür war schwerfälliger als die alte und so war es Cody, der mich seufzend zur Seite schob und die Tür für mich öffnete. Mit einer Verbeugung, die als galant durchgegangen wäre, wenn Cody dabei nicht den Mund zu einem Grinsen verzogen hätte.
Wir liefen die Auffahrt hinunter, wobei ich versuchte, unseren überwucherten Vorgarten zu ignorieren. Jemanden zu finden, der den Garten wieder auf Vordermann brachte, stand aber bereits ganz oben auf Moms To-do-Liste.
Sie war eben ein absoluter Organisationsfreak und wollte stets die Kontrolle über alles behalten. Dr. Yates lässt grüßen. Aber abgesehen davon, war sie ganz in Ordnung und ich kam gut mit ihr klar. Außerdem war sie nicht so oft zu Hause wie Dad, der als freiberuflicher Grafiker ein eigenes Arbeitszimmer in unserem alten Haus hatte. Mom hatte in der Regel bis in den Abend hinein Termine, und wenn ich abends noch Bandprobe hatte, sah ich sie manchmal erst kurz vor dem Schlafengehen. Bisher hatte mich das nie gestört, weil Dad ja da gewesen war, wenn ich zu Abend gegessen hatte. In Zukunft würde ich wohl alleine essen müssen.
»Nicht träumen, einsteigen«, holte mich Cody aus meinen Gedanken und öffnete von innen die Beifahrertür des alten klapprigen Vans, ehe er alles, was sich auf meinem Sitz gesammelt hatte, auf die Rückbank beförderte. Zeitweise hatte ich das Gefühl, Cody wohnte in diesem Auto. Sein Dad hatte ihm den Van geschenkt, nachdem er seine Fahrerlaubnis verloren hatte. Für Cody jedoch war ein Wagen unerlässlich für seinen großen Traum, schließlich gab es für Auftritte jede Menge Equipment zu transportieren.
»Ich bin so froh, wenn die Woche endlich vorbei ist«, begann Cody die tägliche Diskussion im Auto. Schon seit Anfang des Jahres sehnte er den kommenden Samstag herbei. An dem Tag gab es in einem der angesagtesten Clubs im Großraum Seattle einen ›Battle of the Bands‹ für junge Talente und es ging das Gerücht um, dass auch Talentscouts wichtiger Labels kommen würden, die ansonsten nur gelegentlich im Triple Door oder Fiddler’s Inn in Seattle anwesend waren, an deren Open-Mic-Nächten wir wegen unseres Alters nicht teilnehmen konnten. Welche Scouts es genau waren, konnte mir niemand sagen. Genauso wenig, ob diese Talentsucher wirklich schon mal jemanden groß herausgebracht hatten. Cody hingegen hielt sich an diesem Glauben fest und setzte alles auf diese eine Karte, von der er hoffte, sie würde sein Schicksal für immer verändern. Ich war realistisch genug für uns beide, unterstützte ihn jedoch bei seinen Träumen. Schließlich waren wir die besten Freunde und auf der anschließenden After-Show-Party würden wir ihn sicher alle wieder aufmuntern können. Zumindest hoffte ich das.
Kapitel 3 – »Muss es denn …
»Muss es denn um diese Zeit schon so heiß sein?«, stöhnte Cody, als wir aus dem Auto stiegen. Er schulterte seinen Rucksack und strich sich eine Strähne aus dem Gesicht. Sein halblanges Haar, das in alle Richtungen abstand, schien jeden einzelnen Strahl der Aprilsonne einzufangen und leuchtete wie ein Heiligenschein. Ich kommentierte seine Aussage nicht und er erwartete auch keine Antwort darauf. Stillschweigend verließen wir den Parkplatz und gingen auf das Schulgebäude zu.
Im Gegensatz zu ihm liebte ich dieses Wetter. Washington, insbesondere die Ecke rund um Seattle, war für sein raues Klima und die vielen Regentage bekannt. Wenn es im April schon Temperaturen über fünfzehn Grad hatte, wurde mir doch gleich warm ums Herz. Ich war ein Sommermensch und mir konnte es nie warm genug sein. Für mich war klar, dass Sonnenstunden und Temperatur ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl meines zukünftigen Colleges waren. Natürlich hatte ich mich auch am Central College direkt hier in Seattle beworben, die Zusage lag bereits im Briefkasten, aber ich hoffte doch auf weitere Möglichkeiten – in wärmeren Gefilden. Ich konnte es mir gar nicht vorstellen, wie es sein würde, selbst im Winter Kleidung zu tragen, wie ich sie mein Leben lang nur im Hochsommer hatte anziehen können. Der einzige Wermutstropfen dabei war die Trennung von Cody.
Er hatte sich mir zuliebe zwar an denselben Colleges beworben – und mit etwas mehr Anstrengung würde er seinen Schnitt auch halten, wenn nicht sogar verbessern –, doch mit seiner eher kritischen Einstellung zu Sonne und Hitze war mir jetzt schon klar, dass er nicht mit mir kommen, sondern in Seattle bleiben würde. Jedes Mal, wenn ich daran dachte, versetzte es meinem Herzen einen Stich. Ich war noch nie länger als ein paar Tage von Cody getrennt gewesen. Tage, an denen wir meine Grandma in D. C. besucht hatten – mehr Urlaub hatten sich meine Workaholic-Eltern nie gegönnt. Abgesehen von dem zauberhaften Wochenende, das wir als Kinder in Disneyland verbracht hatten.
Bis auf dieses eine Wochenende war Cody nie aus Seattle herausgekommen, aber ihn störte es nicht. Das Wetter hier war für ihn perfekt, den grüblerischen, sonnenhassenden Alternative Rocker, der sich tagelang in seinem Zimmer verkriechen konnte, um Stücke zu schreiben oder an Gitarrenriffs zu feilen.
In einer Zeitschrift stand irgendwann, dass Seattle wegen des vielen Regens so große Musiklegenden hervorgebracht habe. Hendrix und Cobain waren die wohl bekanntesten ›Söhne der Stadt‹. Ich konnte mir regelrecht vorstellen, wie sie in ihren Zimmern oder Garagen herumhingen, den prasselnden Regen als Inspiration und Beat zugleich nutzten und Gitarrensaiten anschlugen, bis sie im Einklang mit einfach allem waren. Und genau diese Jungs nahm sich mein bester Freund zum Vorbild.
Ich gab den Lehrern die Schuld an Codys Obsession für die Musik. Immerhin waren sie es, die uns bereits in der Grundschule auf die städtischen Legenden trimmten und Ausflüge zum Greenwood Cemetery in Renton unternahmen, um dem Hendrix Memorial zu huldigen. Die Stadt baute mittlerweile auf die Musiktouristen, nur deshalb fanden hier auch ständig Talentcastings statt, es gab sogar eine eigene Open-Mic-Seite im Internet. Doch viele dieser Veranstaltungen waren für ebenjene Touristen. Im Gegensatz zu der Show am nächsten Samstag – wenn man den Gerüchten glauben konnte.
Pünktlich zum ersten Klingeln betraten wir das Schulgelände und wie immer, wenn es nicht regnete, befanden sich die meisten Schüler noch außerhalb des weitläufigen Gebäudes und genossen die seltenen Sonnenstrahlen. Manche reckten ihre Gesichter zur Sonne wie Sonnenblumen, hielten die Augen geschlossen und sogen jedes bisschen Licht in sich auf. Hätten wir mehr Zeit gehabt, wäre ich wohl eine von ihnen gewesen. Ich lächelte vor mich hin.
»Was ist?«, fragte Cody mit erhobenen Augenbrauen.
Ich schüttelte den Kopf und deutete nur auf die Schar der Sonnenanbeter, was er nach einem kurzen Blick mit einem Augenverdrehen quittierte.
Wir gingen im Zickzack an den vielen kleinen Grüppchen vorbei auf die Treppe zu, die zum Haupteingang führte. Kurz davor hörte ich es. Ich bekam eine Gänsehaut, schloss kurz die Augen und holte tief Luft.
Jeder hier an der Schule kannte dieses Lachen. Auf mich hatte es dieselbe Wirkung wie Fingernägel auf einer der grünen Tafeln im alten Unterrichtstrakt. Amy Rosenberg klang wie die böse Königin aus den Disney-Filmen. Oder wie eine Hexe. Mit geschlossenen Augen stellte man sich eine faltige Alte mit Warze und Kopftuch vor.
Leider war Amy genau das Gegenteil und sah aus wie ein blonder Engel mit glänzenden blauen Augen und der Figur eines Topmodels. Zum Gesamtpaket gehörten natürlich auch Schmollmund und hohe Wangenknochen. Beim Verteilen der Schönheit hatte Amy definitiv das große Los gezogen – weswegen sie vermutlich nicht mehr anwesend war, als man Verstand und Menschlichkeit verteilt hatte.
Aus diesem Grund erschallte ihr hexenhaftes Lachen mehrmals am Tag, oft begleitet vom oberflächlichen Gelächter zweier Möchtegern-Amys: Anastasia und Drizella. Wobei Drizella eigentlich Drew hieß, aber seit die beiden an Amys Hintern klebten und ihr Gift auf sie abfärbte, hatten sie einfach zu viel Ähnlichkeit mit Cinderellas Stiefschwestern. Cody und ich waren aufgrund der Namensähnlichkeit und ihres gehässigen Verhaltens irgendwann dazu übergegangen, die beiden nur noch ›die Stiefschwestern‹ zu nennen. Ohne Amy hingegen konnte man sich mit den beiden sogar unterhalten.
»Wem sie wohl heute den Morgen versaut?«, seufzte Cody und reckte sich, um über unsere Mitschüler hinwegzusehen, die sich um Amy, ihre Anhängsel und das arme Opfer scharten. Leider fand diese hässliche Amy-Show inklusive Demonstration ihres Einflusses mindestens einmal die Woche statt. Natürlich meist vor der Schule oder in Abwesenheit sämtlicher Lehrer, damit die liebe, nette und hilfsbereite Amy auch ja nie als die Hexe gesehen wurde, die sie eigentlich war.
Cody spannte sich an und ich sah, wie er die Hände zu Fäusten ballte.
»Wer?«, fragte ich und versuchte, mich auch nur annähernd so groß zu machen, dass ich über irgendjemanden schauen konnte, was natürlich vergeblich war. Bei meiner Zwergengröße von etwas über eins sechzig endete so etwas immer in Enttäuschungen.
»Xander«, presste Cody zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, ehe er die hinterste Reihe der Gaffer durchbrach und auch andere zur Seite schob, um nach vorn zu gelangen. Ich hasste es, dass so viele zusahen, aber keiner etwas sagte. Doch Amy hatte mehr als einmal bewiesen, dass sie jedem das weitere Schulleben zur Hölle machen konnte. So auch unserem Bassisten Xander, der erst letzte Woche gewagt hatte, eine Sechstklässlerin gegenüber Amy zu verteidigen. Sie war unserer Möchtegern-Queen eigentlich nur im Weg gestanden und hatte die Schimpftirade ohne Reaktion über sich ergehen lassen. Das hatte selbst Xander aus seiner Wattewelt gezerrt.
Ich stürmte Cody hinterher. Mich konnte Amy sowieso nicht leiden. Ihre fiesen Sprüche prallten an mir ab – zumindest sah es für sie so aus. Außerdem war ich einigermaßen freundlich zu meinen Mitschülern, sodass sich, wenn ich Amys Zielscheibe war, keine schaulustige Menge sammelte, sondern alle schnell den Kopf senkten und weitergingen. Und ohne Publikum lohnte es sich für Amy natürlich nicht, eine solche Show abzuziehen.
Ich seufzte beim Gedanken daran, wie oft ich das Xander schon gesagt hatte. Aber in Amys Gegenwart hatte er Watte im Kopf. Oder rosarote Wolken. Denn er antwortete nur noch stockend und brachte kaum mehr vernünftige Sätze zustande, während er Amy mit großen Augen anhimmelte. Was Amy natürlich gefiel und ihn noch mehr zur Zielscheibe machte.
Genau das sahen wir dicht vor uns, als wir uns zwischen unseren Mitschülern durchgedrängelt hatten.
Amy hatte sich vor Xander aufgebaut, der plötzlich viel kleiner wirkte, als er eigentlich war. »Ich sage es nur noch einmal: Geh mir aus dem Weg.«
»Amy, ich …«, setzte Xander an, doch er kam nicht weiter.
»Ich mag es nicht, wenn man mich nicht respektiert«, zischte Amy sofort und ihre Augen funkelten regelrecht. »Ich akzeptiere es nicht.« Ihre Stimme war eiskalt. Ich wusste nicht, wie sie das machte, aber selbst ich bekam eine Gänsehaut bei den Worten, obwohl sie nicht an mich gerichtet waren.
Den Umstehenden erging es ähnlich. Sie zuckten zurück, als wären sie von etwas getroffen worden. Ich konnte es nicht verstehen, warum Amy auf so viele eine so besondere Wirkung hatte. Auf Lehrer, Mitschüler, Freunde von mir.
»Lass ihn in Ruhe, Amy.« Codys Stimme war freundlich, ließ aber keinerlei Widerworte zu. Natürlich kam trotzdem eine Reaktion. In Form eines Hexenlachens.
Cody verschränkte die Arme herausfordernd und in genau dem Maße gelangweilt, was bei Amy einen Schalter umlegte. Sie hob eine gezupfte Augenbraue und musterte ihn.
»Cody Weaver«, Amy machte eine bedeutungsschwere Pause – oder vielleicht musste sie ja ihr Hirn bemühen, um den restlichen Satz zu bilden?
»Wo sind denn deine zahlreichen Groupies, die du dir so sehr verdient hast?« Sie warf Cody einen abfälligen Blick zu. Amy konnte ihn nicht mehr leiden, seit er sie vor rund einem halben Jahr hatte abblitzen lassen. Sie hatte alles drangesetzt, es so zu drehen, als wären ihre Annäherungsversuche eins ihrer Spielchen gewesen. Nur zu Amys Schande hatte ihr niemand geglaubt. Cody war bei allen beliebt, ein echter Kumpeltyp und im Gegensatz zu Amy: nett. Mich hatte es damals gewundert, dass sie ihn geradezu umworben hatte – das passte eigentlich so gar nicht zu ihr. Besonders ausdauernd war sie jedoch nicht gewesen, sondern hatte sich sehr schnell einem anderen Zielobjekt zugewandt.
»Na ja, ein Groupie steht doch direkt vor mir«, antwortete Cody und sah sie herausfordernd an.
Amys Augen loderten regelrecht auf, als sie erkannte, wie die Menge um sie herum reagierte. Verhaltenes Lachen war zu hören. Ein Umstand, den Amy nicht tolerieren konnte.
»Als hätte ich das nötig«, versuchte sie, Haltung zu bewahren. »Mein Freund spielt in einer anderen Liga.«
Da war ich anderer Meinung. Im Gegensatz zu Amy war Matt sympathisch und ich hatte keine Ahnung, was er an der Giftspritze fand. Eigentlich schätzte ich ihn nicht so oberflächlich ein, aber vielleicht war das auch Wunschdenken. Matt war … nun ja, richtig toll. Er sah gut aus, war sportlich, hilfsbereit und freundlich und wurde von allen gemocht. Vielleicht gehörte es zum typischen Klischee, dass er mit Amy zusammen sein musste? Eine Art unveränderliches Schicksal für den bestaussehenden Jungen der Schule? Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich das bereits geändert. Doch leider stand Matt auf Sport und nicht auf Musik, weshalb er die Cheerleaderin einer Frontsängerin wie mir vorzog. Leider. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte ich Matt hinterhergesehen, wie Xander es bei Amy tat. Ganz so schlimm war es mittlerweile aber nicht mehr – ich war schließlich realistisch veranlagt.
Den Gaffern wurde langweilig und die sinkende Aufmerksamkeit bewegte Amy dazu, die glänzenden Haare hinter sich zu werfen und mit großen Schritten davonzustaksen. Drizella schob Anastasia hinterher.
»Was hat ihr heute nicht gepasst?«, fragte Cody und stieß Xander mit der Schulter an, der zuerst nicht reagierte, sondern Amy mit verträumtem Blick hinterhersah.
Ich schnaubte. Wann würde er es endlich lernen?
Xanders Blick klärte sich und Cody wiederholte die Frage, während wir in Richtung Schulgebäude gingen.
»Dasselbe wie immer«, erklärte Xander nur betrübt. »Eigentlich habe ich ihr nur einen guten Morgen gewünscht.« Was bedeutete, dass sie wieder einmal über sein Aussehen hergezogen war. Grundsätzlich war Xander ziemlich attraktiv: In dem grauen T-Shirt, das er heute trug, zeigte sich endlich auch das Ergebnis des vielen Trainings im Fitnessstudio. Leider hatte er schlimme Probleme mit seiner Haut, was für Porzellanteint-Amy natürlich ein Grund für Hänseleien war. Oberflächliche Schnepfe!
Xander war nach jeder Begegnung mit Amy regelrecht geknickt und wir mussten ihn wieder aufbauen.
»Mach dir nichts draus, sagte ich und drückte ihm freundschaftlich den Oberarm – was zu einem plötzlichen sengenden Schmerz in meiner Handfläche führte. »Verdammt!«, fluchte ich.
»Was ist los?«, fragten meine zwei Jungs alarmiert, doch ich schüttelte nur den Kopf. »Ich habe mich am Wochenende an einer alten Münze geschnitten, die ich als Kind bekommen habe.« Erneut verfluchte ich das Mistding.
»Zeig her«, sagte Cody fürsorglich wie immer, doch ich lehnte ab. Ich hatte schon am Wochenende keine Wunde gesehen. Es musste nur so etwas wie ein feiner Schnitt an Papier sein und ich wollte ja nicht als Jammerlappen dastehen – was jetzt vermutlich zu spät war.
Cody zuckte mit den Schultern und wandte sich Xander zu.
»Klappt es bei dir mit heute Abend? Ich habe noch an dem Auftakt-Song für den Gig gefeilt. Love’s Lost wird unser Durchbruch!«
»Na klar.« Xander zuckte nur mit den Schultern. Die letzten Wochen war er nicht sehr motiviert gewesen und mittlerweile machte ich mir Sorgen, dass er uns – aber vor allem Cody – hängen ließ. So kurz vor dem Auftritt. Er hatte bereits angedeutet, die Band verlassen zu wollen. Ich gab eindeutig Amy die Schuld an Xanders Sinneswandel.
Cody hatte die Lippen zusammengepresst, war tief in Gedanken versunken. Teilte er meine Sorgen? Bislang hatte er es immer abgestritten, dass wir einen schnellen Ersatz für Xander brauchten, aber vielleicht war er sich mittlerweile nicht mehr sicher.
Als wir das Schulgebäude betraten, steuerte Xander den Westtrakt an.
»Dann bis heute Abend im Proberaum«, verabschiedete sich Cody mit einem Schulterklopfen von ihm, ehe wir beide unseren Weg fortsetzten. Schweigend gingen wir noch ein Stück nebeneinanderher, bis auch wir uns trennen mussten. Zum Abschied warf er mir ein kurzes Lächeln zu, das mich zum Strahlen brachte.
Die Groupie-Sache war nicht ganz so abwegig. Am Aussehen konnte es definitiv nicht liegen, dass Cody keine Freundin hatte. Auch nicht an seinem Charme. Ich tippte eher darauf, dass er einfach zu oft den guten Kumpel spielte und sich deshalb nicht mehr daraus entwickelte. Irgendetwas störte die Mädels – selbst die, die ihm ab und an sehnsüchtige Blicke zuwarfen. Ich war ein Mädchen, ich registrierte so was sofort. Cody schüttelte aber jedes Mal den Kopf, wenn ich ihn in die Richtung ausfragte. Jungs konnten so was von ignorant sein.
Er stand etwas abseits und hatte die Szene genau beobachtet. Amy sorgte dafür, dass sich seine Kiefermuskulatur anspannte. Sie war sich ihrer Wirkung auf andere nicht bewusst, interpretierte sie als etwas völlig Falsches. Dennoch musste er aufpassen.
Sie alle waren so jung, völlig unbedarft und wussten nicht, was auf sie zukommen würde. Wussten nicht, dass sie Teil eines großen Planes waren, der schon vor Jahrtausenden begonnen hatte.
Die Münze hatte ihren neuen Träger gefunden. Die nächste Runde hatte begonnen.
Kapitel 4 – Ich bog gerade …
Ich bog gerade um die letzte Ecke vor meinem Klassenzimmer, als ich mit jemandem zusammenstieß. Ich wollte mich bereits entschuldigen, die Worte lagen mir quasi schon auf der Zunge, doch der Zusammenprall musste für irgendeinen Aussetzer in meinem Hirn gesorgt haben. Anders konnte ich mir nicht erklären, wieso ich mit offenem Mund dastand und den Typen anstarrte.
Ich hatte ihn nie zuvor gesehen und er ging definitiv nicht auf unsere Schule. Er war groß, nicht gerade schmal gebaut, aber auch nicht übermäßig trainiert. Doch es war nicht zu übersehen, wie sich seine Brustmuskulatur unter dem eng anliegenden Shirt abzeichnete. Seine dunklen, fast schwarzen Haare waren kurz geschnitten, was sein klassisches breites Männergesicht mit den hohen Wangenknochen sehr gut zur Geltung brachte. Die Deckhaare trug er etwas länger und sie wellten sich leicht. Einzig die Farbe seiner Augen konnte ich nicht ausmachen, denn er trug eine Sonnenbrille! Hier im Gebäude! Mir lag bereits ein passender Spruch auf der Zunge, ich kam aber nicht mehr dazu, die Worte auszusprechen.
»Kannst du nicht aufpassen?«, schnauzte er mich an und ich war so perplex, dass meine übliche Schlagfertigkeit versagte.
»Dasselbe gilt wohl für dich«, antwortete ich mit der Reaktionszeit einer Schnecke. »Oder steht irgendwo geschrieben, dass dir alle Schüler aus dem Weg springen müssen?«
Er verzog den Mund zu einem arroganten Lächeln und machte sich nicht einmal die Mühe, die Sonnenbrille abzusetzen. Dennoch spürte ich seinen musternden Blick auf mir. »Gute Idee, das sollte definitiv irgendwo stehen.«
Ich schüttelte den Kopf. Solche Typen, die vor Selbstbewusstsein nur so strotzten und damit hausieren gingen, kannte ich bereits zur Genüge aus Büchern. Im echten Leben brauchte ich sie nicht auch noch.
Ich trat also zur Seite und wollte schon an ihm vorbeistürmen, als er mich ausbremste, weil er ebenfalls ausweichend zur Seite trat und wir uns nun wieder direkt gegenüberstanden. Na, immerhin. Ein klein wenig Anstand steckte anscheinend doch in ihm. Ich versuchte mich an einem Lächeln und nickte ihm kurz zu, ehe ich ihn schnell umrundete und zu meinem Klassenraum ging.
Der erhöhte Puls hatte dafür gesorgt, dass die Wunde in meiner linken Handfläche wieder pochte, als hätte ich mich frisch geschnitten. Auch wenn es natürlich nicht stimmen konnte, gab ich diesem arroganten Typen die Schuld daran. Ich ballte die schmerzende Hand zur Faust und betrat das Klassenzimmer.
Unsere Mathelehrerin Mrs Brewer war schon da, aber ich war immerhin nicht die Letzte, die unter ihrem kritischen Blick an ihren Platz ging. Ich packte meine Stifte und Bücher aus und lehnte mich zurück. Doch als die Stiefschwestern Drew und Ana hinter mir zu tuscheln begannen, konnte ich nicht weghören. Vermutlich ging es um den neuen Schüler.
»Hast du ihn dir genau angesehen?« Drew seufzte und sah Ana verträumt an, als ich mich gerade zu den beiden umdrehte. Das war zu erwarten gewesen. Klatsch und Tratsch waren das Leben der beiden Stiefschwestern und ihrer Anführerin Amy und sie überschlugen sich fast täglich mit ihren Schwärmereien. Mich nervte dieses Getue.
»Der ist ein arroganter Arsch.«
Tödliche Blicke trafen mich.
»Was weißt du schon?«, sagte Drew finster.
»Er ist wirklich heiß«, schwärmte Ana und drehte eine Haarsträhne um ihren Finger. »Er heißt Phoenix.«
»Was? Wie der Vogel aus der Mythologie?«
Sie sahen mich irritiert an, zuckten jedoch synchron mit den Schultern. Vermutlich hatten sie keine Ahnung, was ein Phönix war. »Amy hat bereits mit ihm gesprochen und ihn an der Schule willkommen geheißen. Er schien sehr interessiert an ihr.«
Nun seufzten die beiden unisono und sahen so todunglücklich aus wie auf einer Beerdigung. Ich verschluckte mich beim Versuch, nicht laut loszuprusten, und musste einen Hustenanfall unterdrücken.
Gerade als Mrs Brewer mit dem Unterricht beginnen wollte, flog die Tür auf und donnerte lautstark gegen die Wand. Der Typ von vorhin trat erhobenen Hauptes ein und schob die Sonnenbrille in die Haare. Ohne mit der Wimper zu zucken, sah er sich im Raum um. In dem Moment, in dem er mich sah – oder sich erinnerte, dass er fünf Minuten zuvor in mich hineingerannt war –, kniff er seine Augen ein wenig zusammen und verzog den Mund zu einem Grinsen.
»Und wer sind Sie?«, fragte Mrs Brewer sichtlich irritiert.
»Phoenix«, war die knappe Antwort.
»Und weiter?«
Er schwieg und neigte bloß seinen Kopf zur Seite. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber Mrs Brewers Blick verschleierte sich kurz, ehe sie nickte. »Wie dem auch sei. Setzen Sie sich.«
Was war das denn?
Phoenix scannte noch einmal den Raum. Er schien ähnlich begeistert wie ich über die Tatsache, dass der einzige freie Platz neben mir war. Langsam trat er näher. Seine Bewegungen erinnerten mich an ein Raubtier – wo auch immer mein Kopf solche Vergleiche hervorkramte. Mit Raubtieren hatte ich bislang herzlich wenig zu tun gehabt.
Er ließ sich auf den Stuhl neben mir fallen und machte keine Anstalten, seine Sachen auszupacken.
»Sie können bei Ihrer Sitznachbarin mit in die Bücher schauen, solange Sie Ihre eigenen noch nicht haben«, wies Mrs Brewer ihn an.
Nein! Nicht auch das noch! Doch sofort rückte Phoenix mit seinem Stuhl näher zu mir. Ich wich ihm so gut es ging aus, während ich mein Mathebuch widerwillig ein wenig in seine Richtung schob und stur darauf starrte. So wie er sich auf den Stuhl flegelte, war er doch eh nicht am Lernen interessiert. Er strahlte etwas aus, das ich nicht zuordnen konnte. Wut? Ablehnung? Es war mir unangenehm, so nah bei ihm zu sitzen, und ich konnte mich definitiv nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren.
Als es endlich zum Ende der Stunde klingelte, raffte ich innerhalb von Sekunden meine Sachen zusammen, warf sie in die Tasche und verließ das Klassenzimmer, ohne mich noch einmal umzublicken. In der nächsten Stunde würde ich neben Cody sitzen – das war doch schon viel angenehmer.
Ich traf ihn dann auch schon bei unseren Spinden. Noch ehe ich ihm von dem neuen seltsamen Schüler erzählen konnte, berichtete er von ihm: »Wir haben einen Neuen«, sagte er und kramte in seinem Schließfach herum. »Er ist total nett und er spielt Bass.« Codys Augen leuchteten. Ich jedoch sah Phoenix schon vor mir, wie er mit seiner Sonnenbrille im dunklen Proberaum stand.
»Bitte nicht!«, flehte ich und Cody sah hinter seiner Schließfachtür hervor.
»Was denn? Du kennst ihn doch gar nicht. Er stand vorhin allein auf dem Flur und hat Heart-Shaped Box vor sich hin gesummt. So sind wir ins Gespräch gekommen. Und weil Xander ja aussteigen will, wäre ein schneller Ersatz umso besser.«
Die Aussage machte mich stutzig. Hätte Phoenix einen Song von Nirvana gesummt, hätte er bei mir vielleicht sogar ein paar Sympathiepunkte sammeln können. Seine überhebliche Art hatte eher das Gegenteil bewirkt. »Und ob ich ihn kenne. Er ist ein arroganter Mistkerl.«
Cody sah mich an, als hätte ich soeben seine Lieblingsgitarre an der Wand zerschmettert.
»Ich saß gerade eine Stunde lang mit ihm im Unterricht und er ist definitiv kein arroganter Mistkerl. Wann hast du ihn denn kennengelernt?«
Die Worte machten mich stutzig und ich runzelte die Stirn. »Ich war gerade eine Stunde mit ihm im Unterricht. Er saß direkt neben mir.«
»Das kann nicht sein.«
Typisch Cody. Ich lachte auf.
»Jetzt sollten wir aber los. Ich hab Hayden gesagt, dass ich gleich zurück bin und er sich gerne wieder neben mich setzen kann.«
»Hayden?«
»Der Neue! Was ist denn heute mit dir los? Du wirkst irgendwie total durcheinander.«
Ich schüttelte den Kopf, stieß die Tür meines Schließfachs zu und trottete gedankenverloren neben Cody her. Zwei neue Schüler an einem Tag – und das mitten im Schuljahr? Das klang eher nach einer guten Story für ein Buch als nach meinem Leben.
Kapitel 5 – Pünktlich zum Klingeln …
Pünktlich zum Klingeln kamen wir beim Unterrichtsraum für die zweite Doppelstunde des Tages an. Vor der Tür wartete ein Junge, der sich aufmerksam umsah. Er hatte dunkelblonde Haare, etwas kürzer als die von Cody, und sein freundliches Gesicht strahlte, als er uns sah. Cody beschleunigte seine Schritte, sodass ich es ihm gleichtun musste. »Kiera, das ist Hayden. Hayden, das ist Kiera, die Sängerin von Excellence.«
Dieser Hayden kannte also sogar schon unseren Bandnamen? Wetten, dass die beiden im Unterricht keine Sekunde aufgepasst hatten?
»Hallo, Kiera. Schön, dich kennenzulernen. Cody hat mir schon sehr viel von dir erzählt.« Hayden streckte mir die Hand entgegen. Der Kontakt verpasste mir einen Stromschlag und ich zog meine Hand schnell wieder zurück.
Ich musterte ihn genau und musste unwillkürlich lächeln. Hayden sah sofort weg und wirkte irgendwie verlegen. Irgendwie niedlich und äußerst sympathisch. Er war wirklich das totale Gegenteil von Phoenix.
Cody nickte in Richtung Klassenzimmer und wir gingen hinein. Der Platz auf Codys anderer Seite war unbesetzt und er bot Hayden an, sich dorthin zu setzen, ehe er selbst neben mir Platz nahm.
»Was grinst du so?«, fragte Cody flüsternd und lehnte sich dabei so weit zu mir herüber, dass mich sein warmer Atem streifte, der nach Kaugummi roch.
»Ich weiß, warum er dir so sympathisch ist.« Ich deutete mit einem kurzen Nicken zu Hayden, der gerade seine Stifte akribisch genau auf seinem Tisch platzierte.
»Er mag Nirvana. Wie könnte er mir da unsympathisch sein?«
Ich schüttelte den Kopf. »Daran liegt es nicht.«
Nun wurde er neugierig. Ich konnte in ihm lesen wie in einem offenen Buch. Doch er hakte nicht nach.
»Er sieht aus wie Anakin Skywalker«, flüsterte ich und verglich das Bild aus meiner Erinnerung mit dem Jungen an Codys linker Seite.
»Das stimmt doch gar nicht«, sagte Cody entrüstet.
Ich schnaubte nur und setzte hinzu: »Und dann heißt er auch noch Hayden. Das hat irgendeinen Nerd-Nerv bei dir getroffen, gib’s zu.«
»Gar nicht wahr.« Cody verschränkte die Arme vor der Brust, schien dann aber über meine Worte nachzudenken. Kurz darauf warf er wahnsinnig unauffällige Blicke zu dem Neuen hinüber.
Ich wartete auf Codys Reaktion und erkannte den Moment, in dem er verstand, was ich meinte, ganz genau. Seine Augen waren weit aufgerissen, als er wieder zu mir sah.
Sein Mund war zu einem Strich verzogen. »Du hast recht. Wenn man ihm ein Lichtschwert in die Hand gibt, steht der Verwandlung zu Darth Vader nichts mehr im Wege.« Er schluckte.
»Sei tapfer. Hayden wird schon nicht zur dunklen Seite der Macht gehören.«
»Redet ihr über mich?«, fragte Hayden und lehnte sich näher zu Cody.
Cody war so ein herzensguter Mensch und der schlechteste Lügner, den ich kannte. Daher druckste er nur herum, bis ich einen Lachanfall bekam.
»Normalerweise ist er nicht so«, entschuldigte ich Codys Verhalten und erklärte Hayden seine Ähnlichkeit mit dem jungen Darth Vader. Hayden schien lange darüber nachzudenken.
»Darth Vader war jung?« Er sah irgendwie irritiert aus, während Cody ihn nur mit weit aufgerissenem Mund anstarrte. Seine Fassungslosigkeit hätte man aus meilenweiter Entfernung gesehen.
Ich stupste meinen besten Freund mit der Schulter an und flüsterte: »Einen Makel muss er doch haben.«
Hayden hatte es trotz des Lärmpegels gehört und runzelte die Stirn. »Ich mache mir nicht viel aus Filmen.«
Das stimmte wohl. Ehe Cody seine Fassungslosigkeit abschütteln konnte, ging die Tür auf. Ich erwartete, dass unser Lehrer eintrat, doch es kam schlimmer.
Phoenix.
Ich sah zu Cody hinüber und versuchte, ihm via Gedankenübertragung mitzuteilen, dass das der Neue war, den ich gemeint hatte. Doch er sah mich nicht einmal an, sondern starrte mit zusammengekniffenen Augen auf Phoenix und verfolgte jeden seiner selbstsicheren Schritte.
Hayden spannte sich sichtlich an und plötzlich schien es im Raum mehrere Grad kühler zu werden und ein Schauer fuhr meinen Rücken hinab.
Ich sah von Hayden zu Phoenix und wieder zurück. Hatte ich jemals gedacht, dass ich