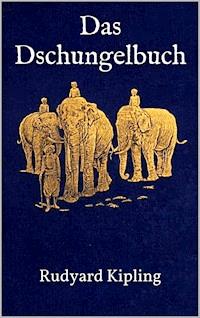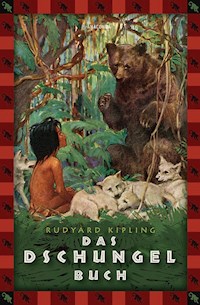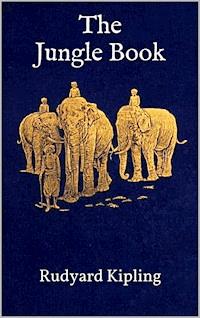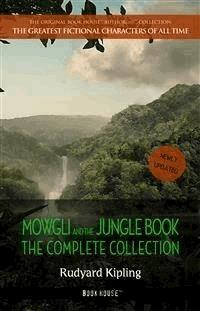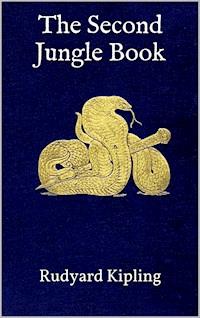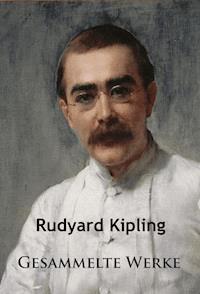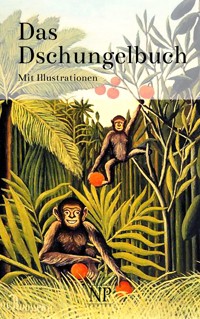0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Werk "Schlichte Geschichten aus den indischen Bergen" ist eine Sammlung von 41 Kurzgeschichten, geschrieben von Rudyard Kipling. Joseph Rudyard Kipling (* 30. Dezember 1865 in Bombay; † 18. Januar 1936 in London) war ein britischer Schriftsteller und Dichter. Seine bekanntesten Werke sind "Das Dschungelbuch" und der Roman "Kim". Außerdem schrieb er Gedichte und eine Vielzahl von Kurzgeschichten. Kipling gilt als wesentlicher Vertreter der Kurzgeschichte und als hervorragender Erzähler. Seine Kinderbücher gehören zu den Klassikern des Genres. 1907 erhielt er als damals jüngster und erster englischer Schriftsteller den Literaturnobelpreis. Verschiedene andere Ehrungen wie die britische Poet Laureateship und eine Erhebung in den Adelsstand lehnte er ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Rudyard Kipling
Schlichte Geschichten aus den indischen Bergen
Übertragen von Marguerite Thesing
Lispeth
Sie war die Tochter Sonoos aus den Bergen und Jadehs, seines Weibes. Eines Tages mißriet ihnen der Mais, und zwei Bären hausten die Nacht über in ihrem einzigen Mohnfeld oben über dem Sutlej-Tale nach Kotgarh zu; darum wurden sie Christen zur nächsten Erntezeit und brachten die Kleine ins Missionshaus zur Taufe. Der Kotgarh-Geistliche gab ihr den Namen Elisabeth, den man »Lispeth« spricht in den Bergen, bei den Pahari.
Später kam die Cholera ins Kotgarh-Tal und raffte Sonoo und Jadeh dahin, und Lispeth wurde bei der Frau des Geistlichen von Kotgarh halb Dienerin, halb Gesellschafterin. Das geschah nach der Zeit der Herrenhuter Missionare, aber damals, als Kotgarh seinen Namen »Herrin der nördlichen Berge« noch nicht ganz vergessen hatte.
Ob das Christentum Lispeth förderte, oder ob unter allen Umständen die Götter ihres Volks das gleiche für sie getan hätten, das weiß ich nicht; jedenfalls wurde sie sehr schön. Wenn ein Mädchen der Berge schön wird, ist es wert, daß man fünfzig Meilen über schlechte Wege wandert, um sie zu sehen. Lispeth hatte ein griechisches Gesicht, – ein Gesicht, wie man es oft malt, und selten sieht. Sie sah aus wie blasses Elfenbein und war außerordentlich groß für ihre Rasse. Dazu hatte sie Augen, die wunderbar waren; und wäre sie nicht in dem abscheulichen Kattun der Missionskleider einhergegangen, sie hätte dem, der ihr unerwartet am Berge begegnete, als das Urbild der auf die todbringende Jagd ausziehenden römischen Diana erscheinen müssen.
Lispeth nahm das Christentum leicht an und ließ es auch nicht, als sie zum Weibe reifte, wie es manches Mädchen in den Bergen tut. Ihre Landsleute haßten sie, weil sie eine Memsahib geworden war, wie sie sagten, und sich täglich wusch; und die Frau des Geistlichen wußte nicht, was sie mit ihr anfangen sollte. Eigentlich kann man von einer stolzen Göttin, die fast sechs Fuß mißt, nicht verlangen, Teller und Schüsseln zu waschen. Darum spielte sie mit den Kindern des Geistlichen, nahm teil am Unterricht der Sonntagsschule, las alle Bücher im Hause und wurde schöner und schöner, wie die Prinzessinnen im Märchen. Die Frau des Geistlichen meinte zwar, das Mädchen müsse nach Simla in Dienst gehen, als Kindermädchen oder als sonst etwas »Besseres«. Aber Lispeth wollte es nicht. Sie fühlte sich glücklich, wo sie war.
Kamen Reisende – nicht oft in jenen Jahren – nach Kotgarh, schloß sich Lispeth in ihr Zimmer ein, aus Furcht, man könne sie nach Simla, oder sonst wohin in die weite Welt mitnehmen.
Eines Tages, als sie einige Monate über siebzehn Jahr alt war, machte Lispeth einen Spaziergang. Sie machte es nicht wie die englischen Damen, die anderthalb Meilen zu Fuß gehen und den Rückweg fahren; sie legte zwanzig, dreißig Meilen zurück auf ihren »kleinen Nachmittagspromenaden«, kreuz und quer zwischen Kotgarh und Narkunda. Diesmal kam sie bei tiefer Dämmerung heim und machte den halsbrecherischen Abstieg nach Kotgarh mit etwas Schwerem im Arme. Die Frau des Geistlichen war im Wohnzimmer eingenickt, als Lispeth schweratmend und ganz erschöpft von ihrer Last eintrat. Lispeth legte sie aufs Sofa nieder und sagte schlicht: »Dies hier ist mein Mann. Ich fand ihn auf der Straße nach Bagi. Er hat sich verletzt. Wir wollen ihn pflegen, und wenn er gesund ist, soll Ihr Mann uns trauen.«
Es war das erstemal, daß Lispeth ihre Auffassung der Ehe kundgab, und die Frau des Geistlichen schrie vor Entsetzen. Allein zunächst mußte sie sich um den Mann auf dem Sofa kümmern. Er war ein junger Engländer; ein spitzer Gegenstand hatte ihm den Kopf bis zum Knochen aufgeschlagen Lispeth sagte, sie hätte ihn unten am Khud gefunden und hierhergebracht. Er atmete unregelmäßig und war bewußtlos.
Er wurde zu Bett gebracht und von dem Geistlichen, der etwas von Medizin verstand, verbunden; Lispeth wartete vor der Tür, für den Fall, daß sie sich nützlich machen könne. Sie setzte dem Geistlichen auseinander, daß das der Mann sei, den sie heiraten wolle, und der Geistliche und seine Frau kanzelten sie hart ab wegen ihres unpassenden Benehmens. Lispeth hörte still zu und wiederholte ihren Vorsatz. Es gehört ein gut Stück Christentum dazu, die unzivilisierten Instinkte des Ostens, wie die Liebe auf den ersten Blick, zu tilgen. Lispeth hatte den Mann gefunden, den sie anbetete, und sie sah nicht ein, warum sie ihre Wahl verschweigen sollte. Sie dachte auch nicht daran, sich fortschicken zu lassen. Sie wollte diesen Engländer pflegen, bis er wohl genug war, sie zu heiraten. Das war ihr harmloser, kleiner Feldzugsplan.
Nach vierzehntägigem leichten Wundfieber kam der Engländer zu vollem Bewußtsein und dankte dem Geistlichen, seiner Frau und Lispeth – besonders Lispeth – für ihre Güte. Er bereise den Osten, sagte er – von »Globetrottern« sprach man nicht in jenen Tagen, wo die junge P.&O. Linie noch klein war, – und sei von Dehra Dun gekommen, um in den Bergen von Simla Pflanzen und Schmetterlinge zu sammeln. In Simla kenne ihn daher niemand. Er glaube, er sei an der Felswand abgestürzt, als er an einem faulen Baumstamm nach einem Farn gegriffen; seine Kulis müßten wohl mit seinem Gepäck durchgegangen sein. Er wolle nach Simla zurück, sobald er sich etwas kräftiger fühle. Das Bergsteigen habe er satt.
Seine Abreise beeilte er nicht gerade, und nur langsam kam er wieder zu Kräften. Lispeth ließ sich weder von dem Geistlichen noch von seiner Frau bereden; darum sprach diese mit dem Engländer und erzählte ihm, wie es um Lispeths Herz stand. Er lachte herzlich und fand die Sache sehr niedlich und romantisch, das reinste Himalaya-Idyll. Da er sich aber in der Heimat verlobt habe, würde hier wohl nichts passieren. Selbstredend würde er vorsichtig sein. Und er war es. Trotzdem fand er es sehr angenehm mit Lispeth zu plaudern, mit Lispeth spazieren zu gehen, ihr allerlei Liebes zu sagen, ihr Kosenamen zu geben und sich langsam zu erholen. Ihm bedeutete das alles gar nichts, Lispeth die ganze Welt. Sie war glücklich in diesen beiden Wochen, denn sie hatte den Mann gefunden, den sie lieben konnte.
Als Kind der Wildnis gab sie sich keine Mühe, ihre Gefühle zu verbergen. Und dem Engländer machte das Spaß. Als er aufbrach, ging Lispeth mit ihm den Berg hinauf bis nach Narkunda, sehr, sehr unruhig und unglücklich. Die Frau des Geistlichen, als gute Christin abgeneigt gegen alles, was irgendwie Aufsehen oder gar Skandal erregen konnte mit Lispeth konnte sie gar nicht fertig werden – hatte dem Engländer geraten, er solle Lispeth sagen, daß er wiederkommen werde, um sie zu heiraten. »Sie ist das reinste Kind, wissen Sie, und, ich fürchte, im Grunde ihrer Seele eine Heidin,« sagte die Frau des Geistlichen. Darum versprach der Engländer auf dem zwölf Meilen langen Bergwege, den Arm um ihre Taille gelegt, daß er wiederkommen und sie heiraten werde; und Lispeth ließ es ihn immer wieder versichern. Sie weinte auf der Narkunda-Höhe, bis sie ihn auf dem Mutiana-Steig aus den Augen verlor.
Dann trocknete sie ihre Tränen, ging zurück nach Kotgarh und sagte zu der Frau des Geistlichen: »Er kommt wieder und heiratet mich. Er ist nur zu seinen Landsleuten gegangen, um es ihnen zu sagen.« Und die Frau tröstete Lispeth und sagte: »Er kommt wieder.« Als der zweite Monat zu Ende ging, wurde Lispeth ungeduldig und erfuhr, daß der Engländer übers Meer nach England gereist sei. Sie wußte, wo England lag, weil es in ihrer kleinen geographischen Schulfibel stand. Aber sie hatte natürlich keinen Begriff vom Meer, da die Berge ihre Heimat waren. Im Hause hatte man eine alte zusammensetzbare Weltkarte. Lispeth hatte damit gespielt, als sie Kind war. – Nun holte sie sie wieder hervor, setzte sie an den Abenden zusammen, weinte für sich und suchte sich vorzustellen, wo ihr Engländer sei. Da sie weder von Entfernungen noch von Dampfern einen Begriff hatte, waren ihre Vorstellungen einigermaßen falsch. Es hätte auch nicht das geringste ausgemacht, wenn sie völlig richtig gewesen wären. Denn der Engländer dachte nicht daran, wiederzukommen und ein Mädchen der Berge zu heiraten. Er hatte sie und ihre Welt schon ganz vergessen, als er in Assam Schmetterlinge jagte. Später schrieb er ein Buch über den Osten, aber Lispeths Name stand nicht darin.
Als der dritte Monat zu Ende ging, pilgerte Lispeth täglich nach Narkunda, um zu sehen, ob nicht ihr Engländer des Weges käme. Das gab ihr Trost, und die Frau des Geistlichen, die sie glücklicher fand, glaubte, daß sie ihre »barbarische und höchst unzarte Laune« überwunden habe. Bald darauf vermochten diese Gänge Lispeth nicht mehr zu trösten, und ihre Stimmung verschlimmerte sich sehr. Folglich hielt die Frau des Geistlichen die Zeit jetzt für geeignet, sie den wahren Stand der Dinge wissen zu lassen, – daß der Engländer ihr nur sein Wort gegeben hätte, um sie zu beruhigen, daß er keinerlei Absichten gehabt hätte, und daß es »nicht recht und nicht schicklich« für Lispeth sei, an eine Heirat mit einem Engländer zu denken, der aus feinerem Ton geknetet sei, und der sich überdies einem Mädchen seines Volkes versprochen habe. Lispeth erklärte, das wäre ja unmöglich, denn er hätte ihr doch gesagt, daß er sie liebe, und sie – die Frau des Geistlichen – hätte doch auch mit eigenem Mund bestätigt, daß er wiederkäme.
»Wie kann denn das nicht wahr sein, was Sie und er gesagt haben?« fragte Lispeth.
»Es war nur eine Ausflucht, um dich ruhig zu machen, Kind,« sagte die Frau des Geistlichen.
»Dann haben Sie mich also belogen,« sagte Lispeth, »Sie und er?«
Die Frau des Geistlichen senkte den Kopf und erwiderte nichts. Auch Lispeth schwieg ein Weilchen; dann ging sie ins Tal hinab und kam in der Tracht des Berglandes zurück, schandbar schmutzig, aber ohne Nasen- und Ohrringe. Sie hatte ihr Haar mit schwarzem Zwirn in einen langen Zopf geflochten, wie ihn die Weiber in den Bergen tragen.
»Ich will zu meinem Volk zurück,« sagte sie. »Lispeth habt ihr getötet. Nur der alten Jadeh Tochter ist übrig geblieben, die Tochter eines Pahari, die Dienerin der Tarka Devi. Ihr Engländer seid Lügner, alle miteinander.«
Ehe sich die Frau des Geistlichen von dem Schreck über Lispeths Umkehr zu den Göttern ihrer Mutter erholt hatte, war das Mädchen auf und davon; und sie kam nie wieder.
Sie schloß sich mit solcher Leidenschaft ihrem unsauberen Volk an, als wolle sie einholen, was das Leben, von dem sie schied, ihr schuldig geblieben war; nach kurzer Zeit heiratete sie einen Holzhauer, der sie nach Pahari-Weise schlug, und ihre Schönheit welkte bald.
»Es gibt keinen Maßstab für die Tollheiten der Heiden,« sagte die Frau des Geistlichen, »und ich glaube, daß Lispeth im Grunde ihrer Seele immer eine Ungläubige gewesen ist.« Wenn man bedenkt, daß Lispeth in dem reifen Alter von fünf Wochen in die Kirche aufgenommen war, macht dieser Ausspruch der Frau des Geistlichen keine Ehre.
Lispeth war eine sehr alte Frau, als sie starb. Des Englischen war sie stets mächtig, und wenn sie betrunken genug war, konnte man sie bisweilen dazu bewegen, die Geschichte ihrer ersten Liebe zu erzählen.
Dann war es schwer zu begreifen, daß das runzelige Wesen mit dem verschwommenen Blick, das einem rußigen Lumpenbündel so ähnlich sah, einstmals die »Lispeth aus dem Kotgarher Missionshaus« gewesen war.
Drei Walzer – – und eine Extratour
In der Ehe tritt immer eine Reaktion ein, manchmal eine starke, manchmal eine schwache, aber früher oder später kommt sie. Sie muß von ihr und von ihm überwunden werden, wenn sie beide ihr ferneres Leben lang nicht gegen den Strom schwimmen wollen.
Bei den Cusack-Bremmils trat die Reaktion erst im dritten Ehejahre ein. Selbst in der besten Zeit war Bremmil schwer zu fesseln gewesen. Aber, bis das Baby starb, war er doch ein idealer Gatte. Mrs. Bremmil ging in Schwarz, magerte ab und trauerte, als wenn dem Weltall der Boden ausgefallen wäre. Bremmil hätte sie vielleicht trösten sollen. Er versuchte es wohl auch; allein je mehr er tröstete, um so mehr grämte sich Mrs. Bremmil, und um so ungemütlicher fühlte sich folglich Bremmil. Tatsache war es, daß sie beide einer Arznei bedurften. Und das Heilmittel kam. Heute kann Mrs. Bremmil darüber lachen, aber damals erschien ihr die Sache gar nicht lächerlich.
Mrs. Hauksbee erschien nämlich auf der Bildfläche; und wo die hinkam, blieben Unruhe und Aufregung meistens nicht aus. In Simla nannte man sie die »Sturmschwalbe«; allein meines Wissens nach hatte sie sich diesen Beinamen schon fünfmal verdient. Sie war eine kleine, brünette, schlanke, mehr als schlanke Frau mit großen, lebhaften veilchenblauen Augen und den reizendsten Manieren von der Welt. Man konnte ihren Namen bei keinem Nachmittagstee erwähnen, ohne daß nicht jede Frau im Zimmer aufstand und – – nun, nicht gerade Segen auf ihr Haupt herabflehte. Sie war klug, witzig, geistvoll und sprühender als die meisten Frauen, aber von allen Teufeln der Bosheit und des Mutwillens besessen. Sie konnte nett sein, sogar zu ihrem eigenen Geschlecht. Aber das ist eine andere Geschichte.
Bremmil ging seiner Wege nach dem Tode des Babys und nach der allgemeinen Ungemütlichkeit, die dem folgte. Und Mrs. Hauksbee nahm ihn in Beschlag. Sie legte keinen Wert darauf, ihre Eroberungen zu verheimlichen. Sie nahm ihn öffentlich in Beschlag und sah darauf, daß man es sah. Er ritt mit ihr, er ging mit ihr spazieren, er plauderte mit ihr, machte Ausflüge mit ihr und frühstückte mit ihr bei Feliti, bis man die Stirne runzelte und »shocking« rief! Mrs. Bremmil blieb zu Hause, kramte unter den Sachen ihres toten Kindes und weinte über der leeren Wiege. Sie wollte von nichts anderem wissen. Aber schließlich machte ihr doch ein halb Dutzend guter Freundinnen ihre Lage klar, damit ihr ja nicht das Beste daran verloren ginge. Mrs. Bremmil nahm es ruhig hin und bedankte sich für den Liebesdienst. So klug wie Mrs. Hauksbee war sie nicht, aber sie war nicht dumm. Sie behielt alles für sich und sprach auch Bremmil nicht von dem, was sie gehört hatte. Das sollte man sich merken. Reden halten, oder über einen Mann weinen, hat noch nie genützt.
Wenn Bremmil zu Hause war, was selten geschah, war er zärtlicher als gewöhnlich; und dadurch zeigte er seine Karten. Die Zärtlichkeit sollte einerseits sein Gewissen, andererseits Mrs. Bremmil beschwichtigen. Beides mißlang.
Da wurden »Mr. und Mrs. Cusack-Bremmil zum 26. Juli 9½ Uhr nach Peterhoff gebeten. Im Auftrag Ihrer Exzellenzen Lord und Lady Lytton, der diensttuende Adjutant.« In der linken Ecke unten: »Es wird getanzt.«
»Ich kann nicht gehn,« sagte Mrs. Bremmil. »Es ist zu kurz – – die arme kleine Florrie – – Aber das braucht ja dich nicht abzuhalten, Tom.«
Im Augenblick meinte sie, was sie sagte, und Bremmil erwiderte, er wolle schon hingehen, natürlich nur, um die Form zu wahren. Er sagte die Unwahrheit, und Mrs. Bremmil wußte es. Sie ahnte, – – und die Ahnungen einer Frau sind zuverlässiger als eines Mannes Gewißheit, – – daß er von Anfang an hatte gehen wollen, und zwar mit Mrs. Hauksbee. Sie saß und überlegte, und das Ergebnis dieser Überlegung war die Erkenntnis, daß das Andenken eines toten Kindes die Zuneigung eines lebenden Gatten bei weitem nicht aufwiegt, Sie entwarf ihren Plan und setzte ihr Alles darauf. In jener Stunde wurde ihr klar, daß sie Tom Bremmil bis ins Tiefste kannte, und diese Erkenntnis setzte sie in die Tat um.
»Tom,« sagte sie, »am 26. abends bin ich bei Longmores zu Tisch. Willst du nicht lieber im Klub essen?«
Damit ersparte sie Bremmil eine Ausrede, mit der er sich zum Essen mit Mrs. Hauksbee hatte frei machen wollen. Er war ihr dankbar dafür, kam sich aber zugleich kleinlich und schlecht vor. Und das schadete ihm nichts. Bremmil verließ das Haus um fünf Uhr, um auszureiten. Gegen halb sechs kam ein großer lederüberzogener Korb von Phelps für Mrs. Bremmil. Sie war eine Frau, die sich zu kleiden verstand; und sie hatte nicht umsonst eine Woche damit zugebracht, dies Kleid zu entwerfen, es zu schneiden, säumen, versteifen, es bauschen und rauschen machen zu lassen, oder wie die Ausdrücke alle heißen mögen. Es war ein pompöses Kleid, – Halbtrauer natürlich. Ich kann's nicht beschreiben, aber die »Queen« hätte es eine »Creation« genannt. Es war ein niederschmetterndes, atemberaubendes Kleid. Sie ging nicht gerade mit Mut an die Ausführung ihres Planes. Aber als sie vor dem großen Spiegel stand, mußte sie sich mit Genugtuung gestehen, daß sie nie in ihrem Leben so gut ausgesehen hatte. Sie war eine große Blondine und hatte, wenn sie wollte, eine prachtvolle Haltung.
Nach dem Essen bei Longmores ging sie auf den Ball nicht allzufrüh – und traf in der Tür Bremmil, Mrs. Hauksbee am Arm. Ihr Blut wallte auf, und sie sah einfach herrlich aus, als sich die Herren um ihre Tanzkarte rissen. Sie vergab alle Tänze, bis auf drei, und die ließ sie frei. Mrs. Hauksbee fing von ihr einen Blick auf und wußte, daß er Krieg zwischen ihnen bedeutete, Krieg bis aufs Messer. Sie ging schon etwas benachteiligt in den Kampf, denn sie hatte Bremmil ein ganz klein wenig zu viel herumkommandiert, und er fing gerade an, es lästig zu finden. Überdies war ihm seine Frau nie so reizvoll erschienen. Er staunte sie von der Saalecke aus an, er starrte ihr von den Gängen aus nach, wenn sie mit ihren Tänzern vorbeiging, und je mehr er starrte, um so mehr nahm sie ihn gefangen. Er konnte kaum glauben, daß das dieselbe Frau war, die mit roten Augen und im wollenen Trauerkleide morgens über dem Frühstückstisch weinte.
Mrs. Hauksbee tat ihr Bestes, ihn auf ihrer Seite zu behalten, aber schon nach den nächsten zwei Tänzen ging er zu seiner Frau über und bat sie um einen Tanz.
»Ich fürchte, Sie kommen zu spät, Mister Bremmil,« sagte sie mit schelmisch blitzenden Augen.
Er mußte um einen Tanz betteln und erhielt schließlich als große Gunst den fünften Walzer. Glücklicherweise war der fünfte auf seiner Karte frei.
Sie tanzten zusammen, und durch den Saal ging eine leise Bewegung. Bremmil hatte eine dunkle Ahnung gehabt, daß seine Frau tanzen könne, aber daß sie so göttlich tanze, war ihm neu. Nach dem ersten Walzer erbat er einen zweiten – selbstverständlich als große Gunst, nicht etwa als sein Recht. Und Mrs. Bremmil sagte: »Zeig mir deine Tanzkarte, mein Schatz.« Er zeigte sie ihr, wie ein Schuljunge seinem Lehrer verbotene Süßigkeiten aushändigt. Sie war mit H.'s besät, auch bei der Tischführung stand ein H. – Mrs. Bremmil sagte gar nichts, aber sie lächelte verächtlich und strich mit dem Bleistift Nummer 7 und 9, – zwei H.s, – aus und gab sie ihm mit ihrem Namen, – einem Kosenamen, den nur sie und er gebrauchten, – zurück. Dann drohte sie ihm mit dem Finger und sagte lachend: »Du dummer, dummer Kerl!«
Mrs. Hauksbee hatte das gehört und fühlte, daß sie den Kürzeren gezogen hatte, wie sie später gestand. Bremmil nahm den siebenten und neunten dankbar an. Den siebenten tanzten sie, den neunten versaßen sie in einem der kleinen Zelte. Was Bremmil sagte, und auch was Mrs. Bremmil sagte, geht keinen von uns etwas an.
Als die Musik »The Roast Beef of Old England« zu spielen begann, gingen die beiden auf die Veranda, und Bremmil sah sich nach dem »Dandy« (es war noch vor der Zeit der Rickshaws) seiner Frau um, während sie in der Garderobe war. Mrs. Hauksbee erschien und sagte: »Sie führen mich doch zu Tisch, Mr. Bremmil?« Bremmil wurde rot und sah dumm aus: »Ach – – hm! Ich gebe mit meiner Frau nach Hause, Mrs. Hauksbee. Es muß wohl ein Mißverständnis vorliegen.« Als Mann redete er natürlich so, als wenn Mrs. Hauksbee ganz allein daran schuld wäre.
Mrs. Bremmil kam aus der Garderobe in einem Schwanenfedermantel mit einem duftigen weißen Schal um den Kopf. Sie strahlte, und sie hatte auch guten Grund dazu.
Das Paar verschwand in der Dunkelheit. Bremmil ritt sehr nahe an dem Dandy.
Dann sagte Mrs. Hauksbee zu mir, – sie sah im Lampenlicht etwas welk und abgespannt aus –: »Glauben Sie mir, die dümmste Frau kann einen klugen Mann lenken, aber es muß schon eine sehr kluge Frau sein, die mit einem Narren fertig wird.«
Dann gingen wir zu Tisch.
Vergeudet
Einen jungen Menschen, der in die Welt hinaus soll und auf eigenen Füßen stehen muß, nach dem von Eltern so beliebten Bevormundungssystem zu erziehen, zeugt nicht von Klugheit. Er muß schon eine Ausnahme unter Tausend sein, wenn er sich nicht durch eine Menge völlig unnötiger Widerwärtigkeiten durchschlagen soll; und unter Umständen wird er scheitern, aus dem einfachen Grund, weil er die wahren Verhältnisse von Wert und Unwert nicht kennengelernt hat.
Man lasse einen jungen Hund getrost die Seife im Badezimmer fressen oder einen frisch gewichsten Stiefel anknabbern, er wird vergnügt knurrend weiterknabbern, bis er schließlich merkt, daß ihm nach Hammeltalg und Wichse sehr schlecht wird. Und daraus wird er folgern, daß ihm weder Seife noch Stiefel gut bekommen. Und daß es eine Dummheit ist, einen großen Hund ins Ohr zu beißen, wird ihm schon sehr bald der erste beste ältere Hund aus der Nachbarschaft beibringen. Da er jung ist, wird er's nicht vergessen und mit sechs Monaten schon wohlerzogen und verfeinerten Geschmackes ins Leben hinausgehen. Man stelle sich aber die schrecklichen Übelkeiten und die Prügel vor, die er hätte ausstehen müssen, wenn man ihn von Seife, Wichse und großen Hunden schützend ferngehalten hätte, bis er mit männlich scharfen Zähnen zur hohen Schule des Lebens herangereift wäre. Dann wende man diese Erkenntnis auf das Bevormundungssystem an und achte auf seine Ergebnisse. Es ist immer noch, um ein nicht gerade schönes Wort zu gebrauchen, das größere von zwei Übeln.
Es war einmal ein junger Mensch, der nach der Theorie des Bevormundungssystems auferzogen worden war. Und die Theorie war sein Tod. Er lebte vom Tage seiner Geburt an im Schoß der Familie, bis er, fast als Primus, auf die Kriegsschule nach Sandhurst kam. Er war in allem, was ein Privatlehrer gut zensiert, ausgezeichnet unterrichtet, und sein Zeugnis trug die gewichtige Bemerkung, daß er »seinen Eltern nie im Leben eine Stunde Kummer bereitet habe.« Was er in Sandhurst außer dem regelrechten Pensum lernte, ist nicht der Rede wert. Aber er sah um sich und fand Seife und Wichse sozusagen recht gut. Er aß davon und kam nicht gerade als Primus aus Sandhurst zurück. Es gab im Zwischenakte eine Szene mit den Seinigen, die viel von ihm erwartet hatten. Dann folgte ein Jahr »vom Gift des Lebens unberührt« in einem Regiment dritten Ranges, wo die jüngeren Offiziere Kinder waren und die älteren alte Weiber. Schließlich kam er nach Indien, wo er, abgeschnitten vom Beistand seiner Eltern, in schlimmen Zeiten nur auf sich selbst angewiesen war.
Nun ist Indien das Land vor allen Ländern, wo man nichts zu ernst nehmen darf – die Mittagsglut natürlich ausgenommen. Zuviel: Arbeit und allzuviel Energie bringen dort einen Menschen gerade so sicher um, wie zuviel Laster und Alkohol. Liebeleien haben nichts auf sich, weil ja jeder bald versetzt wird; weil entweder er oder sie die Garnison verläßt, um nicht wieder zurückzukehren. Tüchtige Arbeit hat nichts auf sich, weil jeder nach seinen schlechtesten Leistungen beurteilt wird, und weil sein Bestes gewöhnlich doch nur anderen zugute kömmt Untüchtige Arbeit hat nichts auf sich, weil andere nicht tüchtiger sind, und weil die Unfähigkeit sich in Indien länger hält als sonstwo. Vergnügungen haben nichts auf sich, weil man sie, kaum genossen, auch schon wiederholen muß, und weil die meisten Vergnügungen nur darin bestehen, sich anderer Leute Geld zu gewinnen. Auch Krankheit hat nichts auf sich, weil sie alltäglich ist, und weil ein anderer des Töten Amt und Würden einnimmt schon in den acht Stunden zwischen Tod und Begräbnis. Gar nichts hat etwas auf sich, nur Heimatsurlaub und Zuschüsse, und auch das nur der Seltenheit wegen. Es ist ein schwerfälliges, ein »kutcha« (rohes) Land, wo alle mit unvollkommenen Mitteln arbeiten, wo man am klügsten niemand und nichts ernst nimmt, und aus dem man am besten möglichst bald in eine Gegend flüchtet, wo Vergnügen wirklich Vergnügen ist, und wo es sich noch lohnt, einen guten Ruf zu haben.
Der junge Mensch nun – die Geschichte ist eigentlich so alt wie das Land – kam und nahm alles ernst. Er war hübsch und wurde verhätschelt. Und auch das Verhätscheln nahm er ernst. Frauen rieben ihn auf, die nicht wert waren, daß man ein Pony sattelte, um zu ihnen zu reiten. Sein neues, freies Leben in Indien gefiel ihm sehr. Und es erscheint unter dem Gesichtswinkel eines Leutnants – zuerst wirklich reizvoll: nichts als Ponys, Spielpartner, Tanzereien usw. Er kostete davon wie ein junger Hund von der Seife. Nur kam er leider erst zum Kosten, als seine Zähne schon männlich scharf waren. Er fühlte sich nicht sicher – ganz wie der junge Hund – und begriff nicht, warum man ihn nicht mit derselben Rücksicht behandelte wie im Hause seines Vaters. Das kränkte ihn.
Er entzweite sich mit anderen jungen Leuten, und da er äußerst empfindlich war, vergaß er es nicht und regte sich darüber auf. Er fand Gefallen am Whist, an Gymkhanas und ähnlichen Dingen, mit denen man sich nach dem Dienst zerstreut. Aber er nahm auch die ernst, genau so ernst, wie er einen »Kater« nahm. Und weil er ein Neuling war, verlor er beim Spielen sein Geld.
Und auch seine Verluste nahm er ernst. Er verwandte ebensoviel Energie und Interesse auf ein billiges Rennen von Ekkapony-Erstlingen mit Stutzmähnen wie auf ein Derby. Daran war einesteils seine Unerfahrenheit schuld – wie bei einem jungen Hund, der ärgerlich den Zipfel des Kaminteppichs anbellt; zum andern Teil kam es von dem Schwindel her, der ihn ergriff, als er aus seiner Ruhe in den unruhigen Glanz eines bewegteren Lebens hineintaumelte. Niemand warnte ihn vor Seife und Stiefelwichse, denn ein Durchschnittsmensch hält es für selbstverständlich, daß ein anderer Durchschnittsmensch sich davor in acht nimmt. Es war herzzerreißend mit anzusehen, wie der Junge sich die Stirn einrannte. Es war nicht viel anders, als wenn ein zu hart gerittenes Füllen, das dem Stallknecht durchgeht, in die Knie bricht und sich zerschlägt.
Die Zügellosigkeit bei Vergnügungen, die kein Ausbrechen lohnen, geschweige denn ein wildes Toben, dauerte sechs Monate: die ganze kühle Jahreszeit hindurch. Wir glaubten, daß die Hitze und die Erkenntnis, Geld und Gesundheit eingebüßt und seine Pferde lahm geritten zu haben, den ›Jungen‹ zur Vernunft und zum Stehen bringen würden. In neunundneunzig Fällen von hundert wäre das auch sicherlich geschehen. Man kann diesen Vorgang in jeder indischen Garnison gesetzmäßig verfolgen. Aber gerade dieser Fall war eine Ausnahme. Denn der ›Junge‹ war empfindsam und nahm alles ernst, was ich nun wohl schon zehnmal gesagt habe. Wir konnten natürlich nicht wissen, in welchem Lichte ihm seine Tollheiten erschienen. Außergewöhnlich oder gar erschütternd waren sie nicht. Er war finanziell fürs Leben vielleicht lahm gelegt und bedurfte daher einiger Fürsorge. Doch eine einzige heiße Saison würde die Erinnerung an seine Streiche absterben lassen, und irgendein Wucherer hätte ihm über seine Geldnöte hinweggeholfen. Aber er muß wohl eine ganz andere Auffassung der Dinge gehabt und sich für rettungslos verloren gehalten haben. Sein Oberst redete ihm am Schluß der kalten Jahreszeit ins Gewissen. Das machte ihn noch unglücklicher; und es war doch nur ein ganz gewöhnlicher »Rüffel«.
Was nun eintrat, ist ein merkwürdiges Beispiel für die Art und Weise, wie wir alle miteinander verkettet und füreinander verantwortlich sind. Das, was dem ›Jungen‹ den letzten Stoß gab, war die Bemerkung einer Frau, mit der er plauderte. Sie zu wiederholen ist zwecklos, denn es war eine von den kleinen, oft grausamen Bemerkungen, die man hinwirft, ohne sie bedacht zu haben. Aber ihm trieb sie das Blut zu Kopf. Er blieb drei Tage lang ganz für sich und kam dann um zwei Tage Urlaub ein. Er wollte angeblich in der Nähe eines etwa dreißig Meilen entfernten Unterkunftshauses für Kanal-Ingenieure jagen. Er bekam Urlaub und war abends bei der Offiziersmesse lauter und herausfordernder denn je. Er wolle Hochwild jagen, sagte er, und fuhr um halb elf in einer Ekka fort. In der Nähe des Unterkunftshauses gab es nur Rebhühner, und das ist doch kein Hochwild. Darum lachten alle.
Am nächsten Morgen kam ein Major von kurzem Urlaub zurück und hörte, daß der ›Junge‹ auf Hochwildjagd gegangen sei. Der Major hatte den ›Jungen‹ liebgewonnen und ihn öfter während der kalten Zeit im Zaum zu halten versucht. Er runzelte die Stirn, als er von dem Ausflug hörte und ging auf die Zimmer des ›Jungen‹, um sie zu durchstöbern.
Als er kurz darauf zurückkam, machte ich gerade dem Kasino meinen Besuch. Außer uns war niemand im Vorzimmer.
Er sagte: »Der ›Junge‹ ist auf der Jagd. Schießt man Hochwild mit einem Revolver und einem Schreibzeug?«
Ich sagte: »Unsinn, Major!« denn ich verstand, was er meinte.
Er sagte: »Unsinn oder nicht, ich fahr' nach dem Kanal – im Augenblick. Ich habe keine Ruhe.«
Dann sagte er nach einer Minute Überlegung: »Können Sie lügen?«
»Das wissen Sie am besten,« gab ich zur Antwort. »Es ist ja mein Beruf.«
»Also gut,« sagte der Major, »Sie müssen mit mir in einer Ekka zum Kanal kommen, gleich, im Augenblick, Schwarzwild schießen. Ziehen Sie sich Ihren Jagdanzug an, rasch, und fahren Sie mit Ihrer Büchse hier wieder vor.«
Der Major war ein energischer Mann; und ich wußte, daß er keinen Befehl umsonst gab. Darum gehorchte ich und fand bei meiner Rückkehr alles bereit für einen Jagdausflug; den Major in einer Ekka, Flintentaschen und Proviant aufgeladen.
Er entließ den Kutscher und fuhr selbst. Im Ort ging es noch im Schritt. Aber sobald wir die staubige Straße und die Ebene erreicht hatten, ließ er das Pony ausgreifen. Ein indisches Pferd kann zur Not alles leisten. Wir legten die dreißig Meilen in noch nicht drei Stunden zurück, aber das arme Tier war auch halbtot.
Einmal sagte ich: »Warum solch elende Eile, Major?«
Er antwortete ruhig: »Der ›Junge‹ ist schon seit einer, zwei, fünf, – vierzehn Stunden jetzt, allein! Ich sage Ihnen ja, ich habe keine Ruhe!«
Seine Unruhe kam auch über mich, und ich half das Pony anpeitschen.
Als wir das Unterkunftshaus erreichten, rief der Major nach dem Diener des ›Jungen‹, erhielt aber keine Antwort. Wir gingen ans Haus heran, riefen den ›Jungen‹ mit Namen und erhielten ebenfalls keine Antwort.
»Er wird noch jagen,« sagte ich, und im gleichen Augenblick sah ich in einem Fenster Licht von einer Windlaterne. Es war vier Uhr nachmittags. Wir blieben wie versteinert in der Veranda stehen und hielten den Atem an, um jeden Laut zu erhaschen. Da hörten wir vom Zimmer her das Brr – brr – brr – von tausend Fliegen. Der Major sagte nichts, aber er nahm seinen Helm ab, und wir schlichen ins Zimmer.
Der ›Junge‹ lag mitten im kahlen, weißgetünchten Zimmer tot auf dem Feldbett. Er hatte sich mit einem Revolverschuß den Schädel fast zerschmettert. Gewehrtasche und Bettzeug waren noch verschnürt. Auf dem Tisch lag seine Schreibmappe mit Photographien. Er war in den Tod gegangen, hatte sich verkrochen wie eine vergiftete Ratte!
Der Major sagte leise vor sich hin: »Armer Junge; armer, armer Teufel!« Dann wandte er sich vom Lager ab und sagte: »Ich brauche Ihre Hilfe in dieser Sache.«
Da ich wußte, daß der ›Junge‹ durch eigene Hand gestorben war, verstand ich, was er mit dieser Hilfe meinte. Ich ging also zum Tisch, nahm einen Stuhl, zündete mir eine Zigarre an und sah die Schreibmappe durch. Der Major blickte mir über die Schulter und sagte immer wieder leise: »Zu spät gekommen! – Wie eine Ratte im Loch! – Armer, armer Teufel!«
Der ›Junge‹ mußte wohl die halbe Nacht darüber verbracht haben, an die Seinigen, seinen Oberst und an ein Mädchen in der Heimat zu schreiben. Nachdem er damit zu Ende gewesen, mußte er sich erschossen haben. Denn er war schon lange tot, als wir kamen.
Ich las alles, was er geschrieben hatte und gab dann Blatt für Blatt dem Major.
Wir sahen aus seinem Bericht, wie schwer er alles genommen hatte. Er schrieb von »unerträglicher Schmach«, – von »unauslöschlicher Schande«, »sträflichem Leichtsinn«, »einem verpfuschten Leben« und so fort. Daneben standen viel private Dinge für Vater und Mutter, viel zu heilig alles, um abgedruckt zu werden. Der Brief an das Mädchen zu Hause war der traurigste. Mir stieg etwas in die Kehle, als ich ihn las. Der Major machte keinen Versuch, trockenen Auges zu bleiben. Ich achtete ihn darum. Er las und der Schmerz schüttelte ihn. Er weinte unbekümmert wie ein kleines Kind. Die Briefe waren so trostlos, so hoffnungslos und so ergreifend. Wir vergaßen die Torheiten des ›Jungen‹ und dachten nur an das, was so armselig auf dem Feldbett lag, und an das Geschreibsel in unserer Hand. Es war völlig undenkbar, die Briefe in die Heimat gehen zu lassen. Sie hätten seines Vaters Herz gebrochen und seine Mutter getötet, nachdem sie erst den Glauben an ihren Sohn getötet hätten.
Schließlich trocknete der Major ruhig seine Tränen und sagte: »Eine nette Überraschung für eine ahnungslose englische Familie. Was sollen wir tun?«
Ich wußte, warum mich der Major mitgenommen hatte und antwortete: »Der ›Junge‹ ist an der Cholera gestorben. Wir waren in der Zeit bei ihm. Wir dürfen uns nicht mit Halbheiten begnügen. Kommen Sie.«
Darauf folgte die traurigste Komödie, die ich je mitgespielt habe: das Erdichten eines ungeheuren Lügenbriefes, der doch strotzen mußte von Glaubwürdigkeiten, um des ›Jungen‹ Haus zu trösten. Ich begann den Brief zu entwerfen, und der Major gab mir, während er das Geschreibsel des ›Jungen‹ zusammenraffte und im Kamin verbrannte, hie und da einen Wink. Als wir anfingen, war es Abend, heiß und ruhig. Die Lampe brannte nur trübe. Allmählich gelang mir der Entwurf. Ich schrieb, daß der ›Junge‹ ein Muster aller Tugenden, der Liebling seines Regimentes gewesen wäre, daß er alle Aussicht auf eine glänzende Laufbahn gehabt hätte und noch mehr; daß wir ihm in seiner Krankheit beigestanden hätten, – für kleine Lügen, versteht sich, war kein Raum – und daß er leicht gestorben wäre. Wieder würgte mich etwas an der Kehle, als ich das niederschrieb und an die Ärmsten dachte, die es lesen würden. Und dann lachte ich auf über das Possenhafte, und ins Lachen mischten sich wieder Tränen, bis der Major erklärte, wir hätten jetzt Alkohol nötig.
Ich wage nicht, zu sagen, wieviel Whisky wir getrunken hatten, ehe der Brief fertig war. Wir spürten nichts davon. Wir nahmen des ›Jungen‹ Uhr, sein Medaillon und seine Ringe.
Zuguterletzt sagte der Major: »Wir müssen auch eine Locke schicken. Frauen legen Wert darauf.«
Wir hatten aber guten Grund, ihm keine Locke abzuschneiden. Der ›Junge‹ hatte schwarze Haare; der Major glücklicherweise ebenfalls. Ich schnitt dem Major mit dem Messer eine Locke von der Schläfe und legte sie unserer Sendung bei. Lachen und Schluchzen packte mich wieder, und ich mußte aufhören. Dem Major ging es kaum anders. Und doch wußten wir beide, daß die schlimmere Arbeit erst getan werden mußte.
Wir verschlossen die Sendung: Photographien, Medaillon, Petschafte, Ringe, Brief und Locke, alles mit dem Siegel des ›Jungen‹.
Darauf sagte der Major: »Um Gotteswillen lassen Sie uns hier fortgehen, aus dem Zimmer fort, wir müssen weiter denken.«
Wir gingen hinaus und schritten am Kanalufer auf und nieder und aßen und tranken, was wir mit uns hatten, bis der Mond aufging. Heute weiß ich genau, wie einem Mörder zumute ist. Wir zwangen uns schließlich dazu, in das Zimmer mit der Lampe und dem, was noch drinnen war, zurückzugehen, und die neue Arbeit begann. Ich schreibe darüber nicht. Es war zu grauenvoll. Wir verbrannten die Bettstatt und warfen die Asche in den Kanal. Wir hoben die Matten vom Boden und verbrannten auch sie. Ich ging ins Dorf, um Spaten zu holen – fremder Leute Hilfe wollte ich nicht –, während der Major – – das andere besorgte. Vier harte Stunden lang gruben wir das Grab. Bei der Arbeit stritten wir darüber, ob es richtig wäre, über dem Grabe die Begräbnisformeln, soweit wir uns ihrer erinnerten, zu sprechen. Wir einigten uns auf das Vaterunser und auf ein persönliches, formloses Gebet für den Seelenfrieden des ›Jungen‹. Dann schütteten wir das Grab zu und legten uns auf der Veranda – nicht im Hause – zur Ruhe. Wir waren sterbensmüde.
Beim Aufwachen sagte der Major stumpf: »Wir können vor morgen nicht zurück. Wir müssen ihm schon die nötige Zeit zum Sterben lassen. Vergessen Sie nicht, daß er erst heute morgen gestorben ist. Das klingt natürlicher.«
Der Major mußte also die ganze Nacht wach gelegen und gegrübelt haben. Ich erwiderte: »Weshalb haben wir eigentlich die Leiche nicht ins Quartier zurückgebracht?«
Der Major sann einen Augenblick nach: »Weil die Leute ausgerissen sind, als sie von der Cholera hörten. Weil die ›Ekka‹ fort war.«
Das war in der Tat wahr. Wir hatten das Ekkapony ganz vergessen, und es war allein wieder nach Hause gelaufen.
Also waren wir uns selbst überlassen, den ganzen langen schwülen Tag im Unterkunftshaus am Kanal. Wir prüften wieder und immer wieder unsere Geschichte vom Tode des ›Jungen‹, ob sich auch nicht etwa eine schwache Stelle darin befände.
Nachmittags erschien plötzlich ein Einheimischer. Wir sagten ihm, daß ein »Sahib« an der Cholera gestorben sei, und fort war er. Als die Dämmerung kam, sprach mir der Major von seinen alten Sorgen um den ›Jungen‹, und erzählte schreckliche Geschichten von Selbstmord und verhindertem Selbstmord, bis uns die Haare zu Berge standen. Er sagte, daß er, als er jung und das Land ihm fremd war, auch auf dem Wege zum Tal der Schatten gestanden hätte, ganz wie der ›Junge‹. Und darum könne er dem armen ›Jungen‹ die chaotischen Kämpfe nachfühlen. Er sagte auch, daß junges Volk in Augenblicken der Reue seine Sünden stets für schwerer und unverzeihlicher hält, als sie es in Wirklichkeit sind. Wir verplauderten den ganzen Abend und gingen immer wieder die Geschichte von des ›Jungen‹ Tod durch. – Als der Mond aufgegangen, und der ›Junge‹ – unserer Theorie nach – eben begraben sein konnte, gingen wir geraden Wegs über Land zur Garnison. Wir liefen von acht Uhr abends bis zum nächsten Morgen sechs Uhr. Obgleich wir todmüde waren, vergaßen wir doch nicht in des ›Jungen‹ Zimmer zu gehen, um seinen Revolver mit der fehlenden Munition an Ort und Stelle zu tun; und auch die Schreibmappe legten wir auf den Tisch. Wir suchten den Oberst auf und meldeten ihm den Todesfall. Mehr denn je fühlten wir uns als Mörder. Dann gingen wir zu Bett und schliefen, bis der Zeiger wieder auf der gleichen Stelle stand. Wir waren völlig erschöpft.
Unsere Geschichte wurde geglaubt, solange es nötig war. Denn nach vierzehn Tagen dachte niemand mehr an den ›Jungen‹. Einige fanden nur noch Zeit, zu bemerken, der Major habe unverantwortlich gehandelt, daß er dem Toten die Möglichkeit eines militärischen Begräbnisses genommen habe. Das Traurigste von allem war der Brief von des ›Jungen‹ Mutter an den Major und mich, mit großen Tintenflecken, die den Bogen bedeckten. Sie schrieb uns viel Liebes über unsere große Güte, und daß sie ihr Leben lang uns dankbar sein würde.
Und in Wahrheit hatte sie auch Grund uns dankbar zu sein, nur nicht ganz aus dem Grund, den sie meinte.
Miss Youghals »Sais«
Hier und da hört man die Behauptung, es gäbe in Indien keine Romantik. Aber hier und da irrt man sich. Unser Leben hat so viel Romantik, wie uns gut tut. Manchmal auch mehr.
Strickland war bei der Polizei. Die Leute verstanden ihn nicht. Darum sagten sie, er sei ein Mann von zweifelhaftem Charakter, und wichen ihm aus. Strickland hatte sich das selbst zu verdanken. Er hatte das sonderbare Prinzip, daß ein Polizeibeamter in Indien die Einheimischen ebensogut kennen müsse wie die Einheimischen sich selbst. Nun gibt es aber zur Zeit in ganz Oberindien nur einen einzigen Menschen, der sich nach Belieben für einen Mohammedaner oder Hindu, für einen einheimischen Schuhflicker oder Fakir ausgeben kann. Und der ist geachtet und gefürchtet bei den Leuten von Ghor Kathri bis zum Jamma Musjid. Von ihm glaubt man, daß er sich unsichtbar machen kann, und .daß er Gewalt hat über alle Teufel. – Aber was hat ihm das schließlich bei der Regierung genützt? Nicht das geringste. Er ist darum nicht Vizekönig geworden, und sein Name blieb England unbekannt.
Strickland war so töricht, sich diesen Mann zum Vorbild zu wählen. Treu seinem Prinzip stöberte er in lauter anrüchigen Gegenden herum, die zu erforschen sich kein anständiger Mensch herabgelassen hätte, – in allen schmutzigen Winkeln, und Ecken. Er bildete sich sieben Jahre lang in dieser eigentümlichen Weise aus, aber die Leute wußten es nicht zu würdigen. Er suchte unablässig Geheimnisse der Einheimischen auszuspionieren, was natürlich jeder vernünftige Mensch für Unsinn hielt. Während seines Urlaubs wurde er einmal in Allahabad in die »Sat Bhai« aufgenommen. Er kannte das Eidechsen-Lied der »Sansis« und den Halli-Hukk-Tanz, einen religiösen Cancan von etwas aufregender Natur. Wer weiß, wann, wie und wo der Halli-Hukk-Tanz getanzt wird, kann stolz darauf sein, denn dann kennt er mehr als die äußere Schale der Verhältnisse. Strickland war nicht stolz, obwohl er einmal in Jagadhri beim Bemalen des Totenstieres – für jedes englische Auge ein Geheimnis – geholfen hatte, obwohl er die Diebessprache der »Changars« beherrschte, obwohl er einmal einen abgefeimten Pferdedieb bei Attok ganz allein gefangen hatte und ein andermal sogar auf der Kanzel einer Grenzmoschee gestanden und den Gottesdienst ganz wie ein »Mullah« abgehalten hatte.
Die Krone seiner Leistungen war sein elftägiger Aufenthalt als Fakir in den Gärten von »Baba Atal« in Amritsar, bei dein er die Spuren der großen Nasiban-Mordaffäre auffand. Aber die Leute sagten ja ganz richtig: »Warum in aller Welt bleibt Strickland nicht ruhig in seinem Bureau sitzen; kann er nicht einfach seine Berichte schreiben, neue Beamte einführen und sich still halten, statt immer nur die Unfähigkeiten seiner Vorgesetzten aufzudecken?« Aus diesem Grunde half ihm selbst die Nasiban-Sache nicht vorwärts. Und darum kehrte er, als sich sein erster Zorn gelegt hatte, wieder zu seiner seltsamen Gewohnheit zurück, das Leben der Einheimischen zu erforschen. Übrigens, wenn jemand erst einmal an solch absonderlichem Vergnügen Geschmack gefunden hat, wird er es sein Leben lang nicht wieder aufgeben. Nichts in der Welt hat stärkere Reize; selbst die Liebe nicht. Wenn andere Leute auf zehn Tage in die Berge gehen, nahm Strickland Urlaub für die »Jagd«, wie er es nannte. Er verkleidete sich, wie es ihm gerade gut schien, mischte sich unter das braune Volk und war für eine Weile verschwunden. Er war ein stiller, brünetter junger Mensch, schlank und schwarzäugig, und, wenn er bei der Sache war, ein sehr interessanter Gesellschafter. Es lohnte sich, Strickland über die Entwicklung des Volkes, wie er sie auffaßte, reden zu hören. Die Einheimischen haßten ihn, aber sie fürchteten ihn auch. Er wußte zu viel.
Als Youghals an den Ort kamen, verliebte sich Strickland ernstlich, – wie er alles tat, – in Miß Youghal. Und sie verliebte sich nach einem Weilchen in ihn, weil er ihr ein Rätsel war. Da sprach Strickland mit ihren Eltern. Aber Mrs. Youghal erklärte, daß sie ihre Tochter nicht in den Verwaltungszweig, der am schlechtesten im ganzen Reiche bezahlt würde, hineinheiraten lasse. Und der alte Youghal erklärte mit genau so vielen Worten, daß er zu Stricklands Tun und Treiben kein Vertrauen habe, und daß er ihm verbunden wäre, wenn er allen mündlichen und schriftlichen Verkehr mit seiner Tochter aufgäbe. »Gut«, sagte Strickland, denn er wollte seiner Liebsten das Leben nicht zur Last machen. Er ließ die Sache nach einer langen Unterredung mit Miß Youghal ganz fallen.
Im April zogen Youghals nach Simla.
Im Juli nahm Strickland drei Monate Urlaub, »dringender Privatangelegenheiten halber.« Er schloß sein Haus zu, wenn auch um alles in der Welt, kein Einheimischer »Estreekin Sahibs« Hab und Gut wissentlich angetastet hätte, und reiste zu einem Freunde, einem alten Färber, nach Tarn Taran. Seitdem war jede Spur von ihm verloren, bis mir eines Tages auf der Promenade in Simla ein »Sais« die folgenden wunderlichen Zeilen übergab:
Verehrter alter Freund,
händigen Sie bitte dem Überbringer eine Kiste Zigarren – am liebsten Super Nr. 1 – aus. Die frischesten erhalten Sie im Klub. Meine Schulden zahle ich, sobald ich wieder da bin. Augenblicklich stehe ich außerhalb der »Welt«.
Ihr E. Strickland.
Ich ließ zwei Kisten kommen und übergab sie mit den besten Grüßen dem Sais. Und der Sais war Strickland selbst gewesen. Er hatte beim alten Youghal Dienst genommen und besorgte Miß Yougals Araber. Der Ärmste sehnte sich nach englischem Tabak und wußte auf jeden Fall, daß ich schweigen würde, bis alles erledigt wäre.
Mit der Zeit fing Mrs. Youghal, die in ihrer Bedienung aufging, an, überall wo sie verkehrte, von ihrem Muster-Sais zusprechen, dem es nie zu viel war, frühmorgens aufzustehen, um Blumen für den Frühstückstisch zu pflücken, der die Pferdehufe wichste, – wirklich wichste, – ganz wie ein Kutscher in London. Miß Youghals Araber sah entzückend aus; er war das reine Wunder. Strickland, – Dulloo meine ich, – entlohnte das reizende Lob, das ihm Miß Youghal beim Ausreiten spendete. Ihre Eltern freuten sich, daß sie ihre törichte Neigung für den jungen Strickland so ganz vergessen hatte, und nannten sie ein gutes, liebes Kind.
Strickland beteuert, daß diese zwei Monate Dienst für ihn die härteste geistige Schulung bedeutet haben, die er je durchgemacht. Daß die Frau eines anderen Sais sich in ihn verliebte und ihn mit Arsenik vergiften wollte, weil er nichts von ihr wissen wollte, ist noch nebensächlich. Aber er mußte sich auch zur Ruhe zwingen, wenn Miß Youghal mit einem anderen ausritt, der mit ihr flirtete, und mußte hinter ihnen herlaufen, ihnen die Decke nachtragen und jedes Wort mit anhören. Auch mußte er guter Laune bleiben, wenn ihn ein Polizist auf der Benmore-Terrasse schalt, besonders einmal, als ihn ein junger »Naik«, den er selber aus dem Dorfe Isser Jang ausgehoben hatte, anschrie, oder wenn ihn gar ein junger Unterbeamter »Sau« nannte, weil er ihm nicht rasch genug aus dem Wege ging.
Aber das Leben bot ihm auch Entschädigungen. Er gewann einen tiefen Einblick in die Schliche und Spitzbübereien der »Sais«; Einblicke, tief genug, wie er sagte, um die halbe »Chamar«-Bevölkerung Ostindiens ins Gefängnis bringen zu können, wenn er im Dienst gewesen wäre. Er wurde Meister im Knöchelspiel, das alle Sänftenträger und Pferdeknechte spielen, wenn sie vor dem Regierungsgebäude oder nachts vorm Gaiety-Theater warten müssen. Er lernte Tabak rauchen, der dreiviertel aus Kuhdünger bestand, und studierte die Weisheiten des Graukopfes, der die Sais vor dem Regierungsgebäude beaufsichtigte. Und dessen Worte waren wertvoll. Er sah manches, was ihm Spaß machte; und er gibt sein Ehrenwort darauf, daß niemand Simla wirklich würdigen kann, der es nicht vom Standpunkt eines Sais aus gesehen hat. Und er meint auch, daß sein Schädel, wenn er alles Geschaute veröffentlichen würde, nicht nur an einer Stelle eingeschlagen werden würde.
Stricklands Schilderung seiner Qualen, wenn er in feuchten Nächten vor der »Benmore-Terrasse« trotz Pferdedecke das Licht sah und die Musik hörte, während der Walzer ihm in den Beinen juckte, ist wirklich nicht langweilig.
Strickland wird demnächst ein Buch über seine kleinen Erlebnisse schreiben. Das Buch wird wert sein, gekauft, oder gar noch mehr: beschlagnahmt zu werden.
So diente er treu wie Jakob um Rahel. Sein Urlaub war fast zu Ende, als die Explosion erfolgte. Er hatte sich wirklich mit bestem Willen bei allen Courschneidereien beherrscht, aber schließlich ging es über seine Kraft. Ein hervorragender, alter General ritt mit Miß Youghal aus und begann jenen so verletzenden Backfischflirt, den Frauen schwer abweisen können, und der den Zuhörer rasend macht. Miß Youghal zitterte vor Furcht, weil ihr Sais das alles hörte. Strickland-Dulloo ertrug es, solange er es aushielt. Aber dann ergriff er die Zügel des Generals und forderte ihn in fließendem Englisch auf, abzusitzen, um sich über die Felswand hinabwerfen zu lassen. Einen Augenblick später weinte Miß Youghal, und Strickland sah ein, daß er sich endgültig verraten habe – daß alles aus sei.