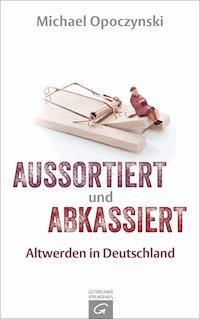15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Benevento
- Sprache: Deutsch
»Schmerzensgeld« - ein unkonventioneller Krimi von WISO-Moderator Michael Opoczynski In »Schmerzensgeld« trifft ein Ermittlerteam mit äußerst unkonventionellen Methoden auf Finanzhaie, die glauben, sich nicht an die Regeln halten zu müssen: Michael Opoczynski rechnet in seinem spannenden Wirtschaftsthriller mit der Banken- und Finanzwelt ab, über die er lange in der ZDF-Sendung »WISO« berichtet hat. Der erste Fall führt die »Gesellschaft für unkonventionelle Maßnahmen« auf die Fährte einer Privatbank, die jahrelang ihre Kunden geprellt hat. Nach allen Regeln der Kunst und gleichzeitig juristisch unangreifbar wurden tausende einfache Leute geschädigt. Sie haben alles verloren. Sie sind wütend, sie wollen Rache. Doch sie sind machtlos – bis sich die Gesellschaft der Sache annimmt. Ihr Ziel: Ungerechtigkeit aufdecken, die Täter fassen und sie in der Öffentlichkeit bloßstellen. Dazu ist ihnen jedes Mittel recht - Packend erzählter Politthriller - Unkonventionelles Ermittlerteam - Fundierte Insider-Kenntnisse aus der Banken- und Finanzwelt Ein moderner Robin-Hood-Krimi mit ironischem Augenzwinkern Michael Opoczynskis Ermittlerteam hat mit den klassischen Detektiven und Polizisten, die man aus Kriminalromanen kennt, wenig gemeinsam. Es ist eine freche, schlagfertige Truppe, die die Gerechtigkeit selbst in die Hand nimmt und sich für die Wehrlosen und Unschuldigen einsetzt. Der Autor war in seiner Arbeit als WISO-Moderator viele Jahre lang mit solchen Schicksalen konfrontiert. Mit »Schmerzensgeld« hat er einen Kriminalroman der anderen Art geschrieben. Wenn Sie anspruchsvolle und spannende Unterhaltung zu schätzen wissen, sollten Sie sich dieses Buch nicht entgehen lassen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Michael Opoczynski
Schmerzensgeld
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger
Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw.
Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage
© 2018 by Michael Opoczynski
© Deutsche Erstausgabe 2018 Benevento Verlag bei Benevento Publishing, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Lektorat: Anja Freckmann, Bernried
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Minion Pro
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: plainpicture
Printed in Czech Republic
ISBN 978-3-7109-0044-0
eISBN 978-3-7109-5061-2
Sämtliche Personen und Handlungen in diesem Buch sind frei erfunden. Sollten sich Ähnlichkeiten zu lebenden Personen oder realen Ereignissen ergeben, so sind diese rein zufällig.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
1
Der Frühling konnte schön sein. Auch in Berlin. Und ganz besonders in Charlottenburg, jenem Stadtteil, in dem viele gepflegte ältere Menschen in gepflegten Wohnungen ein gepflegtes Leben lebten. Wo sie unauffällig gut gekleidet zu Fuß einkaufen gingen, am Arm die politisch korrekte Einkaufstasche aus haltbarem Material, darin eine Flasche französischen Weißweins und zwei Stücke Lachs-Quiche von Aux Delices Normands. Aber heute – der Frühling zeigte, was er draufhatte – waren nicht nur gediegene Altersversorgungsempfänger unterwegs. Da war auch diese vergleichsweise junge Frau. Rotes Kleid, eng und kurz. Absätze hoch. Sie zeigte ihre Figur. Sie swingte sich durch die Suarezstraße, nicht auf dem Bürgersteig, wie es sich gehörte, sondern provozierend am Rande der Fahrbahn. Das war auch kein Problem, eigentlich, denn es war nicht viel los in der Suarezstraße, eigentlich. Sie sprach in ihr Telefon. Oder sie tat so.
Charlottenburg im Frühling. Die Straßen links und rechts der Kantstraße waren still, breit, lichtgrün, bebaumt. Hohe Häuser aus den Gründerjahren, nach dem Krieg zunächst provisorisch, spätestens nach der Jahrtausendwende sorgfältig renoviert. Vier Meter hohe Räume, weiße Flügeltüren, Stuckdecken. Wenn Makler so etwas in die Hände bekamen, löste das echte Begeisterung bei ihnen aus. Hochherrschaftlich, aufwendig saniert, originalgetreu, anspruchsvoll, mit solchen Adjektiven priesen sie derartige Objekte. Auf Deutsch: richtig teuer. Es war still in diesen Wohnungen. Still in den Straßen. Die Bäume trugen frisches Grün, Amseln konzertierten.
Dann knallte es.
Ein lauter Knall. Umso lauter, als alles andere sanft und fröhlich daherkam. Ein Knall von Blech auf Blech auf der Kreuzung zweier Wohnstraßen. Danach für ein paar Sekunden leises Geschepper. Und dann?
Stille!
Richtig tiefe Stille.
Keine plaudernden Passanten. Kein Blätterrauschen. Keine Amseln.
Zwei Autos, beide eigensinnig auf ihrem Kurs, das eine zielstrebig geradeaus über die Kreuzung, das andere von rechts, beide wie ferngesteuert, exakter Treffer mitten auf der Kreuzung. Keine Verletzten, verformtes Blech, Arbeitsbeschaffung für das deutsche Kraftfahrzeughandwerk.
Auf der einen Seite stand das nicht mehr so ganz neue, tiefergelegte und breitbereifte 3er-BMW-Coupé mit Narek Petrosian am Steuer, das sich auf der Suarezstraße fortbewegt hatte, auf der anderen Seite der angejahrte Golf, ein Mann vom Typ Handwerker am Steuer, der von rechts aus der Trendelenburgstraße auf die Kreuzung gestoßen war. Sie waren sich in die Quere gekommen. Der BMW hatte Zierleisten eingebüßt. Der rechte Außenspiegel war abgefallen, auf dem Pflaster zersprungen. Der Golf hatte jetzt eine Boxernase. Stand ihm gut.
Blechschaden. Ein eigentlich harmloser Blechschaden im frühlingsfröhlichen Charlottenburg – und dennoch: Da war was.
Da war was?
Es hatte geknallt, weil der Dreier ohne Vorfahrt zu haben einfach über die Kreuzung gefahren war und weil der Golf mit Vorfahrt ebenfalls über die Kreuzung gefahren war. Weil dessen Fahrer vielleicht einfach nicht mit einem gerechnet hatte, der ihm die Vorfahrt nahm. Oder weil er stur von seinem Vorfahrtrecht Gebrauch machen wollte. Letztlich aber hatte der Fahrer des Dreiers nicht gebremst. Sein Problem.
Normalerweise fuhr Narek Petrosian sorgfältig. Er war oft auf diesen Straßen unterwegs. Er kannte rechts vor links, na klar. Er beachtete rechts vor links, meist jedenfalls. Aber diesmal: Während er so fröhlich vor sich hin fuhr, das Autoradio laut Kanye West spielte, war linker Hand plötzlich diese Blondine aufgetaucht. Die Straße entlanggegangen. Nein, nicht gegangen, geswingt hatte sie. Fast gesteppt! Frühling, kurzes Kleid in Rot, schöne Beine, hohe Absätze: Das war doch zum Hinblinzeln. Und dann? Nicht zu fassen! Hatte sie zurückgeblinzelt. In diesem Augenblick hatte Narek seinen Kopf einfach nicht nach rechts wenden können. Das wäre zu viel verlangt gewesen. Er war weitergefahren.
Nach dem Knall. Als steckte das Echo noch zwischen den Häuserwänden fest. Da – unglaublich – kam die Blonde auf Nareks Auto zu. Sie blieb vor seiner Tür stehen. Narek, noch halb betäubt von Knall und Ruck, öffnete willenlos, als wollte er sie einladen. Und dann hörte er sie hauchen: »Du Armer! Das wird böse!« Nö, dachte Narek spontan, wieso böse? Aber sinnvolles Sprechen fiel ihm schwer: »Wollen Sie … wollen wir … haben Sie …?« Die Frau lächelte versonnen und drehte ab.
Im selben Moment setzte der Golf trotz beschädigter Schnauze zwei Meter zurück, fuhr um den lädierten BMW herum und verschwand in zügigem Tempo in der Suarezstraße. »Oh! Du! Warte!«, säuselte Narek in Richtung Blond. Dann brüllte er Richtung Golf: »He, hallo, was soll das denn …!« Als er zurückschwenkte zur hauchenden Frau, war auch sie verschwunden. Sie war weg. Der Golf war weg. Niemand mehr zu sehen.
Narek fluchte, stieg aus, lief konfus um sein Auto herum. Die rechte Seite sah übel aus. Nicht nur der Spiegel hatte ein Problem, die ganze rechte Seite war eingedellt, verbogenes, verschrammtes Blech vom Kotflügel vorne über die Tür hinweg bis zur Mitte. Ein ziemlicher Schaden. Das sah nach größerer Reparatur aus. Der andere musste auch ganz schön etwas abgekriegt haben. Aber der war weg. Das verstehe einer. Dabei war der doch von rechts gekommen!?
Hatte jemand das alles verfolgt? Vielleicht. Aber zu sehen war niemand auf der Straße. Die Fenster dezent geschlossen. All die gepflegten Leute – nicht zu sehen. Verschluckt von eindrucksvollen breiten Hauseingängen mit schweren hölzernen Haustüren, die von weißem Stuck links und rechts gerahmt wurden. »Bitte keine Werbung«. Hundespaziergänger waren von ihren Hunden weggezogen worden. Ein Rollstuhlfahrer hatte sich weggerollt.
Narek sah das Polizeiauto kommen. Blaulicht. Wieso Polizei? Wozu Blaulicht? Und so schnell? Ein Polizist und eine Polizistin stiegen aus ihrem Passat, setzten ihre Mützen auf und näherten sich ihm.
Ein Ambulanzwagen der Johanniter bog rasant um die Ecke, das hohe Fahrzeug neigte sich in der Kurve, ebenfalls Blaulicht. Die Sanitäter sprangen heraus und kamen auf das trübselige Unfallfahrzeug zu. »Sind Sie verletzt?« Narek merkte: Er war gemeint. Er schüttelte den Kopf, er war einfach völlig verblüfft und deshalb langsam. Aber verletzt? Nein.
Die Johanniter blickten die Polizisten fragend an. Die winkten ab: Nein, nichts passiert außer Blechschaden. Die Sanitäter zeigten keine Enttäuschung über den entgangenen Job, stiegen emotionslos in ihren Rettungswagen und fuhren ohne Blaulicht ab.
»Sie hatten keine Vorfahrt!« Der Polizist runzelte die Stirn und blickte auf das Unfallfahrzeug. »Wo ist der andere?« Und die Polizistin sagte: »Wieso haben Sie den wegfahren lassen?« Ungerechte Welt. Narek hatte gar nichts. Er war nicht gefragt worden. Und überhaupt: Wo war eigentlich die Blonde?
Polizist und Polizistin wechselten Blicke. Bei dieser Szene stimmte etwas nicht. Der Fahrer kam ihnen merkwürdig vor, und dieser Unfall auch. Wo gab’s denn so was, dass der Geschädigte sich davonmachte?
Der Polizist fragte Narek Petrosian nach seinen Papieren, während die Beamtin um das Unfallfahrzeug wanderte. Vorurteile durften sie sich nicht leisten, aber dass sie zu einem Verkehrsunfall gerufen wurden, bei dem der Fahrer mit der offensichtlich geringeren Unfallschuld abhandenkam – das hatten beide noch nie erlebt.
Ein Fahrer mit ausländischem Namen, das beschädigte Fahrzeug sein Eigentum. Ein kritischer Blick stand an, und zwar in den Führerschein dieses Menschen, der konfus wirkte und offensichtlich von der Rolle war. Ihr Kollege sagte: »Was heißt das, Herr Petrosian: Sie wurden abgelenkt?« Gleichzeitig tippte die Polizistin bereits auf ihrem mobilen Informationsgerät herum.
»Na, da war diese blonde Frau!«
Der Polizist rollte die Augen: »Aha, blonde Frau? Der haben Sie nachgeschaut? Beim Fahren?«
»Nein …! Ja …!« Normalerweise stotterte Narek nicht. »… Sie hat mir zugezwinkert!« Narek hasste sich dafür, dass er stotterte. »Ich dachte, also, ich dachte, die will was von mir, und gerade da kam dieser Golf von rechts.«
»Zugezwinkert? Blonde Frau?«
Musste dieser Bulle alles wiederholen? Und dazu noch mit dieser Betonung? Ekelhaft. Als wäre es ein Verbrechen, Frauen hinterherzuschauen. Jetzt war die Polizistin wieder dran. »Wir prüfen gerade einmal Ihre Personalien. Darf ich die Papiere sehen? Dauert einen Moment. Kann Ihr Wagen noch fahren? Ja? Dann parken Sie ihn bitte da.« Sie zeigte auf einen freien Parkplatz.
Parken? Wozu das denn? Die sollten lieber dem Golf hinterhermachen. In Nareks Kopf ging der Alarm an. Und tatsächlich, zwei Minuten später erklärte der Polizist mit finsterem Blick: »Sie kommen mit uns zum Revier!«
Inzwischen hatte die Polizistin nämlich in ihrem Informationssystem sowohl zu dem BMW als auch zu seinem Halter etwas gefunden. Offenbar wollten sich die beiden Beamten den Mann näher ansehen.
Narek konnte ganz schön renitent werden. Auch gegenüber Bullen. Hatte er schon mehr als einmal bewiesen. Im Moment aber stand er neben sich. Was passierte hier? Resigniert steuerte er sein zerbeultes Auto auf den Parkplatz zwischen zwei Bäumen, stieg brav aus und ließ sich willig auf den Rücksitz des Polizeiwagens bugsieren. Die beiden Polizisten nahmen vorne Platz. Motor an, ein paar Sätze in den Sprechfunk, und los ging’s. Der blau-weiße VW entfernte sich zügig. Die Sonne schien wieder, und die Amseln holten Luft, um ihr Konzert fortzusetzen.
In einiger Entfernung wurde ein Motor angelassen. Es war ein Caddy Lieferwagen, »B. Fromm Innenausbau« stand an der Bordwand. Ein Mann und eine Frau saßen darin. Der Wagen fuhr zügig ab.
Er stand im kleinen Büro hinter dem Laden auf einem Bein, schlüpfte geschickt in die saubere Baumwollhose und zog anschließend den weißen Kittel drüber. Dann beugte sich Vural Tabak über den Schreibtisch, legte seinem Vater, der am Computer langsam und sorgfältig eine Bestellung beim Großhändler aufgab, eine Hand auf die Schulter. »So, Baba«, sagte Tabak, »bin wieder da!«
Der Vater knurrte missbilligend (wegen der Abwesenheit) und zugleich zufrieden (weil der Sohn zurück war). Tabak strich ihm liebevoll über den kahlen Kopf. Hoffentlich bleibt mir das noch eine Weile erspart, dachte er und ging hinaus, um den Kollegen an der Fleischtheke zu unterstützen.
Den Golf hatte er auf den Schrottplatz zurückgebracht. Das Kurzzeitkennzeichen würde er morgen abgeben. Die Versicherung würde er anrufen. Alles schön ordentlich.
Das rote Kleid hing im Schrank. Die roten Pumps standen drunter. Abteilung Verführung, dachte Feli. Sie trug wieder den üblichen Hosenanzug in Anthrazit, die schwarzen halbhohen Schuhe – Typ Business, die weiße Bluse, brav. Sie bestieg ihren Mini und fuhr zu ihrer Bürogemeinschaft, wo sie sich ihr Geld mit dem Makeln von Versicherungen und dem Vertrieb von Anlageprodukten verdiente. So ein schöner Tag, dachte sie, eigentlich zu schade fürs Büro.
Er rangierte rückwärts in den Hof. Stellte den Caddy (»B. Fromm Innenausbau«) in die Ecke, schloss ab und trat durch die Hoftür ins Treppenhaus. Erster Stock. Van de Loo machte auf. Pfister hatte sein Kommen per WhatsApp angekündigt. Van de Loo guckte fragend, Pfister nickte.
»Sag was!«, sagte van de Loo.
»Alles nach Plan«, sagte Pfister. »Blechschaden. Die Polizei war schnell, na klar! Er hat blöd geguckt. Sie haben ihn mitgenommen.«
»Gut«, sagte van de Loo. »Hoffentlich hat er’s kapiert.«
Ich müsste mal wieder Wein bestellen, dachte Cromm, während er den Lagerraum begutachtete. Er hatte Dienst. So nannte er das, wenn er in der Pizzeria seiner Schwester pflichtgemäß den Papierkram machte, die Vorauszahlung der Umsatzsteuer errechnete, die frische Pasta bestellte, die Rechnungen der Lieferanten bezahlte – und dann noch die Personalbuchhaltung erledigte. Er konnte das. Aber er musste es nicht mögen!, dachte er. Es war einfach eine Vereinbarung zwischen ihnen. Er war zuständig dafür, und sie bezahlte seine Arbeit.
Wein bestellen. Das war seine Lieblingstätigkeit. Wenn auch die richtig guten, teuren Italiener tabu waren. »Finger weg!«, hatte seine Schwester gemahnt, »unsere Gäste haben keinen Sinn für teuren Wein.« Dennoch machte es Spaß. Da kannte er sich aus. Während er am Schreibtisch saß und die Preise der Weißen aus dem Friaul verglich, machte sein iPhone ein Geräusch. »Erfolg«, schrieb van de Loo. »Gut«, schrieb Cromm zurück.
2
Noch nicht lange her, keine drei Wochen, als es nachts noch frisch gewesen war, manchmal sogar frostig, war die alte Frau ins Büro gekommen. Eine alte Frau auf der Suche nach Hilfe. Sie hatte zögernd die Hand auf die Klinke des ehemaligen Friseurladens gelegt. Nachbarn, denen sie von ihrem Erlebnis erzählt hatte, hatten sie hergeschickt. Da könne man ihr helfen – vielleicht, hieß es. Die Leute in dem Büro wären ein bisschen merkwürdig, aber wenn sie anbissen, dann ging’s zur Sache. Sie müsse halt überzeugen.
»Verbraucherbüro« stand über der Tür, ein Plastikschild mit Versalbuchstaben, rot auf weißem Grund, von beiden Seiten durch einen Strahler beleuchtet, also eine eher bescheidene Variante, auf sich aufmerksam zu machen, angesichts der Möglichkeiten moderner Lichtwerbung. Aber in dieser Straße in Gesundbrunnen passte das. Es war eine Straße, wie sie gerne im Fernsehen gezeigt wird, wenn TV-Journalisten Multikulti vorführen wollen. Der Supermarkt türkisch. Die Bäckerei fest in eritreischer Hand. Gegenüber der Ein-Euro-Shop – Thermobecher, Haarband, Boxershorts oder eine Messer-Gabel-Löffel-Kombo aus Alu, alles für nur einen Euro. Ein buntes Sortiment, afghanische Geschäftsführung. An der Ecke eine Raucherkneipe; ein Zufluchtsort für die letzten alten deutschen Männer im Kiez, die hier Darts spielen, rauchen und trinken durften. Was sie heftig und hoffnungslos taten.
Links und rechts Mietshäuser. Viele stammten aus der Zeit der Jahrhundertwende. Die ehemals hohen Räume waren nicht selten von Heizkostenfanatikern durch abgehängte Decken (Eiche, hell, Furnier) ruiniert worden, ansonsten hatte man die Gebäude seit Jahrzehnten nicht mehr renoviert, die großen Wohnungen waren geteilt oder gedrittelt. In manchen gab es Etagenheizung, in manchen einzelne Öfen. Wer die quietschenden Haustüren zu den alternden Treppenhäusern aufstieß, roch Keller und Gekochtes, blickte auf abgeschliffene Holzstufen, verbeulte Blechbriefkästen, verschlissene Tapeten und von vielen Händen glatt geschliffene Handläufe von Geländern. In den Hauseingängen hingen zwanzig bis dreißig Briefkästen, obwohl hier ursprünglich nur jeweils fünf Wohnungen untergebracht gewesen waren. Ein paar deutsche Namen an den Kästen, viele türkische, dazwischen auch kosovarische und bulgarische, neuerdings auch ein paar aus Syrien. Kinderwagen im Treppenhaus, außerdem alte Fahrräder, mit dicken Stahltrossen gesichert. Fahrräder waren begehrt.
Und es gab die Neubauten. Auch schon gealtert, errichtet in den Lücken, die Kriegsbomben im Straßenzug hinterlassen hatten. Häuser mit dünnen Nachkriegswänden, mit vielen Dreizimmer- und Zweizimmer-Appartements, mit Badezimmern ohne Fenster. Mit engen Treppenhäusern und Aufzügen mit Angstzuschlag. Hier herrschte schlechte Luft, weil Menschen auf zu engem Raum lebten; Geschrei, weil Menschen sich stritten, wenn es eng wurde; Lärm aus vielen Fernsehern, die immer liefen und kaum Zuschauer hatten. Alle lebten dicht an dicht, aber keiner grüßte keinen, wenn man sich zufällig begegnete. Hier wurde die Miete noch direkt kassiert, zum Monatsanfang. Wer dann nicht zahlte oder nicht zahlen konnte, sollte nicht auf Mieterrechte pochen.
So war sie, die Straße, in die sich die alte Frau getraut hatte. Sie kam aus einem besseren Kiez, und hier war es ihr nicht ganz geheuer. Dieses alte Ladenlokal passte wunderbar hierher, mit dem kleinen Schaufenster, das vermutlich vor Jahren zuletzt geputzt worden und ebenso lange mit Pappschildern vollgestellt war. »Finanzierungen« stand auf einem, »Kaufberatung« oder auch »Reparaturservice« auf anderen. Ein Werbefoto zeigte glückliche Menschen vor einem schrecklichen Reihenhaus. Alles nicht ganz frisch, alles nicht richtig sauber.
Neben dem Schaufenster eine ehemals verglaste Tür, die Füllung war durch Sperrholz sicherer geworden. Im Schaufenster rechts ein »open/closed«-Schild zum Umdrehen. Heute guckte »open« nach außen. Über dem Türgriff klebte ein Zettel:
Verbraucherbüro
Private kostenpflichtige Hilfe für Kunden und Verbraucher
Montags, mittwochs, freitags 10 bis 17 Uhr
Gesellschaft für unkonventionelle Maßnahmen e.V. i. G.
Telefon 26 51 62 00 oder 0170 70070090
Die alte Frau legte die Hand auf den Griff. Die Tür öffnete sich in einen etwa zwanzig Quadratmeter kleinen Raum, der überheizt war, möbliert mit Schreibtisch (ältlich, gebraucht), einem Stuhl davor und einem dahinter (stabil und hässlich, aus dem Schäfer-Katalog). An den Wänden Raufasertapete in schmuddeligem Weiß. Ein Selbstzusammenbau-Regal, vollgestopft mit Broschüren, die lange nicht geordnet worden waren. An der Decke Halogenstrahler aus dem Baumarkt. Der Schreibtisch fast leer und fast sauber.
»Hallo? Jemand da? Ist da jemand?«
Silvio Cromm, in grauer Wollhose, grauem Pullover und weißem Hemd – ein uniformähnlicher Stil, der sich aus seiner Vergangenheit erklärte –, trat aus dem Flur, ein halb volles Glas in der Hand, setzte sich hinter den Schreibtisch, seufzte und nickte: »Ich bin da. Was kann ich für Sie tun?«
Er lief in der Hierarchie als – wohlgemerkt: selbst ernannter – Spezialist Nummer 1. Er war 52 Jahre. Mittelgroß. Bauchansatz. Zu wenig Bewegung. Zu viel Rotwein. Trug nicht nur heute Pullover, sondern immer. Dicke im Winter, dünne im Sommer. Haare brizzolato, wie er, der halbe Italiener, selber sagte, und wenn man ihn fragte, was das heißt – und diese Frage wünschte er sich –, sagte er lächelnd: »Elegant angegraut!« Seine Mutter war Deutsche, sein Vater kam aus Italien, er selbst war in West-Berlin geboren, hatte sich zum Musterdeutschen entwickelt und zeigte manchmal einen unangenehmen Hang zur Pedanterie, hasste zum Beispiel südländische Unpünktlichkeit, streute aber gerne italienische Brocken ein. Er war Ex-Polizist (LKA, gehobener Dienst). Das war ihm irgendwann widerwärtig geworden. Die Jobs waren blöd. Die Politik mischte sich immer öfter ein. Und er musste den Kollegen verheimlichen, dass er schwul war. Polizei und schwul? Das war praktisch nicht akzeptiert. Also hatte er jahrelang Herrenwitze erzählt. Freundinnen erfunden. Auf Chauvi gemacht. Bis er sich selbst blöd fand. Bis er es nicht mehr ausgehalten hatte. Vor vier Jahren hatte er gekündigt. Lebte seither gut von der halben Pension, die ihm als Polizist zustand, und dem Gehalt, das ihm die Schwester aus dem Restaurantgeschäft überwies. Er lebte solo, hatte manchmal vorübergehende Freundschaften. Und er investierte Zeit und noch viel mehr in die Gesellschaft. Seiner Schwester gefiel das nicht. Er wehrte sich: »Hier kann ich tun, was ich als Polizist nicht durfte«, sagte er, »Gerechtigkeit schaffen.«
Cromm nestelte an dem Monitor im Ohr, beguckte die Besucherin und nickte und schob ein »Guten Tag!« hinterher.
Sie hatte sich zögernd in den Raum hineingewagt und den Mann vorsichtig angeschaut. Komisch, der war noch gar nicht alt und schon schwerhörig? Sie war eine alte Frau wie viele andere: leicht gebeugt, weiße kurze Haare, beige Jacke, braune Hose, gesunde Schuhe, Einkaufsbeutel am Arm. Aber dazu ein wacher Blick.
»Also, mir haben Freunde gesagt, ich könnte zu Ihnen kommen. Ich brauche Hilfe. Mein Name ist Waltraud Stöffel.«
Sie schaute ihm in die Augen, er schaute zurück: »Aha, Sie brauchen Hilfe!?«
Sie blickte sich um: »Kann ich reden?«
»Setzen Sie sich bitte. Und reden Sie! Sagen Sie mir erst mal: Wer sind die Freunde?«
Im ersten Stockwerk über dem Büro hatte van de Loo seine Augen auf dem Bildschirm, er prüfte den Sitz seines Headsets und sagte in das Mikrofon: »Aha. Eine Referenz. Unsere Kundschaft vermehrt sich. Mundpropaganda.« Cromm nickte kaum merklich.
Sie setzte sich. »Meine Freunde, das sind Karl und Emma Schröder. Dr. Karl Schröder, er war mal Anwalt. Die wohnen in meiner Straße, im Händelweg. Sie haben Ärger mit einem Elektrohändler gehabt. Dann waren sie bei Ihnen, das hat glaube ich genützt.«
»Ach. Und jetzt brauchen Sie Hilfe.«
In seinem linken Ohr räusperte es sich und sprach: »Stimmt. Es gibt die Schröders. Fall vor acht Monaten gelöst.«
Inzwischen hatte die Frau zu erzählen begonnen: »Ja. Man hat mich reingelegt. Beim Autofahren. Ich fahre Auto, noch ganz gut. Ich habe einen Polo, und eigentlich bin ich noch fit, aber vorige Woche ist es passiert …«
»Sie wird ausführlich.« Cromm konnte van de Loos Grinsen hören.
Beide, Cromm unten, van de Loo oben, ahnten, was jetzt kommen würde. Es waren wieder welche unterwegs, die es auf einen Crash anlegten. Die Fälle ließen sich kaum aufdecken, und es kam nie zur Anzeige.
»An der Kreuzung bei mir zu Hause, Körnerstraße, Ecke Kapellenstraße, letzten Dienstag, da ist einer von rechts gekommen. Ja, von rechts. Ja, er hatte Vorfahrt, aber er war weit weg, wirklich weit weg, gar kein Problem. Also bin ich losgefahren. Ich habe genau aufgepasst. Aber dann hat der andere Fahrer Gas gegeben, richtig Vollgas. Ich bin sicher, er hat es darauf angelegt: Der ist absichtlich in mich reingefahren. Im letzten Moment hat er dann doch noch gebremst. Ich konnte nichts tun. Wissen Sie, ich sag es Ihnen: Der wollte in mich reinfahren. Und nach dem Knall ist er ausgestiegen und schreiend auf mich zugelaufen, hat die Fahrertür aufgerissen. Er hat rumgebrüllt …«
»Was haben Sie getan?«
»Na, ich habe sofort die Polizei geholt – auch weil ich vor dem Mann Angst hatte. Die haben ihm gesagt, er soll sich beruhigen, und dann alles aufgenommen. Aber zu mir waren sie auch nicht sonderlich nett. Vom absichtlichen Reinfahren wollten sie überhaupt nichts hören. Im Gegenteil, sie meinten, rechts vor links sollte ich am besten immer beachten, und haben gefragt, ob ich denn noch fit wäre, ob ich alles mitkriegen würde … Da habe ich lieber nichts mehr gesagt. Jetzt ist meine Versicherung dran. Die werden alles zahlen. Bis auf dreihundert Euro, die muss ich dazuzugeben. Und ich werde herabgestuft.«
»Na, da kann man kaum was machen.«
»Aber das war ja auch nicht das Schlimmste.«
»Ja?«
»Danach ging es erst richtig los. Als die Polizei weg war, hat sich der Fahrer des anderen Wagens an mich rangemacht. Der hat total gedrängelt. So ein Türke war das, und jung. Er wollte zweitausend Euro. Extra. Weil das Auto nicht ihm gehörte, sondern seinem Chef. Der würde ihm jetzt Ärger machen. Die Versicherung würde nur einen Teil ersetzen, weil das ein altes Auto sei. Er müsste dem Chef den Wertverlust ersetzen. Der hat so Druck gemacht, es war schrecklich. Ich bin dann mit ihm zur Bank und – haben Sie eben den Kopf geschüttelt? Hören Sie mal! Der hat mich bedroht!«
Er unterbrach: »Also, Sie haben wirklich gezahlt?«
»Deswegen bin ich doch hier. Ich habe verhandelt, gebettelt, ich bin doch nicht reich. Schließlich war er mit tausendfünfhundert Euro zufrieden. Aber jetzt tut das weh, das Geld …«
Im Ohr: »Lass dir die Daten geben. Das könnte was für uns sein.«
»Haben Sie Name und Adresse von dem Mann?«
»Ja. Habe ich. Die hat die Polizei aufgenommen. Der Mann ist ein Ausländer, ein türkischer Deutscher, er heißt Narek Petrosian. Meine Versicherung brauchte das auch. Hier, bitte, ist alles …«
Im Ohr: »Sag mal, wir sollten mal wieder eine schöne Tour durch Kreuzberg machen. Mit Wein und Weib. Was meinst du?«
»Bitte, ernsthaft!«, sagte Cromm laut und deutlich.
Im Ohr: »Na gut. Verstehe. Für dich ohne Weib?«
Frau Stöffel guckte verwirrt: »Ich bin ernsthaft!«
»Ja, natürlich«, sagte Cromm, drehte sich um, guckte zur kleinen fast unsichtbaren Kamera und zog die Augenbrauen so hoch er nur konnte. Nachdem er sich zurückgedreht hatte, fischte er ein Tablet aus der Schreibtischschublade und sagte: »So. Ernsthaft. Wir können Ihnen nicht versprechen, dass wir Ihnen das Geld wiederbeschaffen. Das wird schwierig.«
Frau Stöffel schob die Unterlippe vor.
»Frau Stöffel, wenn das Ihr Ziel ist, sollten Sie zu einem Anwalt gehen. Aber da mache ich Ihnen keine Hoffnung. Im Gegenteil, das könnte Ihnen noch mehr Ärger bringen. Ihr Gegner ist vermutlich ein harter Brocken. Nachtragend, rachsüchtig. Nicht gut für Sie.«
Frau Stöffels Unterlippe zeigte einen bedenklichen Überhang.
»Wir können eins versuchen«, sagte Cromm. »Wir können zu diesem Petrosian Kontakt aufnehmen. Und versuchen, ihm klarzumachen, dass er mit solchen Sachen aufhört. Dass er Sie endgültig in Ruhe lässt. Schluss und Aus!«
Frau Stöffel blickte skeptisch: »Und was habe ich davon?«
»Ruhe. Sie werden in Ruhe gelassen. Das ist was wert.«
»Und mein Geld?«
»Tja …! Vielleicht kommen wir dran. Vielleicht nicht. Wir sind nicht die Polizei.«
Frau Stöffel seufzte.
»So viel kann ich Ihnen anbieten«, sagte Cromm. »Wenn Sie einverstanden sind, tun Sie etwas Gutes. Sie verhindern nämlich, dass der Mann die Masche auch bei anderen probiert. Und jetzt überlegen Sie ganz in Ruhe: Sollen wir? Oder sollen wir nicht? Ja? Oder nein?
Frau Stöffel dachte nach. Dann sagte sie mit fester Stimme: »Ja!«
»Gut«, sagte Cromm. Er klappte die Abdeckung des Tablets auf und sagte: »Dann brauche ich jetzt bitte die Einzelheiten …«
Im Laden waren damals die Einzelheiten beschrieben worden. Frau Stöffels Zuhörer hatte viel Geduld gezeigt und alles notiert, was ohnehin elektronisch aufgezeichnet wurde. Er hatte auch möglichst viel zur Person des Fahrers wissen wollen, sein Aussehen, irgendwelche Auffälligkeiten. Aber darüber brachte er nicht mehr viel aus der alten Dame heraus.
Der Kaffee war schrecklich. In der Kantine hatten sie eine alte Maschine aus der Zeit, als das Wort »Espresso« noch einen exotischen Klang hatte. Das stolze Produkt dieses Automaten hier, der nie kaputtging, war eine Flüssigkeit mit der Bezeichnung »Filterkaffee«. Eigentlich sollte man so was nicht trinken, dachte Polizeiobermeister Johann Knapp wieder einmal, aber er sah keine Alternative, also griff er zu einem Pappbecher, zapfte sich »Filterkaffee« und ging zur Kasse, wo ein Praktikant Dienst schob. Wortlos legte Knapp seine Speicherkarte auf die Kontaktfläche, nahm Milch und Zucker und suchte sich einen Platz an einem der freien Sechsertische, nah am Fenster, damit er zusehen konnte, wie sich draußen die Frühlingssonne gerade wieder verabschiedete.
Kaum hatte er sich hingesetzt, trat ein Mann in den Pausenraum, kam an seinen Tisch, zeigte fragend auf einen Stuhl und ließ sich nieder. Es war ein Kollege, Werner Dreier, Kriminalkommissar beim LKA, Abteilung für Wirtschaftskriminalität im vierten Stock, ein netter Kollege, weil er sich trotz höherer Laufbahn und Karriere nicht zu schade war, bei einem uniformierten Kollegen am Tisch zu sitzen.
»Na?«, fragte er, »schönen Tag gehabt?«
»Na ja, normaler Dienst halt, Streife mit der Schülerin, der Anwärterin. Du kennst sie?«
Dreier nickte. »Ich kenne sie, macht keinen schlechten Eindruck.«
»Ja, die wird noch was. Sie ist ehrgeizig. Aber mir fällt ein: So ganz normal war es heute doch nicht. Wir haben etwas erlebt, also ich sag mal: sehr speziell.« Knapp nahm einen Schluck von seinem Kaffee und verfluchte im Stillen die Maschine. »Es fing schon komisch an: Wir waren auf Streife in Charlottenburg, da wurden wir zu einem Verkehrsunfall in der Suarezstraße gerufen. Das Revier sagte, sie hätten einen anonymen Hinweis zu dem Unfall bekommen, von einem nicht identifizierbaren Handy. Außerdem hatten wir im Nachhinein den Eindruck, dass der Anrufer den Unfall schon angekündigt hatte, bevor er überhaupt passiert war, denn als wir vorfuhren, war noch keine Minute vergangen.«
Dreier nickte höflich, mäßig interessiert.
Knapp geriet in Fahrt: »Dann der Unfall. Da hatte einer rechts vor links ignoriert, und es hatte gekracht. Routine eigentlich. Das Problem war nur, dass der mit der Vorfahrt sich davongemacht hatte. Zurück blieb ein Typ mit einem 3er-BMW, ziemlich von der Rolle, hat seine Fahrlässigkeit gar nicht erst bestritten. Viel Blech- und kein Personenschaden. Warum bleibt der Geschädigte nicht da und wartet auf uns? Komisch, oder?«
Dreier horchte auf. Tatsächlich, das war ungewöhnlich. »Und, weiter?«, fragte er neugierig.
»Na ja, wie gesagt, uns kam das komisch vor, zumal der Typ mit dem Dreier was von einer blonden Frau am Straßenrand erzählt, der er nachgeguckt hätte, weil sie ihn angemacht hätte. Jedenfalls – der hatte ja einen Migrantennamen …«
»Oh-oh!«, unterbrach ihn Dreier mit hochgerecktem Zeigefinger.
Aber Knapp ließ sich nicht aufhalten. »… also habe ich ihn und sein Auto mal gecheckt. Also, zum Fahrer: deutsche Staatsangehörigkeit, gemeldet in Spandau, Nachname Petrosian, gibt’s ja nicht so häufig, oder?«
»Armenisch«, warf Dreier ein. Es hatte da mal einen Weltklasse-Schachspieler gleichen Namens gegeben.
»Jedenfalls gab es über diesen Herrn Petrosian ein Dossier. Keine Verurteilungen, nur Anzeigen und Ermittlungen, ohne dass der Staatsanwalt es bis zur Anklage gebracht hätte. Aber immerhin. Er war in acht Monaten dreimal aktenkundig geworden. Mit Verkehrsunfällen, bei denen er jedes Mal Vorfahrt hatte. Immer rechts vor links. Immer alte Autos. Immer nur Blechschaden, allerdings heftiger. Es hatte Zeugen gegeben, aber eine Unfall-Absicht nachweisen konnte man ihm nicht. Also eine Absicht, es krachen zu lassen.«
Dreier wurde nachdenklich. Es gab seit längerem Gerüchte über eine libanesische Rechts-vor-links-Bande. Die kauften ausgelutschte Youngtimer und lauerten an unübersichtlichen Ecken auf unbedarfte ältere Fahrer. Wenn die naiv über die Kreuzung tuckerten, kamen sie mit Vollgas von rechts, bremsten in letzter Sekunde (die Bremsspuren waren wichtig, damit es keine Diskussion über eine Mitschuld geben konnte) und ließen es schließlich krachen. Nach dem Unfall jammerten sie ihren Opfern vor, dass die Versicherung nicht den ganzen Schaden übernehmen würde. Das Auto wäre ein wertvoller Old-timer. Sie machten den verunsicherten Opfern Druck, um zusätzlich zum Geld von der Versicherung abzukassieren. Insgesamt waren sie mehrfach erfolgreich gewesen und dabei kaum zu überführen.
»Aber diesmal ist er von links gekommen?«, fragte Dreier.
»Das war’s ja! Diesmal war er der Dumme!«
»Und?«
»Wir haben ihn mitgenommen, hier ins Präsidium.«
»Was!? Mitgenommen? Eine Vernehmung? Mit welchem Vorwurf? Das hat er sich gefallen lassen?«
»Na ja, für uns war das eine Zeugenvernehmung.« Knapp trank einen Schluck von dem Kaffee, der kälter noch schlechter war. »Außerdem stand der Mann so was von neben sich! Den hätten wir gar nicht ans Steuer seiner beschädigten Blechschüssel lassen dürfen.«
»War sein Auto nicht mehr fahrfähig?«
»Na ja, doch, schon. Der 3er-BMW ist zwar auf der rechten Seite ein bisschen schlanker, und man kann vorne rechts nicht mehr einsteigen. Aber fahrfähig? Doch, geht noch.«
»Na, dann wart ihr mit der Vernehmung aber auf dünnem Eis, mein Lieber!«
»Weiß ich. Aber wir haben ihn hier doch wirklich nur als Zeugen befragt: Erst zur Sache selbst. Und dann überhaupt. Warum er so oft Unfälle hätte. Ob er uns das erklären könne. Aber inzwischen war er zu sich gekommen. Kaum saß er am Tisch und hatte sein Glas Wasser, wurde er schweigsam. Wir mussten ihn gehen lassen, schließlich lag nichts vor.«
»Interessant. Kann ich das mal sehen?«
»Du willst den Vorgang?«
»Hmhm!«
»Du kriegst die Vorgangsnummer.« Damit konnte Dreier alles einsehen. Und das hatte er auch vor.
Die Sonne war untergegangen, der Filterkaffee getrunken, die Pause vorbei, Dreier und Knapp gingen ihrer Wege. Knapp müde, Dreier nachdenklich.
3
Eigentlich war er in der Stadt lieber mit Bahn oder Bus unterwegs. Tagsüber war das bequem und schneller als mit dem Auto. Heute aber hatte er viel vor, und in der späten Nacht mit der U-Bahn zurück, na ja – da wurde es manchmal eklig. Nicht alle Menschen, die nachts in der U-Bahn rumhingen, waren angenehme Zeitgenossen. Ein paarmal hatte er fast Ärger bekommen. Heute wollte er einfach kein Risiko eingehen. Deshalb hatte der Sharan gewonnen.
Der VW-Van war sein »Dienstwagen«, für Dreharbeiten mit dem Kamerateam, für Einkäufe und Lasttransporte. Blau und noch glänzend. Ein Diesel mit Automatikgetriebe, den die VW-Pressestelle seinerzeit freundlichst rabattiert hatte, weil sie hoffte, dass man als Journalist der Welt mitteilte: der Sharan Diesel ist großartig. VW ging es gerade nicht so gut, und man war dort in der Pressestelle hungrig auf Lob. Er sah dafür keinen Grund, aber den Rabatt nahm er gerne. Er sah in dem geduldigen Volkswagen einen Packesel für werktags, pflegte ihn weder, noch schonte er ihn. Die Sonntage jedoch, die waren seiner Bella vorbehalten, seiner Giulia Super, einer alten Dame von 1968, gut in Schuss, verhätschelt, immer gewaschen; wenn es möglich gewesen wäre, hätte er sie sogar onduliert.
Er folgte der Navi-Stimme: »Nach fünfhundert Metern rechts abbiegen.« Und nach zwanzig Sekunden: »Sie haben Ihr Ziel erreicht.« Die Wollankstraße. Das »Ziel«, von dem das Navi sprach, lag in Gesundbrunnen. Der etwas schäbige Ortsteil des ansonsten ziemlich feinen Bezirks Mitte. Vor der Reform war dies hier der Wedding. Jenes legendäre Viertel, in dem in den Zwanzigerjahren die Arbeiter lebten, die Kommunisten die Mehrheit hatten, die Nazis auf den Straßen beschossen wurden. Heute hieß es Gesundbrunnen, auch wenn an Kneipenschildern und Graffitis noch der Wedding auftauchte. Jetzt waren die Arbeiter und ihre Frauen sehr alt und mussten Platz machen: den Osteuropäern und Türken, den Studenten und vereinzelt auch Künstlern. Hier also hatte die Gesellschaft für unkonventionelle Maßnahmen ihren Sitz. Allein die Ortswahl bewies schon den Mut zum Unkonventionellen.
Von dieser sogenannten Gesellschaft hatte er schon vor Monaten gehört und war neugierig geworden. Ein privates Etablissement, eine Art Verbraucherschutz-Büro, aber doch wohl mehr als nur eine Konkurrenz zu den staatlichen Verbraucherzentralen. Wie er erfahren hatte, boten sie handfeste Hilfe für Kunden, die sich schlecht behandelt fühlten. Denen Unrecht geschehen war, wo man aber mit freundlicher Vermittlung oder auch juristischer Unterstützung nichts machen konnte. Da konnte diese Gesellschaft helfen – ganz praktisch, sehr direkt, sehr wirksam, häufig jedoch mit nicht zulässigen Methoden.
So etwas gab’s sonst nirgendwo. Es gab die gemeinnützigen und staatlich geförderten Verbraucherzentralen. Die waren überlaufen und manchmal überfordert. Dann gab es Verbraucheranwälte, die – weil es zu viele von ihnen gab – händeringend und nicht immer auf ganz saubere Weise Klienten suchten. Das konnte für die Kläger teuer werden – ohne Garantie auf einen Sieg vor Gericht. In dieser Marktlücke hatte sich anscheinend diese Gesellschaft für unkonventionelle Maßnahmen eingerichtet. War das eine Geschäftsidee? Ein Start-up? Oder steckten Wohltäter dahinter? Was er so über diese Gesellschaft hörte – und die Erzählungen hatten ihn bislang alle auf seltsam verschlungenen Wegen erreicht –, klang immer ein bisschen geheimnisvoll.
Also hier: die Mitte der Wollankstraße. Er fand in der Nähe einen nicht ganz korrekten Parkplatz. Kein Problem. In diesem Kiez schrieb die Polizei keine Strafzettel. Er stieg aus und schaute sich um. Die Straße empfing ihn mit Krach, Gewusel und mit dem Klang unterschiedlicher Sprachen. Es gab hier schon noch ein paar Deutsche. Aber sie waren die Minderheit. Entweder alt und dageblieben. Oder jung und auf Durchreise: Studenten, die sich über niedrige Mieten freuten. Der Rest war türkisch, polnisch, bengalisch, libanesisch und so weiter. Meist funktionierte das reibungslos. Überfremdungspöbler aus ostdeutschen Städten hätten mal vorbeikommen sollen, um zu sehen, wie so was ging. Aber das hätte ihr Weltbild ins Wanken gebracht.
Als eine Frau mit Kind und Einkaufstüte vorbeikam, sprach er sie spontan an: »Kennen Sie die Gesellschaft für unkonventionelle Maßnahmen?« Die Antwort waren staunende Augen, Schulterzucken, Kopfschütteln. Es war also nicht so, dass der Laden ein Begriff war. Obwohl sie praktisch vor dem Ladenlokal des Vereins standen, hatte die Frau nicht die geringste Ahnung. Manchmal, dachte er, ist unverhohlene Präsenz das beste Versteck.
Als Freelancer suchte er immer nach Storys. Meist konnte er sich aussuchen, was er machen wollte. Er arbeitete auch für Printmedien, vor allem aber fürs Fernsehen. Für die Dokumentationsformate im Fernsehen. Manchmal fragten sie nach ihm und packten ein schwieriges Thema auf den Tisch, eins, das sie selbst nicht anfassen wollten, wo es gefährlich werden konnte oder wo am Ende nach langer Recherche möglicherweise nichts rauskam. Aber oft entdeckte er auch selbst eine Story und ging damit zu den Redaktionen. Immerhin: Er war sowohl bei den politischen als auch bei den Wirtschaftsmagazinen im Geschäft. Das konnte nicht jeder Kollege von sich sagen. Also bitte, dachte er, beklag dich nicht.
Inzwischen stand er direkt vor dem trübseligen Schaufenster der Gesellschaft. Man konnte kaum glauben, dass die hier irgendetwas Ernsthaftes bewegten. Es sah unscheinbar aus und billig. Drinnen funzelte Baumarktlicht an der Decke. Eine alte Frau saß mit dem Rücken zu ihm. Ein nicht mehr junger Mann saß hinter dem Schreibtisch. So einer hatte ihn angerufen: Man hätte vielleicht eine Geschichte.
Neugier war die Grundvoraussetzung in seinem Beruf. Und er gestand sich ein, dass es ihnen gelungen war, ihn neugierig zu machen. Warum nahmen sie überhaupt Kontakt auf? Wozu brauchten sie ihn? Der am Telefon nannte seinen Namen nicht, dafür aber den Namen einer Bank. Einer großen deutschen Bank. Von der man gehört hatte, dass sie gute Geschäfte mit ihren Privatkunden machten, mit den kleinen Leuten – gerade mit denen. Wie konnte man mit kleinen Leuten, die kleines Geld hatten, gut verdienen? Dachte er so vor sich hin, als der Mensch am Telefon sagte, sie hätten eine gute, vielleicht eine sehr gute Geschichte über diese Bank und ihre Geschäfte mit kleinen Leuten. Ob ihn das interessieren würde? Ob er Lust hätte?
Er hatte Lust.
Hier war er: Sönke Ahlers. 49 Jahre alt, Journalist, Reporter, in keiner festen Beziehung lebend, häufige kurze Freundschaften, hin und wieder auch mal vorübergehend liiert. Wenn seine Freundinnen sich schmeichelnd an ihn ranwanzten, dass man zusammen doch viel schöner und billiger leben könne, war für ihn der Zeitpunkt zum Schnitt gekommen. Morgens gemeinsam im Bad? Deine Zahnbürste? Meine Zahnbürste? Er hat seine Eigenheiten und seine Vorlieben. Die wollte er nicht teilen oder sich gar einschränken. Nix da. Und tschüs!
Ein festes Einkommen mit Lohnsteuerkarte hatte er nicht – aber die Honorare waren nicht schlecht. Sie kamen nicht pünktlich zum Monatsersten, sondern mal selten und dann wieder alle auf einmal. Aber eine Festanstellung hatte ihn nie gereizt. Für ihn war Journalismus Freiheit, Selbstständigkeit, manchmal sogar Abenteuer. Sein Name war in der Branche bekannt, wurde großgeschrieben direkt unter der Überschrift oder im Vorspann einer TV-Reportage. Er wurde gebucht, manchmal solo, manchmal musste er sich sein Kamerateam, seine Cutterin oder seinen Stringer selber suchen, Hauptsache, das Honorar stimmte. Alles gut also – jedenfalls einerseits.
Andererseits liebte er das Leben mit der jeweiligen Freundin, mit gutem Essen und Trinken, Autofahren mit der Giulia und Urlaub in Ländern weit weg. Ging fürs Erste alles, mit einem Nachteil: Es blieb nichts übrig. Altersvorsorge war nur ein Wort, er versuchte, es zu ignorieren. Riester-Rentner waren Spießer. Er, Sönke Ahlers, altersvorsorgte überhaupt nicht. Jeden Monat tausend Euro abzweigen? Keine Lust, bisher jedenfalls. In letzter Zeit allerdings legte sich manchmal so ein Schatten über ihn, wenn er morgens aufstand und ächzte. Wie würde das in zwanzig Jahren sein? Wenn er noch lauter ächzen müsste? Dann schickte ihn keiner mehr ins Abenteuer. Den alten Sack brauchen wir nicht. Und was dann? Wo kamen die Honorare dann her? Mit anderen Worten: Nicht alles war gut.
Was immer half, taugte auch in diesem Fall: entschlossen wegschauen. Augen zu und weitermachen. Rein in neue Jobs, in neue Geschichten. Auf zu Themen, die andere nicht hatten und die seinen Marktwert steigerten. So wie jetzt zum Beispiel. Vielleicht konnte er aus dieser komischen Gesellschaft ja eine Story machen. Er hatte die Adresse, kannte ein paar Gerüchte, war neugierig auf den Vorschlag dieser Leute und vorsichtig zugleich.
Als Profi wollte er ihnen ein paar Schritte voraus sein. Recherche war alles. Er trat noch etwas näher auf das Ladenlokal zu, blickte wieder prüfend hinein, merkte sich alles und machte, dass er davonkam. Schließlich war er ja nicht verabredet. Er setzte sich ins Auto, um zu warten, bis einer rauskam, dem er auf den Fersen bleiben würde. Damit wäre er schon schlauer. Erst danach würde er einen Termin anfragen. Neugier kostete nichts, konnte aber viel einbringen.
Nicht dass er sich über zu wenig Arbeit beschweren konnte. Aber Kriminalkommissar Dreier hatte was geschnuppert. Dreier saß in seinem Büro und blickte aus dem Fenster, um sich zu konzentrieren. Immerhin hatte er ein Zimmer fast für sich allein, denn sein Zimmerkollege war viel unterwegs, der Mann hatte Fortbildung und Bildungsurlaub für sich entdeckt und fehlte seitdem häufig. Das ging zulasten der übrigen Mitarbeiter in der Abteilung. Aber dafür hatte Dreier in dem Achtzehn-Quadratmeter-Raum mit drei Türen und einer Fensterfront mit morschen Fensterrahmen nur einen leeren Schreibtisch und einen verstaubten Bildschirm als Gegenüber. Das Alleinsein im Zimmer war die Mehrarbeit wert, es war seine Entschädigung für die Drückebergerei des Kollegen.
Immer wenn Dreier die Designermöbel in den Polizistenbüros der TV-Serien sah, stöhnte er demonstrativ auf. So ein Bullshit. Das gab es sicherlich – irgendwo. Aber er saß in einem Altbau, der sparsam renoviert worden war, an einem entsprechenden hölzernen Schreibtisch auf einem gesunden, aber hässlichen Bürodrehstuhl – früher schwarz, jetzt speckig; den Boden bedeckte ein abgewetzter Linoleumboden, der älter aussah, als er war – was für eine Leistung, dachte Dreier –, und von der Decke leuchtete bläulich weißes Energiesparlicht, das rosige Gesichter in trübäugige Wasserleichen verwandelte. Einmal in der Woche war Ramadan, so nannten es die Kollegen alles andere als politisch korrekt, wenn das kopftuchtragende Reinigungspersonal kam und zügig-nachlässig so tat, als ob es putzte.
Wenn er Kollegen in anderen Städten besuchte, sah es bei denen ähnlich aus. Wer zum Teufel hatte eigentlich diese Designermöbel? Und die schlanken blonden Assistentinnen? Und den verständnisvollen Chef, der einem bei Ärger den Rücken freihielt? Wo ging es so zu?
Persönliche Dinge gab es in seinem Zimmerteil kaum. Er hasste dergleichen, da waren die Fotos von den Kindern seines entschwundenen Kollegen an der Wand gegenüber und dessen Urkunden über angebliche Leistungen im Polizeisportverein, derer Dreier sich geschämt hätte, zumal die Urkunden alt waren und dem aktuellen Taillenumfang des Kollegen spotteten – na ja. Manchmal hätte er den Kram gerne abgehängt, aber in einem Anfall von Aberglauben fürchtete er, dass genau in diesem Moment der Kollege zurückkommen und es zum Eklat kommen könnte: »He, was machst du da!?« Und dann würde der Mann nie mehr zu Fortbildungen entschwinden, und er würde immer neue grausige Trophäen in seinem Regal platzieren und schlechte Fotos aufhängen oder hässliche Kaffeebecher mit pseudo-witzigen Bürosprüchen auf den Tisch stellen und so weiter. Nee, lieber alles so lassen.
Der Kollege war auch heute abwesend. Und so konnte Dreier auf sich selbst zurückgeworfen in Ruhe nachdenken. Irgendetwas war da faul mit diesem kleinen Rechts-vor-links-Gauner, es nervte ihn, dass man dem Mann und seiner Bande nicht beikommen konnte. Bei diesem speziellen Unfall aber war die Sache oberfaul, ein Unfall, der den Gauner-Fahrer seinerseits in die Bredouille gebracht hatte. Wenn Dreier etwas nicht leiden konnte, war es Selbstjustiz. Das war die Axt am Stamm des Rechtsstaats. Wenn demnächst jeder jedem in die Fresse schlug – wo sollte das enden? Manchmal kam es vor, dass sich konkurrierende Banden gegenseitig dezimierten. In solchen Fällen waren sich die Polizisten einig, dass man zusehen durfte, solange keine Außenstehenden in Gefahr gerieten. Und wenn dann alles vorbei war, gab es nur noch halb so viele potentielle Täter wie zuvor, die Lage war übersichtlicher, die Arbeit einfacher.
Aber wo sollte denn Konkurrenz herkommen? Davon hätte er längst gehört. Die Stadt war groß, aber auch geschwätzig. Da war nichts – er war sich sicher. Andererseits, welches der ältlichen ängstlichen Opfer wäre zu einer Racheaktion fähig? Trotzdem, dieses Gejammer von Petrosian, eine Blonde im kurzen Rock hätte ihn abgelenkt … Vielleicht war das doch keine Schutzbehauptung.
Jedenfalls stieg Dreier in die Tiefen seines PCs hinab und forschte: Wer könnte so eine Aktion durchführen? Wer hätte daran Interesse? Er gab seine Suchwörter ein und hoffte auf Treffer. Er hoffte vergeblich.
Das Archiv half ihm letztlich nicht weiter. Sein Gedächtnis schon eher: Es gab einen Ex-Kollegen. Einen, der gut in seiner Arbeit gewesen war. Engagiert. Tapfer sogar. Ohne auf die Uhr zu schauen bei komplizierten Fällen, ohne Furcht bei kritischen Einsätzen. Der sich jedoch mit der Zeit immer mehr über die politischen Fesseln geärgert hatte. Und die Frechheiten der Täter. Ihm erschienen irgendwann die rechtlichen Einschränkungen zu stark. Polizisten durften in der Öffentlichkeit verhöhnt und bespuckt werden und konnten dagegen kaum etwas tun. Wenn einer der gepiesackten Polizisten sich wehrte, kam es schnell zu großem Wehklagen in den sozialen Netzwerken und zu einem Aufstand in der Presse. Bis schließlich auch noch die Politiker sich rührten und die Polizisten ermahnten, sie sollten doch bitte sehr … sie dürften nicht so hart … nicht so einseitig … und so weiter. Und im schlimmsten Fall setzte auch noch einer von der Polizeispitze, der auf politischen Rückhalt für die eigene Karriere hoffte, mit besserwisserischen Sprüchen eins obendrauf, und die jeweiligen Ermittler standen besonders dumm da.
Silvio Cromm – mit dem er gerne zusammengearbeitet hatte – hatte das immer genervt. Alle im Präsidium hatten die gleichen Probleme, schwiegen aber zähneknirschend. Cromm jedoch hielt sich nie zurück. Bis er schließlich für einen Strafprozess die Fakten gegen einen brutalen Kriminellen zusammengetragen hatte, einen Mann, der mehrfach in Wohnungen eingedrungen war und nicht nur gestohlen und geraubt, sondern der einige Bewohner zusammengeschlagen und auch noch verhöhnt hatte. Im Prozess jedoch war Cromm von der Verteidigung als Rassist attackiert worden, weil der Angeklagte aus einer Sinti-Familie kam. Man hatte ihn gedemütigt, und am Ende war er auch noch lächerlich gemacht worden von dem enttäuschten Staatsanwalt, der den Freispruch genau wie Cromm als Niederlage empfand, aber jede Kritik von sich weisen wollte.
Da hatte Cromm kurz entschlossen den Job – trotz seiner hohen, gut bezahlten und sicheren Position – hingeworfen. Cromm befand sich natürlich in einer luxuriösen Lage, da er finanziell unabhängig war. Seine italienische Sippe mit den Restaurants sorgte für das Grundeinkommen. Dreier hatte das fast verstanden.
Außerdem: Da war noch etwas.
Die Zeiten hatten sich geändert, und es gab keine Benachteiligung wegen sexueller Orientierung. Amtlich. Offiziell. Aber Polizei war Polizei, so wie Militär Militär war. Da waren Schwule nicht so gerne gesehen. Über Cromm war schon lange getuschelt worden. Cromm hatte anders als alle anderen keine Frau, keine Kinder, keine