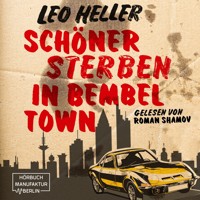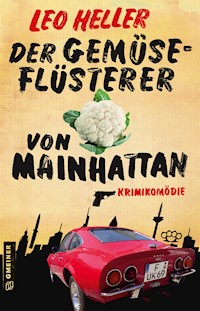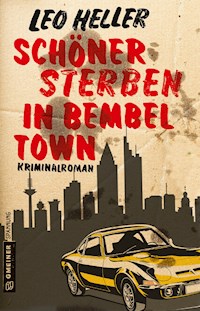
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Detektiv Jürgen McBride
- Sprache: Deutsch
Der Frankfurter Detektiv Jürgen McBride, Opel-GT-Fahrer und Kunstbanause, wird beauftragt, ein gestohlenes Kunstwerk von Josef Beuys wiederzufinden. Dem Werk, ein mit Kojotenblut gezeichnetes Eichhörnchen, werden magische Kräfte nachgesagt. Außer McBride machen auch andere, finstere Typen Jagd auf das Bild. Bei McBrides unkonventioneller Vorgehensweise kommt es zu jeder Menge Missverständnissen. Klar, dass dabei nicht nur Herzen, sondern auch Nasen gebrochen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leo Heller
Schöner Sterben in Bembeltown
Kriminalroman
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Fotos von: © Leszek Czerwonka / stock.adobe.com und © pfrang117 / stock.adobe.com
und © Samiran Sarkar / shutterstock.com
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6120-0
Haftungsausschluss
Weder die Personen noch die Ereignisse, die ich beschreibe, sind erfunden. Vielmehr hat sich die ganze Chose in den drei heißen Hochsommerwochen im Jahr 2013 in und um Frankfurt genau so abgespielt, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Etwas dazuzuerfinden ist auch nicht nötig gewesen. Denn das Leben selbst denkt sich bekanntlich die besten Geschichten aus.
Inhalt
Impressum
Haftungsausschluss
Inhalt
Erst mal zwei schöne Leichen
Daheim ist zu Hause und umgekehrt
Bad Homburg hat die höchste Blondinen-Dichte in ganz Deutschland
Das Geheimnis der Monika Bärheimer
Wahre Kunst verlangt Opfer
Pflücke keine Blumen am Straßenrand, wenn du zur Gärtnerei unterwegs bist
Das Horoskop aus der Bild-Zeitung
Ein gut Stück weit Betroffenheit
Schicksalsjahre einer Kaiserin
Des Menschen bester Freund
Rürup und Hartz IV
Beuys and girls
Karneval der Kulturen oder wie mir die alte und junge Frau Hegemann das Leben retten
Rowdytum und Goldbroiler
Cannonball
Mon Chéri mit der Piemontkirsche
Frankfurt Fashion Weekend
Illuminati
Doom Day in Bad Sobernheim
What is and what should never be
Duluda Deluxe. Fünflagig
Nachtrag
Nachtrag zwei
Lesen Sie weiter …
Erst mal zwei schöne Leichen
Ein scharfer Knall zerreißt den Morgen und zittert an den Backsteinwänden der alten Fabrik entlang. Die da draußen halten augenblicklich ihren Schnabel. Keiner wagt, auch nur den geringsten Krach zu schlagen in dem von alten Lagerhallen und heruntergekommenen Wohngebäuden umbauten Hinterhof im Frankfurter Gutleutviertel, aus dem alle guten Leute schon vor langer Zeit weggezogen sind.
Ich werfe die zerplatzte Brötchentüte aus dem Fenster und mich selbst zurück in meine Kiste. Ich versuche wieder einzuschlafen. Mein Ausflug ins Frankfurter Bahnhofsviertel ist wieder mal aus dem Ruder gelaufen. Und heute Morgen wandern Erinnerungen an die letzte Nacht als kotzgrüne Nachbilder auf der Innenseite meiner aufgerauten Hirnschale umher. Grell und verzerrt wie die Spiegelungen der Bumslokal-Leuchtreklamen auf dem nassem Asphalt. Gesprächsfetzen rotieren an der Zimmerdecke und fallen mir aufs Gesicht wie aufgeweichte Bierflaschen-Etiketten. Mir ist übel. »Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung.« So heißt es doch irgendwo, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht für jemanden, der um zehn Uhr abends mit einem Becher Pfefferminztee ins Bett geht.
Die Nachbilder auf meiner Schädelinnenwand verblassen. Ich sinke zurück in einen halb wachen Zustand. Das Telefon klingelt. Ich lasse es klingeln und warte darauf, dass der Anrufer aufgibt. Ich widme mich so lange dem Kotz-Kaleidoskop an der Zimmerdecke. Das Telefon beruhigt sich. Einen Moment lang herrscht Stille. Dann setzt draußen einer der zirpenden Zauser zaghaft sein Zwitschern an diesem Samstagmorgen fort. Mein Telefon antwortet ihm.
Das Display zeigt an, dass es kurz vor halb sieben ist. Unglaubliche sechs Uhr dreißig an einem Samstag! Stinksauer schnauze ich meinen Namen in den Sprechapparat.
»Spreche ich mit der Detektei McBride?«, flötet die Stimme einer Frau zurück, circa zweiunddreißig Jahre alt, blond, Akademikerin, ein Meter vierundsiebzig groß, Körbchengröße fünfundsiebzig B und mit einer Fehlstellung im unteren Lendenwirbelbereich.
»Mit wem sonst, wenn Sie meine Nummer gewählt haben? Hören Sie, was auch immer in Sie gefahren ist …«
»Mister McBride, bitte, ich weiß, es ist vielleicht noch etwas früh. Es tut mir wirklich leid, aber ich brauche Ihre Hilfe.«
»Vielleicht noch etwas früh? Rufen Sie während der Bürozeiten an, dienstags bis freitags von zehn bis achtzehn Uhr, montags geschlossen, und jetzt Gute Nacht.«
»Mister McBride, entschuldigen Sie, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, hier spricht Ellen von Unschwer.«
»Na und?«
»Ihr Büro ist mir persönlich empfohlen worden. Die Sache ist mir sehr, sehr wichtig. Ich fühle mich bedroht.«
»Wenden Sie sich an die Polizei, die …«
»Mister McBride, sind fünfhundert Euro Tagesgage angemessen? Ohne Ihre Spesen selbstverständlich. Gerne als Wochenvorschuss.«
Ich brauche heute Morgen für alles etwas länger. Volle drei Sekunden hänge ich sprachlos in der Leitung. Die Anruferin schweigt ebenfalls. Madame beliebt zu pokern. Mir flitzen die fünfhundert Euro Tagesgage und das Wort »Wochenvorschuss« wie ein Vollgummiball im Kopf rum.
»Kommen Sie bitte sofort zum Eisernen Steg auf die Sachsenhäuser Seite«, übernimmt die unbekannte Pokerqueen die Initiative.
»Frau von Unschwer, bevor ich irgendwo hinkomme, muss ich wissen, von wem oder was Sie sich bedroht fühlen und was ich damit zu tun habe.« Am anderen Ende der Leitung tönt Rauschen. Ellen hat aufgelegt.
Schön. Ein seriöser Auftrag beginnt anders. Aber selbst wenn sich das Ganze als Fake herausstellen sollte: Ich kann’s mir nicht leisten, die Chance auf einen so fetten Job durch die Lappen gehen zu lassen. Dann wird das eben mein erster Arbeitstag, den ich seit meiner Kündigung vom Polizeidienst um eine so frühe Uhrzeit antrete. Eine kalte Dusche und ein heißer Maxwell-Instant-Kaffee bringen mich in weniger als fünf Minuten an den Start. Ich stürme die ausgelatschte Treppe der alten Gummistiefelfabrik hinunter zum Parkplatz in meinen Opel GT. Fünfhundert Euro Tagesgage plus Spesen plus Blondine in Nöten – here I come!
Zehn Minuten später stehe ich am Eisernen Steg und schaue mich nach meiner Auftraggeberin um. Aber hier ist keine blonde Lady mit einem Bündel grüner Scheine. Nichts und niemand ist hier. Außer einem Mann mit seinem Hund, der in einiger Entfernung gemütlich in der Morgensonne auf einer Bank sitzt und lange Schatten auf den Kies wirft. Unten am Mainuferweg zockelt ein knallorangefarbenes Vehikel unserer ruhmreichen Frankfurter Kehr- und Müllbeseitigungstruppe den Gehweg entlang. Ich warte eine Zigarettenlänge lang am Treppenaufgang zum Eisernen Steg. Dann entscheide ich mich, den Mann auf der Parkbank, der mit in den Nacken gelegtem Kopf die Sonnenstrahlen genießt, zu fragen, ob er eine junge Frau gesehen hat. Der Kies der Uferpromenade knirscht unter den Absätzen meiner Cowboystiefel. Der Typ im piekfeinen Burberry-Mantel scheint mich nicht zu bemerken. Auch sein Köter ignoriert mich. Ich will den Mann gerade ansprechen, als ich sehe, warum die beiden Kollegen so völlig die Ruhe weghaben: Herr und Hund ziert exakt in der Mitte ihrer Stirn ein Ein-Cent-großes Loch. Ein rotes Rinnsal kriecht über die Wange des Mannes und versickert unter seinem Mantelkragen.
Wer auch immer die beiden gelochstanzt hat, hat Sinn fürs Dekorative. Und kann mit einer Kanone umgehen. Dem Durchmesser der Einschusslöcher nach zu urteilen, handelt es sich bei der Schusswaffe um eine großkalibrige 44er. Nichts deutet auf Gegenwehr oder auf eine überraschte Reaktion hin. Kombiniere haarscharf: Herr und Hund haben ihren Killer gekannt.
Das Vernünftigste ist, aus diesem Job auszusteigen, bevor ich ihn überhaupt angetreten habe. Es kann kein Zufall sein, dass Hund und Herrchen tot am Eisernen Steg in der Morgensonne sitzen, nachdem Frau von Unschwer mich ausgerechnet hierherbestellt hat. Die Sache stinkt zum Himmel, aber gewaltig! Gerade als ich die Polizei anrufen will, kracht der King mit »You Ain’t Nothing But A Hound Dog« in meiner Hosentasche los. Der Klingelton des unsterblichen King of Rock ’n’ Roll auf meinem Smartphone erscheint mir an dieser Stelle wie ein mystischer Querverweis zu dem niedergestreckten Vierbeiner. Kann so was Zufall sein? Wohl kaum.
»Haben Sie ihn gefunden?«, will meine Auftraggeberin wissen.
»Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Ich rufe jetzt die Polizei. Wenn Sie glauben, ich lasse mich in einen Mordfall reinziehen, irren Sie sich. Wiederhören.«
»Warten Sie!«, schreit Frau von Unschwer in ihr Handy. »Warten Sie bitte, Mister McBride, nur ein klitzekleines Augenblickchen. Er ist tot, nicht wahr? Bitte, glauben Sie mir, ich habe damit nichts zu tun.«
Noch zögere ich, das Gespräch zu beenden. Die Verzweiflung der steilen Aristokratin macht mich ein gut Stück weit betroffen – circa einen halben Meter weit. Ihre weibliche Hilflosigkeit verfängt hier durchaus. Normalerweise verfängt ja immer nirgendwo nichts. Hier aber ausnahmsweise doch.
»Ich habe Johannes geliebt, ich hätte ihm nie etwas antun können. Ich weiß nicht, wer das getan hat, ich …« Die Frau bricht in Tränen aus.
»Beruhigen Sie sich, Frau von Unschwer. Ich denke, das ist ein Fall für die Polizei.«
»Bitte sagen Sie Ellen zu mir. Können Sie nicht einfach alles so lassen, wie es ist? Es hat Sie doch noch niemand gesehen. Bitte fahren Sie zurück in Ihr Büro. Ich werde Ihnen alles erklären. Sie erhalten Ihr Honorar für eine Woche im Voraus. Ich brauche Sie jetzt, ich habe doch sonst niemanden …«
Ab hier ertrinken Ellens Worte in einer Flut von herzzerreißenden Schluchzern. Das und die Aussicht auf fünfhundert Euro Tagesgage lassen mich die beiden Worte sprechen, durch die ich in diesem mörderischen Sommer zum Lover, Lügner und beinahe zur Leiche werden sollte: »Okay, Ellen!«
Satt röhrt der Motor meines Opel GT Baujahr 1972 auf, als mein blecherner Freund und ich durch die Häuserschluchten des Frankfurter Bankenviertels hauteng über der Asphaltdecke zurück Richtung Gummistiefelfabrik gleiten. Selbst in dieser Situation kann ich nicht anders, als die vollkommene Ästhetik dieses Jahrhundertwerks aus der Rüsselsheimer Fahrzeugschmiede zu loben. Nichts kann einen Mann glücklicher machen als eine kühle Flasche Binding Export am Feierabend, ein Sieg der Eintracht gegen Bayern, ein ohne Grillanzünder entzündetes Grillfeuer und der Sound eines Opel GT Baujahr 1972. Und zwar genau in dieser Reihenfolge.
Daheim ist zu Hause und umgekehrt
Zu Hause im Hof der alten Fabrik gibt es von meiner Auftraggeberin weit und breit keine Spur. Wie war das noch: »Sie erhalten Ihr Honorar für eine Woche im Voraus«? Als ich auf dem Weg in mein Fabrikloft in den Briefkasten schaue, sind da keine Euroscheine. Stattdessen liegt da etwas Schwarzes, Glänzendes. Ein Revolver. Eine Smith & Wesson, Kaliber 44. Ich muss nicht Detektiv sein, um zu erraten, dass es sich bei der Wumme um die Lochstanze für den Kollegen am Eisernen Steg handelt. Ich schiebe die Kanone in die Arschtasche meiner Levis 501 und eile rauf in meine Wohnung.
Routinemäßig checke ich oben im vierten Stock am Eingang zum Loft die Lage. Der Fußabtreter, der mit der linken Ecke normalerweise unter der Eingangstür steckt, liegt jetzt schnurgerade an der Türkante. Lautlos drehe ich meinen Wohnungsschlüssel im Schloss und reiße die Tür mit einem Ruck auf.
Sofort bricht die Hölle über mich herein. Den Speedpunch, der von links auf mich zutankt, pendele ich noch locker aus. Da trifft mich von der dunklen Seite des Eingangs der harte Beat eines Schlagstocks hinters Ohr. Damned! Ich habe nicht mit zwei Angreifern gerechnet. Aber jetzt ist keine Zeit, in eine Analysis of Defense einzusteigen. Eins ist klar: Jeder andere wäre durch einen solchen Schlag auf den Schädel für ein paar Stunden ins Reich der Träume geschickt worden. Ich aber habe durch meine Zen-Ausbildung bei den KFC Special-Forces in Burma gelernt, wie man durch Bewusstseinssplitting drohenden Ohnmachten entgehen und damit extrem lange kampffähig bleiben kann.
Neulich las ich in der Zeitung, dass es in Indien einen Guru gäbe, der seit siebzig Jahren ohne Nahrung und ohne Toilettenbesuche auskäme. Das wundert mich nicht. So ähnlich übermenschlich muss man sich meine Unempfindlichkeit gegenüber für Durchschnittsheimer tödliche Schläge vorstellen.
Einen Wimpernschlag später bin ich wieder auf den Beinen. Die durch den Schlag hinters Ohr erhaltene Energie wandele ich in einen sogenannten Koma-Mizekaze um. Dabei täuscht man einen Angriff auf die Kniescheibe des Gegners vor und lässt dann seine Faust voll auf der Zwölf explodieren. Im dunklen Wohnungseingang markiert das Weiße eines Augenpaares kurz mein Ziel. Auf gut Glück schieße ich den lasermäßigen Punch ab. Leider schlägt der Upper Cut nicht auf den Punkt ein. Wenn dieser legendäre Schlag sitzt, dann gibt es niemanden auf der Welt, der ihm etwas entgegensetzen könnte. Aber auch der halbe Treffer reicht aus, um den Angreifer über den Parkettboden rutschen und zehn Meter weiter wie einen nassen Putzlappen an die Wand klatschen zu lassen. Das dürfte die Verve des Heißsporns fürs Erste bremsen.
»BANG-BANG-BANG!« Ohne Vorwarnung bellt der schwere Revolver des zweiten Gangsters auf. Im Hechtsprung katapultiere ich mich hinter den massiven Küchenblock, auf dem ich noch gestern eine herrliche »Ratatouille pauvre Allemagne« kreiert habe und der jetzt durch die Kugeln der Gangsterspritze wie ein »Filet du porc à la poivre vert« traktiert wird.
Gnadenlos spielt mir der Gunman auf seiner Kanone das Wiegenlied vom Totschlag. Mit den Meissner-Frühstückstellern meiner Oma, die ich als Wurfsterne im Stil der Ninja Turtles abfeuere, halte ich mir den Freak vom Leib. Eisblaue Feuerlanzen antworten mir. Aus der Deckung beobachte ich, wie der an die Wand geklatschte Kriminelle zu sich kommt. Wenn dieser Kollege mich mit einer zweiten Kanone ins Kreuzfeuer nimmt, ist diese großartige Detektiv-Story beendet, bevor sie richtig angefangen hat.
Der geohrfeigte Nahkämpfer ist für einen Augenblick nicht zu sehen. Da bricht der Typ wie ein epileptischer Tsunami aus meinem Schlafzimmer hervor. Mit beiden Händen umklammert er mein sechshundert Jahre altes rasiermesserscharfes Samurai-Schwert, das er von der Schlafzimmerwand gerissen hat. Mit seinen zwei Zentnern Muskelmasse jagt er auf mich zu, um mich in der nächsten Sekunde zu halbieren. Mitten im Angriffssprung des Violation-Maniacs ziehe ich die 44er aus meiner Levis 501. Hoffentlich ist die Knarre geladen. Ich entsichere und … WAMM! Dem angreifenden Freak reißt es den kahlrasierten Stierschädel nach hinten. Sein brutales Gesicht gefriert zu einem blöden Lächeln. Wie eine zu prall aufgeblasene Gummipuppe, aus der gerade Luft entweicht, flattert er durch den Raum. Er rudert mit den Armen und schmettert, von seinem Angriffsschwung getragen, volle Kanne in den goldenen Bilderrahmen meiner wertvollen Gustav-Klimt-Ölbild-Reproduktion vom Frankfurter Flohmarkt.
Nach der missglückten Schwertattacke seines Kollegen zieht es der Ballermann vor zu flüchten. Gelenkig wie eine Katze flieht er über das heiße Blechdach der Fabrik. Da ich aus rechtlichen Erwägungen Leuten ungern in den Rücken schieße, lasse ich die Smith & Wesson stecken und schleudere ihm das Nächstbeste, das ich zu fassen kriege, hinterher. Meine Adilette trifft den Fighter hart am Kopf. Der Gunman strauchelt. Aber er ist gleich wieder auf den Beinen. Grinsend empfiehlt er sich mit einem ironischen Militärgruß, indem er sich mit zwei Fingern an die Schläfe tippt. Er springt vier Meter tiefer in den Fabrikhof, rollt sich auf dem Pflaster ab und verschwindet durch das Eingangstor der Gummistiefelfabrik.
Schade. Ich hätte gern den Grund seines Besuches gewusst. An eine Befragung des anderen ist nicht zu denken. Der Hüne hängt mit seiner Visage mitten in der Molkerei der splitternackigen Heroinnen meiner Gustav-Klimt-Originalfälschung vom Frankfurter Flohmarkt und bereichert die aristokratische Gold- und Ultramarin-Palette des Meistermalers der Donaumonarchie durch einige blutrote Einsprengsel im unbekümmerten Duktus eines Jackson Pollock. Ich schäle den Kerl vorsichtig aus dem Goldrahmen, um das wundervolle Gemälde nicht noch mehr zu beschädigen. Sein Gorillarücken schlägt auf dem Fußboden auf. Noch immer sinnlos grinsend, trägt er ein rotes Mal auf der Stirnmitte. Offensichtlich ist er tot. So tot, wie man nur sein kann, wenn man so richtig tot ist. Nachdenklich betrachte ich die rauchende 44er Smith & Wesson in meiner Hand.
Keine gute Idee, dem Mann ausgerechnet mit dieser Waffe das Licht auszupusten. Und dann auch noch genau zwischen die Augen.
Das letzte Mal, als ich gezwungen war, einen Menschen mit einer Waffe ins Jenseits zu befördern, war vor drei Jahren während eines Polizeieinsatzes. Das war auf den Tag genau an meinem fünfunddreißigsten Geburtstag. Danach habe ich den Polizeidienst quittiert.
Fortan musste ich meine Gegner ohne Waffe liquidieren. Jetzt, rückblickend nach drei Jahren, kann ich sagen: Mit einer Kanone fällt das bedeutend leichter.
Nach dem Besuch der beiden Einbrecher ist meine Wohnung ein Müllhaufen. Schubladen sind herausgezogen und durchwühlt, Möbel wurden umgestürzt. Mein Anglerausweis, die Eintrittskarte vom Ramones-Abschiedskonzert in Offenbach, das vollständige Kicker-Abo der Jahrgänge 1996 bis 2013, mein ganzes Leben liegt auf dem Boden verstreut. Was haben die beiden Freaks eigentlich gesucht? Geld kann es nicht gewesen sein. Außerdem braucht es keine zwei Muskelschränke mit Einzelkämpferausbildung, um in eine Wohnung einzubrechen. Der Besuch der beiden muss im Zusammenhang mit dem Auftrag der Lady und dem Ableben des Herrn mit Hund stehen.
Jetzt steht erst mal die Zwischenlagerung des stürmischen Gustav-Klimt-Liebhabers an. Sein eingefrorenes Grinsen geht mir langsam auf die Klicker. Also ab in den Kühlschrank mit dem Kerl. Außer einem Dutzend Halbliterpullen Binding Export und ein paar Riegeln Kinder Country ist mein Kühlschrank leer. Bis ich eine Endlagerungsstätte für den Typ gefunden habe, werde ich ein paar Tage warmes Bier trinken müssen. Nicht nur deswegen muss ich mir bald was einfallen lassen. Falls es zu einer polizeilichen Untersuchung kommen sollte, wäre es nicht ganz einfach zu erklären, wieso der Mann mit derselben Waffe und der gleichen Einschussstelle erledigt wurde wie der Frühaufsteher am Eisernen Steg.
Dieser Job beginnt schon mit zwei Toten an einem Morgen! Hat sich meine Auftraggeberin eigentlich mit ihrem richtigen Namen vorgestellt? Bei ihren Anrufen war die Rufnummer unterdrückt. Bei Google checke ich, ob irgendwer namens »Ellen von Unschwer« existiert. Kaum habe ich die ersten Buchstaben ihres Nachnamens eingetippt, da erscheint auf den ersten Plätzen: »Ellen von Unschwer, IAC, International Art Consultants«. Adresse und Telefonnummer in Bad Homburg. Ich wähle und warte.
»Tut mir leid, Frau von Unschwer nimmt am Wochenende keine Gespräche entgegen«, näselt eine Empfangsdame. »Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen?«
»Wie ich schon sagte, hier ist McBride, Jürgen McBride, Privatdetektiv. Könnte ich Frau von Unschwer sprechen? Es ist dringend.«
»Tut mir leid, das ist nicht möglich – versuchen Sie es am Montag noch mal. Worum geht es denn?«
»Tja, das weiß ich selbst noch nicht so richtig.«
»Wenn Sie das nicht wissen, dann kann es ja nicht so dringend sein. Entschuldigen Sie bitte, wir haben zu tun. Auf Wiederhören.«
Damit kann ich mich nicht zufriedengeben. Womit bin ich eigentlich beauftragt? Doch wohl nicht, um ein exekutiertes Herrchen samt totem Hund zu besichtigen? Höchste Zeit, meiner Auftraggeberin einen Besuch abzustatten.
Bad Homburg hat die höchste Blondinen-Dichte in ganz Deutschland
Laut brüllt der Vierzylinder-Motor meines Opel GT auf, als ich aus der Ausfahrt der Gummistiefelfabrik im Gutleutviertel auf die Straße presche und irgendeinem Bürohengst, der sein Leben mit dem Ratenkauf eines Audi-SUVs verwirkt hat, die Vorfahrt nehme. Hauteng gleitet meine Asphaltdrohne über der Fahrbahndecke auf die Autobahn 661 in Richtung Bad Homburg.
Die Auffahrt zum Firmensitz der International Art Consultants, einer klassizistischen Villa, ist mit Karossen im Wert von drei Einfamilienhäusern zugeparkt. Das ist für Bad Homburg kein ungewöhnlicher Anblick. Die ganze Stadt scheint aus Millionären zu bestehen. Und ihrem Personal. Am Ende der Aufgangstreppe versuche ich die drei Meter hohe Eingangstür mit der Hand aufzuziehen. Keine Chance.
»Ja bitte?«, knarzt es aus einem Lautsprecher. Das blauschwarze Krakenauge der Überwachungskamera glotzt mich an.
»McBride, hier ist Jürgen McBride. Ich möchte zu Frau Unschwer«, spreche ich in die gläserne Halbkugel.
»Sehr gerne, Herr McBride.« Ist das nicht die gleiche Frauenstimme, die mich vorhin am Telefon hat abtropfen lassen? Die schwere Eingangstür öffnet sich lautlos. Ich betrete den weißen Marmorboden des Empfangsraums, in dem sich nichts befindet außer einem zierlichen Rokoko-Schreibtisch, an dem eine Empfangsdame vor einem Apple-Air-Laptop sitzt. Hinter der Frau in Leopardenbluse hängt ein schlampig gemaltes, graues Bild, auf das jemand mit Kinderschrift »Flieg, Maikäfer, flieg« geschrieben hat. Als ich an den Schreibtisch herantrete, hebt die Dame ihr hübsches Köpfchen von ihrer Tipparbeit. Sie schenkt mir ein Empfangsdamen-Lächeln und flötet wie ein Vögelchen: »Frau von Unschwer erwartet Sie bereits.« Schimmert hinter ihrer Gucci-Brille mit dem violett getönten Glas nicht ein tüchtiges Veilchen? Ein Vögelchen mit einem Veilchen?
Die Concierge schraubt sich auf ihren Lackhacken in die Senkrechte. Ihre schlanke Hand weist mir den Weg mit einer Geste, wie man sie sonst nur aus den Sissi-Filmen von Kaiser Franz Josefs Mutter kennt. Meine Fresse, hier geht es anders zu als in der Trinkhalle, an der ich vor wenigen Stunden mein letztes Binding Export abgepumpt habe. Aber sei’s drum. Toleranz wird bei mir großgeschrieben. Mit einem gelangweilten Nicken reagiere ich, als ob ich Besseres gewohnt wäre.
Die Empfangsdame tippelt mir voraus, klopft leise an einen Türrahmen und wippt ihre Hochsteckfrisur ein Stückchen durch den Türspalt: »Herr McBride wäre jetzt da, Frau von Unschwer.« Lächelnd hält sie mir die Tür auf.
Da sehe ich Ellen von Unschwer zum ersten Mal. Plötzlich bin ich wieder vierzehn. Unfähig zu sprechen, stürze ich kopfüber in das Meeresblau dieser wundervollen Augen. Mein detektivisch geschultes Unterbewusstsein schafft es gerade noch, ihre nach dem ersten Telefongespräch vorschnell präjudizierte Körbchengröße von 75 B auf 80 D zu korrigieren. Sie spricht mich mit einer warmen klangvollen Stimme an, die jedes fühlende Wesen vernichten muss: »Ich freue mich, dass Sie mir helfen wollen, Mister McBride.«
Seit Langem hat keiner mehr »Mister« zu mir gesagt. Noch habe ich in den vergangenen zehn Jahren hierzulande jemanden getroffen, der »McBride« aussprechen konnte, ohne dass es geklungen hätte wie das Fantasie-Englisch einer Eurovision-Song-Contest-Sängerin.
Ich will nicht sagen, dass ich von meiner Auftraggeberin beeindruckt bin – das wäre untertrieben. Die zutreffende Formulierung ist: Ich – als verstandesbegabtes, selbstbewusstes Wesen – bin ab sofort nicht mehr existent. Für alle, die noch nie richtig verliebt gewesen sind – und das sind nach neuesten Schätzungen des Max-Planck-Institutes dreiunddreißig Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung –, das ist, was passiert, wenn du wirklich verliebt bist.
Frau von Unschwer bietet mir einen Platz auf einem schweren Ledersessel an. Dankbar für die Möglichkeit, mich aus meiner Idiotenstarre zu lösen, steuere ich das Sitzgerät an. Unter dem Eindruck von Ellens aristokratischer Anima tapse ich wie ein ferngesteuerter Zombie durch den Raum. Das Parkett knarzt unter meinen ungelenken Schritten. Hinter mir ertönt ein Hüsteln, das wie ein unterdrücktes Lachen klingt. Ich drehe mich um und blicke in das Antlitz des ewigen Widersachers. Ein Typ mittleren Alters mustert mich hämisch mit halb geschlossenen Augenlidern. Mein Blick fällt auf seine übergroßen Hände. Die behaarten, manikürten Pratzen ragen aus blitzweißen Hemdsärmeln heraus, die mit goldenen Manschettenknöpfen geschlossen sind. Seine halb langen Haare sind mit Haaröl aus seiner gebräunten Stirn nach hinten gekämmt. Schwarz und fettig kräuseln sie sich auf dem Kragen seines hellgrauen Maßanzugs.
»Danke, Fredo, ich brauche dich heute nicht mehr«, verabschiedet Ellen den kosmetisch konservierten Mephistopheles. Der Kerl erhebt sich. Sitzend hat er um einiges größer gewirkt. In seinen metallbeschlagenen Pferdelederschuhen klackert er über das Eichenparkett. Mit »Ich rufe dich morgen früh an, chérie« tritt er ab. Ohne meine Ermittlungsarbeiten durch Voreingenommenheit belasten zu wollen: Diese falsche Schlange erscheint mir vom ersten Augenblick an höchst verdächtig.
Ellen schließt die Tür ihres Büros hinter Fredo. »Das ist mein langjähriger Berater und Anwalt Fredo Friedelstein«, klärt Ellen mich auf und kommt damit meinem detektivischen Interesse zuvor.
Als Ellen vorbeischwebt, weht mir der Duft ihres Parfums in die Nase. Frisch wie das Odeur der Meeresluft der Côte d’Azur. Unterlegt mit Noten von blühendem Lavendel und Rosmarin, etwas Schampus und einem Hauch von Benzin – so in etwa riecht diese Frau. Ihr Parfum erweckt in mir Erinnerungen an die Zeit, als der Opel GT und ich das erste Mal zusammen über die kurvigen Küstenstraßen von St. Tropez gebrettert sind. Ich spüre, dass ich meine Nase schon viel zu tief in diesen Fall gesteckt habe, um wieder aussteigen zu können.
»Also, wie kann ich Ihnen helfen, Frau von Unschwer?«
»Wissen Sie, Mister McBride … aber wir wollen doch bitte Du zueinander sagen. Du weißt ja bereits, dass Johannes … Johannes W. Körner …« Ellen kann nicht weitersprechen.
»Johannes W. Körner ist der Name Ihres, äh … deines erschossenen Geschäftspartners, nicht wahr?«, versuche ich sie mit der Distanz eines professionellen Privatdetektivs zu beruhigen.
»Ja.« Sie fährt sich mit beiden Händen durch ihre dichten blonden Locken. »Johannes hat das alles nicht ernst genommen.«
»Wann haben … ähh … hast du erfahren, dass er ermordet worden ist?«
»Heute Morgen. Um kurz nach sechs. Ich habe gerade mit ihm telefoniert, als es passiert ist.«
»Schläft man um diese Uhrzeit nicht normalerweise? Warum war er so früh unterwegs?«
»Johannes wollte einen Informanten wegen einer bei uns gestohlenen Zeichnung kontaktieren. Ich wollte wissen, was er gerade treibt. Er hat abgenommen. ›Ich bin jetzt am Eisernen Steg. Alles gut, Ellen!‹, sagte er und dann: ›Moment mal, bleib dran.‹ Dann hat es zweimal geknallt. Die Verbindung wurde unterbrochen. Ich habe wieder und wieder versucht ihn zu erreichen. Er hat nicht mehr geantwortet. Danach habe ich dich angerufen, Jürgen.«
»Und wieso ausgerechnet mich?«
»Unsere Agentur hatte bereits am Freitag beschlossen, einen Privatdetektiv mit Ermittlungen wegen des Diebstahls der Zeichnung zu beauftragen. Dieser Detektiv bist du.«
»Was genau ist mein Auftrag, Ellen?«
»Zuerst einmal geht es immer noch um die Wiederbeschaffung der gestohlenen Zeichnung. Sagt dir der Name Beuys etwas, Jürgen?«
»Klar, Beuys. Joseph Beuys, richtig? Klar, den kennt man doch. Ist das nicht der Typ mit dem Fettstuhl? Den die Putzfrau weggeräumt hat? Ziemlich abgefahrene Geschichte. Ich mag ja diese moderne Kunst echt gern. Am liebsten übrigens die Expressionisten. Der Allergrößte ist für mich Gustav Klimt. Da kommt so schnell keiner mit, was?«
Ellen mustert mich einen Moment lang schweigend. Ihre Stirn legt sich in Falten. Sorgenfalten, vermute ich. Die ganze Geschichte nimmt die Frau bestimmt sehr mit. »Wie auch immer – die Beuys-Zeichnung besitzt einen sehr hohen Wert. Es gibt nichts Vergleichbares im zeichnerischen Oeuvre von Joseph Beuys. Sie ist am letzten Donnerstag gestohlen worden. Normalerweise ist sie in einem Safe der Commerzbank verschlossen. Wir haben in unserem Haus eine Expertise für eine Versteigerung bei Sotheby’s ausgestellt. Zu diesem Zweck ist sie einen halben Tag in unserem Haus gewesen. Anschließend haben wir die Zeichnung durch einen Security-Dienst zur Commerzbank zurückstellen lassen. Außer dem Art-Depot-Management der Commerzbank und unserer Agentur hat niemand gewusst, dass es sich bei dem Beuys um das ›Mantra Nr. 1‹, die wertvollste Beuys-Zeichnung überhaupt, handelt. Der Fahrer des Transportes ist nicht darüber informiert gewesen, was er transportiert. Er ist mit der Zeichnung nie bei der Bank angekommen. Fahrer und Transporter sind seitdem verschwunden. Jetzt vermutet die Versicherung der Commerzbank, dass der Diebstahl durch Fahrlässigkeit unserer Firma oder möglicherweise sogar in unserem Auftrag erfolgt ist.«
»Wie sieht die Zeichnung eigentlich aus?«
»Darauf sind ein Eichhörnchen und ein Autograf zu sehen, ein Mantra von Joseph Beuys.«
»Ein Eichhörnchen und ein Manta? Der Typ fährt auf Opel Mantas ab?«
Ellen lässt ein helles Lachen aus zwei perfekten Zahnreihen aufblitzen, neben denen sich Michelle Hunzikers Beißer wie kariöse Rußstumpen ausnehmen. »Ein Mantra ist eine Art Sinnspruch, dem man durch wiederholtes Aufsagen eine gewisse Wirkung nachsagt.«
»Und wie heißt dieses Mantra auf der Zeichnung?«
»Das Mantra heißt: ›Jeda – Jeda – Audu – bist ein großer Künstler.‹« Nachdem dieser Satz verklungen ist, verstummen wir beide aufs Neue. Wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
»Also ein Eichhörnchen und ein Spruch.«
»Genau. Das Ganze ist auf einem hellblauen Löschpapier mit Kojotenblut geschrieben«, klärt Ellen mich auf.