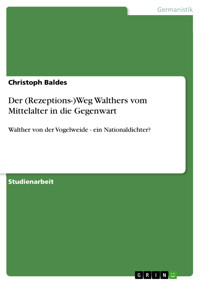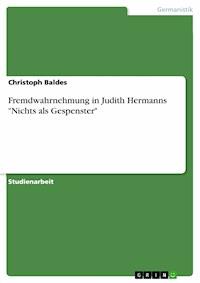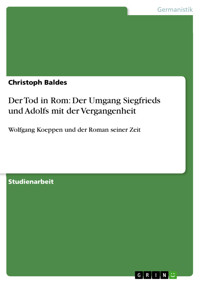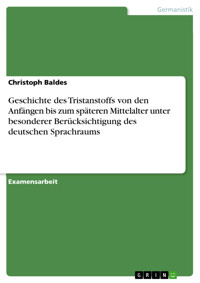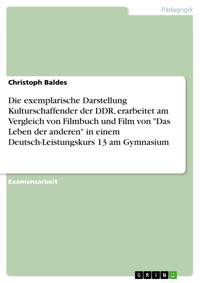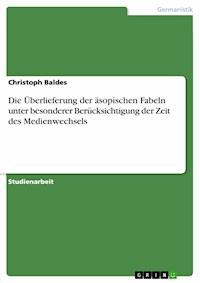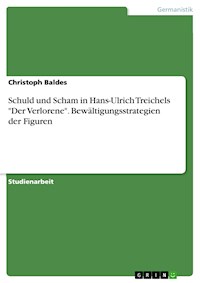
Schuld und Scham in Hans-Ulrich Treichels "Der Verlorene". Bewältigungsstrategien der Figuren E-Book
Christoph Baldes
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,0, Universität Trier (Neuere deutsche Literaturwissenschaft), Veranstaltung: "Die Novelle", Sprache: Deutsch, Abstract: Treichel beschreibt in seiner Novelle das Leben einer deutschen Familie in den Nachkriegsjahren aus der Sicht ihres jüngsten Kindes. Geprägt ist dieses Leben von der Suche nach einem auf der Flucht verlorengegangenen Sohn, Arnold, dessen Verlust die Eltern schwer belastet, aber auch von der Suche nach einer neuen Identifikation in einer Gesellschaft, die schwer an dem Erbe der Nationalsozialisten zu tragen hat. Während im Laufe der Erzählung diese Positionierung unter vielen Problemen nach und nach gelingt, scheitert die Suche nach dem verlorenen Sohn trotz Ausschöpfen aller Möglichkeiten schließlich endgültig. Fast alle Personen der Erzählung sind gekennzeichnet durch ein Gefühl von Schuld und Scham; die Ursachen hierfür sind sehr vielfältig: ein verlorener Krieg im Allgemeinen, im Einzelnen ein verlorengegangener Sohn, die fehlende Möglichkeit von Eltern, ihrem Kind Liebe und Zuneigung zu bieten, größte Befangenheit im zwischenmenschlichen Bereich, ein von Vorurteilen geprägtes Bild der Welt, das Gefühl von Unzulänglichkeit. Die Novelle zeigt auf, wie die einzelnen Figuren mit dieser Problematik umgehen, wie sie sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln können oder wie sie so sehr mit Schuld und Scham befangen sind, dass eine solche Entwicklung überhaupt nicht möglich ist. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich damit, inwiefern insbesondere die Hauptcharaktere der Erzählung, nämlich Mutter, Vater und Erzähler, von Schuld und Scham determiniert sind und wie sie damit umgehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis:
1. Einführung
1.1 Die Fabel
1.2 Der Autor
1.3 Zeitliche und örtliche Einteilung
1.4 Der Aufbau
1.5 Hinführung zum Thema
1.6 Was sind „Scham und Schuld“?
2. Die Mutter
2.1 Die Ausgangslage
2.2 Auftreten und Auswirkungen von Schuld und Scham
2.3 Das Verhältnis zu anderen Personen
2.4 Die Entwicklung der Person
3. Der Vater
3.1 Die Ausgangslage
3.2 Auftreten und Auswirkungen von Scham und Schuld
3.3 Das Verhältnis zu anderen Personen
3.4 Die Entwicklung der Person
4. Der Erzähler
4.1 Die Ausgangslage
4.2 Auftreten und Auswirkungen von Schuld und Scham
4.3 Das Verhältnis zu anderen Figuren
4.4 Die Entwicklung der Person
5. Ergebnis
5.1 Zusammenfassung
5.2 Deutung auf gesamtgesellschaftlichen Kontext und Voraussicht
5.3 Novelle oder Roman?
6. Literaturverzeichnis
7. Anhang
7.1 Internet-Rezension Daniela Ecker
7.2 Internet-Rezension Helmut Hirsch
7.3 Internet-Rezension Wolfgang Müller
Endnoten
1. Einführung
1.1 Die Fabel
Treichel beschreibt in seiner Novelle das Leben einer deutschen Familie in den Nachkriegsjahren aus der Sicht ihres jüngsten Kindes. Geprägt ist dieses Leben von der Suche nach einem auf der Flucht verlorengegangenen Sohn, Arnold, dessen Verlust die Eltern schwer belastet, aber auch von der Suche nach einer neuen Identifikation in einer Gesellschaft, die schwer an dem Erbe der Nationalsozialisten zu tragen hat. Während im Laufe der Erzählung diese Positionierung unter vielen Problemen nach und nach gelingt, scheitert die Suche nach dem verlorenen Sohn trotz Ausschöpfen aller Möglichkeiten schließlich endgültig.
1.2 Der Autor
Hans-Ulrich Treichel ist ein bis heute eher unbekannter Autor der Gegenwart. Neben der vorliegenden Erzählung, die 1998 erschienen ist, ist er vor allem durch Gedichts- und Prosabände in Erscheinung getreten; zu nennen sind hier „Liebe Not“ (1986), „Seit Tagen kein Wunder“ (1990) und „Der einzige Gast“ (1994). Sein Repertoire umfasst aber auch Romane wie „Der irdische Amor“, im vergangenen Jahr (2002) erschienen, und Libretti, u.a. für die Theater in Basel und Berlin. Für sein Schaffen wurde er 1985 mit dem Leonce-und-Lena-Preis der Stadt Darmstadt und dem Förderpreis des Bremer Literaturpreises (1993) ausgezeichnet. Treichel ist seit 1995 Professor am Deutschen Literaturinstitut der Universität Leipzig und forscht in der modernen Literatur. Er gilt als angesehener Wolfgang-Koeppen-Fachmann.
Erwähnenswert ist die Biographie Treichels vor allem deshalb, weil „Der Verlorene“ eine Erzählung mit starken autobiographischen Zügen ist (vgl. Staub, 9): Wie der Erzähler ist auch er in Westfalen geboren, wie dessen Eltern sind auch seine Eltern Vertriebene. Und während der Erzähler auf der Suche nach einer Identität ist, befand sich Treichel in seiner Jugend auf der Suche nach Heimat– wobei Heimat und Identität unabdingbar zusammen gehören. Bemerkenswert auch, dass Treichels Vater „Arnold“ heißt – genau wie der Vater des Erzählers.
1.3 Zeitliche und örtliche Einteilung
Die Handlung umfasst an die 17 Jahre: Angefangen bei dem Überfall auf dem Flüchtlingstreck am 20. Januar 1945, bei dem der älteste Sohn als Säugling verloren geht, bis hin zu der Inaugenscheinnahme des vermeintlich wiedergefunden Sohnes kurz vor dessen Volljährigkeit. Die Handlung setzt mit dem Überfall auf den Flüchtlingstreck in der Nähe eines kleinen Dorfes westlich von Königsberg ein. Der Treck führt aus dem Osten, genauer gesagt aus dem ostpreußischen Rakowiec im Kreis Gostynin, der alten Heimat der Familie, in den Westen. Nach der Flucht findet die Familie in Ostwestfalen in der Nähe des Teutoburger Waldes ein neues Zuhause. Hier spielt der größte Teil der Handlung, vor allem in dem alten Fachwerkhaus, einer alten Postfiliale, die sie nun bewohnt. Die Erzählung endet vor einem Metzgereigeschäft am Marktplatz eines Dorfes entlang der Autobahn Bielefeld-Hannover.
Der Erzähler berichtet nicht von seinem ganzen Leben, sondern beschränkt sich auf Episoden. Diese beginnen in seiner Kindheit, entscheidend sind jedoch seine frühen Jugendjahre, die „eines morgens“ (Treichel, 14) beginnen. Ein entscheidender Handlungsplatz ist hier neben seiner Heimat das Anthropologische Institut der Universität Heidelberg.
1.4 Der Aufbau
Die gesamte Erzählung ist in der Ich-Erzähltechnik geschrieben. Entsprechend ist bei der Beschreibung der Ereignisse eine starke Subjektivität vorhanden. Die Erzählung läuft im Wesentlichen zeitlich linear ab, sofern sie das Leben des Erzählers beschreibt. Dieser baut jedoch immer wieder Rückblenden auf die Geschehnisse vor seiner Zeit ein.
Die Erzählung ist in einen Rahmen gepackt: Sie beginnt mit dem Blick auf das einzige Foto des verlorenen Bruders und endet mit dem Blick durch die Schaufensterscheiben auf den vermeintlich wiedergefundenen Bruder. Auffallend hierbei ist, dass Treichel seinen Schluss offen lässt – er trifft keine genaue Aussage darüber, ob er es nun wirklich ist oder nicht: Er überlässt die Interpretation des Schlusses ganz dem Leser.
Der Leser trifft beim Lesen der Erzählung auf zwei Handlungen: zum einem, deutlich und klar zu erfassen, die Geschehnisse rund um die Suche nach dem verlorenen Bruder; wichtig ist aber auch die Entwicklung der Personen im Laufe der Erzählung.
1.5 Hinführung zum Thema
Fast alle Personen der Erzählung sind gekennzeichnet durch ein Gefühl von Schuld und Scham; die Ursachen hierfür sind sehr vielfältig: ein verlorener Krieg im Allgemeinen, im Einzelnen ein verlorengegangener Sohn, die fehlende Möglichkeit von Eltern, ihrem Kind Liebe und Zuneigung zu bieten, größte Befangenheit im zwischenmenschlichen Bereich, ein von Vorurteilen geprägtes Bild der Welt, das Gefühl von Unzulänglichkeit.
Wie im vorangegangen Abschnitt bereits erwähnt wurde, zeigt die Novelle auf, wie die einzelnen Figuren mit dieser Problematik umgehen, wie sie sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln können oder wie sie so sehr mit Schuld und Scham befangen sind, dass eine solche Entwicklung überhaupt nicht möglich ist.
Die Hausarbeit beschäftigt sich damit, inwiefern die Hauptcharaktere der Erzählung, nämlich Mutter, Vater und Erzähler, von Schuld und Scham determiniert sind und wie sie damit umgehen.
1.6 Was sind „Scham und Schuld“?
Zu Beginn der weiteren Untersuchung soll erst geklärt werden, was man genau unter den Begriffen „Scham“ und „Schuld“ versteht. Als Grundlage sollen die Erklärungen im Universalwörterbuch der deutschen Sprache dienen:
Demnach versteht man unter Scham die Einsicht, den sozialen Erwartungen an die eigene Person nicht genügen zu können. Dies kann der tatsächliche Fall sein, oftmals existiert dieses Versagen jedoch nur in den eigenen Vorstellungen. Folgen von Scham können zum einen Unlustgefühle sein, aber auch Verhaltensreaktionen wie Erröten, Herzklopfen oder Blickvermeidung. Scham ist immer vom sozialen Kontext abhängig.
2. Die Mutter
2.1 Die Ausgangslage
Die Mutter nimmt im Laufe der Handlung den meisten Platz in Anspruch, kann also neben dem Erzähler als wichtigste Person gelten. Müller spricht gar von der „Geschichte [...] einer Mutter“. Sie ist eine misslaunige Person, die mit sich und ihrer Umwelt nicht zufrieden ist. Deutlich wird das an ihrem verkniffen Gesicht und ihrem Blick, der einerseits erschöpft wirkt, andererseits zugleich gehetzt in der Ferne schweift (vgl. Teichel 104). Diese Ambivalenz wird auch an ihrem Handeln deutlich: wird sie manchmal als apathische Person beschrieben, die sich an nichts erfreuen kann und immer wieder für gedämpfte Stimmung sorgt, so dass die Mitmenschen sie eher meiden, kann sie sich durchaus in der Öffentlichkeit auch als starke Frau präsentieren, die vor allem nach dem Tod ihres Mannes die Geschäfte so weiterführt, dass sie von den Angestellten mit allergrößtem Respekt behandelt wird.
2.2 Auftreten und Auswirkungen von Schuld und Scham
Fast alle Schuld- und Schamgefühle der Mutter lassen sich an einem Ereignis festmachen, nämlich an dem Überfall der Russen auf den Flüchtlingstreck. Hier hat sie ihren erstgeborenen Sohn verloren, hier wurde sie vergewaltigt. In nur wenigen Momenten zerbricht ihr ganzes Leben. Kein Wunder also, dass sie bis heute an Spaziergängen keinen Spaß findet und Reisen gar ganz vermeidet – zu groß ist die Projektion bei diesen Beschäftigung auf die traumatische Flucht.
Schamgefühle werden bei ihr vor allem durch die Vergewaltigung ausgelöst. Auch nach so langer Zeit spricht sie nicht offen darüber, sondern erzählt stattdessen immer, dass damals „etwas Schreckliches passiert“ (Treichel, 14) sei. Ein normales Verhältnis zur Sexualität scheint für sie nicht mehr möglich. Deutlich wird das daran, dass es kaum Zärtlichkeiten zwischen ihr und dem Vater gibt, aber auch, wenn ihr bei Intimszenen am Fernseher die Schamröte zu Gesicht steigt (vgl. Treichel, 31). Meist ist eine solche Szene für die Mutter, die eigentlich gerne fern sieht, sogar Anlass, den Fernseher auszuschalten. Auf Grund dieser Tatsachen stellt sich auch die Frage, ob der Erzähler ein gewolltes Kind ist. Denn dieser kam kurze Zeit nach der Flucht auf die Welt, und es ist unwahrscheinlich, dass sie direkt nach der Vergewaltigung wieder Geschlechtsverkehr mit dem Vater hatte. Nicht ausgeschlossen also, dass der Erzähler ein „Produkt“ der Vergewaltigung ist, was auch die Abneigung ihrem zweiten Sohn gegenüber erklären würde.
Schuldgefühle spürt sie für den Verlust ihres Sohnes Arnold. Ihr Leben ist geprägt von Selbstvorwürfen. Ist es richtig gewesen, Arnold einer fremden Frau zu übergeben? Ist ihr Handeln im Gegenüber der Russen zu voreilig gewesen? Wie geht es Arnold, was macht er, geht es im gut, lebt er überhaupt noch? Auf alle diese Fragen gibt es für die Mutter keine zufriedenstellenden Antworten. Sie kann nicht akzeptieren, dass es Arnold für sie nicht mehr geben wird. Deutlich wird das vor allem, wenn sie bei Gesprächen über ihren Sohn immer wieder in Tränen ausbricht oder ihr Körper von einem Zittern geschüttelt wird. Sie versucht, in eine Scheinwelt zu fliehen, eine Welt, in der Arnold noch existiert: Nur so ist es zu erklären, dass sie stundenlang vor der einzigen Fotografie verbringt, die es von ihm gibt. Der fortschreitende Realitätsverlust zeigt sich auch dann, wenn sie die größtenteils negativen Ergebnisse der Suchdienste, die die Familie beauftragt hat, ins Positive verkehrt und sich so Hoffnungen macht, die nie in Erfüllung gehen werden. Folge dieses Realitätsverlustes ist ein starker Ich-Bezug, da sie die Menschen in ihrer Umgebung kaum wahrnimmt, wie auch das Verhältnis zu ihrem Mann und zu ihrem zweiten Sohn zeigt.
2.3 Das Verhältnis zu anderen Personen
Stark beeinflusst durch die Schuld- und Schamgefühle ist das Verhältnis der Mutter zu ihrem Ehemann. Der Leser bekommt den Eindruck, dass die Ehe zwischen den beiden nur auf dem Papier besteht. Zärtlichkeiten existieren zwischen den Eltern des Erzählers scheinbar nicht. Erst während der Reise nach Heidelberg, als beide auf eine baldige positive Lösung des Problems hoffen, legt der Vater seinen Arm um seine Frau, während diese ihren Kopf an dessen Schulter legt (vgl. Treichel, 118f.). Ansonsten leben die beiden jeweils ihr eigenes Leben: Während sich die Mutter in ihre Scheinwelt flüchtet, sucht der Vater seine Gefühle in Arbeit zu erdrücken. Ein gemeinsames Wochenende, an dem sich beide Partner erfreuen, gibt es nicht. Die gemeinsamen Spaziergänge werden nur gemacht, um den „christlichen Respekt vor dem Sonntag“ (Treichel, 19) zu zeigen. Später verbindet der Vater diese Spaziergänge oftmals mit Kundenbesuchen. Erst mit dem Tod des Vaters wird deutlich, wie sehr die Mutter wirklich an ihrem Ehemann hängt: Als der Vater nach seinem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert wird, bleibt sie Tag und Nacht an seinem Bett. Und als der Vater stirbt, zeigt sie erstmals Gefühle, die nicht in direktem Zusammenhang mit Arnold stehen. Einen wahren Ausbruch an Innigkeit erlebt der Leser, als die Mutter ihn in der Kapelle ein letztes Mal herzt (vgl. Treichel, 136). Und als ob sie ihn für ihr distanziertes Verhalten zu seinen Lebzeiten entschädigen wolle, führt sie sein Werk als Geschäftsmann mit voller Hingabe und großem Erfolg weiter.
Für den Leser sehr deutlich wird auch das Verhältnis der Mutter zu ihrem Sohn, dem Erzähler. Die Mutter vernachlässigt in der Trauer um Arnold ihren zweiten Sohn, für sie hat er nur eine untergeordnete Rolle. Deutlich zu erkennen ist das an den Fotografien der Familie: Während von Arnold nur eine, dafür aber umso schönere Aufnahme existiert, ist der Erzähler nur unvollständig auf Fotos zu erkennen. Müller drückt es in seiner Rezension noch drastischer aus: „Der vorhandene Bruder wird [...] über die Sorge um den verloren gegangenen vergessen.“ Nur wenn sich ihre Sorge um Arnold in Hoffnung wandelt, findet sie Zeit, an den Erzähler zu denken: In Heidelberg versucht sie mit dem Vater darüber zu sprechen, wie sehr er unter der Situation zu leiden habe (vgl. Treichel, 120), und auch nach dem Tod des Vaters bringt sie ihm mehr Aufmerksamkeit entgegen, versucht ihn zu trösten – wobei sich die Frage stellt, ob sie wirklich ihn trösten möchte, oder ob sie einfach jemanden braucht, bei dem sie selber Trost finden kann, der Sohn also seinen toten Vater ersetzen muss. Dieses Gefühl empfindet auch der Erzähler selber: „Wenn sie mich wahrnahm, dann war es, als erblicke sie in mir nicht mich, sondern jemand anderen“ (Treichel, 139). Eine Erklärung für diese Ablehnung und fehlende Liebe wäre die bereits oben angedeutet Möglichkeit, dass der Erzähler ein Russenkind ist.
Eine weitere wichtige Beziehung entsteht zwischen der Mutter und Herrn Rudolph, dem Dorfpolizisten. Bereits am Anfang der Erzählung ein Freund der Familie, kümmert er sich nach dem Tod des Vaters um die Mutter. Die Mutter findet in dem Polizisten eine Stütze in der für sie schwierigen Zeit. Er übernimmt für sie Behördengänge und hilft ihr bei anderen Formalitäten - auch bei der weiteren Suche nach Arnold. Doch obwohl es sich Herr Rudolph anders wünscht - es kommt zwischen den beiden zu keinerlei Intimitäten (vgl. Treichel, 141). Unklar ist, warum. Denn nach eigener Aussage hat die Mutter durchaus Interesse an einer Hochzeit mit Herrn Rudolph, und die beiden verbringen viel Zeit miteinander, in der sie zusammen Musik hören und Gespräche führen. Trotzdem gibt sie ihm eine Absage. Sie leidet scheinbar noch immer an der Vergewaltigung, dass sie befürchtet, den Erwartungen des Polizisten nicht gerecht werden zu können.
2.4 Die Entwicklung der Person
3. Der Vater
3.1 Die Ausgangslage
Der Vater kann als Patriarch der Familie angesehen werden. Seine Familie kennt ihn als Mann, der nicht viel redet, sondern stattdessen kurze Befehle und Arbeitsanweisungen verteilt. Deutliches Beispiel ist hier der Fernseher, der nur mit seiner Erlaubnis benutzt werden darf; auch die Situation in der Kantine in Heidelberg ist symbolisch, wenn er seinen Sohn zur Essensausgabe schickt, um sich sein Essen bringen zu lassen. Diese „Führungsstärke“ hat dem Vater, der wie sein verlorener Sohn Arnold heißt, zu beruflichem Erfolg verholfen: Vom Besitzer einer Leihbücherei über den Erfolg als Lebensmittelhändler hat er es in den Nachkriegsjahren zu einem erfolgreichen Fleischgroßhändler geschafft. Er ist damit ein Teil des Wirtschaftswunders in der deutschen Nachkriegszeit. Seinen erworbenen Reichtum zeigt er öffentlich, zu erkennen an den immer teurer werdenden Autos, die er sich gönnt, begonnen bei einem Ford „Buckeltaunuss“ bis hin zu einer Limousine, dem Opel Admiral. Entsprechend ist er ein hochgeachteter Mann, dies wird anhand der vielen Trauernden an seiner Beerdigung deutlich. Erstaunlich ist, dass der Vater trotz dem Miterleben zweier Kriegsniederlagen den alten Zeiten nachtrauert: so dient als Ziel des sonntäglichen Spaziergang der Bismarckturm, und so teilt er auch das alte Obrigkeitsdenken, was deutlich an dem Respekt zu erkennen ist, mit dem er Professor Dr. Freiherr von Liebstedt gegenübertritt.
3.2 Auftreten und Auswirkungen von Scham und Schuld
Schuldgefühle sind beim Vater natürlich in erster Linie ebenfalls durch den Verlust von Arnold bedingt. Doch im Gegensatz zur Mutter versucht er, die Ereignisse im letzten Kriegsjahr zu verdrängen. Er flüchtet sich in seine Arbeit, er „büßt durch Arbeit“ (Hirsch). So gelingt es ihm, mit der Situation scheinbar besser umzugehen. Hat eine Suchaktion mal wieder keinen Erfolg, ist er ebenso wie die Mutter bestürzt, erfährt aber keinen Schock. Stattdessen erdrückt er seine Verzweiflung im Geschäft, sieben Tage die Woche dirigiert er seine Arbeiter und kümmert sich um seinen Großhandel. Durch die Flucht vor den Problemen flüchtet er auch vor seiner Familie, lässt Mutter und Sohn mit ihren Problemen alleine, so dass eine große Distanz aufgebaut wird.
Doch beim Vater kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Er gehört zu den Menschen, die eine große Scham dafür empfinden, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren hat. Er identifiziert sich stark mit seiner ostpreußischen Herkunft. Und er ist der Meinung, dass die „Deutschen“ wirklich etwas Besseres sind. Am schönsten zu erkennen ist diese Grundeinstellung, wenn er von seinem Heimatdorf Rakowiec erzählt, von der Unterteilung in ein blühendes „deutsches“ Rakowiec I und ein verkommenes „polnisches“ Rakowiec II (vgl. Treichel, 110). Er verkörpert den idealen deutschen Mann: schweigsam, sparsam, diszipliniert. Wie sehr ihn der verlorene Krieg beschäftigt, zeigt sich auf dem Ausflug nach Heidelberg. Beim Anblick der Schlossruine zeigt sich seine ganze Verbitterung; dabei lässt es ihn gleichgültig, dass das Schloss bereits im pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört wurde – den Hinweis seiner Frau schiebt er mit der Bemerkung „Krieg ist Krieg“ (Treichel, 122) auf Seite. Ein Deutscher darf keinen Krieg verlieren. Während die Mutter in Bezug auf den verlorenen Sohn die Realität missachtet, lebt der Vater bezüglich seiner Herkunft und seinem Nationalbewusstsein in einer irrealen Welt: Deutlich wird das immer wieder an seinen Vorurteilen, die er negativ „dem“ Russen oder den Polen gegenüber hat, mit denen er positiv dem preußischen Bauerntum huldigt.
3.3 Das Verhältnis zu anderen Personen
Für den Vater sollen im Folgenden drei Beziehungen näher betrachtet werden: sein Verhältnis zu seiner Frau, zu seinem Sohn und zu seinen Geschäftspartnern.
Letztere spielen eine wichtige Rolle im Leben des Vaters. Diese sind Menschen, die ihm vertrauen, bei denen er sich sein Selbstbewusstsein holen kann. So ist er auch um sie besorgt und achtet peinlichst darauf, dass diese mit seiner Ware zufrieden sind. Er spricht mit ihnen über ihre Sorgen, um darauf reagieren zu können. Dabei ist er nicht immer ihrer Ansicht. „Das Leben ist ein Kampf“ (Treichel, 35) – so stimmt er einerseits seinen Kunden zu, die sich über die zunehmende Konkurrenz beschweren; „Konkurrenz belebt das Geschäft“ (Treichel, 35) – so andererseits seine Ansicht, wenn er alleine ist. Hinter dieser Doppelseitigkeit verbirgt sich die Angst des Vaters, er könne das Vertrauen seiner Kunden verlieren. Er hat Angst, nicht nur privat, sondern schließlich auch beruflich zu scheitern. Das möchte er unter Aufwendung aller Mittel vermeiden. Deshalb versucht er auch, möglich selbständig zu werden, sich auf niemanden verlassen zu müssen. Er baut sein eigenes Kühlhaus, er kontrolliert persönlich seine Lieferanten. Doch immer ist es ihm wichtig, auf Grund seiner bäuerlichen Herkunft einerseits und seines Vorlebens als Lebensmittelhändlers andererseits „einer von ihnen“ zu sein. Sie geben ihm somit eine Identifikation.
Bereits von der anderen Seite beleuchtet wurde das Verhältnis zwischen dem Vater und seiner Frau. Es lässt sich feststellen, dass der Vater der Mutter gegenüber mehr Gefühle zeigt als umgekehrt. Er sorgt sich um seine Frau. Er versucht sie in schwierigen Zeiten zu trösten, so zum Beispiel bei dem Erhalt des Briefes von Professor Dr. Keller aus Hamburg. Sein Trost besteht darin, sie in ihrer Traumwelt zu bestärken: „Ihr ähnelt Euch“ (Treichel, 71). Er versucht sie so vor der Realität zu schützen. Das ist für ihn einfacher, als mit ihr über die wahren Probleme zu sprechen, vor denen er letztlich genau wie die Mutter flüchtet. Stattdessen versucht er, sie mit Geschenken aufzuheitern. Erst als sie das Geld verbrennt, mit dem er das neue Auto kaufen möchte, beginnt er zu verstehen, dass er sie nicht so einfach zufrieden stellen kann. Doch seine einzige Idee, wie er das Problem lösen kann, ist es, die Suche nach Arnold von vorne aufzurollen. Dabei bestreitet er sogar den gerichtlichen Weg. Anstatt sich gemeinsam der geringen Chancen und somit der Realität bewusst zu werden, macht er es sich immer wieder einfach und weckt einfach ihre Hoffnungen von vorne – und um diese aufrecht zu halten, ist er sogar bereit, entgegen seinen Prinzipien die Reise nach Heidelberg zu unternehmen.
Als problematisch kann man das Verhältnis zwischen Vater und Sohn bezeichnen. Es ist gekennzeichnet durch ein Nichtverstehen des Vaters dem Sohn gegenüber. So hat er keine Ahnung von den Gesichtskrämpfen seines Sohnes, unter denen dieser zu leiden hat und ihm ein scheinbares Grinsen ins Gesicht legen. Stattdessen vermutet er dahinter eine Ungezogenheit. Und auch des Erzählers Übelkeit, die diesen beim Autofahren befällt, sorgt den Vater nicht weiter. Er versucht sie entweder durch Ermahnungen oder – wie auf der Fahrt nach Heidelberg - durch Tabletten zu beseitigen. Überhaupt fehlt ihm das Verständnis für die Probleme seines Sohnes. Seiner Ansicht nach ist die gesamte Situation mit dem verlorenen Arnold für seinen Sohn am einfachsten auszuhalten (vgl. Treichel, 120). Der Vater macht sich keine Gedanken darüber, dass sein Sohn nicht unter dem eigentlichen Verlust als vielmehr unter den Begleitumständen zu leiden hat; Mitgefühl ist ihm fremd. Zwar stellt er Arnold im Vergleich mit dem Erzähler nicht so sehr in den Vordergrund wie die Mutter, trotzdem herrscht eine sehr große Distanz zwischen Vater und Sohn; diese löst sich seitens des Vaters nur, wenn er bewusst das Gespräch mit dem Erzähler sucht. Dann versucht er, nett zu sein, anstatt ihn herumzukommandieren, und er spricht mit ihm „wie zu einem Freund“ (Treichel, 50). Ansonsten empfindet er seinen Sohn meistens als aufmüpfig. So sind ihm beispielsweise dessen Haare zu lang. Die Geringschätzung durch den Vater ist dem Erzähler auch durchaus bewusst: „In den Augen des Vaters fehlte mir nichts so sehr wie eine anständige Portion Hirn“ (Treichel, 42).
3.4 Die Entwicklung der Person
4. Der Erzähler
4.1 Die Ausgangslage
Es gibt keine Fotos, auf denen der Erzähler auffallend zu sehen wäre – er ist ein unscheinbarer Mensch, seinen Mitmenschen eher unsympathisch als sympathisch: „Die Laborantin musterte mich mit kühlem Blick und schnalzte auf [...] abschätzige Art mit der Zunge“ (Treichel, 94). Hinzu kommt Übergewichtigkeit, übergroßes Geltungsbedürfnis und ständiges Selbstmitleid. Und fehlt ihm einerseits die Bande zu seiner Familie, erfährt der Leser im Laufe der Erzählung auch nichts von Freunden. Nach dem Tod seines Vaters erwähnt der Erzähler zwar, dass seine Schulkameraden ihn auf Grund seiner schwarzen Trauerbinden meiden würden (vgl. Treichel, 134), doch liegt die Vermutung nahe, dass er auch sonst ein Außenseiter ist: „Die meisten Menschen übersahen mich.“ (Treichel, 139). Und obwohl er sich selber nicht negativ darstellen möchte: Der Leser erlangt doch oft den Eindruck, dass der Erzähler auch nicht besonders gescheit ist: zu sehr fällt seine Naivität ins Auge, zu oft zeigt er sie. Und auch die Bemerkung von Professor Dr. Liebstedt, dass er „ein aufgewecktes Kerlchen sei“, ist eher als Ironie zu verstehen – es besteht für den Professor keine Veranlassung für eine solch positive Bemerkung. Vielleicht ist es einfach auch nur Höflichkeit. Die Sensibilität des Erzählers lässt einen manchmal glauben, „dass nicht etwa Arnold, sondern der erzählende Bruder selbst der Verlorene ist“ (Müller).
4.2 Auftreten und Auswirkungen von Schuld und Scham
Der Erzähler ist wohl das größte Opfer von Schuld und Scham, sein ganzes Leben wird davon beeinflusst. Problematisch dabei ist, dass es für ihn auf den ersten Blick keinen Grund für diese Gefühle gibt, die er dauernd spürt: Wird er angeschaut, fühlt er sich durchschaut und schämt sich. Kommt es in friedlicher Zweisamkeit mit der Mutter vor dem Fernseher zu Intimszenen, schämt er sich. Sitzt er beim Essen, fühlt er sich schuldig. Wird im Kühlhaus seines Vaters eingebrochen, fühlt er sich ebenfalls schuldig. Und er fühlt sich schuldig, wenn die Familie bei einem Spaziergang an ihrem Ziel ankommt. Bei der Untersuchung in Heidelberg nimmt dieser Zustand so extreme Formen an, dass er gar stark ins Schwitzen kommt und seine Schläfen zu glühen beginnen. Bedingt sind diese Gefühle wohl damit, dass er „in einer von Schuld und Scham vergifteten Atmosphäre“ (Treichel, 17) groß geworden ist, er sich seinen Mitmenschen angepasst hat. Doch sein schlechtes Gewissen hat auch tiefergehende Gründe, nämlich sein Hass und Neid auf seinen verloren gegangenen Bruder. Hass und Neid, die in der Angst begründet sind, sein toter Bruder würde wieder auftauchen und ihn in seinen Rechten beschränken: Er müsste seinen Nachtisch teilen, müsste vielleicht sogar sein Zimmer räumen. Und darin, dass Arnold die Zuneigung empfängt, die seiner Meinung nach ihm zusteht. Nicht bewusst ist dem Erzähler, dass seine Situation nicht schlechter werden kann – schließlich steht sein toter Bruder schon jetzt im Mittelpunkt, ist sogar Schuld daran, dass er selber in einer schlechten Atmosphäre leben muss. So wünscht er, dass Arnold besser doch verhungert wäre, er wünscht sich sogar einen dritten Weltkrieg herbei; dabei weiß er natürlich um die Widernatürlichkeit dieser Wünsche, die seinem verlorenen Bruder gegenüber falsch und ungerecht sind. Vielleicht schämt er sich auch, weil er in seinem Innersten weiß, wie viel besser es ihm selber geht: „Zum Glück war ich kein Findelkind“ (Treichel, 113).
Fühlt er auch Schuld und Scham, weil er den Eltern nicht weiterhelfen kann? Möglich. Denn er spürt sehr wohl, dass er ihre Erwartungen nicht erfüllen kann - und je mehr er dies spürt, versucht er seine Schuldgefühle in Trotzreaktionen unterzubringen. Typisches Beispiel hierfür ist der Haarschnitt: Während sein Vater sehr kurze Haare an ihm wünscht, möchte er sie möglichst lang haben. Und auch die Reisekrankheit ist aus dieser Perspektive zu betrachten. Sie ist eine Trotzreaktion, die aus dem tiefsten Inneren kommt.
Und schließlich gibt es noch einen weiteren Grund für seine Schamgefühle: Wenn er wirklich ein Russenkind ist, so ist er die Verkörperung der Gefühle seiner Mutter, er ist (schuldlos) Schuld an ihren Schamgefühlen. Und dessen ist er sich sehr wohl bewusst, er spricht es sogar einmal direkt an: „Vielleicht [bin ich] sogar ein Russenkind“ (Treichel, 151).
4.3 Das Verhältnis zu anderen Figuren
An keinen Beziehungen ist der Leser näher dran als an denen des Erzählers – denn nur er hat die Möglichkeit, seine inneren Empfindungen dem Gegenspieler gegenüber mitzuteilen. Auffallend ist, dass alle Beziehungen geprägt sind vom Ich-Bezug des Erzählers. Betrachtet werden soll zuerst seine Beziehung zu den Eltern:
Wie bereits bei der Untersuchung von Vater und Mutter gesehen, herrscht zwischen ihnen und dem Sohn eine große Distanz. Besonders groß ist diese zwischen Vater und Sohn. Der Erzähler kennt ihn nur als einen Geschäftsmann – entsprechend ist dies aus seiner Bemerkung während der Untersuchungen in Heidelberg herauszulesen: „Es war mir bis zu diesem Zeitpunkt auch ganz natürlich erschienen, dass der Körper des Vaters nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus gestärkten Hemden, einem Anzug [...] bestand“ Treichel, 88f.). Und ähnlich ist auch seine Bemerkung in der Friedhofskapelle zu deuten, wenn er konstatiert, dass er „den Vater zu Lebzeiten nie als einen Menschen wahrgenommen“ habe. (Treichel, 135). Eher erscheint ihm der Vater als eine Maschine, immer nur am Arbeiten, immer nur am Kommandieren. Gefühle kennt der Erzähler von ihm nicht. Genaugenommen hat er überhaupt keine Beziehung zu seinem Vater – seine Behauptung, er lese nach dem Tod seines Vaters in der Bibel, um ihm ein guter Sohn zu sein, ist nichts mehr als eine Selbstlüge: In Wirklichkeit möchte er damit Herrn Rudolph imponieren, der sich in dieser Zeit um ihn kümmert – eine Sache, die er letztlich auch nicht richtig abzustreiten versucht. Am Sterbebett schaut der Vater seinen Sohn noch einmal an, ohne ihn jedoch zu erkennen. Es stellt sich letztlich die Frage, ob der Vater seinen Sohn jemals richtig erkannt hat.
Auch das Verhältnis zwischen Erzähler und Mutter ist nicht wesentlich besser, selbst wenn es von mehr Nähe geprägt ist. Fehlende mütterliche Zuneigung führt dazu, dass ihm seine Mutter fremd ist und immer fremd bleibt. Zwar versucht er, sie zu verstehen, doch es gelingt ihm nicht. Er blockt bei allen Gefühlsregungen der Mutter ab, möchte sich nicht umarmen lassen, möchte nicht, dass er sie rührt, weil er solches aus seiner Kindheit nicht gewohnt ist. Er kann ihr nicht den Halt geben, den sie von ihm erwartet, dazu sind sie sich zu fremd. Und diese Fremdheit nimmt mit zunehmendem Alter sogar noch zu: So schafft sie es noch nicht einmal, mit ihrem Sohn über die mögliche Adoption des Findelkindes zu sprechen, Herr Rudolph muss die Vermittlerrolle übernehmen. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass den Erzähler eine solche Beziehung kränkt, dass er sich Gedanken über die fehlende Liebe macht, darüber, ob er überhaupt gewollt ist.
Der Erzähler benötigt das Gefühl, akzeptiert zu werden, das Gefühl, gebraucht zu werden. Dieses Gefühl kann ihm Herr Rudolph geben, zumindest anfangs. Er kümmert sich um den Erzähler, als seine Mutter am Sterbebett des Vaters wacht, er hört ihm zu, als er von seinen Erlebnissen in Heidelberg erzählt. Herr Rudolph ist auch der Mensch, bei dem der Erzähler situationsbedingte Gefühle erkennen kann. Nicht wie bei der immerapathischen Mutter oder dem immer geschäftig-ernsten Vater. So imponiert ihm der Dorfpolizist, der eine Art „Ersatzvater“ für ihn ist. Er möchte ihm etwas zurückgeben; so ist er ihm gegenüber gehorsam, deutlich an dem freiwilligen Lesen der Bibel beim Tode des Vaters zu erkennen. Doch je mehr der Umgang mit Herrn Rudolph alltäglicher wird, desto mehr kühlt auch diese Beziehung ab, besonders ab dem Moment, indem er die Vaterrolle so sehr übernimmt, dass der Erzähler bei ihm nicht mehr ständig im Mittelpunkt steht. Bei den ersten Anzeichen von Missfallen seitens Herr Rudolphs konstatiert der selbstgefällige Erzähler, „dass ich Herrn Rudolph nicht mehr mochte“ (Treichel, 170). In der Beziehung zu Herrn Rudolph wird deutlich, dass der Erzähler den sozialen Ansprüchen nicht genügen kann und somit wohl immer bei seinen Mitmenschen im günstigsten Fall Mitleid, aber wohl nie Akzeptanz erreichen wird.
Interessant ist auch sein Verhältnis zu seinem verlorenen Bruder Arnold, dem vermeintlichen Findelkind 2307. Als Kind, als er noch der Meinung ist, dass Arnold verhungert ist, ist er stolz auf seinen Bruder, er „fühlte [sich] vom Schicksal ausgezeichnet“ (Treichel, 11). Denn mit einem Bruder, der so tragisch ums Leben gekommen ist, kann er die Aufmerksamkeit erhaschen, die ihm seitens der Eltern fehlt. Es macht ihm schwer zu schaffen, als er die Wahrheit erfährt, seine ganze Vorstellung wird so über den Haufen geworfen. Besonders problematisch stellt sich die Tatsache dar, dass das Mitleid Außenstehender, das bisher er abbekommen hat, nun auf den verlorenen Bruder umgeleitet wird, dem es vermeintlich schlechter geht. Und nach und nach versteht er, dass sein Bruder daran Schuld ist, dass er in so schlechter Atmosphäre aufwachsen muss. Der anfängliche Stolz wandelt sich nach und nach in Ablehnung – so ist sich der Erzähler sicher, dass seine Gesichtskrämpfe mit Arnold zu tun haben (vgl. Treichel, 57). Am Ende herrscht blanker Hass – um den unüberwindlichen Schatten seines Bruders loszuwerden, wünscht er sich gar den dritten Weltkrieg. Findelkind 2307 ist für ihn eine Bedrohung. Doch äußere Ablehnung und Hass werden von ihm mit zunehmendem Alter auch gerne künstlich aufrechterhalten, eine Bewältigung lehnt er innerlich ab. Denn sein verlorener Bruder bzw. das Findelkind geben ihm immer wieder die Gelegenheit, sich zu verstecken. Bei eigenem Versagen lebt es sich einfacher, die Schuld auf Arnold abzuladen, als an sich selber zu arbeiten. Deshalb auch seine große Angst, dass sein Bruder wiedergefunden wird – sie liegt nicht wirklich darin begründet, dass er mit ihm teilen müsste, sondern vielmehr darin, dass er seine Position als armer, nichtbeachteter Sprössling aufgeben müsste. Nur so ist der Schluss der Erzählung zu erklären, dass er als einziger seinen Bruder in dem Metzgerjungen erkennt; denn die Aufgabe der Suche der Mutter bedeutet für ihn auch der Verlust seiner eigenen Deckung und seine eigene Offenbarung. Würde aber auch die Mutter ihren vermeintlichen Erstgeborenen erkennen, hätte er „gewonnen“, da es für die Mutter unmöglich scheint, diesen widerzubekommen, da die Quellen bereits ausgeschöpft sind – und der Erzähler könnte sich für immer hinter den „Verlorenen“ verstecken.
4.4 Die Entwicklung der Person
Nimmt die Mutter eine positive und der Vater eine eher negative Entwicklung, kann man beim Erzähler davon sprechen, dass er keine Entwicklung nimmt. „Vom Tag meiner Geburt an herrschte ein Gefühl von Schuld und Scham“ (Treichel, 17) – so die Ausgangslage des Erzählers zu Beginn der Erzählung. Und daran ändert sich im Laufe der Handlung nichts – am Ende spürt er „wieder die Schuld und die Scham, die [er] immer spürte“ (Treichel, 171). Es stellt sich die Frage, warum der Erzähler keine Entwicklung nimmt. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass er in Selbstmitleid vergeht. Oftmals versteht er nicht, unternimmt jedoch auch nichts dafür, zu verstehen. Und während er abfällig auf seine Mutter schaut, die sich nur langsam weiterentwickelt, bemerkt er seinen eigenen Stillstand nicht. Zu sehr ist er damit beschäftigt, sich selbst zu bemitleiden, sich über andere Personen zu wundern.
5. Ergebnis
5.1 Zusammenfassung
„Dieser Roman ist [...] das beste Beispiel dafür, wie man durch die verzweifelte Suche nach der verlorenen Vergangenheit die Gegenwart völlig außer Acht lassen kann“ - Dem zusammenfassenden Urteil von Ecker kann man nur zustimmen. Alle drei Hauptfiguren sind in ihrem Handeln dermaßen von den Geschehnissen der Vergangenheit, von dem Krieg, dem Verlust des Sohnes und dessen psychische Auswirkungen determiniert, dass sie sich in der Gegenwart nicht zurecht finden. Die Mutter hängt mit ihren Gedanken ständig in der Vergangenheit und vergisst die gegenwärtige Verpflichtungen ihrem Sohn gegenüber, und der Vater lebt zwar, beruflich erfolgreich, äußerlich scheinbar im Jetzt, kann aber auf Grund der Vergangenheit keine Bindung zu seiner Familie aufbauen. Der Erzähler schließlich findet sich nicht zurecht, da ihm keine Perspektive für die Zukunft gegeben wird, sondern die Vergangenheit ihn dauernd einzuholen droht. Für alle drei Personen gibt es keine Gegenwart; stattdessen mischen sie die Vergangenheit immer wieder neu auf. Dadurch gelingt es ihnen nicht, sich soweit zu entwickeln, dass sie ihren Frieden mit dieser finden können.
5.2 Deutung auf gesamtgesellschaftlichen Kontext und Voraussicht
Treichels Erzählung, autobiographisch stark beeinflusst, stellt natürlich eine individuelle Familiengeschichte dar; trotzdem ist die beschriebene Problematik in der Nachkriegszeit omnipräsent: Zerstörte Familien, die sich neu formieren und organisieren müssen, sind überall in Deutschland zu finden. Der Verbleib der Familienangehörigen ist nicht geklärt – so kehren beispielsweise erst im Oktober 1955 die letzten Kriegsgefangen nach Hause, der Verbleib von Flüchtlingen bleibt oftmals unbekannt. Viele Menschen müssen völlig von vorne beginnen, sind auch bereit dazu. Sie flüchten sich, ähnlich dem Vater, in Arbeit und suchen dort das Vergessen. Vergessen durch Verdrängung, Vergessen dadurch, dass die Spuren der Vergangenheit nach und nach gelöscht werden. Dabei entsteht die Generation, der Deutschland das berühmte „Wirtschaftswunder“ zu verdanken hat.
Doch schon bald revoltiert die Jugend, die sich nicht genug beachtet fühlt, die unter den Erwachsenen zu leiden hat, die die Wunden des Krieges noch nicht überwunden haben: Eltern, die selber keine Freude mehr kennen und sie auch ihren Kindern nicht gönnen, Lehrer, die ihre Verbitterung in totalitärem Unterricht zu unterdrücken versuchen. Da man selber nicht weiß, wo man steht, gelingt es auch nicht, den Kindern und Jugendlichen ihren Platz in der Gesellschaft zu geben. Doch diese werden größer und selbständiger, und sie werden zur Generation der 68er, die versuchen, aus dem engen Korsett, das man ihnen anlegt, auszubrechen. Sie wollen nicht mehr dazugehören. Tendenzen, die auf alle Fälle auch schon bei Treichels Erzähler festzustellen sind – die Revolte beginnt mit den langen Haaren.
Und schließlich gelingt es doch noch, die Nachwirkungen des Krieges zu überwinden, die Vergangenheit beginnt zu bröckeln. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in der von Treichel beschriebene Familie: In Heidelberg führt Professor Liebstedt seine Untersuchungen in einem Raum durch, der stark vom Verfall bedroht ist. Aber er wird nicht mehr renoviert – denn er wird nicht mehr lange benötigt werden. Und nicht nur äußerlich steht die Vergangenheit immer weniger im Mittelpunkt - auch innerlich lösen sich die Menschen von ihr, wie deutliche Ansätze der Mutter zeigen. Das Leben geht weiter.
5.3 Novelle oder Roman?
Zum Abschluss der Arbeit soll noch die Gattungsfrage der Erzählung geklärt werden. Denn einerseits wird sie in unserem Proseminar „Novelle“ behandelt, andererseits wird sie in der Sekundärliteratur oftmals als Roman bezeichnet. Im Umfeld des Textes wird keine Aussage über die Gattung gemacht, so dass die Klärung, um was es sich denn nun handelt, noch aussteht. Bei der Untersuchung soll die im Seminar erarbeitete Definition der Novelle als Grundlage dienen: Eine Erzählung mittlerer Länge, die ein konflikthaftes Ereignis auf dichte und prägnante Weise gestaltet.
Der Anfang der Definition ist zweifelsohne erfüllt – es liegt eine Prosaerzählung mit mittlerer Länge vor. Zwar hat das Buch 175 Seiten und ist damit an einer oberen Grenze angelangt, doch auf Grund von einfacher Sprache und Syntax ist die Erzählung ohne Frage in einem Zuge lesbar. Interessanter wird die Frage, ob es sich um „ein
6. Literaturverzeichnis
Primärliteratur:
Treichel, Hans-Ulrich: Der Verlorene. Frankfurt am Main 1998.
Sekundärliteratur:
Ecker, Daniela: Hans-Ulrich Treichel – Der Verlorene. http://www.die-leselust.de/ buch/ treichel_ hansulrich_verlorene.htm am: 24. Februar 2002.
Hirsch, Helmut: Immer wieder eine Entdeckung: Kindheit. Hans-Ulrich Treichel: Der Verlorene. http://www.berlin-chronik.de/Lesezeit/blz99_06/text19.htm am: 24. Februar 2002.
Müller, Wolfgang: [ohne Titel]. http://www.dickinson.edu/glossen/heft16/treichel.html am: 24. Februar 2002.
Staub,
7. Anhang
7.1 Internet-Rezension Daniela Ecker
Das Bild eines lachenden Babys auf einer weißen Wolldecke löst bei der Mutter jedesmal eine wahre Tränenflut aus.
Das sei sein älterer Bruder, der während des Krieges gestorben sei, wird ihm, dem Nachkriegskind, immer wieder erzählt. Ein Bruder, der nur aus einem Bild besteht - und der dennoch einen Schatten auf ihn wirft.
Nach einigen Jahren sind die Eltern der Meinung, er könne jetzt die ganze Wahrheit ertragen - dass dieser Bruder nicht, wie vermutet, tot, sondern auf der Flucht verlorengegangen sei.
Und so aberwitzig die Hoffnung auch sein mag, die Mutter klammert sich daran, den Verlorenen wieder zu finden.
Schädelvermessungen, Fußvergleiche, Blutbild - alles wird überprüft, auf Übereinstimmungen durchsucht. Oder wäre doch die "Sprache des Blutes" stärker?
Dieser Roman ist für mich das beste Beispiel dafür, wie man durch die verzweifelte Suche nach der verlorenen Vergangenheit die Gegenwart völlig außer Acht lassen kann.
Immer ist es nur der verlorene Bruder, der gesucht wird, vermisst wird - der lebende Sohn bleibt dagegen ein Schatten, dem vorgeworfen wird, die Suche nicht ernst genug zu nehmen, keine Trauer zu verspüren.
Die Erzählung findet ihren tragikomischen Höhepunkt bei den Untersuchungen in Heidelberg; die Wahrscheinlichkeit, dass das in Frage kommende Findelkind der Bruder des Jüngeren wäre, ist noch relativ hoch. Aber als Elternteil kommen weder Vater noch Mutter in Frage.....
Ein Buch, das ich wirklich nur aus ganzem Herzen weiterempfehlen möchte - weil es eine interessante Zeit schildert, dabei auf schmerzhafte Weise humorvoll bleibt - und weil Treichel ganz einfach gut erzählen kann....
Stand: 24. Februar 2002
7.2 Internet-Rezension Helmut Hirsch
Immer wieder eine Entdeckung: Kindheit
Hans-Ulrich Treichel: Der Verlorene
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1998, 175 S.
Kindheit vergeht nicht nur schnell, sie wird auch schnell wieder vergessen. Von den meisten jedenfalls. Die kleine Schar jener, die sich, gern oder weniger gern, ihrer Kindheit immer wieder erinnern, ebbt nicht ab. Denn Erzähler beginnen nie von heute auf morgen zu schreiben, sie tragen das, was sie einmal mitzuteilen haben, Jahre, Jahrzehnte mit sich herum. Je länger die Geschichten und Bilder, die Töne und Stimmen im Gedächtnis lagern, um so besser werden sie oft, wenn sie denn aufgeschrieben werden. Denn wie oft hört man von Freunden oder Bekannten Kindheitsgeschichten, ohne sie je zwischen zwei Buchdeckeln nachlesen zu können.