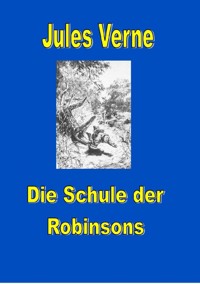
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach einem Schiffbruch retten sich zwei Überlebende auf eine Insel. Aber was ist das für eine Insel fernab aller Schifffahrtsrouten? Zunächst wie eine Idylle, in der die beiden Robinson spielen, tauchen plötzlich nicht nur Kannibalen auf, sondern wohl auch alle Raubtiere der Welt - vom Tiger über Löwen. Krokodil und Panther, Bären und Schlangen ist alles vertreten, was gefährlich ist. Das alles aber nur, weil Godfrey von seinem millionenschweren Onkel getestet werden soll - ein Roman mit vielen heiteren Episoden, dabei spannend wie jeder Jules-Verne-Roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jules Verne
Die Schule der Robinsons
Jules Verne
Die Schule der
Robinsons
Edition Corsar D. u. Th. Ostwald
Braunschweig
In dem Roman werden Ausdrücke verwendet, die heute nicht mehr üblich sind. Sie wurden jedoch beibehalten um den Stil der Zeit zu bewahren.
Texte: © 2025 Copyright by Thomas Ostwald nach der Ausgabe des Hartleben-Verlages 1885 und der von mir betreuten Taschenbuchausgabe im Pawlak-Verlag 1984 durchgesehen und korrigiert
Umschlaggestaltung: © 2025 Copyright by
Thomas Ostwald
Edition Corsar
Dagmar u. Thomas Ostwald
Am Uhlenbusch 17
38108 Braunschweig
Erstes Kapitel
In dem der Leser Gelegenheit haben wird, wenn es ihm beliebt, eine Insel zu erstehen.
»Eine Insel zu verkaufen! Gegen Barzahlung mit Zuschlag der Unkosten an den Meistbietenden abzugeben!« So wiederholte, ohne Atem zu schöpfen, Dean Felporg, der Kommissär der »Auktion«, welche zum Zwecke dieses eigenartigen Verkaufs veranstaltet war.
»Insel zu verkaufen! Insel zu verkaufen!«, erklang die noch schärfer durchdringende Stimme des Ausrufers Eingraß, der sich inmitten einer erregten Menge hier und dort hindrängte.
Wirklich erschien der geräumige Saal des »Auktionshotels«, Sacramentostraße Nr. 10, vollgestopft mit Menschen. Hier bewegte sich nicht allein eine gewisse Anzahl Amerikaner aus den Staaten Kalifornien, Oregon und Utah, sondern auch verschiedene Franzosen, die einen nicht unbedeutenden Teil der dortigen Einwohnerschaft bilden, neben Mexikanern in ihrer malerischen Sarape, Chinesen in weitärmeligem Überkleid, spitzen Schuhen und konischen Mützen, Canaquen aus Ozeanien und einzelnen Schwarzfüßen, Dickbäuchen und Plattköpfen, d.h. Vertretern noch vorhandener Indianerstämme, die von den Ufern des Trinityflusses hierhergekommen waren.
Wir beeilen uns hinzuzufügen, dass obiger Vorgang in der Hauptstadt von Kalifornien, in San Francisco, spielte, jedoch nicht zu jener Zeit, wo die lohnende Ausbeutung neuer Fundstätten - wie 1849 bis 1852 - Goldsucher aus der ganzen Welt hier zusammenführte. San Francisco war schon nicht mehr, was es früher gewesen, eine Karawanserei, ein Landungsplatz, eine Herberge, wo die geschäftigen Leute, welche nach den Goldländereien des westlichen Abhangs der Siera Nevada strömten, für eine Nacht schliefen - nein, seit einigen zwanzig Jahren hatte das alte und bekannte »Gerba Buena« Platz gemacht einer in ihrer Art einzigen, schon von 100.000 Seelen bevölkerten Stadt, die sich, wegen Mangels an Raum auf dem flachen Vorland, an der Lehne zweier Hügel ausgebreitet hatte, welche ihr noch Raum zu weiterer Ausdehnung gewährten - einer Stadt, welche Lima, Santiago, Valparaiso und alle Rivalen an der Westküste der Neuen Welt raschen Schrittes überflügelte und welche die Amerikaner zur Königin des Stillen Ozeans, zur »Perle der Westküste« zu erheben wussten.
Heute - man schrieb den 15. Mai - war es noch recht kalt. In diesem, den Einwirkungen der Polarströmungen ausgesetzten Land erinnern die ersten Wochen dieses Monats mehr an die letzten Wochen des März im mittleren Europa. In dem genannten Auktionslokal hätte man davon übrigens blutwenig verspürt. Die unaufhörlich ertönende Glocke desselben hatte eine übergroße Menge Publikum hierhergezogen und eine wirkliche Sommertemperatur ließ auf jedermanns Stirn große Schweißtropfen hervortreten, welche die Kälte draußen schnell ausgetrocknet hätte. Nun möge aber niemand glauben, dass diese Personen alle in genanntem Saal erschienen wären mit der Absicht, das Verkaufsobjekt zu erstehen; im Gegenteil, es waren meist nur Neugierige. Wer, wenn er auch reich genug dazu war, hätte so töricht sein können, eine Insel im Stillen Ozean zu kaufen, welche die Regierung ausgeboten hatte? Man sagte sich vielmehr, dass aus dem Verkauf nichts werden und dass sich kein Liebhaber würde hinreißen lassen, den geforderten Preis gar zu überbieten. Daran wäre freilich der öffentliche Ausrufer nicht schuld gewesen, denn dieser bemühte sich redlich, durch seine Redefertigkeit, seine Gesten und die mit den verlockendsten Metaphern geschmückten Lobpreisungen die Anwesenden zu animieren.
Man lachte - aber es bot keiner.»Eine Insel! Eine Insel zu verkaufen!«, wiederholte Eingraß.
»Aber es kauft sie kein Mensch«, antwortete ein Irländer, dessen Tasche nicht soviel enthielt, um einen Strandkiesel damit zu bezahlen.
»Eine Insel, welche nach Taxpreis kaum auf 6 Dollar per Acre zu stehen käme!«, rief der Kommissär Dean Felporg dazwischen.
»Und bringt nicht ein Viertel-Prozent ein!«, bemerkte ein dicker Farmer und gewiegter Kenner des Landbaues.
»Eine Insel, welche nicht weniger als 64 Meilen (120 Kilometer) im Umfang und 225000 Acres (90.000 Hektar) an Oberfläche misst.« - »Ruht sie wenigstens auf solidem Grund?«, fragte ein Mexikaner, ein alter professioneller Besucher des Saales, dessen persönliche Solidität in diesem Augenblick mehr als zweifelhaft erschien.
»Eine Insel mit jungfräulichen Wäldern«, posaunte der Ausrufer, »mit Hügeln, Wiesen, Wasserläufen ... «
»Die auch garantiert sind?«, schrie ein Franzose dazwischen, der etwas geneigt schien, auf den Köder anzubeißen.
»Die Wiesen garantiert!«, versicherte der Kommissär Felporg, der viel zu lange Erfahrung in seinem Metier besaß, um sich von den kleinen Scherzen des Publikums aus der Rolle bringen zu lassen.
»Auf zwei Jahre?«
»Bis zum Ende der Welt!«
»Und noch ein bisschen darüber!«
»Eine Insel zum vollen Eigentum!«, ließ sich der Ausrufer wieder vernehmen. »Eine Insel ohne jedes schädliche Tier, ohne Raubzeug, ohne Reptilien!«
»Auch ohne Vögel?«, fügte ein Bruder Lustig hinzu.
»Und ohne Insekten?«, setzte ein anderer die Fragen fort.
»Zurücklegen - ein ander Bild?«, rief eine Stimme, als hätte sich's um ein Bild oder eine alte Teemaschine gehandelt. Der ganze Saal brach in helles Gelächter aus, doch ohne dass jemand auf die Taxe nur einen halben Dollar geboten hätte.
Wenn das Verkaufsobjekt inzwischen unmöglich von Hand zu Hand gehen konnte, so hatte man doch den Plan der Insel in vielen Exemplaren verbreitet. Die Liebhaber sollten vorher beurteilen können, was sie von diesem Stückchen des Globus zu erwarten hatten. Hier war keine Überraschung, keine Enttäuschung zu befürchten. Lage, Orientation, Verteilung und Höhenverhältnisse des Bodens, hydrographisches Netz, Klimatologie, Verkehrswege - über alles konnte man sich aufs genaueste unterrichten. Man brauchte also nicht die Katze im Sack zu kaufen, und der geneigte Leser darf glauben, dass von irgendeiner Betrügerei bezüglich des angebotenen Verkaufsobjekts gewiss nicht die Rede sein konnte. Übrigens hatten die unzähligen Journale der Vereinigten Staaten, ebenso die von Kalifornien, wie die Tagesblätter, die Halb-Wochen- und Wochenblätter, die Halb-Monats- und Ganz-Monats-Zeitungen, die verschiedenen Revuen, Magazine, Bulletins usw. schon seit mehreren Monaten nicht aufgehört, die öffentliche Aufmerksamkeit auf diese Insel zu lenken, deren Licitation durch Kongressbeschluss gutgeheißen worden war.
Eine isoliertere Lage hätte man sich freilich kaum vorstellen können, außerhalb aller Seeverkehrswege und Handelsstraßen, obgleich die Insel Spencer nur in verhältnismäßig geringer Entfernung und sozusagen noch in amerikanischen Gewässern lag. Hier umschließen aber die schräg nach Norden und nach Süden verlaufenden regelmäßigen Strömungen einen See mit ruhigem Wasser, den man zuweilen als das »Fleurieusche Becken« bezeichnen hört.
Fast im Mittelpunkt dieser enormen Wasserfläche ohne deutlich erkennbare Strombewegung liegt die Insel Spencer. In Sicht derselben kommen auch nur wenige Schiffe vorüber. Die großen Straßen des Stillen Ozeans, welche die Neue Welt mit der Alten Welt verbinden, und zwar die nach China ebenso wie die nach Japan, durchschneiden eine weit südlichere Zone. Segelfahrzeuge würden auf diesem Fleurieuschen Becken endlose Windstillen antreffen, und die Dampfer, welche den geradesten Weg einschlagen, könnten keinen Vorteil davon haben, wenn sie dasselbe passierten.
Infolgedessen nahmen weder die einen noch die anderen Kenntnis von der Insel Spencer, welche sich gleich dem isolierten Gipfel eines unterseeischen Berges des Großen Ozeans erhebt. Für denjenigen, der sich dem Geräusch der Welt entziehen will, der die Ruhe in der Einsamkeit sucht, hätte es in der Tat nichts Besseres geben können als dieses mehrere hundert Meilen von der Küste verlorene Land. Für einen freiwilligen Robinson wäre es ein Ideal in seiner Art gewesen! Freilich hätte er den verlangten Preis erlegen müssen.
Warum suchten die Vereinigten Staaten aber sich überhaupt dieser Insel zu entledigen? Folgten sie dabei nur einer Laune? Nein. Eine große Nation kann nicht nach augenblicklicher Laune handeln wie der einzelne Mensch. Die wirkliche Ursache war folgende: Bei der Lage, welche sie innehatte, war die Insel Spencer seit langer Zeit eine vollkommen unnütze Station gewesen. Sie zu kolonisieren hätte keine praktischen Erfolge haben können. Von militärischem Gesichtspunkt bot sie kein Interesse, weil sie nur einen durchweg verlassenen Teil des Stillen Ozeans beherrscht hätte. Für den Handel erschien sie ebenso belanglos, weil ihre Produkte weder für Hin- noch für Rückfahrt die Kosten gedeckt hätten. Um darauf eine Strafkolonie zu etablieren, lag sie der Küste immer noch zu nahe. Sie aus irgendwelchen Rücksichten zu okkupieren, wäre also allemal eine nicht lohnende Mühe gewesen. So lag sie denn auch seit über Menschengedenken völlig öde, und der aus »eminent praktischen Männern« zusammengesetzte Kongreß hatte deshalb beschlossen, die Insel Spencer zur öffentlichen Versteigerung zu bringen - freilich unter einer daran geknüpften Bedingung: dass der etwaige Ersteber ein Bürger des freien Amerikas sei.
Für nichts und wieder nichts wollte man die Insel indes nicht weggeben; so war der Taxwert derselben auf elfhunderttausend Dollar festgesetzt worden. Für eine Aktiengesellschaft, welche die Urbarmachung und Ausbeutung derselben hätte betreiben können, wäre das ja eine Bagatelle gewesen, wenn das Geschäft nur einigermaßen günstige Chancen geboten hätte; doch man vermag gar nicht oft genug zu wiederholen, dass davon gar keine Rede sein konnte. Alle Sachverständigen legten auf dieses von dem Landkomplex der Vereinigten Staaten losgerissene Stückchen Erde nicht mehr wert als auf ein im ewigen Eis des Pols verlorenes Felsen-Eiland. Für den einzelnen Partikulier war die Summe immerhin eine bedeutende. Man musste schon reich sein, um sich eine Laune zu gestatten, welche in jedem Falle kaum 1/100. Prozent von dem darauf verwandten Kapital einbringen konnte. Man musste sogar ungeheuer reich sein, denn der Verkauf wurde nur gegen Barzahlung - »casch«, wie die Amerikaner sagen - abgeschlossen, und sicher sind auch in den Vereinigten Staaten diejenigen Leute selten, welche 1100000 Dollar wie ein Taschengeld ins Wasser werfen können, ohne die Aussicht, etwas davon wiederzusehen. Und doch war der Kongress fest entschlossen, die Insel auch keinen Deut unter dem Taxpreis zu veräußern. 1100000 Dollar! Keinen Cent weniger, sonst blieb die Insel Spencer Eigentum der Union. Man durfte also voraussehen, dass kein Liebhaber so toll sein werde, einen derartigen Preis daran zu wagen. Übrigens galt auch noch als Bedingung, dass der Eigentümer, wenn je ein solcher gefunden wurde, nicht etwa als König der Insel, sondern nur als Präsident der Republik daselbst auftreten dürfte. Er hätte also niemals die Berechtigung erworben, Untertanen zu haben, sondern nur Mitbürger, die ihn für einen bestimmten Zeitraum zu jenem Amt ernannten und dessen fortwährender Wiederwahl kein Hindernis im Wege stand. Auf jeden Fall blieb ihm verwehrt, einen Stammbaum von Monarchen zu begründen. Niemals würde die Union die Entstehung eines, wenn auch noch so kleinen Königreichs innerhalb der amerikanischen Gewässer geduldet haben. Diese Beschränkung war vielleicht geeignet, manche ehrgeizige Millionäre abzuschrecken, welche gern mit den wilden Königen der Sandwichsinseln, der Marquisen, Pomotus oder anderer Archipele des Großen Ozeans rivalisiert hätten.
Kurz, ob aus diesem oder einem beliebigen anderen Grunde - es meldete sich niemand. Die Zeit verrann; der Ausrufer überbot sich, die Anwesenden zum Bieten zu bewegen, der Kommissär strengte sein Organ aufs höchste an, ohne doch irgendwo eines jener leisen Zeichen mit dem Kopfe zu erhalten, welches diesen ehrenwerten Agenten doch niemals entgeht, und von dem Kaufpreise sprach überhaupt fast keiner.
Es soll hierbei nicht verschwiegen bleiben, dass der Hammer sich immer und immer wieder über das Pult erhob, die summende Menge ließ das jedoch unberührt.
Wie vorher flogen Scherzworte herüber und hinüber, und boshafte Witze gingen von Mund zu Mund. Die einen boten zwei Dollar für die Insel, alle Unkosten inbegriffen; andere wollten gar noch Geld heraus haben, um dieselbe zu übernehmen.
Und immer rief, schrie und brüllte der Ausrufer weiter:
»Eine Insel zu verkaufen! Eine Insel zu verkaufen!« Keiner Seele fiel es ein, zu kaufen.
»Garantieren Sie dafür, dass sich dort >Flats< - das ist goldhaltiger Alluvialboden - vorfinden?«, fragte der Spezereihändler Nunpy aus der Merchant Street.
»Nein«, erklärte der Kommissär, »aber es ist nicht unmöglich, dass sich dergleichen dort finden, und der Staat überlässt dem Erwerber alle seine Ansprüche auf diese goldführenden Ländereien.«
»Ist denn nicht wenigstens ein Vulkan da?«, erkundigte sich Deckhurst, der Schänkwirt aus der Montgomerystraße.
»Nein, ein Vulkan nicht«, erwiderte Dean Felporg; »da würde sie auch teurer sein!« Allgemeines Gelächter begleitete diese Antwort. »Insel zu verkaufen! Insel zu verkaufen!«, heulte Eingraß, dessen Lungen sich vergeblich abquälten.
»Nicht einen Dollar, nicht einen halben Dollar, nicht einen Cent unter der Taxe«, sagte zum letzten Male der Auktionator; »ich beginne also: Zum ersten! ... Zum zweiten!«
Totenstille ringsherum.
»Wenn niemand bietet, wird die Auktion aufgehoben! Zum ersten! ... Zum zweiten!«
»Zwölfhunderttausend Dollar!«
Diese vier Worte erschallten aus der Mitte des Saales wie vier Revolverschüsse.
Die ganze, einen Augenblick betäubte Versammlung drehte sich nach dem Tollkühnen um, der es gewagt hatte, diese Zahl hinauszurufen ...
Es war William W. Kolderup aus San Francisco.
Zweites Kapitel
Wie William W. kolderup mit J. R. Taskinar aus Stockton in Kollision kommt.
Es war einmal ein ungewöhnlich reicher Mann, der ebenso nach Millionen zählte wie andere nach Tausenden. Das war William W. Kolderup.
Man erklärte ihn für reicher als den Herzog von Westminster, dessen Revennen sich auf 800.000 Pfund belaufen und der über 40.000 Mark den Tag, über 28-29 Mark in der Minute verfügen kann - für reicher als den Senator Jones von Nevada, welcher 35 Millionen Renten besitzt - selbst für reicher als Mackay, dem seine 2.750.000 ff und Renten 6.220 in der Minute, also fast 2 Mark in der Sekunde abwerfen.
Wir sprechen gar nicht von den kleinen Millionären, den Rothschilds, Van der Bilts, den Herzogen von Northumberland, den Stewarts; auch nicht von den Direktoren der mächtigen Bank von Kalifornien und anderen in der Alten und Neuen Welt wohl akkreditierten Persönlichkeiten, denen William W. Kolderup noch bequem hätte Almosen reichen können. Dieser hätte ohne sich zu bedenken eine Million weggegeben wie unser- eins eine Mark.
Den soliden Grundstein zu seinem sich jeder Berechnung entziehenden Vermögen hatte dieser ehrenwerte Spekulant bei der ersten Ausbeutung der Golddistrikte Kaliforniens gelegt. Er war der Hauptgesellschafter des schweizerischen Kapitän Sutter, auf dessen Terrain 1848 die erste Goldader entdeckt wurde. Seit dieser Zeit findet man ihn mit ebenso viel Glück wie Intelligenz beteiligt bei allen großen Unternehmungen beider Welten. Er warf sich kühn in allerlei Spekulationen des Handels und der Industrie. Seine unerschöpflichen Mittel ernährten Hunderte von Fabriken; seine Schiffe exportierten deren Erzeugnisse nach dem ganzen Erdball. So wuchs sein Reichtum nicht allein in arithmetischer, sondern gleich in geometrischer Proportion. Man sagte von ihm, wie man gewöhnlich von Jenen Milliardären zu sagen pflegt: dass er sein Vermögen gar nicht kenne. In Wirklichkeit kannte er es auf den Dollar, aber er machte kein Aufhebens davon.
In dem Augenblick, wo wir den Leser mit all der Ehrerbietung, welche ein Mann »von so großer Oberfläche« verdient, vorstellen, besaß William W. Kolderup zweitausend Comptoirs, verteilt an allen Enden der Erde; vierundachtzigtausend Angestellte in den verschiedenen Bureaux Amerikas, Europas und Australiens; dreihunderttausend Korrespondenten; eine Flotte von fünfhundert Seeschiffen, welche unausgesetzt für ihn unterwegs waren, und er gab jährlich nicht weniger als 1.000.000 für Stempelmarken und Briefporto aus. Er war mit einem Wort die Perle in der Krone des so reichen Frisco, ein Schmeichelname, den die Amerikaner im vertrauten Gespräch der Hauptstadt von Kalifornien beilegen.
Ein von William W. Kolderup getanes Gebot hatte man also unzweifelhaft das Recht für ernst gemeint zu halten; und als die Zuschauer der Auktion denjenigen erkannt, der den Taxpreis der Insel Spencer mit hunderttausend Dollar überboten hatte, entstand eine unwillkürliche Bewegung; die Witzeleien verstummten einen Augenblick, die Scherzworte wurden von Ausrufen der Bewunderung abgelöst und donnernde Hurras dröhnten durch den Saal.
Dann folge dem Höllenlärmen das tiefste Schweigen; aller Augen erweiterten sich, aller Ohren richteten sich in die Höhe. Wären wir selbst gegenwärtig gewesen, wir hätten natürlich den Atem angehalten, um nichts von der aufregenden Szene einzubüßen, welche doch entstehen musste, wenn irgendein anderer Liebhaber gewagt hätte, mit William W. Kolderup konkurrieren zu wollen.
Doch war das zu erwarten oder überhaupt möglich? Nein! Man brauchte nur William W. Kolderup anzusehen, um zu der Überzeugung zu gelangen, dass er bei einer Gelegenheit, welche seine finanzielle Bedeutung berührte, niemals einem anderen weichen würde.
Er war ein großer, kräftiger Mann mit mächtigem Kopf, breiten Schultern, wohlproportionierten Gliedern und mit solid verbundenem Knochengerüst von Eisen. Sein gutmütiger, aber entschlossener Blick senkte sich nicht gerne zu Boden. Das ins Graue spielende, noch jugendlich volle Haar bildete einen wahren Busch um seinen Schädel, die geraden Linien seiner Nase ein geometrisch gezeichnetes, rechtwinkeliges Dreieck. Einen Schnurrbart trug er nicht. Der nach amerikanischer Mode geschnittene Bart ließ die Mitte des Kinnes frei, schloss sich mit zwei Spitzen an die Lippenenden an und endigte mit »Pfeffer- und Salzfarbe« an den Schläfen. Dazu hatte er weiße, symmetrisch am Rand eines feinen, geschlossenen Mundes verteilte Zähne, ein richtiger Commodorekopf, der sich beim Sturm erhebt und dem Orkan das Gesicht zukehrt. Kein Unwetter hätte ihn beugen können, so sicher war derselbe auf dem ihm als Stütze dienenden Hals eingelenkt. Bei einem solchen Kampf bedeutete jede Bewegung dieses Kopfes von oben nach unten nicht weniger als hunderttausend Dollar.
Aber hier war an keinen Kampf zu denken.
»Zwölfhunderttausend Dollar! Zwölfhunderttausend Dollar!«, rief der Kommissär mit dem eigenartigen Akzente eines Agenten, der endlich einen Lohn für seine Bemühungen winken sieht.
»Zu zwölfhunderttausend Dollar hat sich ein Käufer gemeldet!«, wiederholte der Ausrufer Eingraß.
»Oh, man könnte getrost mehr bieten«, murmelte der Schänkwirt Deckhurst, »William W. Kolderup würde doch nicht nachgeben.«
»Er weiß wohl, dass sich's niemand erdreisten wird!«, antwortete der Krämer aus der Merchant Street.
Vielfache »St!« geboten den beiden ehrenwerten Genossen Stillschweigen. Man wollte jetzt hören. Alle Herzen klopften lauter. Würde eine Stimme sich zu erheben wagen, auf die William W. Kolderups zu antworten? Er - ein prächtiger Anblick - rührte sich nicht; er stand da, ebenso ruhig, als interessierte ihn die Sache gar nicht. Seine Nachbarn konnten jedoch beobachten, dass seine beiden Augen zwei mit Dollar geladenen Pistolen mit gespanntem Hahn glichen.
»Niemand bietet mehr?«, fragte Dean Felporg. Kein Laut.
»Zum erster! ... Zum zweiten!«
»Zum ersten! ... Zum zweiten!«, wiederholte Eingraß, der an diesen kleinen Dialog mit dem Auktionskommissär schon gewöhnt war.
»So schlage ich zu!«
»Wir schlagen zu!«
»Für zwölfhunderttausend Dollar die Insel Spencer, wie sie geht und steht!«
»Für zwölfhunderttausend Dollar!
»Haben alle recht gehört - recht verstanden?«
»Wird es niemand später gereuen?«
»Für zwölfhunderttausend Dollar die Insel Spencer!«
Die beklemmte Brust der Zuhörer arbeitete krampfhaft. Sollte in der letzten Sekunde noch ein höheres Gebot erfolgen? Die rechte Hand über sein Pult ausgestreckt, bewegte der Kommissär Felporg den elfenbeinernen Hammer. Ein Schlag, ein einziger Schlag, und die Zuteilung war vollendet.
Gegenüber einer summarischen Ausübung des Lynchgesetzes hätte das Publikum kaum erregter aufpassen können.
Der Hammer senkte sich langsam, berührte fast das Pult, erhob sich wieder, zitterte ein wenig auf und nieder, wie ein Degen, den der Kämpfer vorher schwingt, ehe er zustößt - dann senkte er sich schneller nach abwärts ...
Doch noch bevor der trockene Schlag erfolgte, erklangen von einer Stimme die vier Worte: »Dreizehnhunderttausend Dollar!«
Zuerst ein allgemeines »Ah!« der Verwunderung, dann ein zweites, nicht weniger allgemeines »Ah« der Befriedigung. Es hatte sich noch ein Mehrbieter gefunden. Ein Wettkampf stand bevor.
Wer war jedoch der Unverfrorene, der es wagte, mit William W. Kolderup aus San Francisco auf DollarBreitlagen zu kämpfen?
Das war J. R. Taskinar aus Stockton.
J. R. Taskinar war reich, aber er war noch dicker. Er wog vierhundertneunzig Pfund. Wenn er beim letzten Kongress der dicken Männer in Chicago nur den zweiten Preis erhalten hatte, so lag das daran, dass man ihm nicht Zeit ließ, sein Diner zu vollenden, wodurch er zehn Pfund einbüßte.
Dieser Koloss, welcher eigens für ihn gebaute Stühle und Sessel benützte, um seine enorme Persönlichkeit mit Zuversicht darauf platzieren zu können, wohnte in Stockton am St. Joachim. Jene gehört zu den bedeutendsten Städten Kaliforniens, bildet eine der Hauptmetropolen für die Bergwerkserzeugnisse des Südens und rivalisiert mit Sacramento, wo die Minenprodukte des Nordens zusammenströmen. Von hier aus gelangt auch sehr viel kalifornisches Getreide zur Verladung.
Nicht allein die Ausbeutung von Bergwerken und der Handel mit Getreide hatten J. R. Taskinar zu einem ungeheuren Vermögen verholfen, nein, auch das Petroleum strömte gleich einem zweiten Paktolos durch seine Kassenschränke. Übrigens war er ein Gewohnheitsspieler, ein glücklicher Spieler, und der »Poker«, das Roulette des westlichen Amerikas, hatte sich den von ihm besetzten Nummern stets besonders günstig erwiesen. So reich er auch sein mochte, war er doch ein niederer Charakter, dem niemand so leicht das Eigenschaftswort »ehrenwert« beilegte, trotz dessen gewöhnlichen Gebrauchs in jenen Ländern. Alles in allem war es, wie man zu sagen pflegt, ein gutes Schlachtpferd, und vielleicht wälzte man ihm noch mehr auf den Rücken, als er wirklich verdiente. Gewiss ist jedoch, dass er sich bei mancher Gelegenheit nicht gescheut hatte, von dem »Derringer«, das ist der kalifornische Revolver, Gebrauch zu machen.
Wie dem auch sei, J. R. Taskinar hegte einen speziellen Hass gegen William W. Kolderup, er beneidete denselben wegen seines Vermögens, seiner gesellschaftlichen Stellung und wegen seiner Ehrenhaftigkeit. Er verachtet ihn, wie ein sehr dicker Mensch einen anderen verachtet, den er das Recht hat, mager zu nennen. Es war nicht zum ersten Mal, dass der Geschäftsmann aus Stockton dem Kapitalisten aus San Francisco irgendein Geschäft - ob dasselbe gute oder schlechte Aussichten bot - aus reiner Rivalität aus den Händen zu winden versuchte. William W. Kolderup kannte ihn durch und durch und behandelte ihn bei jeder Gelegenheit so verächtlich, dass es jenen nur noch mehr reizen musste. Einen Erfolg aus der jüngsten Zeit konnte J. R. Taskinar seinem Gegner nie vergeben, den, dass der letztere ihn bei den vorhergegangenen Senatswahlen aus dem Felde geschlagen hatte. Trotz seiner Anstrengungen, seiner Drohungen und Verleumdungen - die an seine Helfershelfer verschwendeten Tausende von Dollar gar nicht zu erwähnen - saß doch William W. Kolderup an seiner Stelle im gesetzgebenden Rate von Sacramento.
J. R. Taskinar hatte in Erfahrung gebracht - wie, vermögen wir nicht zu sagen-, dass es William W. Kolderups Absicht sei, die Insel Spencer zu erwerben. Diese Insel musste für ihn übrigens ebenso unnütz sein wie für seinen Rivalen. Gleichviel; es bot sich damit eine neue Gelegenheit, einen Streit anzufangen, zu kämpfen, vielleicht einmal zu siegen; J. R. Taskinar konnte sich dieselbe nicht entziehen lassen.
Aus diesem Grund war J. R. Taskinar in der Auktion erschienen, mitten unter der Menge Neugieriger, welche seine Absichten natürlich nicht ahnen konnten, so wenig, wie dass er alle seine Batterien in Gefechtszustand gesetzt, oder warum er abgewartet, bis sein Gegner den Taxpreis, so hoch dieser auch erschien, überboten hatte.
Endlich hatte William W. Kolderup gerufen gehabt:
»Zwölfhunderttausend Dollar!«
Und als William W. Kolderup schon annehmen durfte, dass er den Zuschlag erhalten werde, hatte er sich erst bemerkbar gemacht durch die mit Stentorstimme hinausgeschleuderten Worte:
»Dreizehnhunderttausend Dollar!«
Alle Welt kehrte sich, wie wir wissen, dabei um.
»Der dicke Taskinar!«
Dieser Name lief von Mund zu Mund. Ja, der dicke Taskinar! Er war jedermann bekannt. Seine Korpulenz hatte zu mehr als einem Artikel in den Journalen der Union Veranlassung gegeben. Wir wissen eben nicht, welcher Mathematiker durch Transzendentalrechnung nachgewiesen habe, dass seine Körpermasse hinreichend sei, auf unseren Satelliten einen bemerkbaren Einfluss auszuüben und in noch abzuschätzender Weise die Elemente des Mondumlaufs zu stören.
Die physischen Eigenschaften J. R. Taskinars interessierten in diesem Augenblick jedoch die im Saale Anwesenden gewiss weniger; weit mehr Aufsehen erregte der Umstand, dass er in öffentlichen und direkten Wettbewerb mit William W. Kolderup eingetreten war. Damit drohte ein gewaltiger, durch Dollarexplosionen geführter Kampf auszubrechen, und wir vermögen nicht zu entscheiden, auf welchen der beiden Geldschränke die Liebhaber von unsinnigen Wetten ihren Einsatz gewagt hätten. Enorm reich waren beide und Todfeinde obendrein! Das Ganze musste demnach auf eine Frage der Eigenliebe hinauslaufen.
Nach der schnell unterdrückten ersten Erregung herrschte in der ganzen Versammlung wieder eine Totenstille. Man hätte eine Spinne können ihr Netz weben hören.
Da unterbricht die Stimme des Kommissärs Dean Felporg das allgemeine Schweigen.
»Für dreizehnhunderttausend Dollar die Insel Spencer!«, rief er sich erhebend, um die Bietenden besser im Auge haben zu können.
William W. Kolderup hatte sich ein wenig nach der Seite J. R. Taskinars gewendet. Die Nebenstehenden machten unwillkürlich Platz, um die beiden Feinde einander gegenübertreten zu lassen. Der Mann von Stockton und der von San Francisco konnten sich in die Augen sehen und mit Bequemlichkeit beobachten. Die Wahrheitsliebe verpflichtet uns zu der Bemerkung, dass sie es daran nicht fehlen ließen. Niemals hätte der eine es über sich gebracht, den Blick vor dem des anderen zu senken.
»Vierzehnhunderttausend Dollar!«, sagte William W. Kolderup.
»Fünfzehnhunderttausend Dollar!«, antwortete J. R. Taskinar.
»Sechszehnhunderttausend!«
»Siebzehnhunderttausend!«
Erinnert das nicht an die beiden Industriellen von Glasgow, wer von ihnen auf die Gefahr einer Katastrophe hin einen Fabrikschornstein am höchsten bauen würde? In unserem Falle bestanden die Schornsteine freilich aus Goldbarren.
Bei jedem Gebot des anderen bedachte sich übrigens William W. Kolderup, bevor auf aufs Neue noch mehr bot, während Taskinar immer wie eine Bombe herausplatzte und sich nicht eine Sekunde Zeit zur Überlegung nehmen zu wollen schien.
»Siebzehnhunderttausend Dollar!«, wiederholte der Kommissär. »Nur munter, meine Herren, das ist nicht zu viel!«
Man wäre versucht gewesen, zu glauben, dass er aus Geschäftsgewohnheit hinzugesetzt hätte: »Der Rahmen allein ist mehr wert!«
»Siebzehnhunderttausend Dollar!«, heulte der Ausrufer Eingraß.
»Achtzehnhunderttausend Dollar«, antwortete William W. Kolderup.
»Neunzehnhunderttausend Dollar«, meldete sich J. R. Taskinar.
»Zwei Millionen!«, rief William W. Kolderup, dieses Mal ohne zu zögern, hinterdrein.
Sein Gesicht war etwas bleicher geworden, als er die letzten Worte sprach, aber seine Haltung blieb die eines Mannes, welcher entschlossen ist, einen Kampf nicht aufzugeben.
J. R. Taskinar kam allmählich in die Hitze. Sein Gesicht ähnelte schon einigermaßen jenen farbigen Scheiben an den Eisenbahnen, deren roter Schein einem Zug das Zeichen gibt, anzuhalten. Höchstwahrscheinlich bekümmerte sich sein Gegner aber nicht im Geringsten um derartige Signale und hätte nur die Dämpfe im Kessel noch weiter angespannt.
J. R. Taskinar fühlte das. Das Blut stieg ihm ins Gesicht, welches eine apoplektische Röte zeigte. Zwischen den fleischigen, mit kostbaren Brillantringen überladenen Fingern drehte er an der ungeheuren goldenen Panzerkette, an welcher seine Uhr hing. Er fixierte seinen Gegner und schloss dann für einen Moment die Augen, um sie hasserfüllter als je wieder zu öffnen.
»Zwei Millionen fünfhunderttausend Dollar!«, rief er endlich in der Hoffnung, durch diesen kühnen Sprung jedes Mehrgebot auszuschließen.
»Zwei Millionen siebenmalhunderttausend Dollar!«, antwortete William W. Kolderup ganz gelassen.
»Zwei Millionen neunmalhunderttausend!«
»Drei Millionen!«
Ja, William W. Kolderup aus San Francisco hatte drei Millionen Dollar gesagt!
Schon wollte man ihm zujubeln; der Auktions-Kommissär vereitelte das jedoch dadurch, dass er das Gebot wiederholte, während der erhobene Hammer durch eine unwillkürliche Bewegung der Muskeln sich zu senken drohte. Man hätte behaupten können, dass Dean Felporg, der sich sonst gegen Überraschungen bei einer öffentlichen Versteigerung so trefflich gerüstet zeigte, jetzt kaum noch imstande war, sich aufrecht zu erhalten.
Alle Blicke hingen an J. R. Taskinar; seine voluminöse Persönlichkeit empfand das Gewicht derselben, noch mehr freilich die Last jener drei Millionen Dollar, welche ihn zu zermalmen schien. Er wollte offenbar den Mund auftun; um noch mehr zu bieten, er konnte es nicht. Er wollte ein Zeichen mit dem Kopf geben - er konnte es ebenso wenig.
Endlich ließ sich seine Stimme vernehmen, zwar nur schwach, aber doch hörbar genug für den Kommissär.
»Drei Millionen fünfmalhunderttausend!«, murmelte er.
»Vier Millionen!«, schallte das Echo seitens William W. Kolderups.
Das war der letzte Keulenschlag, J. R. Taskinar sank zu Boden, der Hammer traf mit trockenem Schlag den Marmor des Pultes.
Die Insel Spencer war William W. Kolderup aus San Francisco für vier Millionen Dollar gerichtlich zuerteilt worden.
»Ich werde mich rächen!«, murmelte J. R. Taskinar. Und nachdem er noch einen Blick voll glühenden Hasses seinem Überwinder zugeschleudert, kehrte er
nach dem Occidental-Hotel zurück.
Inzwischen donnerten die Hurras, die »Hips« dreimal vor den Ohren William W. Kolderups; sie begleiteten ihn nach der Montgomery Street; ja der Enthusiasmus dieser Amerikaner ließ sie so weit gehen, dass sie sogar den Yankee-doodle zu singen vergaßen.
Drittes Kapitel
Worin ein Gespräch zwischen Phina Hollauey und Godfrey Morgan auf dem Pianino begleitet wird.
William W. Kolderup war nach seinem Hotel in der Montgomery Street zurückgekehrt. Diese Straße ist die Regent Street, der Broadway, die Ringstraße oder die Unter den Linden von San Francisco. In der ganzen Ausdehnung dieser langen Pulsader, welche die Stadt parallel ihrer Quais durchschneidet, herrscht Bewegung, Geschäftigkeit und Leben: zahlreiche Pferdebahnwagen, andere mit Pferd oder Mauleseln bespannte Geschirre, geschäftseifrige Leute, welche sich auf den Trottoirs an den Seiten drängen; Flaneurs, die vor den verlockend ausgestatteten Schaufenstern stehen, und noch zahlreichere Liebhaber an den Türen der
»Bars«, in denen ganz speziell kalifornische Getränke verabfolgt werden. Es wäre wohl unnütz, den Palast des Nabob von San Francisco zu beschreiben. Im Besitz so vieler Millionen, hatte er eben zu viel Luxus um sich; mehr Komfort als Geschmack; weniger künstlerischen als praktischen Sinn - man kann eben nicht alles gleichzeitig haben. Der Leser begnüge sich zu erfahren, dass sich hier ein prachtvoller Empfangssalon vorfand und in diesem Salon ein Pianino, dessen Akkorde durch die laue Atmosphäre des Hotels zitterten, als der steinreiche William W. Kolderup dahin zurückkam.
»Gut«, sagte er für sich, »sie und er sind beisammen. Erst ein Wort an meinen Kassierer, dann werden wir von etwas anderem plaudern!«
Er begab sich nach seinem Kabinett, um das kleine Geschäft bezüglich der Insel Spencer vollends zu ordnen und nachher nicht weiter daran zu denken. Zu ordnen bedeutete ja weiter nichts, als aus dem Portefeuille einige Hände voll Wertpapiere zu nehmen und die neue Erwerbung zu bezahlen. Vier Linien an seinen Wechselagenten, mehr bedurfte es dazu nicht. Nachher wollte William W. Kolderup sich mit einer anderen »Kombination« beschäftigen, die ihm ganz anders am Herzen lag.
Richtig! Er und sie befinden sich im Salon; sie vor ihrem Piano, er halb ausgestreckt auf einem Sofa. Nur halb auf die Notenperlen lauschend, die unter den Fingern des reizenden Mägdleins hervorgingen.
»Hörst du mich?«, sagte sie.
»Gewiss!«
»Ja, aber auch mit Verständnis?«
»Das wollt' ich meinen, Phina! Noch nie hast du die Variationen Auld Robin Grays1 so entzückend gespielt.«
»Ich spielte nur nicht Auld Robin Gray, Godfrey ... es war der Happy moment ... « - »Ach, so täuschte ich mich also«, antwortete Gedfrey mit so gleichgültigem Ton, dass dieser niemand entgehen konnte. Das junge Mädchen erhob die Hände und hielt die Finger einen Augenblick gespreizt über dem Klavier, als sollten sie wieder herabsinken, um einen Akkord zu greifen. Dann aber drehte sie sich auf dem Klavierschemel und sah kurze Zeit den gar zu schweigsamen Godfrey an, dessen Blicke den ihrigen aus dem Wege zu gehen suchten. Phina Hollauey war das Patenkind William W. Kolderups. Eine Waise, erzogen auf seine Kosten, hatte er ihr das Recht zugestanden, sich als seine Tochter zu betrachten, und die Pflicht, ihn wie einen Vater zu lieben. Sie ließ sich in dieser Hinsicht nichts zu Schulden kommen.
Sie war ein noch sehr junges Mädchen, »hübsch in ihrer Art«, wie man oft sagt, auf jeden Fall reizend, eine Blondine von sechzehn Jahren, mit dem Gedankengang einer Brünette, was man aus dem Kristalle ihrer dunkelblauen Augen leicht herauslas. Wir können nicht umhin, sie mit einer Lilie zu vergleichen, obwohl dieses Bild unabänderlich in der besseren Gesellschaft gebraucht wird, um amerikanische Schönheiten zu bezeichnen. Es war also eine Lilie, da es doch nicht anders geht, aber eine Lilie, die auf solidem, nicht leicht schwankendem Stängel prangte. Unzweifelhaft besaß sie warmes Gefühl, diese junge Miss, daneben aber auch viel praktischen Verstand, ein gewisses Selbstbewusstsein, und endlich ließ sie sich nicht mehr als nötig von den Illusionen und Träumereien bezaubern, welche ihrem Geschlecht und Lebensalter sonst eigen sind.
Träume - wie schön, wenn man schläft, nicht wenn man wach ist. Und sie - sie schlief weder in dieser Minute, noch dachte sie überhaupt daran, zu schlafen.
»Godfrey?«, nahm sie wieder das Wort.
»Phina?«, erwiderte der junge Mann.
»Wo bist du jetzt?«
»Bei dir ... in diesem Salon ... «
»Nein, nicht bei mir, Godfrey, nicht in diesem Salon! ... Aber weit, weit von hier ... jenseits der Meere, nicht wahr?«
Ganz mechanisch verirrte sich Phinas Hand, die Tasten suchend, in eine Reihe verminderter Septimen, deren trauriger Klang laut genug sprach, den aber der Neffe William W. Kolderups doch am Ende nicht verstand. Denn das war dieser junge Mann, derart das Band der Verwandtschaft, welches ihn mit dem reichen Herrn des Hauses verknüpfte. Der Sohn einer Schwester dieses Inselkäufers und seit vielen Jahren elternlos, war Godfrey Morgan wie Phina auferzogen in dem Haus seines Onkels, dem das nie aussetzende Geschäftsfieber keine Zeit gelassen hatte, ans Heiraten zu denken.
Godfrey zählte jetzt zweiundzwanzig Jahre. Nach Vollendung seiner Erziehung war er eigentlich völlig müßig gegangen. Das Leben bot ihm nach allen Seiten Wege, sein Glück zu machen; ob er einen solchen nach rechts oder links wählte - ihm kam es darauf wenig an, denn der Erfolg konnte ihm in keinem Falle fehlen. Übrigens war Godfrey eine hübsche Persönlichkeit von vornehmer Eleganz, der niemals seine Krawatte durch einen Ring gezwängt und weder seine Finger, noch die Manschetten, oder den Brustlatz mit jenen Juwelenfantasien bepflastert hatte, welche seine Landsleute so besonders lieben.
Es wird niemand darob erstaunen, wenn wir es aussprechen, dass Godfrey Morgan Phina Hollaney heiraten sollte. Hatte es überhaupt anders sein können? Alle Verhältnisse wiesen ja darauf hin. Übrigens wollte William W. Kolderup diese Verbindung; er sicherte damit das Glück zweier Wesen, die er über alles liebte, ohne zu rechnen, dass Phina dem Godfrey gefiel und dass Godfrey auch Phina nicht missfiel. Die gute finanzielle Stellung des Hauses unterstützte ebenfalls diese Heirat. Seit ihrer Kindheit war ein Konto dem jungen Mann, ein anderes dem jungen Mädchen eröffnet worden; es bedurfte also nur einer Übertragung, um das neue Konto für beide Gatten in schönster Ordnung zu haben. Der würdige Spekulant hoffte, dass sich die Sache so am leichtesten abwickeln ließ und - von etwaigen Irrtümern und Fehlern abgesehen - alles bestens stimmen müsse.
Aber einen Irrtum, ein Versehen hatte er, wie wir sofort sehen werden, doch außer Rechnung gelassen. Ein Irrtum, weil sich Godfrey selbst zum Heiraten noch gar nicht reif genug fühlte; ein Versehen, weil man unterlassen hatte, ihn rechtzeitig auf diese Eventualität vorzubereiten.





























