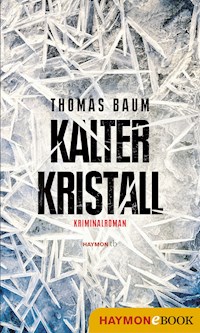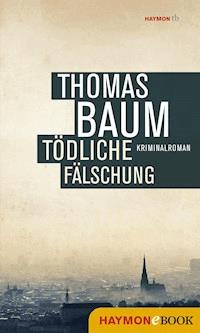Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Worschädl-Krimis
- Sprache: Deutsch
THOMAS BAUM NIMMT DICH MIT AUF EINE LITERARISCHE ACTION-ACHTERBAHN! CYBER-ATTACKEN AUF DIE GANZE STADT Sicherheit ist für den POLIZISTEN ROBERT WORSCHÄDL Kernkompetenz, aber CYBERSICHERHEIT IST NICHT UNBEDINGT SEIN SPEZIALGEBIET. Als eine PROGRAMMIERERIN AUF BRUTALE WEISE UMS LEBEN Leben kommt, muss er sich erstmals in jene Abgründe des Internets wagen, in denen sich SONST NUR BÖSWILLIGE HACKER HERUMTREIBEN … Mordverdächtig ist die JUGENDLICHE, ZUR GEWALT NEIGENDE TOCHTER - doch ist das Mädchen wirklich zu so einer grausamen Tat fähig? WORSCHÄDLS MENSCHEN- UND TECHNIKKENNTNIS werden hart auf die Probe gestellt. ANGRIFFE AUS DEM DARKNET - UND PLÖTZLICH ZWEIFELST DU AN DEINER EIGENEN WAHRNEHMUNG! War die Ampel wirklich grün, über die ich gefahren bin? Bin ich in meinem Zuhause in Sicherheit? Ist mein Arbeitskollege der zuverlässige, freundliche Mensch, für den ich ihn bisher gehalten habe? DIE MENSCHEN IN LINZ KÖNNEN SICH SELBST NICHT MEHR TRAUEN. Ampelanlagen spielen verrückt, Lichter gehen unvermittelt aus. Und dann ist da plötzlich dieses ERPRESSERSCHREIBEN: WENN KEIN GELD FLIESST, WIRD DEM KRANKENHAUS DER STROM ABGEDREHT. Wie zur Hölle soll Worschädl EINEN TÄTER ENTLARVEN, DER EIN ANONYMES, DIGITALES GESPENST IST?! Noch dazu eines, das GANZE STÄDTE AUSSER GEFECHT SETZEN kann … THOMAS BAUM PACKT KRIMI-ACTION AUS ÖSTERREICH ZWISCHEN ZWEI BUCHDECKEL Als DREHBUCHPROFI UND KINOHIT-AUTOR weiß Thomas Baum genau, wie er dich AM BESTEN UNTER STROM SETZEN kann. So auch im VIERTEN BAND RUND UM SEINEN OBERÖSTERREICHISCHEN KOMMISSAR ROBERT WORSCHÄDL. Für alle, die BEIM LESEN GERNE HELLWACH BLEIBEN wollen! *************************************************************************** Du suchst Hochspannung? Du stehst auf schnelle Verfolgungsjagden, und unerwartete Wendungen bewirken bei dir die beste Gänsehaut? Dann ist dieser Thomas-Baum-Krimi voll dein Ding. Wenn du den erstmal im Kopf laufen hast, kann der Fernseher ausbleiben, denn mehr Thrill kann dir auch die beste TV-Krimiserie nicht bieten. Melissa Modersbacher – Projektleitung *************************************************************************** DIE KRIMIS VON THOMAS BAUM UM ROBERT WORSCHÄDL: Donau so rot Tödliche Fälschung Kalter Kristall Schwarze Sterne
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Baum
Schwarze Sterne
Kriminalroman
1
Sie hasste ihre Tochter bis aufs Blut und wünschte sich ihre Nähe. Zugleich hatte sie Angst vor ihr. Wegen der roten Linie, die sie in letzter Zeit mehrmals überschritten hatte.
An ihre verbalen Entgleisungen hatte sich Daniela längst gewöhnt. Daran, dass sie von ihr oft mit den schlimmsten Schimpfwörtern bedacht wurde.
Sie hatte aufgehört, sie deswegen zurechtzuweisen. Ihr Ausdrücke wie dreckige Hure oder verfickte Fotze zu verbieten. Das fruchtete nicht. Wirkte eher wie Öl im Feuer. Konnte dazu führen, dass sie umso wilder tobte. Außer sich. Wie ein Tier.
Ihre Wutausbrüche, bei denen sie Stühle und Tische mit Fäusten und Tritten traktierte. Oder Blumentöpfe packte und auf den Boden schleuderte.
Vor einem halben Jahr klatschte dann zum ersten Mal Jasmins Hand in Danielas Gesicht. Mit voller Wucht. Darauf war sie nicht vorbereitet gewesen. Das hatte sie aus den Angeln gehoben.
Sie taumelte gegen das Bücherregal. Blutete aus der Nase. Konnte nicht fassen, dass Jasmin ihr auch noch die Faust gegen die Schläfe stieß.
Daniela knickte ein, sank in die Knie, landete auf dem Boden. In diesem Moment hielt Jasmin inne. Schien zu begreifen, dass sie ein Tabu gebrochen, eine Grenze überschritten hatte.
Blickte für Sekunden irritiert auf ihre Hände, war nicht in der Lage, sie ihrer Mutter entgegenzustrecken. Ihr auf die Beine zu helfen. Spielte stattdessen gleich wieder die Coole: „Selber schuld.“
Daniela war darin geübt, nach einem Tiefschlag wieder hochzukommen. Lange durchzuhängen war in ihrem Leben noch nie drin gewesen. Aber jetzt fühlte sie sich wie gerädert. Als ob zentnerschwere Gewichte auf ihr lasten würden. Unendlich müde und erschöpft.
Sie blickte zu ihrer Tochter hinauf.
Kalte Augen.
Nicht das geringste Mitgefühl.
So wie gestern. Nur war sie da stockbesoffen gewesen. Verlangte wie so oft nach Geld. Beschwerte sich lautstark darüber, wie kurz sie gehalten wurde.
Den Einwand, dass man sich seine finanziellen Mittel üblicherweise durch Arbeit verdienen müsse, ignorierte sie.
Danielas Klarstellung, dass sie nicht mehr bereit sei, ihre Faulheit zu unterstützen, brachte das Fass zum Überlaufen.
Zuerst wurde sie von ihrer Tochter mit den Fäusten attackiert. Dann zum ersten Mal auch mit dem Kopf. Der flog nach vorn, krachte gegen ihre Stirn und stieß sie mit ihren 58 Kilo wie nichts gegen die Wand. Zerplatzende Sterne, schwarz-weißes Flimmern. Und nahezu im selben Moment, kurz nach dem Aufprall, der Reflex. Die metallene Stehlampe.
Daniela packte sie mit beiden Händen, riss sie samt dem Kabel hoch und ließ sie auf Jasmin niederkrachen. Mit ihrer ganzen Kraft. Das brachte die betrunkene Jugendliche ins Wanken. Der zweite Hieb streckte sie nieder. Jasmin landete auf allen Vieren, wusste nicht, wie ihr geschah.
Als sie ihr unmögliches, gewalttätiges Kind so hilflos vor sich liegen sah, erinnerte sie sich daran, wie sie es vor 16 Jahren in ihren Armen geschaukelt und ihm die Brust gegeben hatte.
Von Anfang an hatte sie Jasmin allein großgezogen. Schulauswahl, Zahnspangen- und Impfentscheidungen – bei all diesen Herausforderungen war sie immer auf sich gestellt gewesen. Nein, sie war ganz sicher keine fehlerlose Mutter. Aber sie gab immer ihr Bestes.
Nur war das längst nicht mehr genug.
Ihre Tochter war ihr nicht nur entglitten und über den Kopf gewachsen.
Sie war ihr zur Gefahr geworden.
„Hau ab! Na los! Verschwinde aus meiner Wohnung! Ich will dich hier nie wieder sehen!“
Ihre gestrigen Worte konnte sie sich heute kaum verzeihen. Weil sie Jasmin hart getroffen hatten. Es war schließlich auch ihre Wohnung. Ihr Bad, ihr Klo, ihre Küche. Hier war sie aufgewachsen, hier hatte sie ihr Zimmer, hier konnte sie sich jederzeit etwas aus dem Kühlschrank holen. Ganz abgesehen davon, dass sich Jasmin um ihre Wäsche noch nie selbst gekümmert hatte.
Unmögliche Vorstellung, dass sie auf all diese Annehmlichkeiten ab sofort verzichten sollte. Aber so wie ihre Mutter sie jetzt anfunkelte, außer Atem, wütend, schien sie es richtig ernst zu meinen.
Mit einem Mal wirkte Jasmin ratlos. Vielleicht sogar ein wenig traurig. Was sie weder wahrhaben noch in Worte fassen konnte.
„Ganz wie du willst, du blöde Sau“, zischte sie, rappelte sich hoch, zog den Kopf ein, würdigte Daniela keines Blickes und schlich davon. Wie ein geschlagener Hund.
Seither war sie nicht mehr aufgetaucht. Und hatte sich auch nicht gemeldet. Dabei wusste Jasmin genau, dass ihre Mutter für sie auch während der Arbeit zu erreichen war.
Selbst während des heute so hektischen Krisenmeetings hatte sie ihr Handy nicht aus den Augen gelassen. Von den vielen Nachrichten, die das Display zum Aufleuchten brachten, kam keine einzige von ihrer Tochter.
Während sie jetzt bei eingeschaltetem Fernseher ihre Blusen und Hosen bügelte, hoffte sie inständig, dass Jasmin endlich auf ihre Anrufe reagierte. Sich wenigstens zu einer SMS bequemte. Als sie die Hausarbeit um knapp vor zehn beendete und sich mit einem Glas Wein aufs Sofa setzte, kam immer noch nichts.
Es war völlig egal, was am Bildschirm vor sich ging. Serie, Talkshow, was auch immer. Sie konnte sich ohnehin nicht konzentrieren. Aber die Stimmen taten ihr gut. Die verschiedenen Gesichter. Sie sorgten dafür, dass sie sich nicht allein fühlte.
Das „Ding Dong“ der Türglocke ertönte, als Daniela schon halb eingeschlafen war. Sie schoss hoch, warf beinahe das Weinglas um, hastete zur Tür und fragte sich noch, warum Jasmin nicht selbst öffnete. Sie hatte doch einen Schlüssel.
Aber vielleicht war das ein Zeichen von Respekt.
Vielleicht hatte sie dazugelernt.
Diese Annahme erwies sich als großer und fataler Irrtum.
Das wurde Daniela klar, als sie die Tür öffnete, das metallene Blitzen sah und im nächsten Augenblick spürte, wie etwas Heißes in ihren Bauch eindrang.
Im Zurücktaumeln kam der nächste Stich.
Sie hörte sich selbst schreien.
Merkte, wie die Tür ins Schloss fiel.
Wusste, dass es für sie kein Morgen gab.
2
Chefinspektor Robert Worschädl hatte den Eindruck, dass seine Kollegin Sabine Schinagl den Dienstwagen heute viel ausgeglichener lenkte als in der vorigen Woche. Sie bremste beifahrerfreundlicher und bediente auch das Gaspedal nicht mehr ganz so rabiat.
Demnach musste sich in Schinagls Leben in den vergangenen Tagen etwas Entscheidendes ereignet haben. Die Tiefdruckphase, in die sie durch widrige Umstände geraten war, schien ausgestanden. Der Kork, so vermutete Worschädl, war endlich aus der Flasche.
Der Chefinspektor riskierte einen vorsichtigen Blick zur Seite und fand seine Vermutungen bestätigt: Sie wirkte aufgeräumter und stabiler, hatte sich besser unter Kontrolle und arbeitete ihren Zorn nicht mehr ungefiltert an dem unschuldigen Fahrzeug ab.
Der Wagen hieß auch nicht Michael und hatte mit ihr die letzten vier Jahre weder Wohnung noch Bett geteilt. Genauso wenig hatte er in seinem Tonstudio während des Komponierens eines Werbe-Jingles ein inniges Naheverhältnis zur zuständigen Marketing-Managerin entwickelt. Und er war auch nicht so dämlich, sich eine frivole SMS auf sein offen herumliegendes Handy senden zu lassen.
„Der führt sich auf wie ein vertrottelter Bankräuber, der 200.000 Euro einsackt und auf der Flucht im Foyer seinen Führerschein verliert“, wetterte Schinagl vor drei Wochen, als sie Worschädl in ihre Misere einweihte. „Dieser Arsch ist nicht einmal in der Lage, eine Affäre vor mir geheim zu halten! Zum Kotzen!“
Worschädls Frau Karoline beschrieb dieses Verhalten aus ihrer psychotherapeutischen Perspektive als unbewusste Selbstanzeige: Schau her, ich habe etwas angestellt. Überführe und bestrafe mich, damit ich endlich von meiner Schuld befreit bin. Und dann haben wir uns bitte wieder lieb.
Sollte Michael tatsächlich auf den Fortbestand ihrer Beziehung gehofft haben, wurde das durch Schinagls kompromisslose Entscheidung im Keim erstickt.
Sie wollte keine Erklärung hören und ließ sich auf keine Diskussionen ein, sondern gab Michael exakt einen Tag, um seine Sachen zu packen und zu verschwinden. Wenn er in ihrer Achtung nicht ins Bodenlose fallen wolle, solle er sein leidendes Dackelgehabe samt dem dazugehörigen Gewinsel bleiben lassen und gefälligst die Verantwortung für seinen Fehltritt übernehmen.
„Robert, wie soll ich deine Blicke deuten?“, erkundigte sich Schinagl bei ihrem Kollegen, während sie die Kärntner Straße entlangfuhren.
„Welche Blicke?“
„Irgendwas beschäftigt dich.“
„Nur eine Vermutung.“
„Und die wäre?“
„Er hat gestern endlich seine letzten Sachen abgeholt.“
„Bis auf einen Plastikrasierer. Den habe ich allerdings nicht eingerahmt und auf mein Nachtkästchen gestellt, sondern im Mülleimer entsorgt.“
„Und hat er wenigstens eingesehen, dass er Mist gebaut hat?“
„Er hält meine Reaktion nach wie vor für überzogen. Meine Kinder sehen das leider ähnlich. Aber derart unintelligent hat mich nicht einmal ihr leiblicher Vater beschissen.“
Schinagl bog nach rechts ab und wich damit einem Demonstrationszug gegen den Klimawandel aus, der sich vom Hauptbahnhof mit bunten Transparenten und lautstarken Parolen in Richtung Zentrum bewegte. Von diesen vornehmlich jungen, engagierten Menschen ging einiges an positiver Energie und unbändigem Kampfgeist aus.
„Gefühlt demonstrieren die jetzt schon jede Woche“, beschwerte sie sich.
„Und das zur besten Schulzeit am späten Vormittag. Aber wenigstens sorgen sie dafür, dass in die internationalen Klimakonferenzen endlich ein wenig Bewegung kommt.“
„Bis dahin ziehen sie an den Fridays for Future verlässlich unsere Verkehrspolizisten ab, und wir dürfen den Kleinkram erledigen.“
Mit Kleinkram meinte Schinagl beispielsweise den Anruf einer Pensionistin, die sich Sorgen um ihre Nachbarin machte. Die hatte seit drei Tagen die Morgenzeitung vor ihrer Tür nicht weggenommen, und weder sie noch ihre Tochter hatten auf das Läuten reagiert.
Normalerweise kein Fall für die Einheit Leib und Leben, aber wenn die Kollegen für den möglichst geordneten Ablauf einer Demo sorgen mussten, wurde man schon einmal für harmlose Alltagsvorfälle eingespannt.
Sie fuhren durch eine gediegene Wohngegend. Vier- oder fünfstöckige Wohnhäuser, erbaut Ende der 1990er Jahre. Ansprechende Architektur. Außerdem ausreichend Grünflächen mit Teppichstangen, Holztischen und Bänken zum gemütlichen Zusammensitzen und Plaudern. Dazwischen familienfreundliche, nett gestaltete Spielplätze.
Das Empfangskomitee vor dem Haus mit der Nummer 24 bestand aus einer etwa 65-jährigen, fülligen Frau, die mit kurzen Schritten auf sie zueilte, als sie am Straßenrand parkten und aus dem Auto stiegen.
Nora Kleinfried. Sie hatte das Wachzimmer verständigt, trug für Mitte Oktober eine zu warme Winterjacke und begrüßte sie mit der textintensiv ausgestalteten Feststellung, dass sie die Herrschaften von der Polizei mindestens eine Viertelstunde früher erwartet habe. Im nächsten Wortschwall stellte sie klar, dass sie weder übertrieben ängstlich noch hysterisch sei, sondern einer der wenigen Menschen, die in diesem von Egoisten bevölkerten Land noch bereit wären, Verantwortung zu übernehmen.
Als sie ihre nächste Verbalattacke damit begann, dem Chefinspektor und der Bezirksinspektorin in rasantem Tempo zu erklären, was jetzt am besten zu tun sei, ergriff Worschädl das Wort.
„Frau Kleinfried, bis jetzt haben Sie alles gut gemacht, aber …“
„Moment, ich war noch nicht fertig, also noch einmal von vorn.“
„Sie haben alles gut gemacht, aber jetzt …“
„Hallo, Sie wissen doch noch gar nicht alles! Lassen Sie mich erklären …“
„Nein, bitte, halt!“ Worschädl hob beide Hände und hoffte inständig, dass er damit den Redefluss von Frau Kleinfried unterbrechen würde.
Fehlanzeige.
„Wie bitte? Höre ich richtig? Sie wollen der ehemaligen, sehr erfolgreichen Filialleiterin eines Lebensmittelgroßmarkts einfach so das Wort verbieten?“
„Um Himmels willen, nein. Gratulation. Sie sind auch verbal eine Kanone.“
„Das klingt nicht nach einem Kompliment. Ich quatsche Ihnen wohl zu viel.“
Schinagl registrierte Worschädls Hilfe suchenden Blick und schaltete sich ein: „Mein Kollege leidet unter begrenztem Aufnahmevermögen.“
„Mein Gott, ist das Ihr Ernst?“ Nora Kleinfried wirkte ehrlich besorgt.
„Leider. Er braucht kleine Redeportionen, damit er Ihnen folgen kann.“
„Und ich dachte schon, es liegt an mir. Dann muss ich mich also kürzer fassen.“
Während sich Worschädl ein Grinsen kaum verkneifen konnte, degradierte ihn Kleinfrieds mütterlich-besorgter Blick zum entwicklungsverzögerten Sonderschüler. Er nutzte ihr betroffenes Innehalten und ergriff rasch das Wort: „Sie haben einen Schlüssel für die Wohnung?“
„Wie das bei guten Nachbarn eben üblich ist.“ Frau Kleinfried reichte Worschädl einen Schlüssel, an dem ein blauer Wollfaden befestigt war, und betrat vor ihnen das Haus. Sie passierten die Postfächer und nahmen statt des Aufzugs die Treppe, die rechter Hand nach oben führte.
Im ersten Stock wandte sich Kleinfried nach links und führte sie durch einen hellen, freundlichen Gang bis zur dritten Tür links. Sie war nicht abgesperrt, sondern nur ins Schloss gezogen, ließ sich also mit einem einfachen Schnappen öffnen.
Schon beim ersten Blick in den Vorraum flog Worschädls Hand zum Schulterholster. Mit dem Beseitigen von Spuren hatte man sich hier nicht aufgehalten.
Der große Blutfleck an der vormals weißen Wand in unmittelbarer Nähe der Eingangstür ließ auf eine gewalttätige Auseinandersetzung schließen. Aus den roten Spritzern neben der Garderobe, dem Schuhschrank und einer Kommode schloss der Chefinspektor, dass jemand mit gezielter, roher Brutalität vorgegangen war.
Hinter Worschädl griff auch Schinagl nach ihrer Waffe und machte der ehemaligen Filialleiterin mit einer Geste klar, dass sie Abstand halten und die Wohnung keinesfalls betreten sollte. Dafür erntete sie keinen Widerspruch, sondern zustimmendes Nicken. Angesichts der blutigen Spuren blieb Frau Kleinfried gerne auf dem Gang zurück.
Schinagl zog die Tür hinter sich zu und folgte ihrem Kollegen, der mit der Pistole im Anschlag die angrenzenden Räume sicherte: Schlafzimmer, Bad, Toilette, ein Jugendzimmer.
„Kein Mensch da, wir sind allein“, sagte Worschädl, als er das Wohn-Esszimmer mit angrenzender kleiner Küche betrat.
Hier war die Situation eskaliert.
Hier sah es nach Schlachtbank aus.
Dem Täter war es offenbar egal gewesen, dass sich das Blut auf dem hellen Parkettboden, den Stühlen rund um den Esstisch und auf dem Gläserschrank verteilte.
„Verdammte Scheiße“, stöhnte Worschädl.
„Sieht nach einem Gemetzel aus.“ Schinagl kämpfte gegen das Versagen ihrer Stimme. „Jedenfalls hatte der Täter nicht vor, seine Tat groß zu verbergen.“
„Wirkt eher wie das Gegenteil“, murmelte Worschädl. „Als ob wir sofort erkennen sollten, dass etwas Schreckliches vorgefallen ist.“
„Also ein Verbrechen mit einer Botschaft?“
„Kann sein“, antwortete Worschädl und hielt sich selbst davon ab, voreilige Schlüsse zu ziehen.
Fest stand nur, dass es hier zu einer entsetzlichen Bluttat gekommen war.
Außerdem war erwiesen, dass etwas Entscheidendes nicht stimmte.
Vom Opfer fehlte jede Spur.
3
Er betrachtete sich als unbedeutendes Etwas im All. Als galaktischen Vogelschiss. Von einem Stern aus gesehen, der Abermillionen Lichtjahre entfernt im Weltraum seine Kreise zog, war er ein Nichts.
In Wahrheit war er jedoch mehr.
Weil mit Gefühlen ausgestattet.
Und mit Bedürfnissen.
Zum Beispiel nach Zugehörigkeit.
Zu einer Gruppe, einem System.
Auch ein Stern wie der Chi Cygni stand 600 Lichtjahre entfernt nicht nur für sich selbst, sondern war Teil gleich mehrerer Formationen. Er gehörte zum Sternbild des Schwans, wurde zugleich dem Sternentyp Mira zugerechnet und reihte sich darüber hinaus in die Galaxie der Milchstraße ein. Exakt dort besetzte auch ein Planet namens Erde unter Milliarden von anderen Sternen ein winziges Plätzchen.
Dieser Umstand bedeutete nichts weniger als die ständig vorhandene Verbindung selbst des bedeutungslosesten Erdenmenschen mit dem gesamten Universum. Wer, egal ob am Tag oder bei Nacht, hinauf zum Himmel blickte, durch die Wolken, an der Sonne vorbei und hinaus in den unvorstellbar weiten Raum, kam nicht umhin, einem Zitat zuzustimmen, das er irgendwann aufgeschnappt hatte: „Es gibt (da oben und darüber hinaus) keine Stelle, die dich nicht sieht.“
Es gibt uns nicht allein für uns. Die Vorstellung eines Daseins diesseits des eigenen Tellerrands ist eine trügerische. Wir sind immer Teil des Ganzen. Das Ganze ist immer Teil von uns.
Wobei die galaktische Verbundenheit den Mangel an irdischer nicht ausgleicht. Die eine blieb immer abstrakt, während die andere praktisch und handfest erfahrbar gewesen wäre.
Wäre.
Möglichkeitsform.
Aber was nicht war, konnte noch werden.
Die Erfahrung lehrte, dass es sich nicht erzwingen ließ. Doch zumindest hatte er den Mut gefasst, sein Dilemma zu benennen.
Mit aller Deutlichkeit.
Seine Einsamkeit.
Seine Verlorenheit.
Andere hätten ihn vielleicht als in sich gekehrt und grüblerisch bezeichnet. Er selbst beschrieb sich als Suchenden.
Als nach Verbindungen Suchenden.
Natürlich gab es auch Erfolge. Oberflächliche Bekanntschaften. Kleine Begegnungen mit Kollegen. Kurzfristige Mitgliedschaften bei dem einen oder anderen Verein. Hoffnungslose Versuche, die letzten Endes zu nichts führten. Die Erfahrung tiefer, langanhaltender Beziehungen war ihm bis heute versagt geblieben.
Er nahm sein Poloshirt aus der Waschmaschine und hielt es gegen das Licht.
Großartig.
Alles sauber.
Alles in Ordnung.
Alles wieder an seinem Platz.
Aber seine Mission war noch lange nicht zu Ende.
4
„Wann haben wir Sie angestellt? Hallo! Ich habe Sie was gefragt, Herr Klammer!“
„Sie wissen das so gut wie ich!“
„Ich will es aber von Ihnen hören!“
„Vor eineinhalb Monaten! Zufrieden?“
„Es sind zwei! Zwei komplette Monate, Herr Klammer! Und welche lächerliche Kopfquote hatten wir für diese Zeit vereinbart?“
„Kopfquote! Wie das schon klingt!“
„Wir sind hier nicht auf dem Kinderspielplatz! Also, alter Mann!“
Klammer hasste diese feiste Pappalatur. Das arrogante Grinsen. Dieses Arschgesicht.
Noch vor vier Monaten hätte Paul Klammer diesen höchstens 160 Zentimeter großen, plumpen, vielleicht 30-jährigen Rotzlöffel keines Blickes gewürdigt. Geschweige denn auch nur ein Wort mit ihm gesprochen. Inzwischen war er von ihm abhängig und musste sich seine Demütigungen gefallen lassen.
Wenn du ihm mit gestrecktem Bein quer über den Tisch ins Gesicht springst, streichen sie dir die Notstandshilfe, dachte Klammer und verordnete sich absolute Selbstbeherrschung.
„Sieben Schwarzfahrer pro Tag.“
„Oh, er kann sprechen. Gleich noch einmal! Lauter, Klammer!“
„Kopfquote sieben pro Tag!“
„Bravo! Richtig! Sieben! Und nicht einen, zwei oder manchmal sogar keinen einzigen!“
„Wie wäre es mit etwas mehr Toleranz für einen Quereinsteiger?“
„Wie bitte? Quereinsteiger? Nein, mein Freund. Totalversager! Ihre Quote ist unter jeder Sau!“ Der kleine Dicke sprang auf und ruderte mit seinen Armen.
„Als Sommertourist mit der Bim durch die Gegend fahren, das kann wirklich jeder Trottel. Aber glauben Sie, dafür schiebe ich Ihnen monatlich ein sattes Gehalt über den Tisch?“
„Ich werde mich steigern, garantiert.“
„Das versprechen Sie mir mindestens zum zehnten Mal! Wir sind kein Freizeitclub für sozialromantische Träumer und abgehalfterte Burnoutler! Nein! Ich brauche gierige Wölfe, die sich leise anschleichen, im richtigen Moment zuschnappen und die Zähne ins Fleisch ihrer Opfer graben!“
Genau diesen verheerenden Satz müsste man zitieren. „Gierige Wölfe“ – das wäre die passende Überschrift für einen knallharten Artikel über diesen despotischen Wicht und den Quotenwahnsinn seiner privaten Sicherheitsfirma, sagte sich Klammer.
Aber es gab im Moment österreichweit keine Redaktion, die einen Text von ihm angenommen und veröffentlicht hätte. Er war zur Persona non grata geworden und musste sich nun als Quereinsteiger in einer für ihn völlig ungeeigneten Tätigkeit versuchen.
Du musst Arbeitswilligkeit demonstrieren, bläute sich Klammer ein, damit die Behörden mit dir zufrieden sind und das Arbeitslosengeld pünktlich überwiesen wird. Er versuchte es mit einer halbherzigen Entschuldigung.
„Das mit dem Zubeißen habe ich schon verstanden. Nur muss ich das erst entwickeln.“
Herablassendes, selbstgefälliges Lächeln seines Gegenübers: „Wie lange dauert Ihre Probezeit? Noch einen Monat! Ich sage Ihnen was: Aus heutiger Sicht haben wir für Ihren verwöhnten, eingeschlafenen Journalistenhintern keinen dauerhaften Platz bei uns. Einzige Chance: Sie verändern ab sofort Ihr Jagdverhalten und schlagen weitaus öfter zu.“
Genau das wird nicht passieren, dachte Paul Klammer eine halbe Stunde später, während er in seiner alten Klapperkiste den Römerbergtunnel durchquerte.
47 Jahre muss man werden, um sich so erniedrigen zu lassen, fluchte er, nahm die nächste Ampel bei Gelb und reihte sich einige Minuten später in den Nachmittagsverkehr auf der Stadtautobahn ein.
Noch vor nicht allzu langer Zeit als investigativer Aufdecker von korrupten politischen Machenschaften gefeiert, war er jetzt auf diese militaristische Türstehervisage angewiesen, um seinen Kopf über Wasser zu halten.
Er hatte sich zu lange in Sicherheit gewiegt.
Die Zeichen der Zeit zu spät erkannt.
Nicht rechtzeitig begriffen, dass die vehementen politischen Machtverschiebungen im Land auch ihn persönlich treffen und aus dem beruflichen Sattel hieven konnten.
Neue Abhängigkeiten, neue Spielregeln.
Wer das Geld hat, hat das Sagen.
Kurz nach Erstarken der politischen Rechten bei den letzten Wahlen und der darauffolgenden Regierungsbildung wurde erstmals öffentlich an seinem Ast gesägt. Was ihn dazu veranlasste, den Stil der neuen Regierung umso schärfer zu kritisieren.
Plötzlich, ohne vorherige Ankündigung, kam eine Mail: Aus Kostengründen müssen wir Sie leider bla, bla, bla. Fünf Monate später war er entsorgt.
Interessant, dass danach kein anderes Medium im Land bereit war, ihm einen Job zu geben. Fühlte sich an wie eine flächendeckende Order von oben. Leider war das keine Ausnahme, sondern reihte sich in die grimmigen Veränderungen ein, die immer häufiger zu werden schienen: Äußerte man Kritik an den neuen Machthabern, egal ob mündlich oder schriftlich, musste man mit Konsequenzen rechnen.
So wurde aus einem vormals anerkannten, kritischen Journalisten, der nichts so sehr hasste wie übermäßige Kontrolle, ein Fahrscheinkontrolleur beziehungsweise Fahrausweisprüfer in den städtischen Straßenbahnen.
Aber von dem lächerlichen Lohn kann ich mir wenigstens meine neu bezogene Garçonnière hier draußen am Stadtrand leisten, dachte Paul und schweifte gedanklich zu seiner früheren Prachtwohnung inmitten der Linzer Altstadt am Fuß des Schlossbergs ab.
Zu den dunklen Parkettböden, dem großzügigen Arbeitszimmer mit seinem überdimensionierten Bücherregal und all den wunderbaren Vorzügen, die er aufgeben musste, weil er sich diesen Single-Luxus nicht mehr leisten konnte.
Er konnte es sich jedoch auch nicht leisten, zu sehr seiner Vergangenheit nachzuweinen. Zweifellos wäre es besser gewesen, genauer auf die Straße und die an und für sich leere Kreuzung zu achten, die er gerade überqueren wollte.
Dabei fuhr er nicht übermäßig schnell.
Auf alle Fälle im Rahmen der vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzung.
Aber mit der plötzlich auftauchenden Frau und dem blauen Kinderwagen hatte er nun wirklich nicht gerechnet.
5
Daniela Pammingers Wohnung wirkte bis auf das chaotische Jugendzimmer äußerst ordentlich. Nichts deutete auf einen Lebenswandel hin, der nicht zu meistern gewesen wäre oder gar aus den Fugen geraten war.
Sowohl im Wohnzimmer mit graublauer Sitzgarnitur, mittelgroßem Flachbildschirm und einem Schreibtisch mit Bücherregal als auch in der hellgrau furnierten Küche mit einem kompakten Esstisch und vier Stühlen war alles sauber und aufgeräumt. Abgesehen von ihrer Tochter schien die Frau ihr Leben gut im Griff zu haben.
„Bei mir sieht es oft schlimmer aus“, meinte Schinagl, während sie das Bad inspizierte. Der dreiteilige Spiegelschrank war zum Großteil mit Damenutensilien belegt, während eine kleinere Abteilung einer jüngeren Frau zuzuordnen war: falsche Wimpern, farbige Haarsprays, Billig-Schminke.
„Könnte ihrem Früchtchen gehören.“ Schinagl blickte zu Worschädl, der sich mit den Blutspuren auf den Armaturen des Waschbeckens und an den Wänden und dem Boden der Badewanne beschäftigte.
„Dabei lassen die Bilder und Symbole in ihrem Zimmer nicht auf eine pubertäre Jugendliche schließen“, brummte Worschädl.
„Stimmt. Der Doppelachter für Heil Hitler. Mehrfach das Hakenkreuz, ein Schlagring, blau-gelber Fan-Schal …“
„Ein weiblicher Hooligan mit ausgeprägten rechtsextremen Ambitionen“, fasste Worschädl zusammen.
„Die Leuten die Fresse einschlagen und im Jähzorn auch einmal ein Messer ziehen kann.“
„Davon gehen wir aus. Aber das Blut hier, Sabine, das könnte auch ihres sein“, sagte Worschädl, hörte es läuten und ging zur Tür.
Der Kollege von der Spurensicherung, Mitte 30, dicke Brille, Mundwinkel mit der Tendenz nach unten. Lebte offensichtlich in einem Haushalt ohne Kamm und wirkte nicht gerade übermotiviert.
„Guten Morgen. Du hast schon gefrühstückt?“, fragte Worschädl.
„Nur eine Semmel mit Extrawurst, Käse und Tomaten.“
„Und Kaffee?“
„Leider nein. Meine Pads waren aus.“
„Vorsicht. Das da drin wird dir auf den Magen schlagen. Falls du einen Laptop, ein Tablet oder Handy entdecken solltest, möchten wir sofort verständigt werden.“
„In Ordnung.“
„Außerdem vermissen wir die Wohnungsschlüssel.“
„Ich schau mich um. Und wo erwische ich euch?“
„In der Wohnung gegenüber“, antwortete Schinagl, die hinter Worschädl auftauchte. „Wir müssen uns mit der Nachbarin unterhalten.“
„Alles klar“, bestätigte der Spurensicherer erneut, schlurfte bedächtig in die Wohnung und machte sich an die Arbeit.
Eigentlich hätten die Ermittler erwartet, dass Nora Kleinfried auf dem Gang die Stellung halten würde. Doch vermutlich hatte sie sich in ihre schützenden vier Wände zurückgezogen und beobachtete die Vorgänge durch ihren kleinen Türspion.
Die Tür öffnete sie jedenfalls unmittelbar beim Ertönen der Türklingel. Die ehemalige Filialleiterin aktivierte ihren Redefluss, noch bevor Worschädl seinen Fuß über die Schwelle schieben konnte.
Sie beschrieb den Zustand ihrer Wohnung. Erklärte in hastigen Haupt- und Nebensätzen, warum im Vorraum zwischen unzähligen Schachteln und Kisten nur ein äußerst schmaler Gang für das Vorwärtskommen blieb.
Vorrat, Lagerbestand, Erinnerungsstücke.
Mit diesen und ähnlichen Wörtern erläuterte sie ihre beeindruckend umfassende Sammlung an unzähligen winzigen, kleinen und größeren Dingen, die in einem für Außenstehende undurchschaubaren Ordnungssystem bis an die Decke gestapelt waren: Türme aus leeren Joghurtbechern, hunderte Klopapierrollen, Unmengen an Klarsichthüllen und Klemmordnern und zahlloser anderer Krimskrams.
„Zu den Aufgaben einer Filialleiterin gehören auch buchhalterische und personelle Angelegenheiten. Aber das Allerliebste war mir schon immer die penible Regalbetreuung. Der Überblick über das gesamte Sortiment. Die vorausschauende Planung des Abgangs und des Nachschubs. Diese Vorliebe habe ich mir in den Ruhestand mitgenommen. Ich kann Ihnen garantieren, dass Sie in meiner ganzen Wohnung keinen einzigen abgelaufenen Artikel finden. Ich habe das hier voll im Griff.“
Frau Kleinfried hatte in ihrem Wohnzimmer derart viele Packungen an Teigwaren und Sugogläsern gestapelt, dass sie neben dem ebenfalls vorhandenen, immensen Angebot an Vollkorn-, Risotto-, Rundkorn- und Basmatireis niemals an Hunger sterben würde. Ihre Bestände belegten allerdings auch sämtliche vorhandenen Sitzgelegenheiten.
„Tut mir leid, aber man muss Prioritäten setzen. Wir müssen Ihre Fragen also im Stehen besprechen.“
„Kein Problem“, sagte Schinagl.
„Kann nicht schaden, sich möglichst raumsparend auszutauschen“, ergänzte Worschädl.
„Sie müssen hier ja ständig am Ordnen und Sortieren sein“, stellte Schinagl fest.
„Eigentlich ununterbrochen. Und wenn ich Gesellschaft brauche, gehe ich raus auf den Gang oder stelle mich vors Haus.“
„Dann wissen Sie über die Vorgänge im Haus wahrscheinlich gut Bescheid.“
„Sogar sehr gut, junge Frau. Insgesamt hatten wir es immer friedlich hier. Ja, hin und wieder gab es Spannungen, aber im Großen und Ganzen sind wir gut miteinander ausgekommen … bis jetzt. Drüben bei den Pammingers, was ist da vorgefallen?“
„Das wissen wir noch nicht genau“, antwortete Worschädl.
„Aber zweifellos ist Blut geflossen“, meinte Schinagl.
„Um Himmels willen! Fehlt nur noch, dass ich mich hier nicht mehr sicher fühlen kann.“
„Wann haben Sie Ihre Nachbarin zuletzt gesehen?“
„Am Freitag um 15 Uhr 45.“
„Das wissen Sie so genau?“
„Selbstverständlich. Eine Filialleiterin muss immer alles im Auge haben.“
„Und seither hatten Sie keinen Kontakt mit ihr?“, hakte Worschädl nach.
„Nur akustisch. Noch am selben Nachmittag hatte sie einen lautstarken Streit mit ihrer Tochter. Dieser Fratz knallte um exakt 18 Uhr 49 die Tür hinter sich zu und rauschte eine Minute später auf dem Moped davon.“
„Die von Ihnen angegebenen Zeiten …?“
„Stimmen auf die Minute! Ich mache mir meine Notizen. Wer wann geht und wiederkommt und wer zu ungewöhnlichen Zeiten das Haus verlässt beziehungsweise betritt.“
„Dann wissen Sie sicher auch, ob Frau Pamminger in dieser Firma gearbeitet hat“, sagte Worschädl und zeigte Frau Kleinfried Unterlagen, die sie auf dem Schreibtisch in der Nachbarwohnung gefunden hatten.
„Bei Net Security Solution? Ja. Ein sagenhaft stressiger Job. Internet und dieses Zeug. Die trägt Unmengen an Daten im Kopf herum. Muss sich irrsinnig viel merken. Hat nie normale Arbeitszeiten. Und das als ewige Alleinerzieherin. Ich habe keine Ahnung, wie sie das aushält.“
„Achtung, kleine Redeportionen“, flüsterte Schinagl verschwörerisch.
„Entschuldigung.“ Verständnisvoller Blick in Richtung Worschädl. „Kurz zusammengefasst ist sie in der Früh um sechs raus und meistens am Abend nach Hause gekommen.“
„Und wie verträgt sich das mit der jungen Frau, die mit ihr zusammenwohnt?“, fragte Schinagl.
„Mit ihrer Tochter Jasmin? Eigentlich gar nicht. Was sich längst bemerkbar macht.“
„Inwiefern?“
„Sie hat dieses Biest nicht mehr im Griff. Schulabbrecherin. Ruppig, grob. Wenn sie trinkt, geht sie sogar handgreiflich auf ihre Mutter los.“
„Sie meinen, dass sie ihre Mutter auch körperlich attackiert?“, fragte Worschädl.
„Ja, natürlich, sie schlägt zu. Das ist bis auf den Gang zu hören. Ich trommle immer fest gegen die Tür, dann hört sie auf. Ruhe gebe ich erst, wenn ihre Mutter nicht mehr schreit.“
„War sie schon immer so aggressiv?“
„Mit der Pubertät hat sich das zugespitzt. Sie muss Tabletten nehmen. Wegen psychischer Probleme.“
„Risperidon?“, fragte Schinagl und hielt die fast volle Medikamentenpackung in die Höhe, die in Jasmins Zimmer unter dem Bett gelegen hatte.
„Kann sein. Frau Pamminger hat Jasmins Verhalten damit entschuldigt, dass sie das Medikament nicht regelmäßig nimmt und deshalb immer wieder durchdreht.“
„Na toll“, seufzte Schinagl. „Und ihr Vater, spielt der auch irgendeine Rolle?“
„Falls ja, dann nicht in dieser Wohnung oder hier im Haus. Ich habe Frau Pamminger einmal darauf angesprochen, aber sie ist nicht darauf eingegangen. Jasmin hat einmal behauptet, dass sie dieses – ich zitiere – ‚verfickte Arschloch‘ noch kein einziges Mal gesehen hat.“
„Frau Kleinfried, ist Ihnen in den letzten Tagen sonst irgendetwas ungewöhnlich vorgekommen?“
„Nur die Zeitungen vor der Tür von Frau Pamminger.“
„Na gut, dann vielen Dank. Wir melden uns“, beendete Schinagl das Gespräch, schlängelte sich mit ihrem Kollegen durch das Schachteldickicht aus der Wohnung und wartete, bis die Tür hinter ihnen ins Schloss fiel.
„Robert“, begann sie leise, „falls ich jemals Messie-Tendenzen zeige, sag es mir. Möglichst hart und gnadenlos.“
„Einverstanden“, antwortete Worschädl. „Aber vorher machen wir uns bei dem verschlafenen Kollegen von der Spusi schlau.“
„Und schreiben sowohl Jasmin Pamminger als auch ihre Mutter zur Fahndung aus. Europaweit. Es könnte rechtsextreme Zusammenhänge geben.“
6
Paul Klammer reagierte viel zu spät.
Im allerletzten Augenblick.
Die Frau, die plötzlich in seinem rechten Augenwinkel aufgetaucht war, drehte den Kopf zur Seite, nahm ihn mit entsetzten Augen wahr, riss den Kinderwagen zurück.
Im selben Augenblick entschied Paul Klammer, dass es nur eine Chance gab. Winzig klein und zugleich völlig absurd: Er durfte nicht bremsen, weil er den Kinderwagen mitsamt der Mutter dann unweigerlich rammen würde.
Er wirbelte das Lenkrad nach rechts.
Schaffte es, den verdammten Wagen um den Hauch von Millimetern am Kinderwagen vorbeizutreiben.
Das Auto geriet auf die andere Straßenseite.
Krachte im Herumschleudern gegen einen Hydranten.
Kam zum Stehen.
Sekundenlanges Innehalten. Auf Pauls Haut bildeten sich Bäche von Schweiß. Herzstillstand. Wahrscheinlich stand er knapp davor. Drei Atemzüge, bis er aus dem Auto sprang und zu der jungen Mutter eilte.
Sie war im Rückwärtsspringen über den Randstein gestürzt, rappelte sich mit zerrissenen Ärmeln auf, weinte, wischte sich den Rotz von der Nase, stand geschockt vor ihm und schrie ihn an.
Ob er wahnsinnig oder einfach nur betrunken sei. So kranke Idioten wie ihn dürfe man gar nicht erst ans Steuer lassen.
Ihr Sohn, schrie sie, sei ganze drei Monate alt. Hätte sie nicht so geistesgegenwärtig reagiert, wäre ihr Kleiner jetzt tot und sie womöglich schwer verletzt. Wegen eines geisteskranken Arschlochs, das nicht zwischen Rot und Grün unterscheiden könne.
„Es tut mir unendlich leid. Aber bei mir war grün“, stammelte Paul. „Hundertprozentig. Ich bin bei Grün in die Kreuzung gefahren.“
Dieser Versuch einer Rechtfertigung brachte sie nur noch mehr in Rage. Wenn er jetzt noch so oft behaupte, dass er die Kreuzung bei Grün überquert hätte, könne das unmöglich stimmen, weil sie auf dem Gehsteig geduldig auf das Umschalten der Ampel gewartet und den Zebrastreifen selbstverständlich erst bei Grün betreten habe. Wenn er unbedingt wolle, könne sie ihn gerne anzeigen, und dann könne er sein wahnwitziges Verhalten einem Richter erklären.
Allerdings habe sie nicht die geringste Lust, auch nur eine Minute länger mit so einem uneinsichtigen Trottel zu verschwenden. Sprach es, drehte sich samt Kinderwagen und Baby um und ließ Paul stehen.
Fast ein Wunder, dass in der Zwischenzeit kein einziges weiteres Auto in die Kreuzung eingefahren war. Aber einige Passanten hatten sich inzwischen versammelt und betrachteten Paul Klammer wie ein unansehnliches, widerliches Tier.
Er selbst schleppte sich mit schweren Beinen zu seinem Auto, betrachtete den Blechschaden, schätzte ihn auf 3.000 Euro, fand den Kratzer am Hydranten vernachlässigbar, stieg in den Wagen, fuhr los.
Zwei Straßen weiter hielt er an, zog den Flachmann aus der Jackentasche und nahm einen kräftigen Zug. Nur zur Beruhigung.
Er zitterte am ganzen Körper.
Beinahe hätte er ein Kind getötet.
Vielleicht auch dessen Mutter.
Grauenhaft.
Aber die Ampel hat Grün gezeigt. Woran auch immer ich in diesem Moment gedacht habe, ich bin tausendprozentig bei Grün in die Kreuzung gefahren.
Zugleich glaubte er der jungen Frau jedes Wort. Welche Mutter schiebt ihr Kind schon bei Rot über die Straße? Undenkbar. Völlig ausgeschlossen.
Das hieß, dass er sich irren musste. Sich selbst nicht mehr trauen konnte. Kaputter Job, kaputtes Hirn, sagte sich Paul, nahm noch einen Schluck und erschrak dabei über sich selbst.
Weil in ihm wieder diese Frage hochkroch.
Wie weit es noch nach unten ging.
Was ihm noch alles misslingen würde.
Welchen Sinn sein Leben denn noch hatte.
7
Bettina Aigner und kleine Kinder, das hatte sich noch nie vertragen. Nämlich beruflich. Da konnte sie von Ängsten überfallen werden, die sie für Sekunden in einen Zustand absoluter Hilflosigkeit versetzten. Ihre Stimme versagte, ihr Puls fuhr hoch und im selben Moment spürte sie die Hitze im Gesicht. Rote Flecken. Ultrapeinlich.
Aber ich kann es beherrschen, dachte sie, als sie nach dem Fahrradhelm griff, ihren Spind versperrte und den Umkleideraum verließ.
Am Anfang kam immer diese Welle tiefen Mitgefühls. Zum Beispiel heute früh, als ein neuer Mitarbeiter des Bring- und Holdienstes die erste Patientin in den OP geschoben hatte. Der Anblick des entzückenden, erst 18 Monate alten Mädchens brachte sie sofort ins Wanken.
Eine kleine Lea.
Sie sah so armselig und bedürftig aus.
Bettina schloss sie sofort ins Herz.
Wieso musste so ein winziges Mäuschen aufgeschnitten und an seinem Herzen herumgedoktert werden?
Warum konnte Leas Körper in diesem unschuldigen Alter nicht so einwandfrei funktionieren, dass man der Kleinen keine Schmerzen zuzufügen brauchte?
Am liebsten hätte sie die Instrumente weggepackt und wäre mit dem Mädchen hochgefahren, sagte sich Bettina, als sie vor dem Krankenhaus auf ihr Rad stieg und sich kurze Zeit später auf einem der Linzer Radwege in Richtung Keferfeld bewegte.
Ihren Impulsen im OP hatte sie natürlich in keiner Weise nachgegeben. Stattdessen senkte sie den Blick, schluckte, beruhigte ihren Atem und erinnerte sich an ihre Funktion und Rolle. An ihre Aufgaben. Als Teamleiterin des OP-Bereiches 2 hatte sie hundertprozentig zu funktionieren.
Selbststeuerung und Selbstanleitung. Klappte innerhalb weniger Augenblicke. Und war gerade dann unabdingbar, wenn einer wie Udo Rochanski operierte.
Fachlich fantastisch und hochpräzise, menschlich spröde und distanziert.
Bettina ließ sich davon nicht beirren, sondern zog umso freundlicher und zuvorkommender ins Feld. Mit ausreichender Beharrlichkeit ließ sich auch ein Klotz wie Rochanski um den Finger wickeln.
„Guten Morgen, Herr Oberarzt. Wunderbar, dass wir wieder mit Ihnen operieren dürfen.“ (Umwicklung 1)
„Wissen Sie, was ich an unserem OP-Team so schätze? Den herzlichen Umgangston. Jeder ist einmal schlecht drauf, aber wenn sich alle bemühen, geht uns alles gleich viel leichter von der Hand.“ (Umwicklung 2)
„Je spannungsfreier und konstruktiver die Stimmung im OP, desto besser für unsere junge Patientin.“ (Umwicklung 3)
Umwicklungsspezialistin. Diesen Titel hätte man der Diplomkrankenschwester Bettina Aigner ohne Weiteres verleihen können. Sie wollte sich die vielen Stunden an ihrem Arbeitsplatz nicht durch ein mieses Klima vermiesen lassen. Wer ständig mit Krankheit und Leiden zu tun hat, braucht als Ausgleich eine wenig belastete, wohltuende Atmosphäre.
Deshalb nahm Bettina nicht nur auf ihre eigene Stimmung Einfluss, sondern versuchte es auch bei anderen.
Zum Beispiel heute früh.
Als sie Rochanski den Thorax-Spreizer reichte, würdigte er sie immerhin eines schnellen, gar nicht so unfreundlichen Blickes. Außerdem informierte er sie darüber, dass aufgrund einer bereits vorangegangenen Herzoperation mit ausgeprägten Verwachsungen zu rechnen war. Und als er die Blutgefäße rund um den Herzbeutel untersuchte und stärkere Vernarbungen entdeckte, war ihm offenbar nach Kooperation zumute: „Die müssen wir vorsichtig lösen.“
Rochanski und die Wir-Form. Ein so seltenes Ereignis, dass sich alle Augen des siebenköpfigen Teams für einen Moment erstaunt auf den fest gebauten, 1,80 Meter großen Oberarzt richteten, auf dessen vollkommen kahlem Haupt sich Schweißtropfen bildeten.
„Wir dürfen kein Blutgefäß verletzen. Deshalb volle Konzentration.“ Jetzt blickte Rochanski in die Runde. „Alles klar?“
Verblüfftes Nicken rundherum. Der sonst so arrogant wirkende Mediziner hatte offenbar erkannt, dass es da ein Team gab, mit dem man kommunizieren konnte.
„Alles klar“, bestätigte Bettina rasch und übergab ihm eine Pinzette. Rochanski schenkte ihr ein kleines Lächeln und machte sich ans Werk.
Seine Hände zitterten kein bisschen, ihm unterlief nicht der geringste Fehler. Schließlich bat er Bettina, die Herz-Lungen-Maschine einzuschalten, welche nach und nach Leas Kreislauf übernehmen sollte. Nach insgesamt fünf Stunden hatte er dem Mädchen erfolgreich einen neuen Shunt gesetzt, veranlasste die Verlegung auf die Intensivstation und bedankte sich bei Bettina und dem gesamten Team ausdrücklich für die angenehme Zusammenarbeit.
„Großartige Leistung“, gab Bettina zurück, drückte Rochanski die Hand und meinte es ernst. Der Oberarzt hatte erste Schritte in Richtung eines echten Teamplayers gemacht. Aber vor allem hatte er mit seiner ärztlichen Kunst das Leben eines kleinen Mädchens gerettet.
Bettina bat den Bettenfahrer, Lea ganz vorsichtig zu transportieren. Als sich die Lifttür hinter ihnen schloss, wischte sie sich über die Augen.