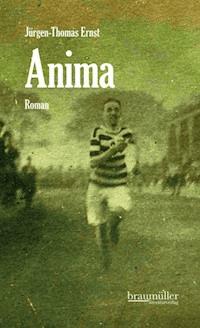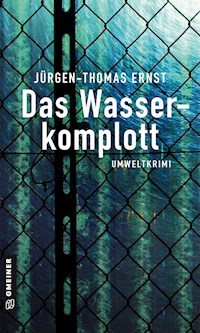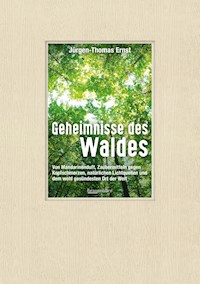16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Sehnsucht ist uns allen gemein. Dass es einen Menschen gibt, den wir lieben und der uns liebt, von dem wir uns verstanden fühlen und den wir verstehen. Manche suchen diesen Menschen ihr ganzes Leben lang. Und finden ihn nicht. Aber es gibt sie, die Menschen, die einander finden. Schweben ist die Geschichte von Rosa und Josef, die in den 1960er-Jahren im Osten aufbrechen, um im Westen ihr Glück zu finden. Sie sind Kinder des Krieges. Genügsam und voller Hoffnung. Sie finden ihr bescheidenes Glück, das jedoch nur von kurzer Dauer ist. Josef bleibt allein zurück. Seine Geschichte zeigt, dass es selbst aus großer Verzweiflung und Trauer einen Weg gibt. Sie zeigt, wie das Pendel des Schicksals zurückschwingt ins Normale. Schweben ist eine Geschichte der Genügsamkeit und des kleinen Glücks, das zum großen wird. Wer es findet, hat letztlich alles gefunden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jürgen-Thomas Ernst
Schweben
Roman
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
1. Auflage 2017
© 2017 by Braumüller GmbH
Servitengasse 5, A-1090 Wien
www.braumueller.at
Coverfoto: © iStock (thawats)
ISBN Printausgabe: 978-3-99200-189-7
ISBN E-Book: 978-3-99200-190-3
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Epilog
Prolog
Eines ist gewiss. Einmal wird die Sonne untergehen, abends um acht werden die Nachrichten gesendet und später wird das Wetter für den folgenden Tag angekündigt. All das wird geschehen, aber du wirst nicht mehr da sein.
1
Mit fünf Jahren saß Josef unter einem Tisch und sah Stühle und Knie, auch den blauen langen Rock der Mutter und ihre Hände, die darauf ruhten und doch nicht ruhten. Das Zittern wollte nicht zu ihren Worten passen. Von der Aussaat sprach sie und von der letzten Ernte. Und jemand anderer erzählte von einer Katastrophe aus früheren Tagen. Obwohl er diese Geschichte zum ungezählten Male wiederholte, taten sie so, als hätten sie nie davon gehört.
„Diese große Stille“, flüsterte er, „bevor der Wind beginnt, das Rauschen der Blätter in den Baumkronen und die Halme auf den Feldern, die aussehen wie große Meere. Der Sturm, der aufzieht und Äste knickt wie Streichhölzer. Danach sieht es aus, als sei ein Riese durch das Getreide gestampft.“
Nach einer kurzen Pause sagte schließlich einer: „Morgen ist er vielleicht schon bei uns.“
Und alle schwiegen, als hätte man ihnen eine Ohrfeige versetzt. Denn sie wussten, was er meinte.
Plötzlich war ihnen, als sei das, wovon man in den vergangenen Jahren und selbst noch vor einigen Monaten euphorisch, später gleichgültig und zuletzt nur noch mit Angst gesprochen hatte, nicht mehr weit entfernt. So, als müsste man nur einen halben Tagesmarsch zurücklegen, um brennende Häuser und jene grässlichen Bilder leibhaftig zu sehen, die so oft in den Filmtheatern vorgeführt worden waren.
Ganz nah war der Krieg auf einmal, und die Hände der Mutter waren wie Antennen, die ahnten, dass er schon bald mitten durch das umliegende Hügell and und vielleicht sogar mitten durch ihr Haus marschieren würde.
Eines Nachts weckte ihn seine Mutter. Er sah, wie Fenster in kurzen Abständen von grellem Licht erhellt wurden. Er hörte den Knall, der darauf folgte, und die Mutter, die ihm zurief: „Schnell jetzt!“
Alle schlüpften schlampig in ihre Kleider und Schuhe und verließen das Haus. Sie eilten einen Pfad entlang. Josef schaukelte wie eine Puppe in den Armen seines Vaters. Und jedes Mal, wenn eine Flut aus Licht die Nacht erhellte, sahen sie taunasse Wiesen und darüber dünne Schleier aus Nebel.
In einem Weinkeller roch Josef später feuchte Erde und den Geruch von Angst. Fast alle Bewohner des Dorfes saßen beisammen. Einige führten hastige Reden. Irgendwo weinte ein Mädchen und flehte: „Ich will nach Hause.“
Aber er sah es nicht, denn es war dunkel. Still hockte er da.
„Ganz ruhig“, flüsterte seine Mutter, „ganz ruhig, Josef. Dann wird alles gut.“
Und je öfter sie es sagte, desto enger wurde ihm in der Brust. Er begann zu husten und zu keuchen, und das Husten und Keuchen nahm kein Ende. Er spürte, wie eine Hand der Mutter unter sein Leibhemdchen fuhr und seinen Rücken streichelte, als eine Frau sagte: „Wenn er so weiterhustet, verrät er uns. Du musst etwas tun, Alberta.“
Und schon mischte sich eine weitere Stimme ins Gespräch: „Sonst finden sie uns. Ich höre die Granateneinschläge bereits viel näher.“
Da erhob sich die Mutter und nahm Josef in den Arm. Seine Füße streiften an Knien und Worte an seinen Ohren. Er wusste nicht, was vor dem Eingang des Weinkellers vor sich ging, aber er ahnte, dass es sehr gefährlich war. Er strampelte und stieß gegen ein Bein, als sich jemand empörte: „So ein frecher Balg! Jetzt reicht es aber! Raus, sonst helfen wir nach.“
Josef jammerte, dass er nicht hinauswolle, aber da zerrte die Mutter ihn schon zum Eingang, und als man die hölzerne Tür in ihrem Rücken versperrte, sagte sie: „Du musst jetzt leise sein, Josef. Dann kann nichts passieren.“
„Ich habe Angst“, flüsterte er.
In das zu lange Schweigen der Mutter, die ihm keine Antwort geben wollte oder geben konnte, spürte er, wie sein Hosenboden ganz warm wurde. Und sie küsste ihn auf die Stirn, zog ihm die vollgenässte Hose aus und warf sie in die Büsche. „Mein Liebling. Das wird schon wieder, ganz bestimmt.“
Danach lagen sie im Wald in einer Mulde. Josef atmete den Geruch von Fichtenästen, die seine Mutter von einigen Bäumen geknackt hatte und die sie nun schützten. Sie drückte ihn an sich und deckte ihn mit ihrem Mantel zu.
„Eines musst du wissen“, flüsterte sie auf einmal ganz ruhig. „Lässt sich nichts mehr ändern, wird es nicht besser, wenn man weint.“
Das Licht einer Taschenlampe glitt durch den Wald. Josef sah Schatten von Bäumen und Sträuchern über den Boden wandern und schloss die Augen. Einmal hielt ihm die Mutter den Mund zu. Die Schritte waren so nah, als stapften sie dicht an Josefs Ohren vorbei. In seiner Verzweiflung griff er nach etwas feuchter Erde und rollte sie zwischen den Fingern zu einem Kügelchen.
Drüben auf der Landstraße näherte sich das Grollen von Motoren. Schüsse fielen. Vom Dorf herüber vernahmen sie das Klirren von Scheiben und das Schreien von Kühen und Kälbern, die aus Ställen getrieben wurden.
„Das geht vorüber. Du musst nur ganz ruhig sein“, wiederholte seine Mutter. „Und du darfst dich mit den Händen nicht so sehr an mir festkrallen, das tut weh.“
Und setzten ihre beruhigenden Worte aus, fluchte sie über einige Menschen im Weinkeller.
Eine Wegstunde in südlicher Richtung saß zur selben Stunde ein Vater vor seinem Haus.
„Drinnen ist mir zu warm“, hatte er seiner Frau kurz zuvor erklärt. In der Ferne hörte er Granaten. Auf seinem Arm hielt er seine einjährige Tochter Rosa. Sie schlief. Plötzlich drang ein Zischen an sein Ohr. Fast im selben Augenblick zerbarst in der Nähe ein Apfelbaum. Die Granate hatte den Vater mit seiner Tochter nur um eine Armlänge verfehlt.
Irgendwann in jener Nacht wich Josefs Aufregung der Erschöpfung. Er ließ das Erdkügelchen aus seinen Fingern gleiten und schlief ein.
Das Erste, was am nächsten Morgen an seine Ohren drang, war das Zwitschern der Vögel. Er spürte die streichelnde Hand seiner Mutter: „Alles ist gut. Du musst dir keine Sorgen machen.“
Noch am selben Vormittag standen sie vor ihrem Haus. Die Holzwände waren mit weißen Hakenkreuzen verunstaltet und auf die Eingangstür hatte jemand mit dicker Farbe auf Russisch das Wort Hier hingeschmiert.
Mit Seifenwasser schrubbten der Vater und die Mutter alles von der Hauswand und der Tür. Und als die Strahlen der Abendsonne die nasse Ostseite des Hauses trafen, schien es, als hätten die Bewohner an diesem Tag versucht, all das abzuwaschen, was sie in den letzten Jahren gedacht, getan und befürwortet hatten.
In dieser Nacht sagte Josefs Vater zu seiner Frau: „Wenn das vorüber ist, ziehen wir weg von hier.“
Wochen später, an einem Abend im Mai, musizierte Josefs Vater draußen vor dem Haus. Um ihn herum hatten etliche Nachbarn Platz genommen. Er spielte auf der Ziehharmonika und lachte. Alle lachten. Auch die, die sonst nie lachten. Manche sangen zur Musik und Josef schloss die Augen und erkannte die Stimmen aus dem Weinkeller wieder. In seinen Gedanken wanderten Schatten durch die Nacht und gleichzeitig atmete er den Geruch von Fichtenästen.
Während er daran dachte, saß er auf dem Schoß seiner Mutter. Sie streichelte seinen Kopf. Ihre Hände zitterten nicht mehr. Ganz leise meinte sie dann: „Glauben muss man, Josef, glauben an das Gute. Manchmal muss man so sehr daran glauben, dass es freiwillig auf einen zukommt.“
Wenig später spürte er einen warmen Tropfen auf seiner Nasenspitze. Und noch einen. Seine Mutter schluchzte leise, während der Vater musizierte und die Nachbarn zu den Klängen der Harmonika sangen. An diesen Augenblick würde sich Josef sein Leben lang erinnern.
Nur langsam kehrte das Leben ins Normale zurück. In den Gasthäusern bekam man in der ersten Zeit nach dem Krieg nicht einmal so viel Bier zu trinken, wie man wollte. Mit dem Wein war es ebenso. Aber wie sprießendes Gras begannen wieder die Märkte und Feste und im Radio übertrug man Spiele aus den Fußballstadien. Nur die Verkrüppelten, die Arm- und Beinlosen, erinnerten an schlimme Tage und natürlich an viele andere Dinge. Aber die sah man nicht. Und die meisten behielten sie für sich.
2
Josef war dreizehn, als der Mechaniker ins Dorf zog. Der Mechaniker war ein eigenartiger Mensch, der mit niemandem sprach und stets eine blaue Arbeitsmontur trug. Am Rand des Dorfes hatte er sich ein Haus mit einer großen Scheune gemietet. Eigentlich hatte er die Scheune mit dem Haus gemietet, denn die meiste Zeit verbrachte er dort hinter den aufgestoßenen Flügeltoren und reparierte Autos. Die Fahrzeuge ließ er auf einem flachen Anhänger herbeikarren, der von einem Traktor gezogen wurde. Es kam auch vor, dass ein Abschleppwagen vor der Scheune hielt und ein Auto ablud. Nach einiger Zeit verschwanden die Wagen so unerwartet, wie sie herbeigeschafft worden waren.
In der Kirche und auf den Dorffesten sah man den Mechaniker nie. Man kannte nicht einmal seinen Namen und man fragte ihn auch nicht danach. In der Ortschaft hieß er zuerst nur Der Mechaniker. Aber es dauerte nicht lange, bis man ihn nur noch den Verrückten nannte.
An einem Tag im August – kurz davor hatte es ein Gewitter gegeben und die Luft war schwül und fett vom Regen, der noch vereinzelt aus dunklen Wolken tropfte – sah Josef den Mechaniker zum ersten Mal. Im düsteren Licht der Scheune beugte er sich gerade über die offene Motorhaube eines Opels und hielt einen chromglänzenden Schlüssel in der Hand. Dabei sprach er mit dem Wagen wie mit einem Kind. Josef lehnte an einem Stapel Bauholz, den man neben der Straße aufgeschichtet hatte, und beobachtete ihn. Zur Scheune waren es gut zwanzig Schritte, weit genug entfernt, um davonzulaufen, falls der Mechaniker wütend werden sollte. Denn es hieß, dass er manchmal die Beherrschung verliere. Dann stieß er Blechfässer um, die hohl und metallisch klingend über den Boden rollten, warf Werkzeuge auf die Wiese und fluchte über sämtliche Heilige, von denen er irgendwann gehört haben musste.
„Seine Worte“, sagten einige im Dorf, „klingen wie böse Gebete.“ Nachdem sich sein Zorn erschöpft hatte, rollte er die Fässer zurück an ihre Plätze und sammelte das Werkzeug wieder ein. Danach saß er lange auf einem Schemel und wischte die Schraubenzieher, Zangen und Schlüssel mit einem Lumpen sauber.
An diesem Nachmittag nahm der Mechaniker Josef gar nicht wahr. Tief versunken montierte er im Motorraum herum. Irgendwann in diesen Stunden setzte er sich in den Wagen und drehte den Zündschlüssel nach rechts. Zuerst schnupperte der Motor nur, seufzte und verstummte. Wenig später sprang er abermals an, war schwer am Leben zu halten und starb wieder ab. Gleichzeitig qualmte dunkler Rauch aus der Scheune. Noch einmal beugte sich der Mechaniker für einige Handgriffe über den Motor und startete erneut. Jetzt schnurrte die Maschine in gleichmäßigem Takt. Eine Zeit lang stand der Mechaniker einfach da und blickte auf die Kolben und Riemen. In diesem Augenblick des inneren Friedens trat Josef langsam näher. Er stand vor dem Tor und beobachtete den Mann, der selbstvergessen die Bewegungen der einzelnen Teile verfolgte. Später erzählte Josef seinen Freunden: „Ich habe ihn lächeln gesehen.“
Aber auf einmal ruckelte der Motor und verstummte. In die Stille hinein, in der nur noch das Läuten einiger Kuhglocken von einer nahen Wiese zu hören war, begann der Mechaniker zu toben, erblickte den Jungen und schrie: „Verschwinde, sonst geschieht ein Unglück!“
Da rannte Josef schon davon, flüchtete auf der nassen Straße an grasenden Kühen vorbei, wich Pfützen aus oder sprang durch sie hindurch, wenn sie zu groß waren. Die Wut des Mechanikers versetzte ihn genauso in Panik wie das Geschrei seines Vaters.
Erst vor dem Elternhaus verlangsamte Josef seine Schritte. Sein Vater, der ihn kommen sah, fragte, ob er etwas gestohlen habe, weil er durch die Gegend renne wie ein Dieb. Josef senkte seinen Kopf, um ihn nicht zu erzürnen, drückte sich an ihm vorbei und verschwand im Haus.
In der folgenden Nacht stiegen Josef die Bilder von zitternden Motoren und dunklem Qualm sogar in die Träume nach. Seit diesem Tag ließ ihn das Magische, das von Motoren ausging, nicht mehr los. Wie von einem Sog erfasst, gegen den er sich nicht wehren konnte und auch nicht wehren wollte, suchte er die Nähe des Mechanikers immer wieder und freute sich, wenn die Scheunentore weit offen standen.
Geduldig saß er dann auf dem Bretterstapel und ließ sich an heißen Tagen von der Sonne quälen. Drüben hantierte der Mechaniker in seinem blauen Arbeitsanzug und litt unter der Hitze, die durch das dünne Dach in die Scheune drückte.
Als Josef ihm eines Nachmittags zusah, gingen seine Schulkameraden vorbei und luden ihn zum Fußballspielen ein. Nicht weit entfernt gab es eine Wiese, die man einige Tage zuvor gemäht hatte. Sie war flach und als Spielfeld gut geeignet. Das Heu liege schon trocken unter einem Dach, meinte einer. Aber Josef schüttelte den Kopf. Er habe leider keine Zeit. Kurz blickte er den Jungen hinterher und hörte einen von ihnen sagen: „Der ist schon genauso wie der Verrückte.“
Wenig später vernahm Josef das leichte Vibrieren des Wagens und den gleichmäßigen Takt des Motors. Der Mechaniker bestaunte die Maschine wie einen Schatz und rieb sich mit einem Lappen die Hände sauber. Aber eigentlich rieb er sie vor Freude. Es war das zweite Mal, dass Josef ihn lächeln sah.
Mit dieser Musik im Rücken näherte sich der Verrückte dem Stapel. Der Junge trat schon zurück auf den Weg und dachte: Das ist ein Trick. Er lächelt, und wenn er vor dir steht, verprügelt er dich. Aber der Mann begann zu winken und rief: „Komm.“
Noch am selben Nachmittag saß Josef auf der Stiege, die auf den Heuboden der Scheune führte. Kurz zuvor hatte ihm der Mechaniker erlaubt, dass er ihm von dort bei der Arbeit zusehen dürfe.
Von nun an betrat Josef die Scheune wie eine eigene Behausung. Irgendwann in diesen Tagen lag ein weiches Kissen auf der Treppe. „Damit du nicht auf den harten Stufen sitzen musst“, meinte der Verrückte.
In der folgenden Zeit lernte Josef alles, was man über Autos erfahren konnte, und wusste bald mit traumgleicher Sicherheit, wo jedes Teil seinen Platz hatte und in welchem Verhältnis es zu den anderen stand.
Immer wenn der Mechaniker wütend wurde, machte sich Josef ganz klein. Manchmal blickte er suchend hinauf zum Dachboden und nach einem Versteck. Drüben im Heu, dachte er, oder im offenen Kasten, in dem verstaubte Stricke hingen. Und im Stillen sagte er sich: Wenn du eines Tages solche Motoren reparierst – und dass er irgendwann solche Motoren reparieren würde, stand für ihn schon in diesen Tagen fest –, wirst du dir die Heiligkeit solcher Arbeiten niemals durch aufbrausende Flüche verderben lassen.
Und in seinen Gedanken sah er sich an einem großen amerikanischen Wagen hantieren. Erst vor wenigen Tagen hatte er ein solches Auto gesehen. Die wuchtigen Stoßstangen glänzten und der grüne Lack schimmerte wie der Rücken eines Rosenkäfers. Horchte man unter die Motorhaube, schien es, als schnurre dort ein riesiges Tier, das zu heulen begann, wenn man das Gaspedal berührte.
Einmal ächzte der Mechaniker unter einer Last, die er nicht alleine zu halten vermochte. Er blickte zu Josef hinüber und sagte: „Hilf mir mal. Ich schaff das gerade nicht alleine.“
Da kam Josef die Stufen herab und stand zum ersten Mal ganz nah bei ihm. Er sah die besessenen blauen Augen, den Blick, der ganz tief in die Sache abgetaucht war, und hörte den Mechaniker so gleichmäßig atmen, als befinde er sich in einem tiefen Schlaf. Auf seiner Stirn glitzerten kleine Tropfen und es roch nach Anstrengung und Schweiß.
„Halten“, sagte der Mechaniker. „Nur halten. Nicht mich ständig anstarren.“
Josef wandte seinen Blick ab und fand Rettung an Zylinderköpfen, Keilriemen und verchromten Muffen und in seinem Inneren lächelte er vor Freude.
Josef war gerade fünfzehn geworden, als er an einem kühlen Herbsttag mit seinem Vater eine staubige Landstraße entlangmarschierte. Kurz nachdem sie die ersten Häuser der nächsten Stadt erreicht hatten, betraten sie das kleine Büro einer Autowerkstatt. Der Vater schien mit dem Mann hinter dem Schreibtisch bereits alles besprochen zu haben, denn der Besitzer nickte nur zu seinen Worten und sagte mehrere Male: „Das machen wir schon.“
„Hier“, erklärte der Vater seinem Sohn, „wirst du drei Jahre in die Lehre gehen. Du beginnst nächsten Montag um sieben Uhr in der Früh.“