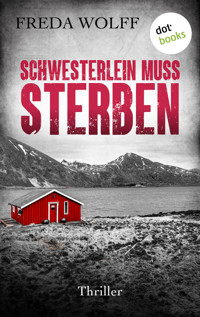
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für die Psychologin
- Sprache: Deutsch
Du musst schwimmen – sonst stirbst du. Bergen in Norwegen. Merette Schulman liebt ihren Beruf als Psychologin – bis sie an Aksel gerät, ihren schwierigsten Patienten. Nicht nur, dass er gesteht, als Vierzehnjähriger seine Stiefschwester getötet zu haben, er scheint auch ihrer Tochter Julia nachzustellen. Als deren Freundin Marie spurlos verschwindet, gerät Merette beinahe in Panik – und sie findet heraus, dass in Aksels Umfeld weitere mysteriöse Badeunfälle geschahen. Die Opfer waren immer junge Mädchen – wie Julia und Marie... »Ich bin Profi. Ich dachte, mich könnte so leicht nichts mehr erschüttern. Aber dieser Thriller hat mich voll erwischt.« – Dietmar Bär Eine toughe Psychologin in Gefahr… Fesselnde Skandinavien Spannung für Fans von Unni Lindell und Karin Fossum. Als Hörbuch bei Saga Egmont erhältlich sowie als eBook bei dotbooks.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Bergen in Norwegen. Merette Schulman liebt ihren Beruf als Psychologin – bis sie an Aksel gerät, ihren schwierigsten Patienten. Nicht nur, dass er gesteht, als Vierzehnjähriger seine Stiefschwester getötet zu haben, er scheint auch ihrer Tochter Julia nachzustellen. Als deren Freundin Marie spurlos verschwindet, gerät Merette beinahe in Panik – und sie findet heraus, dass in Aksels Umfeld weitere mysteriöse Badeunfälle geschahen. Die Opfer waren immer junge Mädchen – wie Julia und Marie...
Über die Autorin:
Freda Wolff ist das Pseudonym des Schriftstellerpaares Ulrike Gerold und Wolfram Hänel. Ulrike Gerold und Wolfram Hänel (beide Jahrgang 1956) haben Germanistik in Berlin studiert und an verschiedenen Theatern gearbeitet, bevor sie gemeinsam zu schreiben begannen. Heute leben und arbeiten sie meistens in Hannover – und schreiben seit über zwanzig Jahren im selben Raum und am selben Tisch, ohne sich dabei mehr zu streiten als unbedingt nötig.
Freda Wolff veröffentlichte bei dotbooks »Schwesterlein muss sterben« (bei SAGA-Egmont auch als Hörbuch erhältlich).
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2024
Dieses Buch erschien bereits 2014 bei Rütten & Loening, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Copyright © der Originalausgabe 2015 Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Karol Kinal unter Verwendung von Bildmotiven von Shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fe)
ISBN 978-3-98952-419-4
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Freda Wolff
Schwesterlein muss sterben
Thriller
dotbooks.
WIDMUNG
Für H. – wie immer
VORSPIEL
Ihr ist kalt. Sie friert. Gleichzeitig spürt sie deutlich den dünnen Schweißfilm auf ihrer Stirn. Sie hat Durst. Ihr ist übel. Sie muss dringend pinkeln.
Ihre Arme sind hinter ihrem Rücken zusammengebunden, das Klebeband schneidet schmerzhaft in die Haut der Handgelenke.
Auch ihre Beine sind eng umwickelt, als hätte jemand absolut sichergehen wollen, dass sie keine Chance hat, sich zu befreien. Ihr Rock ist bis über die Hüfte hinaufgeschoben, das T-Shirt ist zerrissen.
Als sie sich mit einem Ruck auf die Seite rollt und mit dem Gesicht auf dem Boden aufkommt, schürft ihr ein Holzsplitter die Lippe auf. Sie spürt, wie ein Blutfaden über die Wange läuft, unwillkürlich versucht sie, mit der Zunge über die Wunde zu lecken, deutlich kann sie das Blut schmecken.
Sie hat keine Ahnung, wie lange sie bewusstlos war. Noch weniger weiß sie, wo sie ist oder wie sie hierher gelangt sein könnte. Der Raum um sie herum liegt nahezu vollständig im Dunkeln. Vage kann sie die Umrisse einer Tür ausmachen, eine scharfkantige Lichtritze zwischen Tür und Rahmen. Es scheint kein Fenster zu geben. Als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, erkennt sie einen umgestürzten Farbeimer, leere Bierflaschen, einen Pizzakarton, an dem noch die Käsereste kleben, einen wackligen Tisch, dessen fehlendes Bein durch aufeinandergestapelte Plastikkisten ersetzt ist.
Die Aufschrift auf den Kisten kann sie nicht entziffern, dazu reicht das Licht nicht. Die auf dem Beton eingetrocknete Farbe aus dem Eimer schimmert leicht, als würde sie irgendeinen fluoreszierenden Bestandteil haben. Vor der hinteren Wand liegt etwas, dessen Konturen sie nicht zuordnen kann. Der Größe und Form nach könnte es ein zusammengekrümmter Körper sein.
Sie wartet auf eine Bewegung, auf irgendein Geräusch, aber da ist nichts, nur ihr eigener Herzschlag, der das Blut in ihren Ohren pulsieren lässt. Sie braucht lange, bis sie begreift, dass sie nur auf ein altes Fischernetz starrt, das achtlos in der Ecke zusammengeschoben worden ist. Erleichtert stößt sie den Atem aus, den sie unwillkürlich angehalten hat.
Die Luft im Raum ist stickig und heiß, es riecht nach Moder. Brackwasser. Dieselöl. Vielleicht ein Bootsschuppen, denkt sie, irgendwo in einer Bucht zwischen den Felsen am Meer. Das entfernte Rauschen, das sie jetzt wahrnimmt, könnte von der Brandung vor den Schären stammen.
Gleich darauf meint sie auch, eine Möwe schreien zu hören. Nur ganz kurz, dann übertönt plötzlich das nervtötende Summen einer Mücke, die sie umschwirrt, jedes andere Geräusch. Und das Pochen in ihrem Kopf, das mit jeder Sekunde stärker zu werden scheint und jeden klaren Gedanken verhindert.
Erst als die Mücke dicht unter ihrem Auge zu saugen beginnt, kommt sie auf die Idee, um Hilfe zu schreien. Aber ihre Stimme ist nicht viel mehr als ein heiseres Krächzen. Ihr Mund ist so trocken, dass sie kaum die Lippen auseinanderbringt. Erst der zweite Versuch gelingt ihr besser.
»Hilfe! Ist da jemand? Ich bin ...«
Hier, will sie rufen, hört mich jemand?
Aber sie bricht mitten im Satz ab. Vielleicht ist da wirklich jemand, denkt sie. Jemand, der mich bewacht. Draußen vor dem Schuppen. Der nur darauf wartet, dass ich irgendein Lebenszeichen von mir gebe. Und wenn ich um Hilfe schreie, wird er kommen und mich bestrafen ...
Sie hat Angst. Ihre Muskeln verkrampfen sich. Sie fängt an zu zittern und beißt sich auf die geschwollene Lippe. Schmeckt wieder das Blut und spürt erneut die Übelkeit in sich hochsteigen.
»Hilfe!«, stößt sie noch einmal hervor, und diesmal ist es mehr ein verzweifeltes Schluchzen als ein wirklicher Hilferuf.
Aber sie weiß es ohnehin schon. Da ist niemand vor dem Schuppen. Es wird auch niemand kommen und sie befreien. Und keine Hand wird sie an der Schulter rütteln, um sie aus ihrem Albtraum aufzuwecken.
Der Albtraum ist Wirklichkeit. Und es gibt nur eine einzige Person, die überhaupt weiß, wo sie ist. Der, der ihr das hier angetan hat. Sie ist sich sicher, dass es ein Mann sein muss. Sie ist sich nicht sicher, ob sie wirklich will, dass er zurückkommt.
Im nächsten Moment wird ihr schlagartig klar, dass er ihre einzige Chance ist. Ohne ihn wird sie hier ... verdursten. Verhungern. Von irgendwelchen Wildtieren aufgefressen, die über kurz oder lang den Weg in den Schuppen finden werden. Marder. Ratten. Vielleicht ein Fuchs. Ein streunender Hund.
Das schmerzende Pochen in ihrem Kopf ist jetzt so stark, dass sie fürchtet, wieder das Bewusstsein zu verlieren. Sie versucht verzweifelt, den Schmerz zu ignorieren und sich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren. Name. Wohnort. Wo und wann geboren. Sie ist eins neunundsechzig, sie wiegt achtundfünfzig Kilo, sie hat blonde Haare. Augenfarbe grau, unveränderliche Kennzeichen keine, Lieblingsessen Lasagne, Lieblingsgetränk Whiskey Sour, Lieblingsschauspieler Colin Farrel, Schauspielerin Penelope Cruz, Bands Snow Patrol, Arctic Monkeys, Razika. In dieser Reihenfolge. Nein, erst Arctic Monkeys, dann Snow Patrol. Egal, denkt sie, darum geht es nicht, es geht darum, dass sie nicht aufhört, gegen die drohende Ohnmacht anzukämpfen. Also weiter. Sie steht auf die Gedichte von Sylvia Plath. Sie hat keine Ahnung, wie jemand Peer Gynt für große Literatur halten kann. Sie hat vor langer Zeit mal ein Referat über Peer Gynt gehalten und behauptet, dass Peer Gynt wahrscheinlich von morgens bis abends bekifft gewesen war. Sie ist immer noch überzeugt, dass sie recht hatte ... weiter! Sie ist zurzeit ohne festen Freund, sie hat einen gefleckten Kater, der ihr vor kurzem erst zugelaufen ist und für den sie noch einen Namen finden muss. Sie war im Winter Skilaufen auf dem Idre Fjäll und im letzten Sommer in Frankreich am Atlantik. Der Ort hieß ...
Irgendwas mit H am Anfang. Sie spürt Panik in sich aufsteigen, als ihr der Name nicht gleich einfallen will. Nördlich von Biarritz, Capbreton hieß der eine Ort und ... Hossegor! Das war es. Die Gedankenkette in ihrem Kopf reißt unvermittelt ab, und sie sieht sich plötzlich selber wie in einem Film. Sie ist in einem Treppenhaus, plötzlich sind Schritte hinter ihr, und ein Schatten, ein Arm, der auf ihren Kehlkopf gepresst wird und ihr die Luft abschnürt, eine Hand, die ihr gleichzeitig ein Tuch, einen Lappen ins Gesicht drückt. Und dann ... Sie weiß es nicht mehr. Sie erinnert sich an nichts.
Ihr ist immer noch kalt. Und sie muss immer noch pinkeln. Das Pochen in ihrem Kopf hat einem beständigen Schmerz Platz gemacht, der sich pulsierend über Schultern und Brust ausbreitet und sie grelle Lichtkreise sehen lässt, kaum dass sie die Augen schließt. Sie spürt ihre Arme und Beine nicht mehr, als würden sie nicht länger zu ihrem Körper gehören. Die Mückenstiche in ihrem Gesicht jucken unerträglich.
Sie hat keine Ahnung, wie viel Zeit inzwischen vergangen ist. Der Lichtschimmer von der Tür ist schwächer geworden, der Eimer, der Tisch, das Netz sind nur noch vage Flecken in der Dunkelheit. Sie versucht zu rechnen. Es ist Sommer, das heißt, es bleibt lange hell, die Sonne geht erst gegen Mitternacht unter. Es war später Mittag, als sie betäubt worden ist, macht also mindestens sieben Stunden, die sie jetzt hier liegt, eher länger.
Hossegor, sagt sie unvermittelt vor sich hin, als würde es irgendeine Rolle spielen, dass sie den Namen nicht noch mal vergisst. Und der Weg zum Strand führte durch ein Dünental, in dem die Luft in der Hitze flimmerte. Sie erinnert sich daran, wie er sie plötzlich an sich gezogen hat ... sein heiseres Flüstern dicht an ihrem Ohr ... seine Haut, die feucht vom Schweiß war ... seine Hände auf ihrem Körper, sein Mund in ihren Haaren, an ihrem Hals, und dann langsam abwärts, über ihre Brüste, ihren Bauch ...
Sie muss kurz weggedämmert sein. In einem Traum gefangen, wie auf der Flucht vor einer Welt, die nicht wahr sein soll. Als sie den Schlüssel in der Tür hört, weiß sie im ersten Moment wieder nicht, wo sie ist. Dann blendet sie der Strahl der Taschenlampe, die direkt auf ihr Gesicht gerichtet ist. Er ist zurück, denkt sie. Ich muss irgendwas zu ihm sagen. Er muss mir Antworten geben. Ich muss wissen, was das alles soll. Aber sie bringt keinen Ton heraus, nur ihr Atem geht schneller, sie hört sich selber keuchen.
Als er sich über sie beugt, kann sie undeutlich die Maske erkennen, die er trägt. Eine rote Zipfelmütze, eine Knollennase, buschige, weiß angemalte Augenbrauen. Ein weißer Plastikbart, wie bei einer billigen Kasperpuppe. Ein Zwerg, denkt sie. Ein Zwerg aus einem Märchen.
Der Zwerg hält ihr eine Wasserflasche an den Mund. Sie trinkt so gierig, dass das meiste Wasser über ihr Kinn und auf ihr T-Shirt läuft, dann verschluckt sie sich und muss husten. Als sich ihre Blase leert, spürt sie für einen Moment Erleichterung, bis die Taschenlampe über ihren Körper wandert und die Stimme hinter der Maske leise sagt: »Du dreckige Sau!«
»Tut mir leid«, stammelt sie und merkt, wie sie rot wird, »aber ...«
Er hebt die Hand, um sie zum Schweigen zu bringen. An seinem Daumen trägt er einen silbernen Ring mit irgendeinem auffälligen Muster, vielleicht keltisch. Sein Arm ist am Handgelenk tätowiert, sie meint, ein Bild auszumachen, ein Rechteck mit einem Kreuz, vielleicht ein Sarg. Im Fernsehen sind solche Informationen wichtig, denkt sie. Ein Zwerg mit einem silbernen Ring am Daumen und einem Tattoo auf dem Handgelenk. Nein, kein Zwerg, ein Typ mit einer Zwergenmaske, das ist ein Unterschied.
Er hat jetzt ein Messer in der Hand, mit dem er das Klebeband an ihren Beinen auftrennt. Er ist eindeutig bemüht, nicht die feuchten Stellen an ihren Beinen zu berühren, als würde er seinen Ekel nur mühsam unterdrücken können.
Jetzt durchschneidet er auch das Band um ihre Handgelenke. Sie spürt deutlich das Kribbeln, als ihre Fingerspitzen wieder durchblutet werden.
Sein Atem riecht ganz leicht nach Bier. Bier und noch irgendetwas anderes. Schweiß! Und irgendein billiges Deo.
Als er ihr hilft, sich aufzurichten, muss er sie unter den Achseln halten, bis sie wieder alleine stehen kann.
Dann drückt er ihr die Klinge des Messers auf die Lippen.
»Denk nicht mal daran zu schreien«, zischt er undeutlich. Um gleich darauf hinzuzusetzen: »Aber es würde dir sowieso nichts nützen. Hier ist niemand, der dich hören könnte. Das Schloss ist weit weg, hinter den sieben Bergen, und dein Prinz hat eine andere gefunden, die er heiraten will. Er wird nicht kommen, um dich zu retten!«
Als würde er ihr ein Märchen erzählen ...
»Hör auf!«, flüstert sie heiser. »Bitte! Sag mir nur, was du von mir willst. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich habe dir doch nichts getan. Warum ...«
»Du musst mir zuhören«, sagt er. »Du darfst keine Fragen stellen. Nur zuhören. Fragen sind nicht gut für dich.« Er stößt sie vor sich her zur Tür hinaus.
Es ist nahezu dunkel inzwischen, aber der Mond taucht die Umgebung in ein kaltes, fast unwirkliches Licht. Weiter rechts steht ein verfallenes Sommerhaus. Vor ihnen führt ein Holzsteg durch dichtes Schilf zum Wasser. Glattgeschliffene Felsen liegen wie schwarze Schatten in der Bucht. Weit draußen meint sie den hellen Schimmer der Brandungslinie ausmachen zu können.
»Was willst du?«, flüstert sie wieder, als er sie bis zum Ende des Stegs führt, eine Hand mit festem Griff an ihrem Ellbogen, in der anderen immer noch das Messer.
Er ist groß, mindestens einen Kopf größer als sie, und er bewegt sich mit einer selbstverständlichen Leichtigkeit, die zeigt, dass er durchtrainiert ist. Und jung, denkt sie, kaum älter als ich. Seine Stimme hat sie an niemanden erinnert, den sie kennt. Aber das muss nichts bedeuten. Die Maske verändert die Stimme so, dass jeder Versuch, sie irgendjemandem zuzuordnen, unmöglich wird. Die lächerliche Maske ist es auch, die ihr mehr Angst macht als das Messer.
»Was willst du?«, wiederholt sie und merkt, wie ihre Stimme zittert.
»Du wirst jetzt schwimmen lernen«, sagt er. »Schwesterlein muss schwimmen können, sonst stirbt sie. – Zieh dich aus!«, befiehlt er.
»Was? Wieso? Ich will nicht, ich ...«
»Zieh dich aus!«
Die Messerspitze deutet auf ihre Turnschuhe.
Sie bückt sich und knotet mit zittrigen Fingern die Schnürsenkel auf. Das modrige Holz unter ihren Füßen fühlt sich kühl an. Kühl und schmierig.
Die Messerspitze wandert ihre Beine hinauf, bis zum Rock, den sie gerade noch hastig über ihre Oberschenkel gestreift hat.
»Weiter!«
Sie hat Mühe, den engen Rock von ihren Beinen zu bekommen. Wieder sind die feuchten Stellen ihr so peinlich, dass ihr das Blut in den Kopf steigt.
»Weiter!«
Als sie sich das T-Shirt über den Kopf zieht, sieht sie, wie sein Blick auf ihren BH gerichtet ist, unter dem sich deutlich ihre durch die Kälte steif gewordenen Brustwarzen abzeichnen.
»Was willst du?«, flüstert sie noch einmal, während ihr die Tränen über das Gesicht laufen.
Er gibt keine Antwort. Sie bemerkt, dass die Messerspitze in seiner Hand leicht zittert.
Sie greift in ihren Rücken, um den BH zu öffnen.
»Lass das«, keucht er unter der Maske. »Das reicht.«
Gleich darauf packt er sie und versetzt ihr einen Stoß, der sie rückwärts über die Kante des Stegs taumeln lässt. Während sie fällt, hört sie noch einmal seine Stimme: »Schwimm!« Dann schlägt das Wasser über ihr zusammen. Automatisch bewegt sie Arme und Beine, bis sie wieder an der Oberfläche ist.
Für einen kurzen Moment kann sie seinen Schatten auf dem Steg über ihr sehen. Dann wird sie wieder von der Taschenlampe geblendet.
»Schwimm! Ich zeig dir, wohin!«
Sie dreht sich um und schwimmt in die Richtung, die die Taschenlampe ihr vorgibt. Schlingpflanzen streifen über ihre Beine. Aber die Kühle des Wassers lindert den Juckreiz ihrer Mückenstiche. Als sie ihr Gesicht einen Moment länger als für den Schwimmzug nötig eingetaucht lässt, hört sie ihn wieder brüllen: »Schwimm! Du sollst schwimmen!«
Je weiter sie auf das Wasser hinauskommt, umso kälter wird es. Sie spürt, wie ihre Muskeln sich verkrampfen wollen. Sie versucht, ihren Atem unter Kontrolle zu bringen und ihren Rhythmus zu finden. Die nächste Insel ist vielleicht hundert Meter entfernt, mehr ganz sicher nicht. Hundert Meter war auch die Wettkampfbahn, die sie in der Uni in 1 Minute 27 Sekunden geschafft hat.
Der Strahl der Taschenlampe erreicht sie nicht mehr. Sie blickt sich nicht um, um zu sehen, ob er immer noch auf dem Steg ist. Die Felsen vor ihr ragen wie eine dunkle Wand aus dem Wasser.
ERSTES BUCH
»Oh baby, it’s a cruel, cruel world«(Dance with a Stranger)
KAPITEL 1JULIA
Zwei Tage vorher
Julia stand oben auf dem Dach unter dem endlos blauen Himmel und dachte: Wow, das ist es! Hier kannst du alt und grau werden. Im nächsten Moment musste sie über sich selber lachen. Sie war gerade erst vierundzwanzig und verschwendete normalerweise wenig Gedanken ans Altwerden. Aber sie war einfach glücklich, dass sie nach langem Suchen diese Wohnung gefunden hatte, die nicht nur mitten in der Stadt lag, sondern sogar ohne weiteres bezahlbar war.
Im letzten Jahr hatte Julia ihren Bachelor in Kunst gemacht, aber Oslo war irgendwie nicht ihr Ding gewesen. Sie war also zurück nach Bergen gekommen und fürs Erste wieder bei ihrer Mutter untergekrochen. Und jetzt hatte sie nicht nur einen Masterstudienplatz an der Kunstakademie in der Strømsgate, sondern endlich auch noch eine eigene Wohnung!
Ein echter Glücksgriff: eineinhalb Zimmer in einem umgebauten Dachboden in der Magnus Barfots Gate, mit einer Küche, die groß genug war, um einen Tisch für mindestens sechs Personen hineinzustellen, und einem Bad, in dem es eine Badewanne mit vergoldeten Löwenfüßen gab. Aber das Beste war das flache Teerdach genau vor ihrem Fenster, sie brauchte nur hinauszuklettern und die Welt lag ihr zu Füßen. Sie hatte sich schon genau ausgemalt, wo sie die Blumentöpfe hinstellen würde, den rotweiß gestreiften Liegestuhl, ihren Zeichentisch mit dem wackligen Stuhl vom Flohmarkt. Bei schönem Wetter musste es ein Traum sein, hier oben zu arbeiten, mit dem Blick über die halbe Stadt bis zum Hafen hinunter. Und in den Wetternachrichten hatten sie gerade erst gesagt, dass es einen langen und heißen Sommer geben würde.
Julia kickte einen Kiesel über die Kante und wartete auf das Geräusch, wenn er unten im Hof aufkommen würde. Aber es war nichts zu hören außer dem Straßenlärm von der Håkonsgate, der entfernt zu ihr heraufdrang. Und sich vorzubeugen, um über die Kante zu blicken, traute sie sich nicht. Abgründe waren nicht unbedingt ihr Fall, sie schreckte schon vor dem Blick das Treppenhaus hinunter zurück, und sie war ihren Eltern echt dankbar, dass sie nie auf die Idee gekommen waren, aus ihr eine Bergsteigerin machen zu wollen. Allerdings konnte sie sich ihre Mutter auch nur schwer in Kletterschuhen und mit Helm und Seil vorstellen, wie sie gerade in einer schroffen Fjordwand aufstieg. Von Jan-Ole als Freeclimber mal ganz zu schweigen! Aber ihre ganz private Dachterrasse war zumindest groß genug, um nicht zu nah an die Kante zu kommen – und die eiserne Feuertreppe, die sich in Bergen an nahezu jedem Stadthaus befand, würde sie hoffentlich nie benutzen müssen.
Sie nahm den Weg zurück durchs Fenster und ging in die Küche, um sich einen Espresso aufzusetzen. Ihre Schritte und jede Bewegung hallten laut von den noch kahlen Wänden zurück, aber sie war ja auch gerade erst eingezogen und hatte bisher nur das Nötigste die vier Treppen hinaufgeschleppt. In den nächsten Tagen würde sie genug Zeit haben, um alte Filmplakate aufzuhängen, Regale anzuschrauben, die Küche dunkelblau zu streichen, ihr Zimmer fertig einzurichten. Oder einfach nur, um so laut Musik zu hören, dass die Familie unter ihr schon mal wissen würde, was sie in Zukunft erwartete.
Als die Espressokanne zu brodeln anfing, suchte sich Julia einen Becher aus einem der Umzugskartons. Ihren Lieblingsbecher, den mit der Aufschrift »I GOT NOTHING TO WEAR«. Sie nahm ihren Kaffee und wollte wieder hinaus in die Sonne. Aber dann wollte sie plötzlich genau dort draußen Musik haben. Und zwar jetzt, sofort. Sie wollte Amy Macdonald hören, »A Footballer’s Wife«, und laut mitsingen, während sie ganz für sich allein auf dem Dach tanzte. »But the footballer’s wife tells her troubles and strife, I just don’t care in the end who is she to pretend, that she’s one of them, I don’t think so ...«
Solange musste der Kaffee eben warten, ohnehin hatte sie kein Problem damit, kalten Espresso zu trinken, ihre Freunde hatten sich schon mehr als nur einmal über diese Eigenheit lustig gemacht. Aber wenigstens würde sie sich auch nicht die Zunge verbrennen!
Sie setzte also den Becher aufs Fensterbrett und machte sich auf die Suche nach Amy Macdonald. Nach dem dritten Karton gab sie auf. Ihre CDs waren vollständig da, nur diese eine fehlte. Und eigentlich war die Sache ohnehin klar, bevor sie noch lange darüber grübeln musste. Ihre Mutter hatte in den paar Wochen, in denen sie zusammenlebten, die nervtötende Angewohnheit entwickelt, sich wahllos Julias CDs auszuborgen – und was ihr gefiel, verschwand meistens auf Nimmerwiedersehen in dem Chaos ihres Arbeitszimmers, wo sie sich zwischen den Patiententerminen jedes Mal eine Zigarette und einen Song zum Mitsingen gönnte. Wahrscheinlich hatte sie die CD schon in die Finger bekommen, bevor Julia ihre Kartons gepackt hatte.
Ohnehin hatte sie mit Vorliebe in Julias Zimmer herumgeschnüffelt, daran hatten auch vierundzwanzig Jahre Erziehung durch Julia nichts ändern können. Das Kind einer Psychologin zu sein war eben manchmal alles andere als lustig. Julia liebte ihre Mutter, aber war dennoch froh, dass Merette ab sofort keine Chance mehr haben würde, ihren professionellen Deformationen als Kontrollfreak nachzugehen. Die CD allerdings würde sie ihr nicht überlassen, das konnte sie sich abschminken, und mehr noch, sie würde sie sich jetzt sofort zurückholen!
Julia nickte dem Kaffee auf dem Fensterbrett zu: Schön auf mich warten, hörst du? Ich bin gleich wieder da.
Sie verplemperte nur wenig Zeit damit, sich zwischen dem Top mit dem Erdbeermuster und dem schulterfreien Teil in Pink zu entscheiden. Dann wählte sie den kürzesten Rock dazu, den sie auf die Schnelle finden konnte. Sie tuschte sich ein bisschen Mascara auf die Wimpern und war fertig für den Ritt auf ihrem Rennrad, das sie sich noch in Oslo geleistet hatte. Vierundzwanzig Gänge, Vorder- und Hinterradschaltung, Shimano-Bremsen und der Rahmen leuchtend blau!
Im Fahrradkeller traf sie auf einen pickligen Fünfzehnjährigen, der bei ihrem Anblick innerhalb von Sekunden so rot wurde, dass er glatt als Ampelmännchen hätte auftreten können, und sich dann stotternd erbot, ihr das Rad auf die Straße zu tragen.
»In zehn Jahren vielleicht«, meinte sie fröhlich und warf lachend ihre blonden Haare zurück. Sie hoffte nur, dass er es mit seinen Phantasien noch rechtzeitig bis unter die Dusche schaffen würde.
Eine halbe Stunde später hatte sie Amy Macdonald gefunden, wie vermutet im Arbeitszimmer ihrer Mutter, zwischen Stapeln von Fachzeitschriften und irgendwelchen Notizen für einen Artikel, den sie offensichtlich gerade schrieb. Merette war nicht zu Hause, weshalb Julia die Gelegenheit nutzte, um ihrerseits ein bisschen zu schnüffeln. Aber es gab nichts, was ihre Aufmerksamkeit länger als fünf Sekunden gefesselt hätte – und das, wonach sie eigentlich suchte, war nicht dabei: Sie fand nicht den kleinsten Hinweis darauf, ob ihre Mutter nun eine Affäre hatte oder nicht. Bei ihrem letzten Telefongespräch war die Rede von einem Kollegen gewesen, den sie auf irgendeiner Tagung kennengelernt hatte und mit dem sie zu einem »Arbeitsessen« verabredet war. Bei ihrem Lieblingsitaliener! Was Julia sofort stutzig gemacht hatte, denn ihre Mutter lehnte es grundsätzlich ab, mit »Kollegen« irgendwohin zu gehen, wo man sie noch aus der Zeit mit Jan-Ole kannte und schnell irgendwelche Gerüchte entstehen konnten. Originalton Merette: »Ich brauche das nicht, dass sich Gennaro da irgendwas zusammenreimt und es wenig später die halbe Stadt weiß.« Andererseits hätte Julia ihr ein kleines Abenteuer durchaus gegönnt, sie hoffte sogar darauf, dass »es« endlich mal wieder passieren würde. Irgendetwas stimmte da nicht so ganz. Nach der Trennung hatte Merette Schulman, geschiedene Andersen, damals gerade neununddreißig Jahre alt und Diplompsychologin, sich glatt zu einem Leben ohne jeden Sex entschieden. Und behauptete auch noch bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit, dass ihre Abstinenz ihr eine »unvorstellbare geistige Freiheit« ermöglichen würde – was immer sie damit meinte, aber die Trennung lag mittlerweile fast zehn Jahre zurück, und Julia machte sich schon länger ernsthaft Sorgen um ihre Mutter.
Julia wusste selbst nicht, warum sie dann noch mal einen Blick in die CD-Hülle warf, statt sie einfach nur einzustecken. Vielleicht war sie unbewusst daran gewöhnt, dass eine CD-Hülle bei Merettes bekannter Abneigung gegen jede Form einer sinnvollen Ordnung noch lange nicht bedeutete, dass auch die CD drin war. War sie auch nicht, die Hülle war leer. Automatisch griff Julia nach der Fernbedienung auf dem Schreibtisch. Die Anlage lief wie üblich auf Stand-by, und Julia war überzeugt, gleich Amy Macdonald über Victoria Beckham singen zu hören, »but the footballer’s wife tells her troubles and strife ...«
Stattdessen kam eine Männerstimme aus den Lautsprechern. Julia brauchte einen Moment, bis sie begriff, dass es keine CD war, sondern dass sie gerade die Aufzeichnung eines Therapiegesprächs hörte. Dann sah sie auch den USB-Stick in der Anlage stecken. Genervt wollte sie die Wiedergabe unterbrechen, als ein Satz fiel, der sie aufhorchen ließ: »Ich war vierzehn, als ich meinen ersten Mord begangen habe. Mit vierzehn sollte man niemanden umbringen, das ist zu früh. Vielleicht war das auch der Grund, warum es mir nichts ausgemacht hat. Wissen Sie, ich meine, vielleicht habe ich es ja gar nicht richtig begriffen, was ich da gemacht habe. Das könnte doch sein, oder?«
Julia hörte, wie sich ihre Mutter räusperte.
Langsam ließ Julia sich in den schweren Ledersessel sinken, in dem auch ihre Mutter während des Gesprächs wahrscheinlich gesessen hatte. Wie üblich mit dem Kopf in die Hand gestützt und den Blick irgendwo ins Leere gerichtet, um zu signalisieren, dass sie aufmerksam zuhörte, ihr Gegenüber jedoch nicht bedrängen wollte.
»Und was bringt Sie auf die Idee, dass es Ihnen nichts ausgemacht hat?«, kam leise die Stimme von Merette.
»Ich dachte, das wäre vielleicht eine Erklärung dafür, dass ... Also, ich hatte irgendwie Spaß daran. Ich fand es gut.«
»Können Sie das ein bisschen genauer beschreiben?«
»Wie jetzt, genauer beschreiben? Ist doch ganz einfach! Ich hatte Spaß daran, die kleine Schlampe zappeln zu sehen, während ich sie immer wieder unter Wasser gedrückt habe. Bis sie aufgehört hat zu zappeln.«
»Sie kannten das Mädchen?«
»Natürlich. War ja meine Schwester.«
»Und was genau hatte Ihre Schwester Ihnen getan, dass Sie meinten ... sie bestrafen zu müssen?«
»Sie sind echt clever. Woher wissen Sie, dass ich sie bestrafen wollte?«
»Ich dachte, das wäre vielleicht der Grund gewesen, dass Sie ...«
»Exakt. Sie war immer so ... Sie wissen schon, wie kleine Mädchen manchmal so sind.«
»Nein, ich weiß nicht, was Sie jetzt meinen. Versuchen Sie, mir das zu erklären.«
»Natürlich wissen Sie ganz genau, wovon ich rede. Sie sind clever, ich hab’s ja gesagt. Und meine kleine Schwester war genau so. Nein, stimmt nicht. Sie war nicht clever, sie hat nur gedacht, sie wäre es. Deshalb musste ich sie bestrafen. Ich mag es nicht, wenn jemand denkt, er wäre schlauer als alle anderen.«
Pause.
Julia meinte, den Typen auf der Aufnahme atmen zu hören. Und da war auch noch irgendein anderes Geräusch, als würde jemand unentwegt mit dem Fuß auf den Boden klopfen. Dieses nervöse Klopfen kam ganz bestimmt nicht von ihrer Mutter. Als Merettes Patient unvermittelt weiterredete, hatte seine Stimme einen neuen Unterton, den Julia nicht einordnen konnte.
»Jetzt überlegen Sie, was Sie damit machen, richtig? Könnte ja vielleicht sein, dass das immer noch so ist. Dass ich es nicht abkann, wenn sich jemand für clever hält. Und ich hab ja gerade gesagt, dass Sie clever sind. Aber Sie müssen genau zuhören, sonst läuft das nicht. Sie sind clever, habe ich gesagt, nicht, Sie halten sich für clever, das ist ein Unterschied.«
»So geht das nicht, so kommen wir nicht weiter. Lassen Sie mich da bitte raus. Sie wollten mir erzählen, warum Sie ...«
»Nein, wollte ich nicht. Aber wie wär’s, wenn Sie mir zur Abwechslung mal was von sich erzählen? Also, ich meine, was machen Sie so, wenn Sie gerade mal nicht mit irgendwelchen Bekloppten zu tun haben? Haben Sie eigentlich Kinder? Ich wette, dass Sie Kinder haben. Aber keinen Mann, richtig? Wie viele? Kinder, meine ich jetzt, nicht Männer ...«
»Hören Sie damit auf«, sagte Julias Mutter. »Schenken Sie sich bitte Ihre Show, ja?«
»Was denn, schon genervt? Aber wieso? Ich meine, ein kleines Gespräch muss doch wohl noch drin sein, schafft doch Vertrauen. Und ich hab Ihnen ja auch schon was von mir erzählt, jetzt sind Sie dran. Also, was haben Sie so für Geheimnisse? Sagen Sie es ruhig, ist gut aufgehoben bei mir, echt, versprochen. Ich habe sowieso schon überlegt, dass ich vielleicht noch mal Psychologie studiere. Richtig an der Uni und so. Dann könnten wir quasi als Kollegen miteinander reden. Ich erzähle ein bisschen, was ich für Dreck am Stecken habe, und Sie ...«
Julia hatte plötzlich genug gehört. Der ganze Dialog erschien ihr so haarsträubend, dass sie den Player abrupt ausschaltete. Für einen Moment tat Merette ihr leid. Was um alles in der Welt war das für ein Job, bei dem ihr irgendjemand erzählte, dass er gerade erst vierzehn war, als er seine kleine Schwester umgebracht hatte? Und wahrscheinlich kommt dann auch noch raus, dass die Schwester nicht sein einziges Opfer war, genau das hatte der Typ ja gesagt: Meinen ersten Mord, hatte er gesagt, also gab es noch weitere! Aber offensichtlich saß er dafür nicht im Knast, sondern bei ihrer Mutter, die sich den ganzen Scheiß jetzt als Psychologin anhören durfte, ohne etwas tun zu können, weil sie ja an ihre Schweigepflicht gebunden war.
»Hör auf«, sagte Julia laut in die Stille des Arbeitszimmers hinein, »das ist doch alles Quatsch!« Wieso sollte ein Mörder bei ihrer Mutter sitzen? Merette war keine Knastpsychologin, bei ihren Fällen ging es um Leute, die von der nächsten Brücke springen wollten, weil sie nicht mehr weiterwussten, oder die auf Alk oder Pillen waren, weil sie ihren Job verloren hatten oder ihnen die Frau davongelaufen war oder der Mann. So was, aber keine Massenmörder, die kleine Mädchen umbrachten, weil sie ihnen zu clever waren.
Im selben Moment hatte Julia die Lösung. Natürlich, das musste es sein. Merette arbeitete seit einiger Zeit auch stundenweise als Dozentin an der Uni. Was sie da eben gehört hatte, war nichts als eine Übung gewesen, bei der es wahrscheinlich um bestimmte Taktiken der Gesprächsführung ging. Wie man reagiert, wenn der Patient versucht, einen aus dem Konzept zu bringen. So was in der Art. Und im Übrigen war selbst Merette nicht so nachlässig, dass sie die Aufzeichnung eines tatsächlichen Therapiegesprächs einfach so in der Anlage lassen würde. Das passte nicht zu ihr. Wenn es um ihre Patienten ging, war sie unbedingt zuverlässig. Für solche Aufzeichnungen gab es extra den abschließbaren Stahlschrank neben ihrem Schreibtisch.
Julia stieß erleichtert die Luft aus.
»Bescheuerter Beruf«, sagte sie noch einmal laut.
Als sie aufstand, gab das Leder des Sessels ein leicht schmatzendes Geräusch von sich. Julia war vom Nacken bis über den Rücken hinunter klatschnass geschwitzt.
Unschlüssig, ob sie noch weitersuchen sollte, stand sie einen Moment mit der leeren CD-Hülle mitten im Raum. Und plötzlich war die Unruhe wieder da. Irgendein blödes Gefühl, das ihr sagte, irgendetwas wäre ganz und gar nicht in Ordnung. Wieso war Merette eigentlich nicht zu Hause? Wo war sie?
Dann sah Julia die CD auf der Fensterbank neben dem Strauß mit den bunten Papierblumen, den sie vor Jahren als Geburtstagsgeschenk für sie gebastelt hatte. Auf der CD klebte ein kleiner gelber Merkzettel: Unbedingt Julia zurückgeben, sonst flippt sie wieder aus.
Prima, Mama, dachte Julia. Feine Wortwahl für eine Psychologin! Unverändert nervös beschloss sie, Merette auf dem Handy anzurufen. Sie musste ja nicht sagen, dass sie mitten in ihrem Arbeitszimmer stand und in ihren Sachen geschnüffelt hatte. Sie hatte sie nur spontan besuchen wollen und war jetzt enttäuscht, dass niemand zu Hause war. Mehr nicht. Das musste als Begründung reichen. Aber das Handy klingelte endlos, ohne dass ihre Mutter das Gespräch annahm. Und die Mailbox hatte sie wie üblich nicht eingeschaltet.
Julia ging in die Küche, füllte ein Glas mit Leitungswasser und stürzte es in einem Zug hinunter. Sie hatte keine Ahnung, was sie jetzt tun sollte.
Als ihr Handy auf der Küchenablage zu vibrieren anfing, zuckte sie im ersten Moment irritiert zusammen. Dann kam die Erleichterung, dass Merette so schnell zurückrief.
»Hallo, Mama«, sagte Julia. »Merette?«, fragte sie dann noch mal in den Hörer, als sich niemand meldete. Jetzt erst warf sie einen Blick auf das Display. Und da stand »unbekannter Teilnehmer«.
»Hallo, wer ist da?«, rief Julia. »Mit wem spreche ich?« Wieder war die Antwort nichts als Rauschen. Und irgendwo im Hintergrund schrie eine Möwe.
KAPITEL 2X
1 Tag vorher
Er merkte, wie er wütend wurde. Nicht mehr nur verärgert, sondern wirklich wütend. Als würde es gegen ihn persönlich gehen, als wäre das Ganze nur dazu gedacht, um ihn zu frustrieren. Fertigzumachen. Oder schlimmer noch: um ihn gewaltig zu verarschen!
Mit jeder Seite, die er umblätterte, wurde seine Wut größer. Dabei hatte er über achtzig Kronen für das Heft bezahlt! Die blöde Tussi im Zeitschriftenladen hatte es ihm extra noch empfohlen. »Ein ganz neues Heft«, hatte sie gesagt, »ich glaube, das ist was für Sie! Aber Sie müssen mir hinterher unbedingt erzählen, wie Sie es fanden.« Nichts als dummes Gewäsch, um ihn über den Tisch zu ziehen. Und er war darauf reingefallen. Hatte das Geld hingelegt und sich sogar noch gefreut. Fast wie früher, wenn er endlich genug Taschengeld zusammengespart hatte, um sich ein neues Matchbox-Auto kaufen zu können.
Er hatte sich einen Spliff gedreht und den Rauch tief inhaliert, bis das Schwindelgefühl einsetzte. Dann hatte er das Heft aufgeschlagen. Die Enttäuschung kam schon gleich mit der ersten Aufgabe. Lange Reihen mit einzelnen Buchstaben, aus denen er bestimmte Kombinationen heraussuchen sollte. Nicht mal dreißig Sekunden hatte er gebraucht! Verschiedene Symbole, bei denen er eine wiederkehrende Anordnung erkennen sollte. Zehn Sekunden. Billiganagramme, TON=NOT, ABER=RABE, EINST=STEIN, ESSEN=SENSE. Weniger als zehn Sekunden. Wortbruchstücke, Wortsalat, durcheinandergewürfelte Buchstaben, billiger ging es kaum noch.
Er machte sich nicht mal mehr die Mühe, die Lösungen aufzuschreiben. Oder noch auf die Uhr zu blicken. Er war ohnehin kurz davor, das Heft zu zerreißen und in den Müll zu werfen. Ungeduldig drückte er den Joint aus, während seine Augen automatisch die nächste Seite einscannten. Sprichwort-Labyrinth. Die Buchstaben mussten in die richtige Anordnung gebracht werden. Das erste Wort hieß JEDER, dann kam NEBEL, dann ... Er hing fest. Das ergab keinen Sinn. Er kannte kein Sprichwort, das mit JEDER NEBEL begann. Jetzt blickte er doch wieder auf die Uhr. Er las noch mal die Aufgabe, ob er irgendeinen Hinweis übersehen hatte. Ein Labyrinth, die Buchstaben sollten eine unsichtbare Linie durch das Gewirr der Kästchen ergeben ...
Er startete wieder mit dem JEDER, jetzt war er wirklich bei der Sache, obwohl ihm eine Stimme in seinem Hinterkopf sagte, dass er wahrscheinlich irgendetwas in die Aufgabe hineinlas, worum es gar nicht ging. Dass es viel einfacher war, als er dachte. Dass er die Lösung eigentlich auf einen Blick sehen müsste.
Er nahm den Stift und verband einen Buchstaben nach dem anderen. Er brauchte knapp eine Minute, dann hatte er das Sprichwort vor sich: JEDER LEBENSWEG IST RICHTIG. AUCH DIE UMWEGE. Bescheuert, dachte er, das Sprichwort gab es überhaupt nicht, das hatten sie doch willkürlich zusammengebastelt. Aber trotzdem, eine Minute für diesen Quatsch war zu viel! Das hätte er schneller rauskriegen müssen, was war los mit ihm?
Von draußen drang harter Elektrobeat durch das halbgeöffnete Fenster. Es war immer noch heiß, obwohl es schon früher Abend war.
Er stand auf und knallte das Fenster zu. Wahrscheinlich wieder der Penner aus dem Seitenflügel. Ein Typ, der eigentlich eindeutig zu alt war, um Elektro zu hören. Beginnende Stirnglatze und dezenten Knopf im Ohr und immer im Anzug, sogar wenn er den Müll runterbrachte. Eher der Typ, der beim European Song Contest für irgendeinen billigen Schlager mit leichten Anklängen an norwegische Folklore stimmen würde. Aber vielleicht täuschte er sich auch. Auf jeden Fall sollte ein Typ wie er nicht die Nachbarschaft terrorisieren dürfen! Wieso war der Penner eigentlich schon wieder von der Arbeit zurück?
»Haben sie dich rausgeschmissen, oder was?«, fragte er laut, während er das bescheuerte Heft mit einer wütenden Armbewegung in die Ecke warf. Dann ging er in die Küche, um sich Kaffee zu kochen.
Er musste wieder einen klaren Kopf kriegen. Vor allem durfte er sich nicht ständig über irgendwelche Nebensächlichkeiten aufregen, dazu stand zu viel auf dem Spiel. Aber das Warten machte ihn fertig. Er überlegte kurz, ob er schon früher zuschlagen sollte, verwarf den Gedanken aber gleich wieder. So wie er es geplant hatte, war es richtig. Ihm fehlten noch ein paar Informationen, die er dringend brauchte.
Vielleicht sollte er überhaupt erst noch mal bei der Zeitschriften-Tussi vorbeisehen, um ihr die Meinung zu sagen. Dann wäre das schon mal erledigt. Andererseits war das wahrscheinlich doch keine so gute Idee. Er sollte besser auch weiterhin nur den Eindruck des netten jungen Mannes erwecken, der sich ausschließlich für die Hefte mit den Intelligenztests interessierte. »Guter Tipp«, würde er beim nächsten Mal zu der blöden Tussi in ihrem Laden sagen, »danke noch mal, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. Hat mir Spaß gemacht. Waren fast alles Aufgaben, wie ich sie mit vierzehn schon mal gelöst habe. Ich wusste gar nicht, dass es solche Aufgaben immer noch gibt.«
Die kleine Nebenbemerkung würde sie nicht kapieren, dazu war sie zu blöd. Sie würde nur denken, dass er tatsächlich etwas Besonderes sein musste, wenn er mit vierzehn schon Intelligenztests gemacht hatte.
Er erinnerte sich noch genau an den langen Flur auf dem Amt, an den grauen Linoleumboden, die verkratzte Tischplatte, auf der die Bögen mit den Aufgaben lagen. Der Stuhl hatte bei jeder Bewegung gequietscht, und mittendrin hatte die Kugelschreibermine versagt. Die Psychologin hatte ihm dann einen Bleistift gegeben, der auf dem leicht glänzenden Papier nur schlecht zu sehen war. Er wusste auch noch, dass es bei einer der Aufgaben darum ging, einen Baum zu zeichnen. Er konnte noch nie gut zeichnen, aber das Bild gelang ihm nicht schlecht, er war selber überrascht. Und er hatte sich schon mit vierzehn darüber gefreut, wie die Psychologin wohl die offensichtliche Tatsache interpretieren würde, dass er eine Trauerweide gezeichnet hatte.
Sie hatte am offenen Fenster gestanden und geraucht, während er sich durch die Fragen arbeitete. Aus den Augenwinkeln konnte er sehen, wie sich ihr Slip unter dem Rock abzeichnete. Aber es störte ihn, dass sie nach Zigarettenrauch stank, als seine Zeit abgelaufen war und sie zu ihm herüberkam, um die Blätter einzusammeln.
Das Ergebnis bekam er eine Woche später mitgeteilt. Der Erzieher, der damals mit ihm auf dem Amt war, hatte zweimal nachgefragt, ob es auch wirklich keinen Irrtum geben könnte. Dann hatte er ihm kumpelhaft den Arm um die Schultern gelegt: »Alle Achtung, Junge, hätte ich dir gar nicht zugetraut.«
Er hatte ebenfalls nach Rauch gestunken und nach irgendeinem billigen Rasierwasser.
Als die Psychologin aufstand, um ihn zu verabschieden, hatte er wieder nach der Naht unter ihrem Rock gesucht. Aber es war nichts zu sehen, der Stoff war vollkommen glatt. Er hatte kurz die Phantasie gehabt, dass sie diesmal keine Unterwäsche trug. Und vielleicht nur für ihn!
Sie hatte einen IQ von 138 errechnet, weit über dem Durchschnitt: »Die meisten Menschen liegen zwischen 90 und 110.«
Er hatte nicht gefragt, ob sie ihren eigenen IQ wusste. Dass der Sozialarbeiter bestenfalls auf den Wert eines Gorillas kam, war ohnehin klar. Erst viel später hatte er irgendwo gelesen, dass Jodie Foster ihn selber mit einem IQ von 140 noch übertraf. Genauso wie Sharon Stone.
Sharon Stone war trotzdem eine Schlampe. Bei Jodie Foster wusste er es nicht genau. Aber er hatte einen Film mit Sharon Stone gesehen, bei dem sie sich in der Badewanne selbst befriedigte. Und in einer anderen Szene traf sie sich mit einem wildfremden Typen in ihrer Wohnung, und als der sich über sie beugte und ihr unvermittelt zwischen die Beine griff, war sie innerhalb von Sekunden gekommen. Die Szene machte ihn bei weitem mehr an als der Film, mit dem sie dann richtig berühmt geworden war. Obwohl er bei »Basic Instinct« jedes Mal wieder an die Psychologin damals auf dem Amt denken musste. Jedes Mal, wenn Sharon Stone beim Verhör vor Michael Douglas auf dem Stuhl saß und ihm ihre nackte Muschi zeigte.
Die Psychologin, bei der er heute Vormittag gewesen war, rauchte ebenfalls. Er musste unwillkürlich grinsen, als er sich daran erinnerte, wie leicht sie es ihm gemacht hatte. Er wusste jetzt schon mehr über sie, als sie jemals ahnen würde. Die Schlampe hatte es eindeutig nicht anders verdient. Irgendjemand musste ihr dringend mal zeigen, wo ihre Grenzen waren, das hatte er bereits entschieden, als er den kalten Zigarettenrauch in ihrem Atem roch. Sie war genauso wie alle anderen Psychologen, die er kennengelernt hatte. Sie versteckte sich hinter einer Fassade und glaubte, dass sie ihm überlegen war. Dabei hatte sie selbst genug Probleme, die sie nicht gelöst bekam, da war er sich sicher. Aber er würde ihre Fassade Stück für Stück niederreißen, bis nichts mehr von ihr übrig blieb als ein Scherbenhaufen.
Den ersten Schritt hatte er bereits getan, als er ihr das kleine Mordgeständnis geliefert hatte. Und nachdem er neben dem Telefon auf ihrem Schreibtisch den gelben Merkzettel gesehen hatte, brauchte er nur noch eins und eins zusammenzuzählen: NEUE NUMMER VON JULIA. Und eine Handynummer. Er war schon immer gut darin gewesen, sich Zahlen zu merken, ein flüchtiger Blick reichte, um sie in seinem Gehirn abzuspeichern.
Er hatte die Vorfreude noch ein wenig ausgekostet, bevor er die Nummer gewählt hatte. Und die Tochter hatte schon genauso arrogant geklungen wie ihre Mutter, obwohl sie wahrscheinlich gerade erst Anfang zwanzig war. Er war gespannt, wie lange es dauern würde, bis ihre Überheblichkeit sich in Luft auflöste, wenn er erst mal seinen Plan umgesetzt hatte.
KAPITEL 3MERETTE
10 Stunden vorher
Merette hatte die halbe Nacht nicht geschlafen, obwohl sie todmüde war, nachdem sie ihre Nachmittagstermine hinter sich gebracht und schließlich noch einen langen und langweiligen Abend auf der Geburtstagsfeier eines Kollegen durchgestanden hatte – mit zu viel Alkohol und zu vielen Zigaretten. Unruhig hatte sie sich dann in ihrem Bett hin und her geworfen, während ihre Gedanken wie in einer Endlosschleife immer wieder um das Gespräch mit ihrem Patienten vom vergangenen Mittag kreisten. Gegen sechs hatte sie jeden weiteren Versuch einzuschlafen endgültig aufgegeben und sich stattdessen in die Küche gehockt, mit einem Becher heißem Kaffee zwischen den Händen, von dem sie bereits nach dem ersten Schluck wusste, dass ihr Magen über kurz oder lang rebellieren würde. Auch nachdem sie geduscht und sich die Haare gewaschen hatte, fühlte sie sich immer noch wie gerädert.
Jetzt war sie in ihrem Arbeitszimmer und lief unruhig auf und ab. Vom Sessel am Schreibtisch vorbei zum Fenster und zurück. Fünf Schritte hin, fünf Schritte her. Ihr üblicher Weg, wenn ihr etwas durch den Kopf ging, das nach einer Entscheidung verlangte. Aber diesmal war es anders als sonst, diesmal spürte sie so etwas wie eine unbestimmte Angst.
»Mach dich nicht lächerlich«, sagte sie laut und griff nach der Zigarettenschachtel, obwohl sie sich gerade unter der Dusche noch geschworen hatte, ihren Nikotinkonsum konsequent einzuschränken. Auf dem neu gepflanzten Baum im Garten saß eine Amsel und betrachtete sie einen Moment mit schief gelegtem Kopf, bevor sie wieder zu zwitschern anfing. Selbst durch das geschlossene Fenster kam Merette der Gesang des Vogels unerträglich laut vor.
Mit der brennenden Zigarette zwischen den Lippen schob sie wahllos irgendeine CD in den Player. Als ihr der Rauch in die Augen stieg, musste sie heftig blinzeln, um die Playtaste erkennen zu können.
Der Song, der gleich darauf durchs Zimmer schallte, diente nicht gerade dazu, ihre Stimmung zu verbessern. Marianne Faithfull, »I know that woman in the mirror, but tell me, who is she?«. Es war nicht nur Mariannes Stimme, dachte sie, es war vor allem auch die Musik, der schleppende Beat, dieses Dunkle und Abgründige, das in der Melodie mitschwang und das einen unversehens in die tiefste Depression zu ziehen schien. Merette erinnerte sich an ein Interview, in dem Marianne Faithfull erzählt hatte, wie sehr sie es genoss, sich in depressiven Songs zu verlieren.
Aber sie brachte nicht die Energie auf, nach einer anderen CD zu suchen, stattdessen sang sie leise mit, »tell me, tell me, who is she?«.
Ich hätte den Stick nicht in der Anlage vergessen dürfen, dachte sie, das war idiotisch. Aber sie hatte dieses verdammte Patientengespräch in aller Ruhe noch mal hören wollen, ohne dabei den Laptop benutzen zu müssen, mit dem sie die Aufnahme gemacht hatte. Sie war sich nicht sicher, ob Julia wirklich etwas davon mitbekommen hatte, möglich war es jedoch, Julia liebte es, heimlich in ihren Sachen zu schnüffeln.
Merette warf einen Blick durch ihr Arbeitszimmer und versuchte, sich in die Situation eines Patienten zu versetzen, der die Gelegenheit nutzen wollte, um irgendetwas Persönliches über sie in Erfahrung zu bringen. Aber da war nichts, was einen Hinweis geben konnte, kein privates Foto auf dem Schreibtisch, keine mit Wachsmalstiften gekritzelte Kinderzeichnung an der Wand, keinerlei Informationen darüber, dass sie eine Tochter hatte. Bis auf den gelben Merkzettel neben dem Telefon, schoss es ihr gleich darauf durch den Kopf, da stand Julias neue Handynummer! Verärgert über ihre Nachlässigkeit riss sie den Zettel von der Unterlage und zerknüllte ihn.
Aber er hat die ganze Zeit im Sessel gesessen, versuchte sie sich zu beruhigen, er war nicht am Schreibtisch, er konnte den Zettel nicht gelesen haben. Andererseits war es wahrscheinlich ohnehin kein Problem, irgendetwas über sie herauszubekommen – wenn man lange genug suchte, gab das Internet nahezu jede Information preis, die man haben wollte. Und sie trug nach der Scheidung wieder ihren Mädchennamen, genau wie Julia auch. Damit war es nicht weiter schwierig, irgendwelche Einträge von Julias früherer Schule zu finden, Klassenfotos, Bilder aus dem Abiturjahrgang, von der Abschlussfeier, was auch immer. Jemand brauchte also nur eins und eins zusammenzuzählen und würde sofort wissen, dass sie eine Tochter hatte, mehr noch, auch wie alt diese Tochter war und wie sie aussah.
Andererseits war Merette sich ja noch nicht mal sicher, was sie überhaupt von den Bekenntnissen ihres Patienten halten sollte. Möglich war es tatsächlich, dass er aufgrund seiner psychischen Verfassung einen Mitteilungsdrang entwickelt hatte, der ihn zu diesen völlig unerwarteten Geständnissen veranlasste. Hinzu kam, dass er natürlich wusste, dass sie an ihre Schweigepflicht gebunden war, er damit also jeden Freiraum hatte, den er wollte. Aber irgendetwas an der ganzen Sache war nicht stimmig. Er hatte offensichtlich ein Problem mit Frauen, die er für »clever« hielt, das konnte ihn durchaus auf die Idee gebracht haben, einfach nur seine Macht ihr gegenüber demonstrieren zu wollen. Er wollte sie erschüttern, um zu sehen, wie sie reagierte. Seine Geständnisse waren frei erfunden, weil er auf diese Weise sein eigentliches Minderwertigkeitsgefühl verbergen wollte.
Er war mit ziemlicher Sicherheit ein Soziopath, und damit gehörte er in die Patientengruppe, die ihr immer schon am meisten Angst gemacht hatte. Jemand, der – im Fachjargon – an einer dissozialen und narzisstischen Persönlichkeitsstörung litt, war unberechenbar und im Zweifelsfall gefährlich, weil er, ohne zu zögern, auch zu Gewalttaten neigen würde.
Dass er intelligent war, stand außer jeder Frage, nicht nur wegen des Tests, den Merette in den Akten entdeckt hatte. Sie nahm sich nochmals den Ordner vor, während sie die letzte Zigarette aus der Packung unangezündet zwischen die Lippen schob und Marianne Faithfull sang: »Do you remember me, do you remember anything? File it under fun from the past ...«
Besonders viel »fun« hatte es in diesem Lebenslauf eher nicht gegeben, dachte Merette unbewusst, als sie sich durch die Seiten blätterte.
Vor der ersten Sitzung, von der auch die Aufzeichnung stammte, hatte sie sich nur einen schnellen Überblick verschaffen können. Sie hatte den Fall von einem Kollegen aus der sozialpsychiatrischen Abteilung der Uniklinik übernommen, der aus Krankheitsgründen ausgefallen war. Strenggenommen war es gar kein Fall im therapeutischen Sinn, sondern ein vom Gericht bestellter Betreuer hatte ein psychologisches Gutachten angefordert – und es war angeblich so dringend gewesen, dass ein Aufschub nicht in Frage kam. Merette hatte die entsprechende Akte erst am Vormittag desselben Tages in die Hand bekommen, an dem auch der Termin mit dem Patienten war. Sie war sehr verärgert über diese Schlamperei gewesen, die sie zwang, ohne ausreichende Vorbereitung in das Gespräch zu gehen, und hatte tatsächlich kurz erwogen gehabt, den Termin einfach abzusagen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie genau das auch getan hätte, aber jetzt war es zu spät, um irgendetwas rückgängig zu machen.
Automatisch griff sie nach dem Feuerzeug. Als ihr wieder der Rauch in die Augen stieg, drückte sie die Zigarette ärgerlich aus.
Anders als bei ihrer ersten Durchsicht der Aktennotizen suchte sie diesmal nach einem konkreten Hinweis, der ihr helfen würde, die Zusammenhänge zu erkennen. Eine Art fehlendes Puzzleteil, von dem sie keine Ahnung hatte, wie es aussehen könnte ...
Mutter minderjährig und Heimkind, Vater offiziell unbekannt, aber einem Gerücht zufolge möglicherweise einer der Heimerzieher, der noch während der Schwangerschaft des Mädchens die Arbeitsstelle gewechselt hatte. Der Fall war offensichtlich nicht näher untersucht worden, der Junge wurde gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben, im Alter von fünf Jahren dann vom Jugendamt wegen des Verdachts auf Vernachlässigung wieder aus der Familie genommen, es gab jedoch keine Hinweise auf sexuellen Missbrauch.
In der nächsten Pflegefamilie schien es besser zu laufen, bei den Routinekontrollen wurde nur festgestellt, dass der Junge auffällig still und zurückgezogen war, in der Grundschule war er der typische Einzelgänger, der sich schwer damit tat, Freunde zu finden. Allerdings galt er nach Aussage der Klassenlehrerin bei den Mitschülern als eine Art »Held«, nachdem er mehrere Tage lang eine ertrunkene Katze, die er aus dem Hafenbecken gefischt hatte, von den Lehrern unbemerkt in seiner Schultasche mit zum Unterricht geschleppt hatte.
»Also was jetzt?«, murmelte sie halblaut vor sich hin. »Einzelgänger und keine Freunde oder Klassenheld?«
Kopfschüttelnd las sie weiter.
Seine schulischen Leistungen entsprachen dem Durchschnitt, allerdings beklagte die Klassenlehrerin wiederholt seine nahezu totale Verweigerung gegenüber jeder Art von mündlicher Beteiligung. Dennoch gewann er in der vierten Klasse einen Vorlesewettbewerb mit einer Geschichte, von der sich hinterher herausstellte, dass er sie selbst geschrieben hatte. Die Geschichte wurde dann sogar in der Tageszeitung abgedruckt, die angeheftete Kopie war jedoch bis zur Unkenntlichkeit verblichen, das dazugehörige Foto ließ nur mit Mühe den kleinen Jungen erahnen, der verschüchtert in die Kamera blickte, während er seinen Preis entgegennahm.
Merette machte gar nicht erst den Versuch, den Text entziffern zu wollen, sondern blätterte weiter zu den nächsten Einträgen.
Mit zehn Jahren wechselte er auf ein Gymnasium, dann gab es einen »tragischen Unglücksfall«, seine Stiefschwester war ertrunken, weshalb er die Pflegefamilie verlassen musste und ins Heim kam. Aus dieser Zeit stammte auch der Intelligenztest, den das Jugendamt angeordnet hatte. Das Testergebnis war ebenfalls in Kopie beigelegt, ein IQ von 138, der sie aber nicht weiter verblüffte – sie kannte genug Fälle, bei denen der IQ ihrer Patienten im krassen Gegensatz zu ihrer sozialen Kompetenz stand.
»Wieso gibt es keine Angaben weiter zu diesem Unglücksfall?«, fragte sie laut in die Stille ihres Arbeitszimmers hinein. »Was ist da genau passiert?«
Das Mordgeständnis ihres Patienten bezog sich eindeutig auf dieses Unglück, aber in der Akte fehlte jeder Hinweis auf ein Fremdverschulden.
Der Name, mit dem der letzte Bericht abgezeichnet war, ließ sie unwillkürlich den Atem anhalten. Sie kannte den Namen nur zu gut, Dr. Ingvar Alnæs war wahrscheinlich der einzige Kollege, bei dem sie jemals erwogen hatte, den Psychologenverband einzuschalten, um ihm wegen absoluter Missachtung aller Grundsätze einer Therapie die Zulassung entziehen zu lassen. Sie hatte damals eine junge Frau behandelt, die kurz zuvor einen Suizidversuch unternommen hatte. In den Gesprächen mit der Frau stellte sich heraus, dass sie mehrere Monate bei Alnæs wegen psychischer Probleme und Angstattacken in Behandlung gewesen war, seine Therapie hatte darin gegipfelt, dass er die junge Frau mit einer Klobrille um den Hals durch die Fußgängerzone hatte laufen lassen, um auf diese Weise ihr Selbstvertrauen zu stärken.
Aber dann war Alnæs ohnehin in den Ruhestand versetzt worden, und sie hatte schon seit mehreren Jahren nichts mehr über ihn gehört. Eher abwesend überflog sie noch den knappen Abschlussbericht des früheren Kollegen, der in dem Fazit endete, dass der Patient nicht mehr in eine Pflegefamilie vermittelbar war und demzufolge bis zu seiner Volljährigkeit im Heim bleiben sollte.
Ein Gedanke schoss ihr durch den Kopf, der sie den PC hochfahren und den Namen »Alnæs« eingeben ließ. Sie klickte sich durch verschiedene Einträge, bis sie fand, was sie suchte. Ein kurzer Blick auf die Vita bestätigte den spontanen Verdacht, den sie eben gehabt hatte – Alnæs war als psychologischer Mitarbeiter zunächst in einem Heim gewesen, bevor er ins Jugendamt gewechselt war. Und der Name des Heims war identisch mit eben dem Heim, in dem die minderjährige Mutter womöglich von einem Mitarbeiter geschwängert worden war!
Sieh mal einer an, dachte Merette. Dann hat Alnæs also noch viel mehr Dreck am Stecken, als ich geahnt habe! So wie es aussieht, ist er aller Wahrscheinlichkeit nach der Vater des Jungen, den er dann später für immer ins Heim abgeschoben hat.
Sie überlegte, ob diese Information irgendeine Relevanz für die jetzige Situation haben könnte, kam aber zu keinem Ergebnis. Ich muss mit irgendjemandem reden, dachte sie, ich brauche eine Einschätzung von einer Person, die nicht persönlich beteiligt ist. Während sie schon nach dem Telefon griff, ging sie im Kopf die Liste der Namen durch, die für ein solches Gespräch in Frage kamen. Natürlich konnte sie ihre Supervisorin anrufen und einen kurzfristigen Termin vereinbaren, um ihr Problem zu besprechen. Aber gleichzeitig wusste sie, dass sie bei Birgitta nicht die Antworten bekommen würde, nach denen sie suchte. Es ging um mehr als irgendeinen Fall, bei dem sie keinen Ansatz für die Therapie hatte und nicht weiterkam – es ging um sie selbst und die unbestimmte Angst, die sie verspürte. Die Angst, dass die Andeutungen, die ihr Patient gemacht hatte, tatsächlich eine konkrete Bedrohung darstellten, und zwar womöglich auch für ihre eigene Tochter, für Julia!
Auch wenn sie wusste, dass es bislang keinerlei Zusammenhang gab, ließ sie der Gedanke nicht los, dass Julia in Gefahr war. Vielleicht übertrieb sie auch und sah Gespenster. Vielleicht sollte sie auch alle Bedenken außer Acht lassen und sich direkt an die Polizei wenden – sie wusste es nicht. Sie hatte ein Mordgeständnis auf dem Band und keinerlei Einschätzung darüber, ob die Aussage ernst zu nehmen war. Allein der Gedanke, dass sie einen Fehler machen könnte, ließ sie frösteln.
Jan-Oles Nummer kannte sie auswendig. Noch während ihre Finger die Tasten drückten, überlegte sie, wie sie ihr Gespräch auf eine rein professionelle Ebene lenken könnte. Gleichzeitig wusste sie, dass das nicht möglich sein würde. Aber genau das war auch der Grund, warum sie ihn anrief und nicht Birgitta. Jan-Ole war der Einzige, bei dem sie ihre berufsbedingten Gesprächsmuster außer Acht lassen und stattdessen offen über ihre Angst reden konnte. Vor allem brauchte sie seinen Rat, ob sie Julia noch weiter in ihre Probleme hineinziehen sollte, als es durch den dummen Zufall mit der Bandaufzeichnung vielleicht ohnehin bereits geschehen war.
Er nahm das Gespräch schon nach dem zweiten Klingelton an, allerdings war die Verbindung so schlecht, dass sie ihn kaum verstand.
»Wo bist du?«, rief sie anstelle irgendeiner Form von Begrüßung in den Hörer, »ich hör dich ganz schlecht ...«
»Dänemark, in der Nähe von Kopenhagen. Was ist los, Merette?«
Sie nahm es als selbstverständlich hin, dass er sofort wusste, wen er am Apparat hatte. Sollte er auch, dachte sie noch, bevor ihr einfiel, dass er ihren Namen wahrscheinlich ganz einfach auf dem Display gelesen hatte.
»Merette? Bist du noch dran?«
»Sorry, dass ich dich anrufe, aber ... wie lange bist du noch da in Dänemark?«
»Drei, vier Tage vielleicht. Die ehemaligen Kollegen hier haben mich angefordert, es geht um einen Fall, der schon länger zurückliegt, als ich noch im Dienst war, und jetzt ... Aber egal. Warum rufst du an?«





























