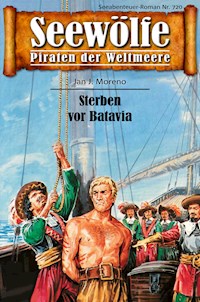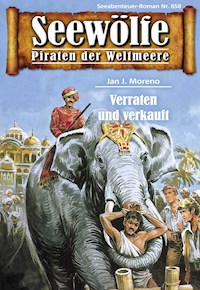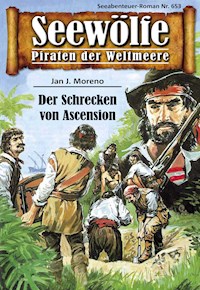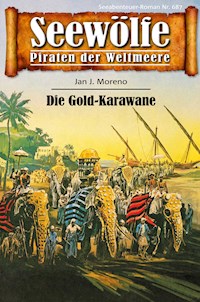Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Der Schamane und die Frau wandten Clint Wingfield, dem Moses der Arwenacks, den Rücken zu. Die Frau wirkte wie eine Schlafwandlerin. Mit eckigen Bewegungen schritt sie in dem Tempelhof auf die Statue zu. Jetzt erst entdeckte der Moses, dass der Schoß der scheußlichen Skulptur wie ein hochlehniger Stuhl geformt war. Ein Thron womöglich. Also wurde die weiße Frau von den Kopfjägern als Göttin angesehen. Hatte sie deshalb zwei Jahre überlebt? Weil ihre helle Farbe und die Länge des Haares die Wilden faszinierten? Clint wartete nicht länger. Knapp zehn Schritte trennten ihn von dem Schamanen. Er umklammerte die Muskete am Lauf und hob sie zum Schlag. Lautlos huschte er näher…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2021 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.eISBN: 978-3-96688-156-2Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Jan J. Moreno
Die weiße Göttinvon Neuguinea
In der Gewalt von Kopfjägern – Clinton setzt alles auf eine Karte …
Der Nebel war ungewöhnlich dicht. Scheinbar von geisterhaftem Leben erfüllt, wogte er durch die Takelage der Schebecke, während die Segel schlaff von den Rahen hingen und nur bin und wieder von schwachen, wellenförmigen Bewegungen durchlaufen wurden. Der Wind hatte nicht die Kraft, den Dunst aufzureißen.
Jedes Geräusch wirkte ungewöhnlich laut. Sogar das dumpfe Gurgeln der Bugsee schwoll zum Dröhnen an. Und das Glasen der Schiffsglocke war vermutlich meilenweit zu hören.
„Die Manila-Galeone hat keinen besseren Wind als wir“, erklärte der Seewolf dem düster dreinblickenden Old O’Flynn. „Die Dons werden also ihren Vorsprung nicht vergrößern …“
Die Hauptpersonen des Romans:
Dom António da Silva – weiß den Arwenacks als Schiffbrüchiger allerlei zu erzählen, und jede Geschichte erscheint phantasievoller als die nächste.
Isabel da Silva – ist bei den Kopfjägern auf Neuguinea zu einer Göttin geworden.
Clint Wingfield – der Moses der Arwenacks möchte nicht gern seinen Kopf verlieren, aber für die Kameraden setzt er ihn trotzdem ein.
Edwin Carberry – möchte den Moses gern in seinen Schutz nehmen, was ihm gründlich mißlingt.
Philip Hasard Killigrew – der Seewolf muß die Waffen strecken, um vielleicht noch eine kleine Chance zu haben.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
1.
Zwei Stunden später wogte der Nebel unverändert dicht über der Arafurasee. Wie die gierigen Fangarme eines aus der Tiefe emporsteigenden Polypen wischten Dunstschwaden über die Decks des Mittelmeerdreimasters, der kaum noch Fahrt lief.
Nur einmal war für wenige Augenblicke über dem Schiff strahlend blauer Himmel sichtbar geworden, danach hatte sich alles wieder grau in grau verhängt. Achteraus senkte sich die Sonne inzwischen der Kimm entgegen, aber nicht mal ein Schimmer verwaschener Helligkeit durchdrang den Nebel.
Old Donegal lehnte mürrisch am Schanzkleid und starrte in den Nebel, als könne er, wenn er nur lange genug daran dachte, die spanische Galeone herbeizaubern.
„Dein Zipperlein hat sich gebessert, Grandad?“
Old Donegal zuckte unwillkürlich zusammen, als er unerwartet angesprochen wurde. Daß sich Philip junior von achtern angeschlichen hatte, war seiner Aufmerksamkeit entgangen.
Aus halb zusammengekniffenen Augen musterte der Alte den Sohn des Seewolfs.
„Ich weiß nichts von einem Zipperlein“, sagte er ärgerlich. „Derartige Gebrechen sind was für Landratten, aber nicht für einen Kerl wie mich.“
„Vor kurzem war anderes zu hören“, erinnerte Philip mit unmißverständlicher Betonung.
Old Donegal wandte sich endgültig um.
„Ein O’Flynn takelt nicht ab“, erklärte er mit eisiger Stimme. „Jedenfalls nicht, bevor ihn Gevatter Tod holt. Merk dir das!“ Da das Grinsen nicht aus Jung Philips Gesicht wich, fügte er ein wenig versöhnlicher hinzu: „Eine gewisse Wetterfühligkeit ist sogar nützlich. Aber das hat absolut nichts mit einem Zipperlein zu tun! Ist das klar?“
„Mir schon“, erklärte Philip. „War ja nur eine Frage.“
Old Donegals Blick wurde mißtrauisch. „Hat dich dein Vater geschickt? Glaubt er, ich sei den Strapazen einer langen Reise nicht mehr gewachsen?“
„Unsinn, Grandad!“ widersprach Jung Philip schroff.
„Was dann? Rück schon heraus mit der Sprache.“
„Mein Vater glaubt, daß der Nebel die Nacht über anhalten wird. Vielleicht entschließt er sich, die Männer an die Riemen zu schicken.“
„Das ist auf keinen Fall verkehrt.“ Old Donegal nickte knapp. „Aber was heißt vielleicht?“
Philip wurde einer Antwort enthoben, denn in dem Moment erklang Carberrys Weckruf unter Deck. Der Profos schickte die Männer der Freiwache nach oben.
Neben den Stückpforten aus dem Oberdeck der Schebecke gab es eine Vielzahl kleinerer Öffnungen für die langschäftigen Riemen. Das Schiff war also nicht nur unter Segeln überaus schnell, es bot auch bei Flaute unschätzbare Vorteile, von einer besseren Manövrierfähigkeit auf engem Raum ganz abgesehen.
Die halbe Crew stand an Deck und pullte. Schon nach kurzer Zeit lief die Schebecke knapp zwei Knoten Fahrt. Das Gurgeln unter dem scharf gehöhlten Vorsteven vermischte sich mit dem Plätschern der gleichmäßig eintauchenden Riemen.
Die hereinbrechende Nacht verschlechterte die Sichtverhältnisse nur unwesentlich. Dan O’Flynn, Old Donegals Sohn, verharrte stundenlang fast unbewegt auf der Back und blickte voraus. Er, der Mann mit den schärfsten Augen der Crew, hätte Hindernisse schneller als jeder andere melden können. Doch alles blieb ruhig.
Nach vier Stunden wurden die Männer an den Riemen abgelöst. Die Schebecke glitt gleichmäßig über das nahezu unbewegte Wasser, das zeitweise wie flüssiges Blei schimmerte.
Kurs Ostnordost lag an. Wahrscheinlich hatte das Schiff die Höhe von Kap Vals schon hinter sich gelassen und glitt parallel zur Küste in Richtung Komoran. Die Distanz zum Land war nur schwer zu schätzen. Hasards Logbucheintragung bezifferte sie auf mindestens zehn Seemeilen.
Kurz nach Mitternacht erklangen die Schreie von Möwen. Niemand sah die Vögel, aber ihre Anwesenheit verriet zumindest die Nähe von Land.
Vorsichtshalber befahl der Seewolf eine Kursänderung um ein Strich nach Steuerbord, obwohl danach die Strömung ungünstiger auflief.
Zum erstenmal seit endlos langen Stunden schlugen die Segel. Doch nur für wenige Augenblicke, danach hing das Tuch wieder schwer von den Rahruten. Der Nebel kondensierte und tropfte in dünnen Rinnsalen auf die Planken.
Der Bö folgte eine zweite, die den Dunst aufriß und in unmittelbarer Nähe der Schebecke verwirbelte. Noch sprang der Wind aber hin und her wie ein junges Fohlen und vereitelte jeden Versuch, die Segel zu trimmen.
Die brechenden Wellen zeigten schwache, glasig schimmernde Schaumköpfe.
Gegen drei Uhr blieb der Wind endlich konstant und drehte auf Südsüdwest bis Süd. Die Riemen wurden nicht mehr gebraucht und von den Arwenacks entlang des Schanzkleides verstaut.
Dan O’Flynn, der die Nacht über kein Auge zugetan hatte, enterte in die Tonne am Großmast auf.
„Von oben erkenne ich mehr als von der Back aus“, sagte er zu Hasard. „Unmittelbar über dem Wasser ist der Nebel am dichtesten.“
„Anschließend verholst du in die Koje!“ befahl der Seewolf. „Wahrscheinlich übersieht nur ein Blinder, daß du dich kaum noch auf den Beinen halten kannst.“
Dan unterdrückte ein Gähnen und rieb sich die geröteten Augen, die seine Erschöpfung widerspiegelten.
„Aye, Sir!“ sagte er. „Sobald die Dämmerung einsetzt, lege ich mich aufs Ohr.“
Nicht ganz so geschmeidig wie sonst enterte er über die Großwanten auf und schwang sich in die Ausgucktonne, deren Boden von der sich niederschlagenden Feuchtigkeit kaum weniger rutschig war als die Decksplanken.
Das Spektiv vor Augen, richtete Dan seine Aufmerksamkeit überwiegend leewärts.
Die ersten Sterne wurden sichtbar, begannen aber zugleich zu verblassen. Das Firmament, von samtener Schwärze, überzog sich mit dem fahlen Grau des beginnenden Morgens.
Keine Viertelstunde verbrachte Dan O’Flynn in luftiger Höhe, als er mit sichtlicher Eile wieder abenterte.
„Ein Lichtschein über der See“, meldete er. „Etwa zwanzig Grad Backbord voraus!“
Damit war klar, warum er seine Entdeckung nicht lauthals verkündet hatte.
„Die Galeone?“ fragte Hasard.
Dan zuckte mit den Schultern. „Wenn sich kein anderes Schiff vor der Halbinsel herumtreibt … Ich konnte nicht mehr erkennen als die schwach blakende Laterne. Die Entfernung beträgt ungefähr eine Meile.“
Der Seewolf nickte knapp.
„Geh unter Deck und hole die Zwillinge und Al Conroy“, sagte er ebenfalls im Flüsterton. „Ich will das Schiff gefechtsklar haben.“
Wenig später war auch die Crew an Deck versammelt. Sogar Plymmie, die Wolfshündin, hetzte einen der Niedergänge hinauf.
„Wehe, wenn du bellst“, raunte ihr Jung Hasard zu. Aber Plymmie verharrte nur wie angewurzelt neben der Kuhlgräting und zog nach einer Weile die Lefzen hoch. Möglicherweise witterte sie schon die Spanier, obwohl von Deck aus immer noch nichts zu sehen war.
Gemeinsam klarierten Al Conroy und Hasards Söhne die sechs Culverinen der Backbordseite. Sie verzichteten darauf, Kohlebecken aufzustellen und Sand über die Planken zu verteilen. Vermutlich würde eine einzige gut gezielte Breitseite genügen, die Spanier zu demoralisieren. Da die Schebecke ohne Positionslaternen segelte, mußte der Überfall die Dons wie ein Blitz aus heiterem Himmel treffen.
Die Entermannschaften bereiteten sich vor. Ferris Tucker, Batuti, Shane und der Moses mannten neben den Blankwaffen Pistolen, Musketen und die bewährten Höllenflaschen an Deck, deren Pulver- und Schrotladungen auf engem Raum verheerende Wirkung erzielten. Nacheinander erhielt der Seewolf Klarmeldungen von Back, Kuhl und Achterdeck.
Carberry reckte erwartungsvoll das Rammkinn, als er sagte: „Für Königin Elisabeth von England und Don Juan de Alcazar von Spanien.“
„Das klingt, als würdest du Juan gern als Nachfolger König Philips des Dritten sehen“, sagte Ferris Tucker.
„Warum nicht?“
„Hast du wirklich darüber nachgedacht, was das für uns bedeuten würde?“
„Einige Erleichterungen, denke ich“, sagte der Profos.
Seine Miene wurde länger, als der Schiffszimmermann entschieden den Kopf schüttelte, und sie verdüsterte sich schlagartig, als Ferris erklärte: „Keinen Raid mehr, bei dem wir die Dons gehörig aufs Kreuz legen können, keine Prügeleien mit Offizieren und Seesoldaten, kein …“
„Hör auf!“ unterbrach Carberry schroff. „Das ist ja nicht anzuhören.“
Der Nebel löste sich inzwischen großflächig auf. Unvermittelt war auch von Deck aus ein fahles Licht zu erkennen. Die Hecklaterne einer Galeone war es jedoch nicht, dazu hing es viel zu tief über dem Wasser.
„Ein Fischerboot“, meinte Dan. „Wahrscheinlich ist es nicht größer als eine Jolle. Aus der Höhe war das zuvor nicht abzuschätzen.“
Die Schebecke hielt genau darauf zu.
Nach wenigen Augenblicken tauchten die Umrisse einer Jolle aus dem Dunst auf.
Das Boot war groß genug, um zwölf Männern Platz zu bieten. Mit schlecht getrimmtem Segel lag es annähernd auf Nordostkurs.
Carberry pfiff überrascht durch die Zähne, als er die fünf Männer entdeckte, die jeder wie ein Häufchen Elend auf den Duchten kauerten. Ihrerseits hatten sie die Schebecke ganz sicher noch nicht bemerkt.
„Die sind arglos“, raunte Batuti. „Es scheint, als wären sie schon länger als einige Tage auf See.“
Mit schäumender Bugwelle schloß die Schebecke auf. Bei einer Distanz von nur noch fünfzig Yards hob endlich einer der Männer in der Jolle den Kopf. Carberry hätte schwören können, daß der Kerl aus schreckgeweiteten Augen die Schebecke anstarrte. Immerhin griff er unter sich, zerrte eine Muskete unter der Ducht hervor und drückte ab, ohne sich vorher der Mühe zu unterziehen, wirklich genau zu zielen.
Aber nichts geschah, die Muskete versagte. Entweder war das Pulver naß geworden, oder der Mann hatte vergessen, die Waffe zu laden. Die Art und Weise, wie er sofort mit dem Ladestock im Lauf herumstocherte, ließ darauf schließen.
Seine Gefährten, die endlich aus ihrer Lethargie aufschreckten, redeten wild gestikulierend aufeinander ein. Die einen schienen ihr Heil in der Flucht suchen zu wollen, die anderen deuteten aufgeregt zu der Flagge Englands, die im Topp der Schebecke flatterte. Eine besonders glückliche Figur machte keiner der fünf.
Der Seewolf preite zu ihnen hinüber: „Wenn ihr Hilfe braucht, nehmen wir euch an Bord!“
Er bediente sich des Englischen, seiner Muttersprache, zumal er noch nicht abzuschätzen vermochte, mit welchen Landsleuten er es zu tun hatte. Einige der Männer in der Jolle wirkten zwar südländisch, konnten aber ebensogut Franzosen oder Holländer sein.
Endlich begann einer von ihnen, das Segel zu fieren. Das Boot verlor daraufhin rasch an Fahrt.
Gleichzeitig ging die Schebecke mit dem Heck durch den Wind, Besan und Großsegel wurden aufgegeit. Sie näherten sich der Jolle in Lee bis auf wenige Yards.
„Wir haben nichts gegen Engländer in diesen Gewässern!“ rief der Mann, der das Segel eingeholt hatte, in schlechtem Englisch. Er war gut sechs Fuß groß und wirkte außergewöhnlich kräftig. Ein verwilderter Bart umrahmte sein kantiges Gesicht. Ebenso wie das kurzgeschnittene Haupthaar war der Bart von der Sonne und Salzverkrustungen gebleicht.
Hasard sah zu, wie von der Kuhl aus Belegleinen und die Jakobsleiter ausgebracht wurden.
„Sie sind Spanier?“ fragte er, nicht eben sonderlich begeistert. Der Akzent des Mannes ließ kaum einen anderen Schluß zu.
„Portugiesen!“ lautete die prompte Antwort. „Ich bin Dom António da Silva, Kapitän der ‚O menino‘.“
„Philip Hasard Killigrew“, sagte der Seewolf. „Mein Schiff hat leider keinen Namen.“
Die letzte Feststellung veranlaßte Dom António, erstaunt die Augenbrauen hochzuziehen. Er schwieg jedoch, denn er hatte plötzlich genug damit zu tun, das Gleichgewicht zu halten, und das lag vor allem daran, daß seine Begleiter ein wenig zu heftig nach den Leinen griffen. Für einen Moment schwankte die Jolle bedrohlich, dann krachte sie hart gegen die Bordwand der Schebecke.
Einige Arwenacks feixten ob dieser seemännischen Meisterleistung.
Als die Portugiesen aufenterten, zeigte sich endgültig, daß sie ihre Bewegungen nicht mehr ganz unter Kontrolle hatten.
„Die Kerle sind stockvoll“, sagte Carberry und traf damit den Nagel auf den Kopf.
„Gerettet“, stammelte der erste. Er taumelte Stenmark geradewegs in die Arme. Als ihm der blonde Schwede mit einigem Nachdruck die flache Hand ins Gesicht setzte, stieß er lediglich noch einen abgrundtiefen Seufzer aus und verdrehte die Augen. „Ich habe den Schatz gefunden“, war das letzte, was er hervorbrachte, bevor er zusammensackte.
Stenmark fing ihn auf, reichte ihn an den Kutscher und Mac Pellew weiter, und Mac diagnostizierte mit Kennermiene: „Bezecht, der Bursche. Er stinkt wie ein abgestandenes Rumfaß.“ An den Kutscher gewandt, jedoch noch so laut, daß es die Umstehenden hören konnten, fügte er scheinheilig hinzu: „Wir können nur hoffen, daß das Beispiel nicht abfärbt.“
2.
Die Gewißheit, an Bord des englischen Schiffes in Sicherheit zu sein, ließ alle Anspannung von den Portugiesen abfallen und einer tiefen Erschöpfung weichen. Lediglich Dom António hielt sich noch auf den Beinen und stand dem Seewolf Rede und Antwort.
Es stellte sich heraus, daß die fünf Portugiesen in der Tat Schiffbrüchige waren. Piraten hatten ihr Schiff, die „O menino“, vor der Küste von Trangan, der größten der nordwestlich gelegenen Aru-Inseln aufgebracht und nach einem erbitterten Gefecht versenkt.
Das war vor sieben Tagen gewesen.
Aufziehender Nebel hatte die Jolle während der ersten Nacht verborgen, am Morgen hatten sich die Portugiesen jedoch auf offener See befunden, ohne die Möglichkeit einer genauen Positionsbestimmung und nur auf den Stand der Sonne angewiesen.
„Schon am zweiten Tag war unser Trinkwasser verbraucht“, berichtete Dom António. „Umkehren konnten wir nicht, weil wir womöglich erneut den Piraten in die Hände gefallen wären. Also blieb uns keine andere Wahl, als auf gut Glück nach Südosten zu kreuzen. Die Halbinsel Kolepom konnten wir wohl am schnellsten erreichen.“
Er nickte dankbar, als ihm der Kutscher eine Muck voll Wasser sowie Zwieback und Pökelfleisch hinstellte.
„Meine Männer sind ebenfalls versorgt?“ fragte er nach einem ersten kräftigen Schluck, bei dem er so hastig trank, daß ihm das Wasser durch den Bart rann.
„Sie schlafen ihren Rausch aus“, antwortete Mac Pellew. „Euch hat es gehörig erwischt.“
„Nur der Rum hielt uns am Leben“, erklärte Dom António. „Es war wohl eine Fügung des Schicksals, daß wir vier Fäßchen an Bord hatten.“
„In den sieben Tagen fiel kein einziger Tropfen Regen?“ fragte Ben Brighton.
„Hm“, erwiderte der Portugiese mit vollem Mund. Der Zwieback war nicht mehr der Beste, denn Mac Pellew hatte bereits einige der unvermeidlichen Maden herausgeklopft, aber das störte ihn herzlich wenig. „Nebel zog häufig auf, aber nicht eine Wolke.“