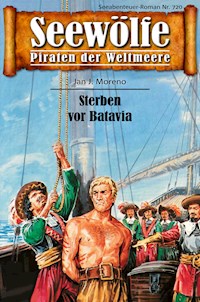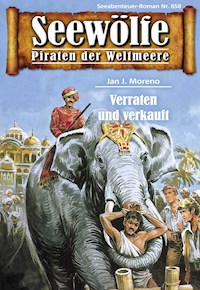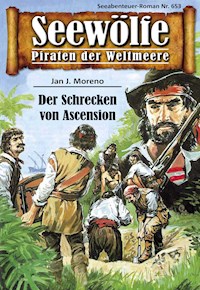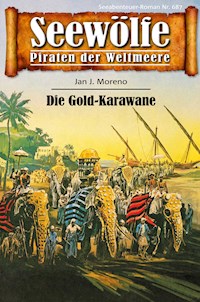Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Der Teniente fintierte mit dem Degen und wollte mit dem Dolch zustoßen, den er in der Linken hielt, doch Hasard umklammerte sein Handgelenk. Ihre Klingen rutschten bis zum Handschutz übereinander. Doch dann mußte der Teniente zurückweichen, wollte er sich nicht selbst mit dem Dolch verletzen. Er brachte das Spill zwischen sich und seinen Gegner. Schweiß rann ihm in die Augen und brannte wie Feuer. Er reagierte hektischer und stieß blindwütig zu. Urplötzlich war da ein kurzer stechender Schmerz in der linken Brust. Erst wollte er ihn ignorieren, doch dann konnte er den Arm nicht mehr heben. Wie durch einen dichter werdenden Schleier sah er, daß der Seewolf den Degen sinken ließ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2021 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.eISBN: 978-3-96688-161-6Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Jan J. Moreno
Draufgänger
Todesmutig greifen die Spanier an
Als José Ramón, von gräßlichen Schmerzen gepeinigt, die Augen aufschlug, wußte er nur eines: Die Hölle hatte sich aufgetan und von einem Moment zum anderen die „Soberania“ in tausend Stücke gerissen und verbrannt.
José Ramón schrie, brach aber gleich darauf nach Atem ringend ab.
Erstickend lastete der Gestank von Pech und Schwefel über der See. Ringsum tobte ein Flammenmeer.
Das Fegefeuer konnte nicht schlimmer sein …
Die Hauptpersonen des Romans:
José Ramón – überlebt den Untergang der „Soberania“, aber sein Haß auf die englischen Piraten verlangt nach Rache.
Don Bartolomeo de Zumarraga – der Kapitän der Manila-Galeone schwankt zwischen Flucht und Angriff und entscheidet sich für einen Mittelweg.
Pablo Barroso – der Teniente meldet sich zu einem Himmelfahrtskommando, und das wird es dann auch.
Old Donegal O’Flynn – hat Gelegenheit, wieder einmal einen überraschenden Schuß aus seinem Holzbein anzubringen.
Philip Hasard Killigrew – fordert seinen Gegner auf, die Flagge zu streichen, aber der gibt nicht auf.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
1.
Wieder schoß in allernächster Nähe eine Feuersäule in den Nachthimmel. Das dumpfe Dröhnen der Explosion wich jedoch sofort einer unerklärlichen Totenstille. Sogar als danach die brennenden Dauben des detonierten Pulverfasses und andere Trümmerstücke abregneten, geschah das für Ramón in absoluter Lautlosigkeit. Der Gedanke, für immer taub zu sein, entsetzte ihn. Er hielt ungewollt in seinen Schwimmbewegungen inne und sackte prompt ab.
… eine schönere Welt erwartete ihn. Die wohlige Wärme eines sonnenüberfluteten Strandes und das Rauschen des warmen Windes in den hohen Palmen versprachen ein sorgloses Leben. Willig gab sich Ramón der sanften Dünung hin, die ihn zunehmend schneller an Land trug.
Aber ebenso plötzlich zogen dunkle Wolken auf. Ein Tropengewitter entlud sich mit heftigem Donner, und eine wahre Sintflut drohte ihn zu ersticken.
Das Rumoren des Gewitters wurde zum Pochen des Blutes in seinen Schläfen …
… und das Wasser war überall.
Im ersten Schreck unfähig zu begreifen, begann Ramón mit Armen und Beinen um sich zu schlagen. Er spürte nicht, daß er die Wasseroberfläche durchbrach, doch als ihn ein sengender Gluthauch traf, schnappte er gierig nach Luft.
Der Rauch reizte zum Husten. Tränen schossen in seine Augen und wurden vom Wasser der Bucht weggespült, das salziger zu sein schien als weiter draußen im Meer.
Wassertretend hielt sich der Spanier an der Oberfläche. Zugleich kämpfte er gegen ein erneut aus seinem Innern aufsteigendes Trugbild an, das ihm eine friedvollere Umgebung vorgaukeln wollte. Er wußte, daß er unweigerlich ertrinken würde, sobald er sich der verlockenden Vision hingab.
Der Feuerschein des brennenden Wracks und der vielen, auf dem Wasser treibenden Trümmer verhinderte eine Orientierung. Die „Soberania“ war von der Wucht der explodierenden Pulverkammer zerfetzt worden. José Ramón interessierte im Moment nicht, wie viele Männer wohl wie er den Angriff der Engländer überlebt hatten. Er mußte den Strand erreichen, bevor ihn womöglich die Piraten auffischten oder Haie im Wasser treibende Leichen witterten und ihr grausiges Mahl hielten.
Ramón zitterte wie Espenlaub. Daran war jedoch weniger die Wassertemperatur schuld, als vielmehr eine innere Kälte, die um so deutlicher wurde, je mehr seine Anspannung und das Entsetzen über den furchtbaren Angriff nachließen. Die Furcht saß ihm im Nacken.
Er suchte den Dreimaster der Engländer, konnte das Schiff aber zumindest in seiner Nähe nicht entdecken. Auch die „Mar adentro“, die Manila-Galeone, war verschwunden. Wahrscheinlich hatten die beiden Beamten der Casa unter dem Eindruck des Geschehens die Flucht befohlen. Von ihnen durfte Ramón keine Hilfe erwarten.
Allmählich kehrte sein Gehör zurück. Das Plätschern der Wellen vermischte sich mit dem Prasseln des Feuers und der gurgelnd in das Wrack einströmenden See. Was nicht von den Flammen vernichtet wurde, war im Begriff, auf Tiefe zu gehen.
Unvermittelt stieß Ramón gegen etwas Weiches. Ein bleiches, verzerrtes Gesicht tauchte vor ihm auf. Leblose, weit aufgerissene Augen schienen ihn durchdringend anzustarren. Der Mund des Toten war wie zum Schrei geöffnet.
José Ramón stieß ein halb ersticktes Gurgeln aus und schob den Leichnam zur Seite. Der Mann hatte zu den Geschützbedienungen gehört und war offenbar von den Splittern eines krepierenden Rohres getötet worden. Aber vielleicht war es falsch, die Toten zu bedauern. In einem Anflug von Ironie fragte sich Ramón, ob womöglich den Überlebenden ein weitaus schlimmeres Schicksal bevorstand als ein schneller Tod.
Der flackernde Feuerschein wurde schwächer, als Teile des Wracks wegsackten. Der Wind trug dem Spanier englische Satzfetzen zu, und endlich entdeckte er die Silhouette der Schebecke, die mit halb aufgegeiten Segeln rund dreihundert Yards seewärts stand. Es sah nicht so aus, als wollten die Piraten die Verfolgung der „Mar adentro“ aufnehmen.
Auch in unmittelbarer Nähe der Schebecke trieb brennendes Holz auf dem Wasser.
Waren die Engländer nicht ungeschoren geblieben? Diese Vermutung erfüllte Ramón mit grimmiger Genugtuung. Falls sich eine Gelegenheit bot, die Heimtücke der Inglése mit gleicher Münze zurückzuzahlen, würde er nicht zögern.
Aber dafür war später genügend Zeit, sobald die Wachsamkeit der Piraten nachließ. Zuallererst mußte er sich darum kümmern, daß er festen Boden unter die Füße kriegte. Der Strand zeichnete sich bereits als dunkle Linie über dem Wasser ab.
Mit gleichmäßigen Schwimmbewegungen strebte Ramón in die Richtung, in die ihn auch die schwache Strömung trieb.
Allmählich erloschen die letzten Brandherde, die Nacht senkte sich endgültig über die Bucht. Fahler Sternenschein ließ es jedoch nicht völlig dunkel werden.
Die Schebecke der Piraten verschmolz mit der Finsternis. Keiner der Bastarde steckte eine Laterne an. Aber auch die Manila-Galeone blieb ohne Hecklaterne in der Nacht verschwunden.
Was Ramón bis eben noch für die Küstenlinie gehalten hatte, entpuppte sich jetzt als eine der im Wasser treibenden kleinen Buschinseln. Nur im Schutz dieser verfilzten Dickichte, die wohl von dem gewaltigen Meeressog losgerissen worden waren, der die „Mar adentro“ und die „Soberania“ auf den Strand geworfen hatte, war den Engländern der Angriff geglückt. Im nachhinein verstand Ramón überhaupt nicht, wieso die Mannschaften beider Galeonen so unvorsichtig gewesen waren. Aber hinterher war man eben immer klüger.
Starke Äste hingen von der Insel herunter. Ramón konnte sich an ihnen hochziehen und lag Augenblicke später mit dem Oberkörper auf einem schwankenden Geflecht aus den verschiedensten Pflanzen. Wurzeln und lehmiges Erdreich bildeten einen recht stabilen Untergrund.
Vier bis fünf Schritte maß die unregelmäßig geformte Insel in der Länge. Die Kadaver zweier größerer Fische hingen zwischen den Ästen fest. Als Ramón die stinkenden Überreste ins Wasser werfen wollte, zischte ihn eine Schlange an. Er schaffte es gerade noch, die Hand vor dem zupackenden Reptil zurückzuziehen.
Ob das Biest giftig war, wußte er nicht – ebensowenig, ob vielleicht weitere Schlangen das dichte Gestrüpp bevölkerten. Jedenfalls packte er entschlossen zu, wirbelte das Tier am Schwanz herum und schleuderte es weit von sich.
Zugleich spürte er, wie ihm schwarz vor Augen wurde. Gegen die quälende Übelkeit ankämpfen, konnte er nicht mehr. Mit einer letzten verzweifelten Anstrengung, bevor ihm endgültig die Sinne schwanden, zog er sich vollends auf das armselige Stückchen Land hoch.
Im Unterbewußtsein spürte José Ramón die sanft wiegende Bewegung der Buschinsel, die aber nicht stark genug war, ihn wachzurütteln. Nach einiger Zeit glitt er aus der Bewußtlosigkeit in einen kaum weniger tiefen, traumlosen Schlaf hinüber.
Später veränderte sich das Gurgeln und Glucksen des Wassers unter der Insel. Vorübergehend wurde es hektischer, und das Schaukeln verstärkte sich, danach klang die Tonlage heller, bis irgendwann die Wellen kaum noch wahrnehmbar waren.
Das verfilzte Stückchen Vegetation, das unter der Einwirkung des Seewassers abzusterben begann und inzwischen mehr schmutzige Farbtöne als saftiges Grün erkennen ließ, hatte sich auf dem Sandstrand verfangen und fiel wegen der zurückgehenden Flut rasch trocken.
Die Bucht war mit Wrackstücken übersät, die deutlich die Grenze des höchsten Wasserstandes erkennen ließen.
José Ramón vermochte später nicht zu sagen, was ihn aufgeweckt hatte, ob das Ausbleiben der steten Bewegung oder die erneute Stille – jedenfalls fühlte er sich, als er die Augen aufschlug, immer noch matt und zerschlagen, als hätte er etliche schlaflose Tage und Nächte hinter sich. Die nassen, nur langsam trocknenden Plünnen klebten unangenehm am Körper und schürften die Haut auf.
Der Himmel hatte sich inzwischen mit jenem fahlen Grau überzogen, das die Sterne verblassen ließ und den nahenden Morgen ankündigte. Die Dämmerung, bevor die Sonne als glühender Feuerball über die Kimm stieg, war ungefähr zehn Breitengrade südlich des Äquators nicht besonders ausgeprägt.
Ramón schaute den Möwen hinterher, die kreischend dicht über ihn hinwegzogen. Knapp eine halbe Meile vor der Küste, in der Morgendämmerung rasch deutlicher zu erkennen, ankerte die Schebecke der Engländer. Von der Manila-Galeone war hingegen weit und breit keine Spur. Capitán Caballero Don Bartolomeo de Zumarraga hatte es wirklich vorgezogen, sein Heil in der Flucht zu suchen, nachdem innerhalb kürzester Zeit beide Begleitschiffe von den Piraten zu den Fischen geschickt worden waren.
José Ramón entsann sich, daß er schon während der Nacht vermutet hatte, die Schebecke könnte ihrerseits bei dem Angriff auf die „Soberania“ beschädigt worden sein. Da der Dreimaster nach wie vor in unmittelbarer Küstennähe lag, schien sich der Verdacht zu bestätigen.
„Don Bartolomeo ist ein Narr“, murmelte Ramón zornig im Selbstgespräch. „Und die beiden Casa-Beamten sind es nicht weniger. Sie könnten sich keine bessere Gelegenheit wünschen, die Übergriffe der Inglése zu vergelten, aber statt anzugreifen, ziehen sie den Schwanz ein und kneifen.“
Er war wütend darüber, daß ihn die eigenen Landsleute im Stich ließen. Den Rest seines Lebens hatte er sich anders vorgestellt als auf einer einsamen Insel fernab jeder Zivilisation. Vorübergehend verstieg er sich in den wüstesten Beschimpfungen, mit denen er gleichwohl die Engländer wie auch die Schiffsführung der „Mar adentro“ bedachte.
Danach war ihm leichter zumute. Vielleicht, sagte er sich, war alles doch nicht so schlimm, wie es den Anschein hatte. Immerhin hatte er die Explosion der „Soberania“ überlebt, und wenn es einer schaffte, dann wahrscheinlich auch andere. Gemeinsam konnten sie innerhalb kürzester Zeit aus den angeschwemmten Trümmern ein Floß zimmern und die Insel verlassen.
Eine Gefahr, entweder zu verhungern, oder, obwohl ringsum vom Meer umgeben, zu verdursten, bestand nicht. Am Strand wuchsen Kokospalmen, und landeinwärts gab es eine üppige Vegetation. Die Bucht war reich an Fischen, und wo dichter Regenwald wuchs, regnete es dementsprechend häufig. Wahrscheinlich entsprangen auf der Insel mehrere Süßwasserquellen am Fuß der nach Osten ansteigenden Berge.
Die ersten Sonnenstrahlen zuckten über das Firmament. Der anbrechende Morgen zeigte dem Spanier, wie heftig die Explosion der „Soberania“ wirklich gewesen war – der Strand, so weit er ihn von seinem Standort aus überblicken konnte, und die Bucht waren von Trümmern übersät. Die detonierende Pulverkammer hatte das Achterkastell abgesprengt und über gut zwei Kabellängen an Land geschleudert.
„Mein Gott!“ José Ramón bekreuzigte sich, als er die beiden Toten entdeckte, die mit schrecklich verdrehten Gliedmaßen zwischen den Uferfelsen hingen. In ihren Körpern schien kein Knochen mehr heil zu sein.
Er selbst konnte von Glück reden, daß ihn schon die Druckwelle der von den Engländern gezündeten Pulverfässer über Bord befördert hatte. Wäre er nicht rechtzeitig im Wasser gelandet, hätte es ihn wahrscheinlich ebenso erwischt wie die beiden Toten.
Was beabsichtigten die verdammten Piraten? Ihr Schiff wirkte verlassen – zumindest konnte Ramón nicht erkennen, daß an Deck gearbeitet wurde. Seine Augen begannen zu tränen, sobald er länger über die in der Morgensonne gleißende Wasserfläche starrte. Bestand die Möglichkeit, daß ihn die Inglése bereits durch ihre Spektive entdeckt hatten? Ihnen traute er jede Gemeinheit zu.
Er brauchte Waffen, zumal nicht mal ein Messer in seinem Gürtel steckte. Deshalb ließ er sich von der Buschinsel, die ihn vor dem Ertrinken bewahrt hatte, ins seichte Uferwasser gleiten. Das seltsame, einer Laune der Natur zu verdankende Gebilde, zeigte inzwischen Auflösungserscheinungen. Wahrscheinlich würden diese kleinen, vom Seebeben irgendwo losgerissenen Inseln bald auseinanderfallen.
Das Wasser reichte Ramón gerade noch bis an die Hüften. Er brauchte nicht zu schwimmen, mußte allerdings darauf achten, daß er nicht in die deutlich erkennbaren Seeigelkolonien trat.
José Ramón watete im Sichtschutz der Buschinsel an Land. Die Flut hatte viel von der „Soberania“ angespült, angefangen mit zersplitterten oder verkohlten Planken über zerschlissenes Segeltuch bis hin zu den persönlichen Habseligkeiten der Mannschaft.
Etwas mehr als vierzig Schritte weiter draußen trieb noch eine Seemannskiste in der schwachen Brandung. Nur der verschlossene, gewölbte Deckel und lediglich eine Handbreite der Kiste selbst waren zu sehen, was vermuten ließ, daß sie mit allen möglichen Utensilien gefüllt war.
Obwohl er vielleicht Waffen finden würde, verzichtete Ramón darauf, die Kiste zu bergen. Das Risiko, von den Piraten gesehen zu werden, erschien ihm größer als der mögliche Nutzen.
Zwei Tote hatte er schon entdeckt, ein Dritter lag bäuchlings im seichten Uferwasser. Sein schulterlanges Haar und die Arme bewegten sich im Rhythmus der auflaufenden sanften Wellen. Ramón bückte sich und drehte den Mann um. Er hatte zu den Geschützmannschaften gehört, ein kräftiger, untersetzter Bursche, der es im Kampf stets mit mehreren Gegnern zugleich hatte aufnehmen können.
Dennoch war er nun tot – wie wohl die meisten der „Soberania“. Von einigen Brandwunden an seinen Oberarmen und dem nackten Oberkörper abgesehen, die jedoch keineswegs vom Überfall der Engländer herrühren mußten, sondern vermutlich eine Folge seiner Tätigkeit als Kanonier waren, wies er keine äußerlichen Verletzungen auf.
Ramón blickte in weit aufgerissene starre Augen, in denen sich noch das Entsetzen spiegelte. Auch ohne die Kenntnisse eines Feldschers erkannte er, daß der Mann ertrunken war.
Ein zweischneidiger Dolch steckte in seinem Gürtel. José Ramón nahm die Klinge ebenso an sich wie die Steinschloßpistole, die der Tote in einem breiten Brustgurt getragen hatte. Zu seinem Bedauern stellte er jedoch fest, daß die Pistole abgefeuert und danach nicht mehr neu geladen worden war. Vielleicht hatte der Mann auf die Engländer geschossen, unmittelbar bevor sich die Ereignisse überstürzt hatten. Pulver und Blei trug er leider nicht bei sich.