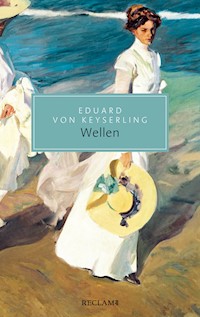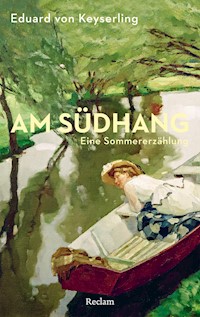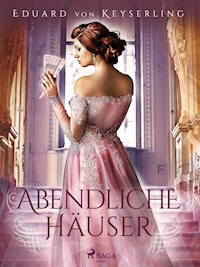0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Keyserling bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Der reiche Beinahe-Autor Magnus von Brühlen will zur schriftstellerischen Fingerübung ein Tagebuch mit seinen "Liebeserfahrungen" verfassen. Nur leider scheitert er allzu oft an verpassten Gelegenheiten. Eine lakonisch-nüchterne Novelle mit ironischen Spitzen, die schon ins Sarkastische reichen – mithin ein eher ungewohnter Keyserling. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eduard von Keyserling
Seine Liebeserfahrung
Eduard von Keyserling
Seine Liebeserfahrung
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: S. Fischer, Berlin, 1909 (92 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962814-42-7
null-papier.de/katalog
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Keyserling bei Null Papier
Fräulein Rosa Herz
Wellen
Beate und Mareile
Seine Liebeserfahrung
Dumala
Abendliche Häuser
Schwüle Tage
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Seine Liebeserfahrung
3. August 1900
Jetzt musste ich das Buch schreiben, ich fühlte es deutlich. Die Gedanken begannen schwer in mir zu werden, zu drücken, wie reife Früchte auf die Zweige drücken. Mit 32 Jahren ist eine Entwicklung nicht abgeschlossen. Der Strich, den ich jetzt unter meine Weltanschauung setzen muss, muss noch nicht definitiv sein. Allein etwas ist fertig in mir und will hinausgestellt sein, will als ein anderes neben mir stehen. Ich muss es auf die Arme nehmen, wie die Mutter das Kind, das sie geboren hat.
Gut! Ich wollte mein Buch schreiben und richtete mein Leben danach ein. In solchen Zeiten müssen wir unser Leben so ordnen, wie es Frauen tun, die guter Hoffnung sind und wissen, dass sie nun nicht mehr nur für sich allein leben. Der Hochsommer ist eine günstige Jahreszeit. Die Straße vor meinen Fenstern ist still und voll grellgelben Sonnenscheins. Hunde liegen auf den heißen Steinen, strecken alle Viere von sich und schlafen. Kinder sitzen auf den Schwellen der Haustüren, die Hände um die nackten Beine geschlungen und sind in der Hitze auch still und schläfrig geworden. Die wenigen Passanten drücken sich die schmalen Schattenstreifen an den Dachvorsprüngen entlang. Dieser unerträglich flimmernden Welt mit ihrem heißen, unreinen Atem seh’ ich es sofort an, dass ich in ihr nichts zu versäumen habe.
Ich ziehe die gelben Vorhänge vor mein Fenster, das gibt eine angenehme goldige Dämmerung. Hie und da sticht durch eine Spalte ein scharfer, blanker Sonnenstrahl in die Dämmerung, und in diesem Sonnenstrahl kreisen einige Fliegen brummend und unermüdlich umeinander.
Ich höre das gern. Diese endlose übellaunige kleine Geschichte, die sie sich erzählen, beruhigt mich. Im Klub hatte ich gesagt, dass ich verreise. Josef hatte den Befehl, keinen Besuch vorzulassen. Die meisten waren ja ohnehin fort aus der Stadt, wer sollte kommen! Mit Frau Meirike hatte ich ein Gespräch über den Küchenzettel. In dieser Zeit musste sie die schweren, feurigen Suppen vermeiden, die sie so gut zu machen versteht und die ich so gern esse. Mehr Bouillon, viel Geflügel, Spargel, zuweilen einen Fisch. Einen lebhaften Mosel habe ich mir für diese Zeit angeschafft. Der Schneider brachte den Anzug aus blauem Sommerflanell, ganz lose gemacht. Mit Blumen in den Zimmern war ich vorsichtig, in meinem Arbeitszimmer durften keine stehen. Aber im Nebenzimmer stand eine Schale voller Zentifolien, diese gesunden roten Kugeln, die einen frischen, starken Rosenduft haben, nicht die perverse Mischung mit Tee oder Vanille oder Zederholzdüften. Die beste Arbeitszeit ist der Vormittag. Nachmittags zur Zigarre musste ich etwas lesen (statt der großen schweren Henry Clay rauchte ich jetzt eine kleine blonde Bock) und dazu hatte ich den Livius gewählt. Der würde mich nicht stören und erzählt mit so schön beruhigender Stimme. Und alles, was geschieht, erscheint so ordentlich für seinen Zweck zugeschnitten, wie die Holzstückchen eines Geduldspieles, die ja doch alle ineinander passen, um das Bild, die Größe des Römischen Reiches zu geben. Das verleiht ein angenehm geordnetes Gefühl, dabei kann man den Kopf nach hinten sinken lassen und die Augen schließen … die Gedanken vergehen … Diese Decius mit der Familieneigentümlichkeit – sich zu opfern – wie die Gicht in anderen Familien – sehr – aristokratisch. – Das ist sehr erfrischend. Wenn ich erwache, dann kann ich wieder bis zum Abend arbeiten.
Wenn es unten auf der Straße lebhaft wird, die Kinder zu lärmen beginnen, ein Geschwirr ganz hoher schriller Stimmen wie von einer Schar betrunkener Vögel, und wenn bunte Abendlichter aus dem Nebenzimmer in mein Schreibzimmer kommen, wenn der weiße Gipskopf der Marietta Strozzi errötet – dann mache ich meinen Spaziergang – der Gesundheit wegen. Die Luft in den Straßen ist eine bedrückende, staubige Zimmerluft. Die Vorstadt ist unerträglich mit ihren grau und rot gestreiften Überbetten, die sich in den geöffneten Fenstern lüften, mit ihren heißen, dampfenden Menschen. Draußen setze ich mich in einen der kleinen Biergärten. Das Buch spricht in mir weiter, und über meinem Schoppen hinweg sehe ich die Menschen und die bunten Plakate an den Bäumen und die Radfahrer wie ferne fremde Bildchen, die mich nichts angehen. Wenn die Laternen angesteckt werden, bleich und glasig in der Dämmerung, gehe ich heim, und die ganze Nacht liegt vor mir für die Arbeit. Ich kann das Fenster an meinem Schreibtisch öffnen. Unten auf der Straße wird es immer stiller – ein »gute Nacht« höre ich zuweilen und das Zuschlagen der Haustür. Die Lichter in den Fenstern erlöschen. Dort über die niedrigen Dächer ragt ein höheres Haus. Dort im vierten Stock entkleidet sich ein Mädchen bei offenem Fenster. Das Viereck des Fensterrahmens ist voll des gelben Lampenlichts, und ich sehe eine weiße Gestalt, die vor einem Spiegel steht und ihr langes, sehr schwarzes Haar emporhebt, um es auf dem Scheitel aufzubinden. Dann erlischt auch dieses Licht, und ich bin mit meinem Buch allein.
Ich habe mir für das Manuskript ein sehr edles Papier angeschafft, leicht gelblich getönt, glanzlos, die heraldische Lilie als Wasserzeichen. Auf dem Umschlag habe ich mit veilchenfarbener Tinte den Titel geschrieben: »Die goldene Kette« – darunter den Vers der Ilias, über den Plato so geheimnisvoll spricht:
»Auf, wohlan, ihr Götter, versucht, dass ihr all’ es erkennt! Eine goldene Kette befestigend oben am Himmel Hängt dann all’ ihr Götter euch an und ihr Göttinnen alle, Dennoch zöget ihr nie vom Himmel herab auf den Boden!«
So muss es gehen.
4. August
Kleine, vernachlässigte Verpflichtungen können sehr störend werden. Wir wollen sie vernachlässigen, wir wollen sie vergessen, aber sie haken sich in uns fest, melden sich mit kleinen flüchtigen Stichen. Sie sind lästig wie die Sommerfliegen, die wir immer vertreiben und die sich immer wieder uns ins Gesicht setzen. Das ist nicht Pflichtgefühl – nur eine Unvollkommenheit in unserem Vorstellungsmechanismus.
Solch eine lästige kleine Verpflichtung ist mir heute zugefallen.
Ich ging nach dem Essen aus, um mir eine goldene Feder zu kaufen. Die Straße war wie ein überheizter, staubiger Korridor. Kaum ein Mensch, dem ich begegnete, nur Hunde, alte Schuhsohlen, Papierfetzen sonnten sich auf den heißen Pflastersteinen. Wie ich um die Ecke biege, fährt ein Wagen an mir vorüber, ein hübscher, kleiner Korbwagen mit zwei falben Ponys bespannt. Ein auffallender kirschroter Kutscher sitzt auf dem Bocke und im Wagen ein Herr, der seinen Panama schwenkt und »Ach – Herr von Brühlen« ruft. Der Wagen hält, und ich muss herantreten. Es ist der Baron Daahlen-Liesewitz, der alte Weltreisende. Gerade dem hätte ich nicht begegnen wollen. Er war mit meinem Vater befreundet, und ich bin ihm einen Besuch schuldig. Ich war ihm früher einmal begegnet und hatte ihm gesagt, dass ich verreise – und nun –: »Wieder hier«, sagte der Baron – Ja, ich war wieder hier, das ließ sich nicht leugnen – »In Arbeit« – murmelte ich. »So? – Fleißig also!« meinte der Baron. »Schön, schön. Aber die Abende sind frei – was? Jetzt muss man die Abende genießen. Mir – ja mir macht die Hitze nichts. Wenn man so’n tropischen Fieberbazillus im Blut hat – der friert leicht und wird dann unruhig. Wir sehen Sie doch bei uns – bestimmt? Ganz ohne Formen. Es ist hübsch da draußen. Ich kündige Sie meiner Frau an. Wenn Sie mich im Stich lassen, gibt’s eine Enttäuschung – also?« – Ein starker Hustenanfall unterbrach ihn. Erkältet hat er sich auch auf seinen Weltreisen. Er drückte mir die Hand und fuhr ab. Fatal!
Er schaut gut aus, der alte Bursche. Das Gesicht quittengelb. Solche Reisende sind immer leberleidend. Das dichte Haar und der Vollbart sind schon grau, aber ein seltsam farbiges Grau, wie das Fell junger Mäuse. Dazu die fieberblanken Augen. Er wohnt da draußen vor der Stadt in seinem schönen Landhause und lässt sich von seiner jungen Frau pflegen, der alte Egoist. Er mag sich den Magen tüchtig an den Genüssen der fünf Weltteile verdorben haben. Die Frau soll so etwas wie eine Schönheit sein, sagte Fred Spall, der ein Verwandter von ihr ist. Also ich gehe morgen hin, damit auch das abgetan ist – aber meine Abende dort verbringen, o nein! Die kann ich besser anwenden, als bei dem alten Daahlen mit seiner kranken Weltleber zu sitzen.
5. August
Ich habe das Manuskript mit der goldenen Kette fortgelegt. Seine Stunde war doch noch nicht ganz gekommen, das weiß ich jetzt. Etwas will noch erlebt sein. – Es soll erlebt werden, ganz – rücksichtslos – bis zur Neige. – Also
Der Gang durch die Vorstadt war wieder qualvoll. Wie reinlich ist der Winter, der die Menschen in ihre Häuser treibt. Und was nicht alles jetzt auf die Straße herauskriecht und herausschaut und sich breitmacht. Der Mensch ist ein Höhlentier und soll in seiner Höhle bleiben – nur abends auf Raub ins Freie hinaus. In der langen Kastanienallee war es besser. Viel gelbe, von der Hitze getrocknete Blätter liegen schon auf dem Wege und rascheln und duften herbstlich. Auf den Bänken sitzen Kindermädchen, große erhitzte Gestalten, seltsam von graugrünen Schatten und grellen Sonnenlichtern gefleckt. Von der Allee muss ich dann wieder in den Sonnenschein abbiegen. Links und rechts Haferfelder voller Mäher. In all dem Rot und Gold stehen Mäher knietief in weißen Leinwandhosen. Die Feldgrillen lärmen wie toll, als wollten sie das Dengeln und Schwirren der Sensen übertönen.