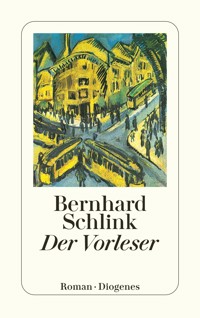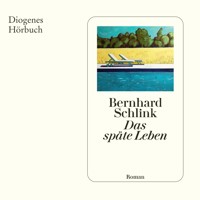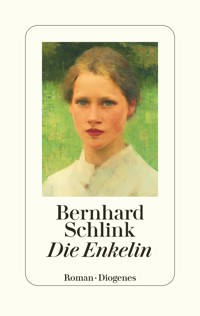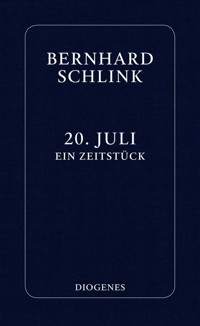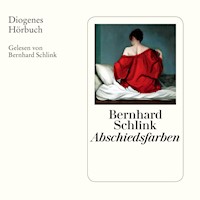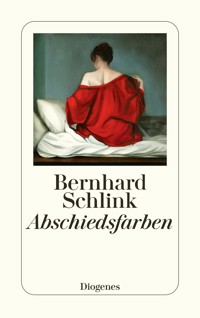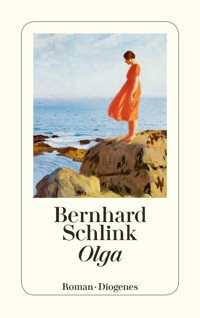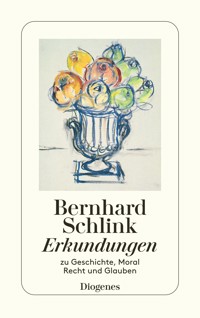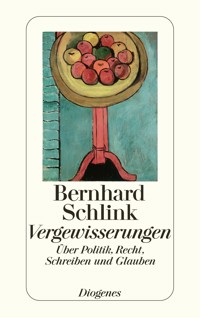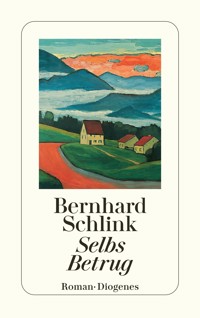
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Selb-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Selb lebt in Mannheim. Er hat eine Vergangenheit als Nazi–Staatsanwalt, eine Gegenwart als Privatdetektiv und weiß nicht, ob er mit fast 70 Jahren noch eine Zukunft hat. Er raucht. Er hat eine Freundin, Brigitte, und einen Kater, Turbo. Er spielt Schach. Aber er löst seine Fälle nicht wie Schachprobleme. Er verstrickt sich in sie, und die Wahrheit, die er herausfindet, ist stets auch eine Wahrheit über ihn selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Bernhard Schlink
Selbs Betrug
Roman
Die Erstausgabe erschien 1992
im Diogenes Verlag
Die Figur des Privatdetektivs Gerhard Selb,
seine Freunde und sein Kater Turbo
treten erstmals in dem von Bernhard Schlink
gemeinsam mit Walter Popp
verfaßten Roman Selbs Justiz auf
(Diogenes Verlag, 1987)
Umschlagillustration: Gabriele Münter,
›Olympiastraße bei Murnau‹,
1936 (Ausschnitt)
Copyright © 2012 ProLitteris, Zürich;
Schloßmuseum Murnau
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 22706 2 (26. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60039 1
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5]Inhalt
ERSTER TEIL
1 Ein Paßbild [9]
2 Jugend dolmetscht [14]
3 Katastrophisches Denken [19]
4 Wie süß, der alte Onkel [23]
5 Turbo auf meinem Schoß [29]
6 Was denken Sie denn? [32]
7 In jedem Schwaben ein kleiner Hegel [38]
8 Dawai, dawai [43]
9 Nachträglich [48]
10 Scott am Südpol [52]
11 Bilder einer Ausstellung [55]
12 Vergebens [59]
13 Ja und nein [62]
14 Zwanzig Schlümpfe [66]
15 Porzellan zerschlagen [69]
16 Breiter, gerader, schneller [74]
17 Im Wege der Amtshilfe [78]
18 Halbgott in Grau [83]
19 Warum gehen Sie nicht? [88]
20 Löcher stopfen [93]
21 Völlig klar [99]
22 Schmerz, Ironie oder saurer Magen [102]
23 Dem Knaben gleich, der Disteln köpft [107]
[6] 24 Marmor, Stein und Eisen bricht [111]
25 Vergiß das Katzenklo nicht! [116]
26 Einfach trotzig [121]
27 Keine guten Karten? [123]
28 Psychotherapeutentrick [128]
29 Bei dem Wetter? [134]
30 Spaghetti al Pesto [138]
31 Wie damals bei Baader und Meinhof [140]
32 Bananen in den Auspuff [146]
33 Am Kaiser-Wilhelm-Stein [154]
34 Engel schießen nicht auf Katzen [161]
35 Schuster, bleib bei deinem Leisten? [166]
ZWEITER TEIL
1 Letzter Dienst [173]
2 So ein Irrsinn! [178]
3 Flau [183]
4 Peschkaleks Nase [188]
5 Gas muß nicht stinken [194]
6 Eine Sommeridylle [200]
7 Tragödie oder Farce? [204]
8 Denk mal nach! [207]
9 Olle Kamellen [212]
10 Wo beides harmonisch zusammenklingt [219]
11 Unterm Birnbaum [225]
12 Über Stock und Stein [231]
13 Lebenslügen [237]
14 Kein guter Eindruck [243]
[7] 15 Schwarz auf weiß [248]
16 Mönch, Eiger, Jungfrau [251]
17 Zu spät [257]
18 Frieden im Herzen [264]
19 Ein schwebendes Verfahren [269]
20 Als ob [275]
21 Ein bißchen gestottert [281]
22 Schreiben Sie einen Artikel! [285]
23 RIP[287]
24 Nach dem Herbst kommt der Winter [293]
25 Komisch [299]
26 Spitzes Kinn und breite Hüften [304]
27 Nägel mit Köpfen [308]
28 Rot markiert [315]
29 Zweierlei Ding [318]
[9]ERSTER TEIL
1
Ein Paßbild
Sie erinnerte mich an die Tochter, die ich mir manchmal gewünscht habe. Wache Augen, ein Mund, der gerne lacht, hohe Wangen und volle braune Locken bis auf die Schultern. Ob sie klein war oder groß, dick oder dünn, krumm oder gerade, zeigte das Photo nicht. Es war nur ein Paßbild.
Ihr Vater hatte mich angerufen, Ministerialdirigent Salger aus Bonn. Seit Monaten sei die Familie ohne Nachrichten von Leonore. Man habe zuerst einfach gewartet, dann bei Freunden herumtelephoniert, schließlich die Polizei benachrichtigt. Nichts. »Leo ist ein selbständiges Mädchen und geht ihrer Wege. Aber Kontakt hat sie immer gehalten, Besuche und Anrufe. Zuletzt haben wir noch gehofft, daß sie zu Semesterbeginn wieder auftaucht. Sie studiert Französisch und Englisch am Heidelberger Dolmetscherinstitut. Nun, das Semester hat vor zwei Wochen angefangen.«
»Ihre Tochter hat sich bei der Universität nicht wieder eingeschrieben?«
Er antwortete gereizt: »Herr Selb, ich wende mich an [10] einen privaten Ermittler, damit er ermittelt und nicht ich. Ich weiß nicht, ob Leo sich wieder eingeschrieben hat.«
Ich erklärte ihm geduldig, daß in der Bundesrepublik Deutschland jährlich Tausende als vermißt gemeldet werden und daß die meisten freiwillig unter- und auch wieder auftauchen. Sie wollen mit den besorgten Eltern, Gatten und Geliebten, die sie als vermißt melden, einfach eine Weile nichts zu tun haben. Solange man über sie nichts hört, besteht eigentlich kein Grund zur Besorgnis. Wenn etwas Schlimmes passiert, Unfall oder Verbrechen, hört man’s.
Das alles wußte Salger. Die Polizei habe es ihm bereits gesagt. »Ich respektiere Leos Selbständigkeit durchaus. Sie ist mit fünfundzwanzig kein Kind mehr. Ich verstehe auch, wenn sie Distanz braucht. Es hat in den letzten Jahren Spannungen zwischen uns gegeben. Aber ich muß wissen, wie sie lebt, was sie macht, wie es ihr geht. Sie haben wohl keine Tochter?«
Ich sah nicht ein, was ihn das anging, und antwortete nicht.
»Es geht auch nicht nur um meine Sorge, Herr Selb. Was meine Frau seit Wochen durchmacht… Also berichten Sie uns bald. Dabei will ich nicht, daß Sie Leo ansprechen und bloßstellen. Sie soll von der ganzen Suche nach ihr nichts merken, und ihr soziales Umfeld auch nicht. Ich fürchte, daß sie das ganz, ganz falsch verstehen würde.«
Das klang nicht gut. Man kann jemanden heimlich beschatten, wenn man ihn hat, und offen suchen, wenn man ihn nicht hat. Ihn nicht haben und so suchen, daß er und sein Umfeld von der Suche nichts merken, geht schlecht.
Salger drängte. »Sind Sie noch dran?«
[11] »Ja.«
»Dann gehen Sie sofort an die Arbeit, und berichten Sie so bald wie möglich. Meine Telephonnummer…«
»Herr Salger, ich werde Ihren Auftrag nicht übernehmen. Guten Tag.« Ich legte auf. Mir ist eigentlich gleichgültig, wie gut oder schlecht die Manieren meiner Klienten sind. Ich bin jetzt bald vierzig Jahre Privatdetektiv und habe sie alle erlebt, die mit und die ohne Kinderstube, die Schüchternen und die Anmaßenden, Angeber und Feiglinge, arme Teufel und feine Pinkel. Dann waren noch die, mit denen ich davor als Staatsanwalt zu tun gehabt hatte, Klienten, die lieber keine gewesen wären. Aber bei aller Gleichgültigkeit – in dem Ministerialorchester, in dem der herrische Ministerialdirigent Salger den Taktstock führte, wollte ich meine Flöte nicht spielen.
Als ich am nächsten Morgen wieder zu meinem Büro in der Augustaanlage kam, hing an der Klappe unten in der Tür der kleine gelbe Zettel der Deutschen Bundespost: »Sehen Sie bitte sofort in Ihren Hausbriefkasten!« Das wäre nicht nötig gewesen; die Briefe fallen durch die Klappe auf den Boden des ehemaligen Tabakladens, in dem mein Schreibtisch, dahinter ein Sessel, davor zwei Stühle, ein Aktenschrank und eine Zimmerpalme stehen. Ich hasse Zimmerpalmen.
Der Eilbrief war dick. Ein Bündel Hundertmarkscheine zwischen einer gefalteten beschriebenen Seite.
Sehr geehrter Herr Selb, bitte verstehen und entschuldigen Sie mein Verhalten vorhin am Telephon aus der Anspannung, unter der meine Frau und ich seit Wochen [12] stehen. Ich kann nicht annehmen, daß Sie wegen des fehlgelaufenen Telephongesprächs Ihre Hilfe verweigern. Erlauben Sie, daß ich als Anzahlung für Ihre Bemühungen DM 5000.– beilege. Bitte bleiben Sie über o. a. Telephonnummer in Kontakt mit mir. Zwar werden Sie in den nächsten Wochen nur meinen Anrufbeantworter erreichen; ich muß meine Frau aus der Hölle des Wartens herausreißen. Aber ich höre meinen Anrufbeantworter auch aus der Ferne regelmäßig ab und werde Sie auf Wunsch alsbald zurückrufen.
Salger.
Ich holte den Sambuca, die Kaffeedose und das Glas aus dem Schreibtisch und schenkte mir ein. Dann saß ich im Sessel, ließ die Bohnen zwischen den Zähnen knacken und das klare, ölige Zeug Zunge und Kehle hinunterrollen. Es brannte, und der Rauch der ersten Zigarette tat in der Brust weh. Ich sah durch das ehemalige Schaufenster hinaus. Es regnete in dichten, grauen Schnüren. Im Rauschen des Verkehrs war das Zischen der Reifen auf der nassen Straße lauter als das Brummen der Motoren.
Nach dem zweiten Glas zählte ich die fünfzig Hundertmarkscheine. Ich drehte und wendete den Umschlag, der ebenso wie der Brief keine Adresse von Salger trug. Ich rief die angegebene Bonner Telephonnummer an.
»Sie sind mit dem automatischen Anrufbeantworter der Telephonnummer 411788 verbunden. Ihre Nachricht, die von beliebiger Länge sein kann, wird innerhalb von 24 Stunden abgehört und beantwortet. Bitte sprechen Sie jetzt.«
[13] Ich rief auch die Auskunft an und war nicht erstaunt, daß für Salger in Bonn keine Telephonnummer vermerkt war. Vermutlich stand er auch nicht im Adreßbuch. Das war grundsätzlich in Ordnung, der Mann schützte seine Privatsphäre. Aber warum mußte er seine Privatsphäre gegen den eigenen Privatdetektiv schützen? Und warum konnte er nicht so kooperativ sein, mir die Heidelberger Adresse seiner Tochter mitzuteilen? Außerdem waren 5000 Mark viel zuviel.
[14] 2
Jugend dolmetscht
Die Polizei hat ihre Routineprozedur, wenn Angehörige jemanden vermissen und verlangen, daß der Apparat in Aktion tritt. Sie fertigt ein Protokoll mit mehreren Durchschriften, läßt sich Photos geben, befestigt diese mit Heftklammern am Protokoll und an den Durchschriften, verschickt den Vorgang an die Landeskriminalämter, die ihn einordnen und ablegen, und wartet. Zunehmend wird der Vorgang statt in der Akte im Computer abgelegt. Aber hier wie dort ruht er, bis etwas passiert, gefunden und gemeldet wird. Nur bei Minderjährigen und beim Verdacht einer Straftat geht die Polizei an die Öffentlichkeit. Wer erwachsen ist und nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommt, kann seine Zelte abbrechen und aufschlagen, wann und wo er will, ohne daß es die Polizei interessiert. Wäre auch noch schöner.
Ich werde in Vermißtenfällen beauftragt, damit ich es mir schwerer mache als die Polizei. Ich rief beim Studentensekretariat der Universität Heidelberg an und erfuhr, daß Leonore Salger nicht mehr als Studentin geführt wurde. Sie war im Wintersemester eingeschrieben gewesen, hatte sich aber zum Sommersemester nicht zurückgemeldet: »Das muß nichts heißen. Manchmal vergessen’s die Studenten einfach und denken erst wegen der Arbeit oder [15] beim Examen wieder dran. Nein, die Adresse kann ich Ihnen nicht geben, weil sie doch nicht mehr eingeschrieben ist.«
Arbeit – das brachte mich darauf, beim Kanzler der Universität anzurufen, mich mit der Personalstelle, Abteilung Studentische Hilfskräfte verbinden zu lassen und zu fragen, ob Leonore Salger hier geführt werde.
»Wer bitte möchte diese Auskunft haben? Nach unseren Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten…« Sie sagte es so streng, wie sie mit ihrem piepsigen Stimmchen konnte.
Ich ließ dem Datenschutz keine Chance: »Selb, Beamtenheimstättenwerk. Guten Tag, Frau Kollegin. Vor mir liegt die Akte Leonore Salger, und ich stelle fest, daß die Arbeitnehmersparzulage noch immer nicht bei uns eingeht. Ich muß Sie doch sehr bitten, das endlich in Ordnung zu bringen. Mir ist, ehrlich gesagt, nicht verständlich, warum Sie…«
»Wie ist bitte der Name?« Jetzt war das Stimmchen schrill vor Erregung über meine Anschuldigung. Der Datenschutz war vergessen, die Akte wurde befragt, und schließlich bekam ich triumphierend mitgeteilt, daß Frau Salger schon seit Februar nicht mehr bei der Universität arbeite.
»Wie denn das?«
»Das kann ich Ihnen auch nicht sagen.« Jetzt klang sie spitz. »Professor Leider hat keinen Antrag auf Verlängerung gestellt und im März die Stelle anders besetzt.«
Ich setzte mich in meinen Kadett, fuhr über die Autobahn nach Heidelberg, fand in der Anlage einen Parkplatz und in der Plöck das Institut für Übersetzen und [16] Dolmetschen und dort im ersten Stock das Vorzimmer von Professor Dr. K. Leider.
»Wen darf ich melden?«
»Selb vom Bundesminister für Bildung und Wissenschaft. Ich habe einen Termin mit Herrn Professor.«
Die Sekretärin sah auf den Terminkalender, mich an und wieder auf den Terminkalender. »Einen Moment.« Sie verschwand im Nebenzimmer.
»Herr Selb?« Auch die Professoren werden immer jünger. Dieser war eine elegante Erscheinung, trug einen Anzug aus dunkler Waschseide, ein helles Leinenhemd, und ein ironisches Lächeln im gebräunten Gesicht. Er bat mich ins Nebenzimmer zur Sitzgruppe. »Was führt Sie zu uns?«
»Nach dem Erfolg von Jugend forscht und Jugend musiziert hat der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft vor einigen Jahren weitere Jugendprogramme initiiert und im letzten Jahr erstmals Jugend dolmetscht realisiert. Sie erinnern sich an unser letztjähriges Anschreiben?«
Er schüttelte den Kopf.
»Sehen Sie, Sie erinnern sich nicht mehr. Ich fürchte, Jugend dolmetscht hat im letzten Jahr nicht die nötige promotion bekommen, nicht in den Schulen und nicht an den Universitäten. Ab diesem Jahr zeichne ich für das Programm verantwortlich, und der Kontakt zu den Universitäten ist mir ein besonderes Anliegen. Einer Teilnehmerin des letzten Jahres verdanke ich den Hinweis auf Sie und auch auf eine Ihrer Mitarbeiterinnen, Frau Salger. Mir schwebt vor…«
Das ironische Lächeln war nicht aus seinem Gesicht gewichen. »Jugend dolmetscht? Was soll denn das?«
[17] »Nun, es erschien zunächst einfach als natürliche Fortsetzung von Jugend forscht, Jugend musiziert, Jugend baut, Jugend heilt, um einige unserer Programme zu nennen. Inzwischen meine ich im Hinblick auf 1993, daß Jugend dolmetscht sogar eine besonders wichtige Rolle spielen wird. Bei Jugend betet arbeiten wir sehr segensreich mit den theologischen Fakultäten zusammen, bei Jugend richtet mit den juristischen. Mit Ihren Fakultäten bzw. Instituten wurde die Etablierung der erforderlichen Zusammenarbeit bisher leider versäumt. Ich denke an einen wissenschaftlichen Beirat, einige Professoren, den einen oder anderen Studenten, jemanden vom Sprachendienst der Europäischen Gemeinschaften. Ich denke an Sie, Herr Professor Leider, und ich denke an Ihre Mitarbeiterin Frau Salger.«
»Wenn Sie wüßten… Aber Sie wissen nicht.« Er hielt mir einen kleinen Vortrag darüber, daß er Wissenschaftler sei, Linguist, und von der Dolmetscherei und Übersetzerei nichts halte. »Eines Tages werden wir wissen, wie Sprache funktioniert, und dann brauchen wir keine Übersetzer und Dolmetscher mehr. Als Wissenschaftler habe ich nicht die Aufgabe, mich darum zu kümmern, wie man sich bis zu diesem Tag schlecht und recht durchwurstelt. Ich habe dafür zu sorgen, daß das Durchwursteln ein Ende findet.«
Dolmetschprofessor sein und ans Dolmetschen nicht glauben – war das die Ironie seines Lebens? Ich dankte für seine Offenheit, pries kritische, kreative Vielfalt und bat, wegen des Beirats in Kontakt bleiben zu dürfen. »Und was halten Sie davon, Frau Salger als Studentin in den Beirat zu berufen?«
[18] »Ich möchte vorausschicken, daß sie nicht mehr für mich arbeitet. Sie hat mich… hat mich gewissermaßen sitzengelassen. Nach den Weihnachtsferien ist sie nicht mehr gekommen, sie ist ohne Erklärung oder Entschuldigung weggeblieben. Natürlich habe ich mich bei den Kollegen und Lektoren umgehört. Frau Salger ist in keiner Lehrveranstaltung mehr aufgetaucht. Ich habe mir damals lange überlegt, ob ich die Polizei anrufen soll.« Er schaute besorgt, und erstmals war das ironische Lächeln verschwunden. Dann kehrte es zurück. »Vielleicht hatte sie einfach genug von Studium, Universität und Institut – ich würde das verstehen. Vielleicht war ich auch ein bißchen gekränkt.«
»Wäre Frau Salger die Richtige für Jugend dolmetscht?«
»Obwohl meine Mitarbeiterin, ist sie von meines Gedankens Blässe nie angekränkelt gewesen. Ein zupackendes Mädchen, eine tüchtige Dolmetscherin mit dem flotten Mundwerk, das man in diesem Beruf braucht, und als Tutorin bei den Erstsemestern beliebt. Doch, doch, wenn Sie sie finden, dann nehmen Sie sie. Sie können sie von mir grüßen.«
Wir standen auf, und er brachte mich zur Tür. Im Vorzimmer bat ich die Sekretärin um Frau Salgers Adresse. Sie schrieb sie mir auf einen Zettel: Häusserstraße 5, 6900 Heidelberg.
[19] 3
Katastrophisches Denken
1942 kam ich als junger Staatsanwalt nach Heidelberg und nahm mit meiner Frau Klara eine Wohnung in der Bahnhofstraße. Das war damals keine gute Adresse, aber ich mochte den Blick auf den Bahnhof, die ein- und ausfahrenden Züge, den aufschäumenden Dampf der Lokomotiven, die Pfiffe und das Rumpeln der nächtlich rangierenden Waggons. Heute führt die Bahnhofstraße nicht mehr am Bahnhof entlang, sondern an neuen Behörden- und Gerichtsgebäuden von glatter, grauer Funktionalität. Wenn das Recht wie die Architektur ist, in der es gesprochen wird, steht es nicht gut um das Recht in Heidelberg. Wenn es dagegen wie die Brötchen, das Brot und der Kuchen ist, die das Justizpersonal um die Ecke kaufen kann, muß einem um das Recht nicht bange sein. Von der Bahnhofstraße geht die Häusserstraße ab, und gleich hinter der Ecke hat sich aus der kleinen Bäckerei, in der Klara und ich vor mehr als vierzig Jahren Kommißbrot und Wasserwecken gekauft haben, eine einladende Backwarenboutique entwickelt.
Daneben, vor dem Klingelbrett in der Häusserstraße 5, setzte ich meine Lesebrille auf. Beim obersten Knopf stand ganz selbstverständlich ihr Name. Ich klingelte, die Tür schnappte auf, und ich stieg das düstere, nach Alter riechende Treppenhaus hoch. Mit meinen neunundsechzig bin [20] ich nicht mehr so schnell. Im zweiten Stock mußte ich verschnaufen.
»Hallo?« Von oben rief’s ungeduldig, eine hohe Männer- oder tiefe Frauenstimme.
»Ich komme.«
Die letzte Treppe führte ins Dachgeschoß. Ein junger Mann stand in der Tür, durch die ich in eine Mansardenwohnung mit Gauben und schiefen Wänden sehen konnte. Er mochte Ende zwanzig sein, hatte sein schwarzes Haar glatt nach hinten gekämmt, trug zu schwarzen Cordhosen einen schwarzen Pullover und musterte mich ruhig.
»Ich suche Frau Leonore Salger. Ist sie da?«
»Nein.«
»Wann kommt sie wieder?«
»Ich weiß nicht.«
»Das ist doch ihre Wohnung, oder?«
»Ja.«
Ich komme nicht mehr mit, was sich junge Leute heute alles einfallen lassen. Neue Schweigsamkeit? Neue Innerlichkeit? Kommunikative Anorexie? Ich versuchte es noch mal: »Mein Name ist Selb. Ich habe ein kleines Dolmetsch- und Übersetzungsbüro drüben in Mannheim, und Frau Salger wurde mir genannt als jemand, der kurzfristig einspringt. Jetzt könnte ich sie dringend brauchen. Können Sie mir bitte helfen, Frau Salger zu erreichen? Und darf ich mich in der Wohnung auf einen Stuhl setzen? Ich bin außer Atem, mir zittern die Beine, und mein Genick wird starr, weil ich zu Ihnen aufschauen muß.« Am Treppenende war kein Absatz, der junge Mann stand auf der obersten Stufe und ich fünf Stufen tiefer.
[21] »Bitte.« Er gab die Tür frei und winkte mich in ein Zimmer mit Bücherregalen, einer Tischplatte auf zwei Holzböcken und einem Stuhl. Ich setzte mich. Er lehnte sich ans Fenstersims. Die Tischplatte war mit Büchern und Papieren bedeckt, ich las französische Namen, die mir nichts sagten. Ich wartete, aber er machte keine Anstalten zu reden.
»Sind Sie Franzose?«
»Nein.«
»Wir haben das als Kinder gespielt. Einer denkt an etwas, die anderen müssen durch Fragen herauskriegen, an was, und der eine darf nur mit Ja oder Nein antworten. Gewonnen hat, wer’s als erster errät. Zu mehreren kann das lustig sein, zu zweit macht es keinen Spaß. Ob Sie wohl in ganzen Sätzen…«
Er gab sich einen Ruck, als habe er geträumt und sei aufgewacht. »Ganze Sätze? Ich sitze jetzt seit zwei Jahren an meiner Arbeit, und seit einem halben Jahr schreibe ich, ich schreibe ganze Sätze, und alles wird immer falscher. Sie denken vielleicht…«
»Seit wann wohnen Sie hier?«
Er war über meine platte Frage sichtbar enttäuscht. Aber ich erfuhr, daß er die Wohnung vor Leo bewohnt und an sie weitergegeben hatte, daß die Vermieterin einen Stock tiefer, seit Anfang Januar ohne Lebenszeichen und dann auch ohne die Miete von Leo, ihn im Februar besorgt angerufen hatte und daß er seitdem provisorisch in der Wohnung hauste, weil er in seiner lebhaften Wohngemeinschaft nicht ruhig schreiben konnte. »Außerdem hat sie so die Wohnung noch, wenn sie zurückkommt.«
[22] »Wo ist sie?«
»Ich weiß nicht. Sie wird’s schon selbst wissen.«
»Hat niemand nach ihr gefragt?«
Er fuhr sich mit der Hand über den Kopf, strich das glatte Haar noch glatter und zögerte einen Moment. »Sie meinen sicher wegen Arbeit, ob jemand wie Sie… Nein, da war niemand da.«
»Was glauben Sie – schafft Frau Salger das: eine kleine Konferenz über Technisches, zwölf Teilnehmer, deutsch-englisch und englisch-deutsch? Ist sie fit?«
Aber er ließ sich nicht in ein Gespräch über Leo verwickeln. »Da sehen Sie, daß die ganzen Sätze nichts nützen. Ich habe Ihnen in ganzen Sätzen gesagt, daß sie nicht da ist, und Sie fragen, ob sie für Ihre kleine Konferenz fit ist. Sie ist weg… auf und davon… husch, husch…« Er flatterte mit den Armen. »Alles klar? Ich will ihr ausrichten, daß Sie da waren, wenn sich’s ergibt.«
[23] 4
Wie süß, der alte Onkel
Zurück im Büro rief ich bei Salger an. Der Anrufbeantworter notierte meine Bitte um Rückruf. Ich wollte wissen, in welchem Studentenwohnheim Leo gewohnt hatte. Dort nach ihren Freunden und nach ihrem Verbleib forschen – es war keine heiße Spur, aber ich hatte keine große Wahl.
Der Rückruf kam am Abend, als ich auf dem Heimweg vom Kleinen Rosengarten noch mal im Büro vorbeischaute. Ich war zu früh dort gewesen, das Lokal war halbleer und ungemütlich, Giovanni, der mich sonst kellnerisch betreut, machte Urlaub in Italien, und die Gorgonzolaspaghetti waren zu schwer. Ich hätte bei meiner Freundin Brigitte besser gegessen. Aber am letzten Wochenende hatte sie sich gefreut, daß ich bei ihr vielleicht doch noch lerne, mich verwöhnen zu lassen: »Wirst du mein lieber, alter Kater?« Ich will kein alter Kater werden.
Salger war diesmal von ausgesuchter Höflichkeit. Er sei sehr dankbar, daß ich mich um Leo kümmere. Seine Frau sei sehr dankbar, daß ich mich um Leo kümmere. Ob es ausreiche, wenn mir nächste Woche eine weitere Abschlagszahlung zugehe. Er bitte mich um unverzügliche Benachrichtigung, wenn ich Leo gefunden habe. Seine Frau bitte mich…
[24] »Herr Salger, welche Anschrift hatte Leo vor der Häusserstraße?«
»Wie meinen Sie?«
»Wo hat Leo gewohnt, bevor sie in die Häusserstraße gezogen ist?«
»Ich fürchte, daß ich Ihnen das auf Anhieb nicht sagen kann.«
»Bitte schauen Sie nach oder fragen Sie Ihre Frau – ich brauche die alte Adresse. Es war ein Studentenwohnheim.«
»Richtig, das Studentenwohnheim.« Salger verstummte. »Liebigstraße? Eichendorffweg? Im Schnepfengewann? Ich komme jetzt nicht darauf, Herr Selb, mir gehen die verschiedensten Straßennamen durch den Kopf. Ich will mit meiner Frau reden und ins alte Adreßbuch schauen, falls wir es dabeihaben. Sie hören von mir. Beziehungsweise wenn Sie morgen früh nichts auf Ihrem Anrufbeantworter haben, dann können wir Ihnen von hier aus nicht weiterhelfen. Wär’s das? Ich darf Ihnen eine gute Nacht wünschen.«
Salger wurde mir nicht sympathischer. Leo lehnte am Löwen und sah mich an, hübsch, wach, mit der Entschlossenheit im Blick, die ich zu verstehen glaubte, und der Frage oder dem Trotz, die ich nicht deuten konnte. So eine Tochter haben und ihre Adresse nicht kennen – schämen Sie sich, Herr Salger.
Ich weiß nicht, warum Klara und ich keine Kinder hatten. Sie hat mir nie erzählt, daß sie deswegen beim Frauenarzt gewesen sei, und von mir nie verlangt, zum Männerarzt zu gehen. Wir waren nicht sehr glücklich miteinander, aber zwischen Eheunglück und Kinderlosigkeit, Eheglück und Kinderreichtum bestehen ohnehin keine eindeutigen [25] Zusammenhänge. Ich wäre gerne Witwer mit Tochter gewesen, aber das ist ein ungehöriger Wunsch, und ich gestehe ihn mir erst ein, seit ich alt bin und keine Geheimnisse mehr vor mir habe.
Ich telephonierte einen Vormittag lang, bis ich Leos Studentenwohnheim fand. Am Klausenpfad, unweit von Freibad und Tiergarten. Sie hatte in Zimmer 4o8 gewohnt, und über verslumte Treppen und Korridore fand ich im vierten Stock in einer Gemeinschaftsküche drei beim Tee zusammensitzen, zwei Studentinnen und einen Studenten.
»Entschuldigen Sie, ich suche Leonore Salger.«
»Hier wohnt keine Leonore.« Der Student saß mit dem Rücken zu mir und redete über die Schulter.
»Ich bin Leos Onkel, komme gerade durch Heidelberg und habe dieses Studentenwohnheim als ihre Heidelberger Adresse. Können Sie…«
»Ach, wie süß, der alte Onkel besucht die junge Nichte. Guck mal, Andrea!«
Andrea drehte sich um, der Student drehte sich um, und die drei betrachteten mich neugierig. Mein Freund Philipp, der als Chirurg bei den Städtischen Krankenanstalten Mannheim mit famulierenden Medizinern zu tun hat, berichtet mir von der Wohlerzogenheit der Studenten der neunziger Jahre. Der Sohn meiner alten Freundin Babs wird Jurist und ist gewandt und höflich. Seine Freundin, eine adrette angehende Theologin, die ich mit »Frau« anredete, wie’s mich die Frauenbewegung gelehrt hat, wies mich sanft zurecht, sie sei »Fräulein«. Die drei vor mir mußten Soziologen sein. Ich setzte mich auf den vierten Stuhl.
[26] »Seit wann wohnt Leo nicht mehr hier?«
»Ich weiß nichts von…«
Andrea unterbrach: »Das war vor deiner Zeit. Leo ist vor einem Jahr raus, in die Weststadt, glaube ich.« Sie wandte sich mir zu: »Ich habe Leos neue Adresse nicht. Aber auf der Verwaltung müssen sie sie haben. Ich muß auch dort vorbei – wollen Sie mitkommen?«
Sie ging vor mir die Treppe hinunter. Der schwarze Pferdeschwanz wippte, und der weite Rock schwang. Sie war ein kräftiges Mädchen, aber anmutig anzuschauen. Die Verwaltung war nicht mehr besetzt, es ging auf vier Uhr. Unschlüssig standen wir vor der verschlossenen Tür.
»Können Sie mir mit einem neueren Bild von Leo helfen?« Ich erzählte, daß Leos Vater, mein Schwager, demnächst Geburtstag hat, das Fest auf dem Drachenfels gefeiert wird und auch die Vettern und Basen aus Dresden kommen. »Ich wollte Leo vor allem treffen, weil ich das Album mit allen Verwandten und Freunden vorbereite.«
Sie nahm mich auf ihr Zimmer. Wir saßen auf der Couch, und aus einem Schuhkarton voller Photos kramte sie ein Studentenleben mit Fastnachts- und Examensfesten, Urlaubsreisen, einem Seminarausflug, der einen und anderen Demonstration, einem Wochenende der Arbeitsgruppe und Bildern vom Freund, der gerne auf seinem Motorrad posierte. »Hier, das war auf einer Hochzeit.« Sie gab mir Leo im Sessel, dunkelblauer Rock und lachsfarbene Bluse, Zigarette in der Rechten und die Linke nachdenklich an die Wange gelegt, das Gesicht konzentriert, als höre sie zu oder beobachte. Nichts Mädchenhaftes mehr, das war eine junge, durchsetzungsbereite, etwas angespannte Frau. [27] »Hier kommt sie aus dem Standesamt, sie war Trauzeugin, und hier gehen wir alle zum Neckar, wir haben auf dem Schiff gefeiert.« Ich schätzte sie auf einssiebzig, sie war schlank, ohne dünn zu sein, und hielt sich gerade.
»Wo ist das?« Leo kam aus einer Tür, Jeans und dunkler Pullover, Tasche umgehängt und Mantel über dem Arm. Sie hatte Ringe unter den Augen, das rechte zugekniffen, über dem linken die Braue gehoben. Ihr Haar war zerzaust und der Mund ein schmaler, böser Strich. Ich kannte die Tür und das Haus. Aber woher?
»Das war nach der Demo im Juni, die Bullen hatten sie festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt.« Ich erinnerte mich an keine Demo im Juni. Aber ich erkannte jetzt, daß Leo aus der Polizeidirektion Heidelberg kam.
»Kann ich die beiden haben?«
»Das auch?« Andrea schüttelte den Kopf. »Sie wollen doch dem Vater eine Freude machen und Leo keinen Ärger, oder? Dann lassen Sie das böse mal und nehmen das liebe. Wie sie da sitzt, das geht in Ordnung.« Sie gab mir Leo im Sessel und packte die anderen Photos zurück in den Karton. »Wenn Sie Zeit haben, können Sie im Drugstore vorbeischauen. Da hat Leo früher jeden Abend rumgehangen, und ich hab sie im Winter noch dort getroffen.«
Ich ließ mir den Weg zum Drugstore beschreiben und dankte ihr. Als ich das Lokal in der Kettengasse gefunden hatte, erinnerte ich mich. Da hatte einmal jemand unter meiner Beschattung seinen Kaffee getrunken und Schach gespielt. Er lebt nicht mehr.
Ich bestellte einen Aviateur, aber der Bar fehlte es am Grapefruitsaft und am Champagner, und so trank ich den [28] Campari alleine. Immerhin kam ich mit dem gelangweilten Burschen hinter der Bar ins Gespräch und zeigte ihm Leo im Sessel. »Wann haben Sie sie zuletzt gesehen?«
»Da schau einer an, die Leo. Ein nettes Bild. Und was wollen Sie von ihr? – Klaus, komm mal her.« Er winkte einem stämmigen Kleinen mit roten Haaren, randloser Brille und blitzgescheiten Augen. So stelle ich mir die Intellektuellen unter Irlands Whiskytrinkern vor. Die beiden redeten halblaut miteinander. Unter meinem interessierten Blick verstummten sie. So wandte ich den Kopf ab und spitzte die Ohren. Ich verstand, daß ich nicht der erste war, der im Drugstore nach Leo forschte. Im Februar war schon einmal jemand dagewesen. Auch Klaus fragte: »Was wollen Sie von ihr?«
Ich erzählte, wie es mir als Onkel im Studentenwohnheim am Klausenpfad ergangen war und daß Andrea mich hierher geschickt hatte. Sie blieben mißtrauisch. Sie hätten Leo seit Januar nicht mehr gesehen – mehr erfuhr ich nicht. Und sie ließen mich nicht aus den Augen, als ich den zweiten Campari trank, zahlte, hinausging und von draußen noch mal durchs Fenster sah.
[29] 5
Turbo auf meinem Schoß
Als nächstes klapperte ich die Krankenhäuser ab. Zwar benachrichtigen sie die Angehörigen von Patienten, die nicht sprechen können. Auch teilen sie der Polizei mit, wenn Patienten zweifelhafter Identität eingeliefert werden. Aber nur ausnahmsweise veranlaßt der Arzt die Benachrichtigung der Angehörigen gegen den Willen des Patienten. Einer, den seine Angehörigen vermissen, kann ein paar Straßen weiter im Krankenhaus liegen. Vielleicht ist ihm egal, daß seine Lieben sich die Augen nach ihm ausweinen. Vielleicht ist’s ihm gerade recht.
Beides paßte nicht zu dem Eindruck, den ich von Leo bisher gewonnen hatte. Und selbst wenn ihr Verhältnis zu den Eltern zerrütteter war, als ihr Vater mich hatte wissen lassen – warum hätte sie Professor Leider und dem Katastrophenphilosophen den Krankenhausaufenthalt verheimlichen sollen? Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, und so machte ich sie durch, die Heidelberger Universitätskliniken, die Städtischen Krankenanstalten Mannheims, die Kreiskrankenhäuser und die Hospitäler der Kirchen. Hier lief ich keine Gefahr, Leos soziales Umfeld scheu zu machen. Ich mußte nicht in fremde Rollen schlüpfen, sondern konnte Privatdetektiv Selb sein, den der besorgte Vater mit der Suche nach der verlorenen Tochter betraut [30] hat. Ich verließ mich nicht aufs Telephon. Darüber kriegt man zwar ziemlich verläßlich heraus, ob jemand im Krankenhaus liegt. Wenn man aber auch wissen will, ob er in den vergangenen Wochen oder Monaten Patient war, spricht man besser vor. Ich tat es zwei ganze Tage lang. Von Leo keine Spur.
Dann kam das Wochenende. Der Regen, der den April bislang begleitet hatte, hörte auf, und beim sonntäglichen Spaziergang durch den Luisenpark schien die Sonne. Ich hatte die Tüte mit altem Brot dabei und fütterte die Enten. Ich hatte auch die Süddeutsche Zeitung dabei und wollte mich zum Lesen in einen der bereitstehenden Liegestühle legen. Aber die Aprilsonne wärmte noch nicht richtig. Oder meine Knochen werden nicht mehr so schnell warm wie früher. Ich war froh, als sich zu Hause mein Kater Turbo in meinen Schoß kringelte. Er schnurrte und streckte wohlig die kleinen Tatzen.
Ich wußte, wo Leo gewohnt, studiert und verkehrt hatte und daß sie jedenfalls in Heidelberg und Umgebung nicht im Krankenhaus lag oder gelegen hatte. Seit Januar war sie verschwunden, im Februar hatte jemand nach ihr geforscht. Im Juli letzten Jahres war sie von der Polizei festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt worden. Der Professor hatte sich positiv über sie geäußert, die Bekannten, an die ich geraten war, nicht negativ. Der Kontakt zu den Eltern war dürftig. Sie rauchte. Ich wußte auch, wo Freunde und Bekannte, Kollegen und Lehrer von Leo zu finden waren. Ich konnte im Dolmetscherinstitut, im Drugstore und in den Geschäften der Nachbarschaft recherchieren. Aber das ging nicht ohne Irritationen des [31] sozialen Umfelds ab. Also mußte ich Salger vor die Wahl stellen, entweder den Auftrag zu beenden oder in Kauf zu nehmen, daß Leo von der Suche erfährt. Das war der zweite Punkt, den ich für Montag vormerkte.
Der erste hätte schon auf die Traktandenliste der letzten Woche gehört: das Psychiatrische Landeskrankenhaus vor den Toren Heidelbergs. Ich hatte es nicht vergessen. Ich hatte mich davor gedrückt. Eberhard hat anderthalb Jahre in der Anstalt verbracht, ich habe ihn oft besucht, und mich haben die Besuche immer fertiggemacht. Eberhard ist mein Freund. Ein stiller Mensch, lebt von seinem kleinen Vermögen, ist Schachgroßmeister und kam 1965 von einem Turnier in Dubrovnik völlig verwirrt zurück. Philipp und ich haben ihm Haushälterinnen besorgt, die es aber nicht bei ihm aushielten. So kam er in die Anstalt. Die Patienten waren in großen Sälen zusammengepfercht, schliefen in doppelstöckigen Betten, hatten nicht einmal eigene Schränke oder Fächer und brauchten auch keine, weil sie alle persönliche Habe, selbst Armbanduhr und Ehering, abgeben mußten. Das Schlimmste war für mich der süßliche Geruch nach Essen, Putz- und Desinfektionsmitteln, Urin, Schweiß und Angst. Wie Eberhard unter diesen Bedingungen wieder gesund geworden ist, bleibt mir ein Rätsel. Aber er hat es geschafft und spielt sogar wieder – gegen den Rat des Arztes, der Stefan Zweigs Schachnovelle gelesen hat. Dann und wann spielen wir. Er siegt immer. Aus Freundschaft läßt er mich manchmal glauben, es sei ein hartes Stück Arbeit für ihn.
[32] 6
Was denken Sie denn?
Das Psychiatrische Landeskrankenhaus liegt in den Ausläufern der Berge. Ich hatte keine Eile und fuhr über die Dörfer. Das schöne Wetter hielt an, der Morgen war hell, und das junge Grün und die Farben der Blüten explodierten. Ich machte das Schiebedach auf und legte die Kassette mit der Zauberflöte ein. Es war eine Lust zu leben.
Das Zentrum der Krankenhausanlage ist der alte Bau. Er wurde in Form eines großen U gegen Ende des letzten Jahrhunderts als Kaserne eines badischen Velozipedistenregiments errichtet. Im Ersten Weltkrieg diente er als Lazarett, nach Kriegsende als Landesarmenhaus und seit den späten zwanziger Jahren als Heil- und Pflegeanstalt. Der Zweite Weltkrieg hat aus dem großen U ein großes L gemacht. Die Mauern, die den alten Bau zum länglichen Geviert geschlossen hatten, sind verschwunden, der Hof weitet sich in das hügelige Gelände, auf dem inzwischen viele neue Funktionsbauten entstanden sind. Ich parkte, schloß das Schiebedach und machte die Musik aus. Der säulengeflankte Eingang war zusammen mit dem ganzen Bau eingerüstet. Um die Fenster leuchtete der rohe Backstein. Man hatte augenscheinlich gerade Thermoglas eingesetzt. Jetzt waren die Maler dabei, alles in zartem Gelb neu zu streichen. Einer pfiff die Arie der [33] Königin der Nacht weiter, während ich über den Kies zum Portal ging.
Der Pförtner wies mir den Weg in die Verwaltung, erster Stock links. Breite, ausgetretene Sandsteinstufen führten nach oben. Neben der Tür zu Zimmer 107 stand: Verwaltung / Aufnahme. Ich klopfte und wurde hineingerufen.
Der Name Leonore Salger sagte der Sachbearbeiterin nichts. Sie wandte sich wieder den Krankenblättern zu. An einigen hefteten Paßbilder, und das brachte mich auf den Gedanken, ihr Leos Photo zu zeigen. Sie nahm es, betrachtete es gründlich, bat mich, einen Moment zu warten, schloß ihren Schrank und ging hinaus. Ich schaute durch das Fenster in einen Park. Die Magnolienbäume und Forsythiensträucher blühten, der Rasen wurde gerade gemäht. Auf den Wegen schlenderten Patienten in Alltagskleidung, andere saßen auf den weißgestrichenen Bänken. Wie hatte sich alles verändert! Als ich damals Eberhard besuchte, war unter den Bäumen die Erde einfach festgetreten. Auch damals schon konnten die Patienten ins Freie, aber in grauer Anstaltskleidung, und es war ein Hofgang wie im Gefängnis, zu fester Stunde, für zwanzig Minuten, hintereinander im Kreis.
Die Sachbearbeiterin kam nicht allein zurück.
»Dr. Wendt«, stellte er sich vor. »Wer sind Sie, und in welcher Beziehung stehen Sie zu ihr?« Er hielt Leos Photo in der Hand und sah mich unfreundlich an.
Ich überreichte meine Karte und erzählte von meiner Suche.
»Es tut mir leid, Herr Selb, aber wir geben Auskünfte über unsere Patienten nur an autorisierte Personen weiter.«
[34] »Also ist sie…«
»Ich möchte dazu nichts weiter sagen. In wessen Auftrag, sagten Sie, arbeiten Sie?«
Ich hatte den Brief von Salger einstecken und holte ihn hervor. Wendt las ihn mit gerunzelter Stirn. Er schaute nicht auf, obwohl er mit Lesen längst fertig sein mußte. Schließlich gab er sich einen Ruck. »Kommen Sie bitte mit rüber.«
Ein paar Türen weiter bat er mich in ein Sprechzimmer mit Sitzgruppe. Der Blick ging wieder in den Park. Hier waren die Handwerker noch nicht fertig. Das Fenster, aus dem die alten Rahmen und Scheiben schon herausgebrochen waren, war provisorisch mit durchsichtiger Plastikfolie geschlossen. Auf Tisch, Regal und Aktenbock lag feiner weißer Staub.
»Ja, Frau Salger war Patientin bei uns. Sie kam vor etwa drei Monaten. Sie wurde von jemandem gebracht, der sie als Anhalterin… Also was genau auf und vor dieser Autofahrt passiert ist, wissen wir nicht. Der Mann sagte, er habe sie eben aufgelesen und mitgenommen.«
Der Arzt stockte wieder und guckte nachdenklich. Er war noch jung, trug Cordhosen mit kariertem Hemd unter dem offenen weißen Kittel und sah sportlich aus. Sein Gesicht hatte eine gesunde Farbe, sein dichtes braunes Haar war kunstvoll zerzaust. Die Augen standen zu eng beieinander.
Ich wartete. »Herr Dr. Wendt?«
»Auf der Fahrt hat sie zu weinen angefangen und überhaupt nicht mehr aufgehört. Das ging über eine Stunde, der Mann hat sich am Ende nicht anders zu helfen gewußt, als sie zu uns zu bringen. Und bei uns ging es so weiter, bis sie [35] die Valiumspritze bekam und einschlief.« Er sann wieder vor sich hin.
»Und dann?«
»Oh, dann habe ich mit der Therapie angefangen, was denken Sie denn?«
»lch meine, wo ist Leonore Salger jetzt? Warum haben Sie niemanden verständigt?«
Wieder ließ er sich Zeit. »Wir hatten… Ich weiß doch erst von Ihnen, wie sie richtig heißt. Wenn nicht unsere Dame an der Aufnahme«, seine Hand deutete in Richtung von Zimmer 107, »zufällig ein paarmal mit ihr zu tun gehabt hätte… Meistens kriegt sie unsere Patienten gar nicht zu sehen. Und daß Sie dann auch noch mit einem Paßbild kommen müssen…« Er schüttelte den Kopf.
»Haben Sie sich mit der Polizei in Verbindung gesetzt?«
»Die Polizei…« Er fummelte ein zerknautschtes Päckchen Roth-Händle aus der Tasche seiner Hose und bot mir eine an. Ich rauchte lieber meine eigenen und holte die Sweet Afton hervor. Wendt schüttelte noch mal den Kopf.
»Nein, von Polizei in unserem Krankenhaus halte ich nicht viel, und in diesem Fall wäre eine polizeiliche Vernehmung zunächst therapeutisch gänzlich unvertretbar gewesen. Und dann ging es ihr schon bald besser. Sie war freiwillig hier, hätte statt zu bleiben auch gehen können, und sie war volljährig.«
»Wo ist sie jetzt?«
Er setzte ein paarmal an. »Ich kann Ihnen… muß Ihnen… Frau Salger ist tot. Sie ist…« Er vermied meinen Blick. »Ich weiß nicht, was genau passiert ist. Ein tragischer [36] Unglücksfall. Sagen Sie bitte dem Vater, wie sehr ich Anteil nehme.«
»Herr Dr. Wendt, ich kann doch den Vater nicht anrufen, um ihm nur zu sagen, daß seine Tochter bei einem tragischen Unglücksfall ums Leben gekommen ist.«
»Natürlich. Sie sehen«, er zeigte zum Fenster, »daß bei uns gerade neue Scheiben reinkommen. Letzten Dienstag hat sie… Wir haben im dritten Stockwerk große, vom Fußboden bis fast unter die Decke reichende Fenster im Flur, und sie ist durch die Plastikfolie nach unten in den Hof gestürzt. Sie war auf der Stelle tot.«
»Und wenn ich jetzt nicht gekommen wäre, hätten Sie sie beerdigen lassen, ohne daß die Eltern auch nur ein Sterbenswörtchen erfahren? Was für eine verrückte Geschichte erzählen Sie mir denn da, Herr Dr. Wendt!«
»Ich bitte Sie, selbstverständlich wurden die Eltern benachrichtigt. Ich weiß nicht, was unsere Aufnahme im einzelnen unternommen hat, aber benachrichtigt hat man die Eltern ganz gewiß.«
»Wie hat man das gemacht, wenn Sie doch erst von mir den richtigen Namen erfahren haben?«
Er zuckte nur mit den Schultern.
»Und die Beerdigung?«
Er sah auf seine Hände, als könnten sie ihm sagen, wo Leo begraben werden soll. »Damit wird wohl auf die Entscheidung der Eltern gewartet.« Er stand auf. »Ich muß jetzt auf die Station. Sie können sich nicht vorstellen, was bei uns los ist. Der Sturz, die Sirenen des Krankenwagens, seitdem gibt’s große Unruhe. Erlauben Sie, daß ich Sie hinausbegleite.«
[37] »Nein«, sagte er, als ich mich vor der Tür zu Zimmer 107 von ihm verabschieden wollte, »hier ist jetzt geschlossen.« Er zog mich weiter. »Ich möchte Ihnen doch noch sagen, daß ich über Ihr Kommen sehr froh bin. Bitte reden Sie bald mit dem Vater. Ihre Überlegung vorhin war natürlich richtig, vielleicht hat die Aufnahme nicht geschafft, die Eltern zu benachrichtigen.« Wir standen unter dem Portal. »Auf Wiedersehen, Herr Selb.«
[38] 7
In jedem Schwaben ein kleiner Hegel
Ich fuhr nicht weit. Beim Baggersee vor Sankt Ilgen hielt ich an, stieg aus und trat ans Ufer. Ich versuchte, Kieselsteine übers Wasser hüpfen zu lassen. Es ist mir schon als Junge am Wannsee nicht geglückt. Ich werde es auch nicht mehr lernen.
Darum lasse ich mir von einem jungen Bürschchen in weißem Kittel aber noch lange nichts vormachen. Wendts Geschichte war faul. Wo war die Polizei geblieben? Eine junge Frau ist seit drei Monaten im Psychiatrischen Landeskrankenhaus, stürzt aus dem schlecht gesicherten dritten Stockwerk, und niemand denkt an fahrlässige Tötung oder Schlimmeres und holt die Polizei? Gut, Wendt hatte nicht gesagt, daß die Polizei nicht dagewesen wäre und ermittelt hätte. Aber er hatte nur Krankenwagen erwähnt, nicht Polizeiwagen. Und wenn am Dienstag die Polizei zugezogen worden wäre, hätte Salger spätestens am Donnerstag Bescheid gehabt, falscher Name hin oder her. Daß es Frau Wie-auch-immer nicht gibt, daß aber Leonore Salger vermißt wird und daß also Frau Wie-auch-immer in Wahrheit Leonore Salger ist – das herauszufinden braucht die Polizei nicht lange. Und wenn Salger am Donnerstag Bescheid gehabt hätte, hätte er mich doch wohl inzwischen benachrichtigt.
Ich aß in Sandhausen zu Mittag. Kein kulinarisches [39] Mekka. Als ich nach dem Essen in meinen Kadett stieg, den ich auf dem Marktplatz in der Sonne geparkt hatte, stand drinnen die Hitze. Es wurde Sommer.
Um halb drei war ich wieder im Krankenhaus. Mir ging’s wie dem Hasen mit dem Igel. Die Sachbearbeiterin in Zimmer 107, ein anderes Gesicht als am Morgen, ließ nach Dr. Wendt suchen, konnte ihn aber nicht finden. Schließlich zeigte sie mir den Weg zur Station, über weite und hohe Gänge, in denen die Schritte hallten. Dort war Dr. Wendt erst recht nicht zu sprechen, die Schwester bedauerte. Übrigens müsse ich vorne in der Verwaltung warten, hier auf der Station zu warten sei gegen die Vorschrift. In der Verwaltung drang ich bis zum Vorzimmer von Direktor Prof. Dr. H. Eberlein vor und erklärte der Sekretärin, der Herr Direktor wolle mich sicher empfangen, lieber mich als die Polizei. Ich hatte eine ziemliche Wut im Bauch. Die Sekretärin sah mich verständnislos an. Ich möge mit meinem Anliegen in Zimmer 107 vorsprechen.
Als ich wieder auf dem Gang stand, öffnete sich die nächste Tür. »Herr Selb? Eberlein. Sie machen Ärger, höre ich.«
Er war Ende fünfzig, klein und dick, zog das linke Bein nach und stützte sich auf einen Stock mit silbernem Knauf. Unter schütterem schwarzem Haar und dichten schwarzen Brauen musterte er mich aus tiefliegenden Augen. Die Tränensäcke und die Backen hingen schlaff. In näselndem Schwäbisch kommandierte er mich an die Seite seiner hinkenden Gemütlichkeit. Auf dem Weg schlug der Stock Synkopen.
»Jede Anstalt ist ein Organismus. Hat ihren Kreislauf, atmet, nimmt auf und scheidet aus, hat Infekte und [40] Infarkte, entwickelt Abwehr- und Heilungskräfte.« Er lachte. »Was sind Sie für ein Infekt?«
Wir gingen die Treppe hinunter und hinaus in den Park. Die Wärme des Tages war schwül geworden. Ich sagte nichts. Auch er hatte beim langsamen Herabsteigen der Stufen nur schwer geschnauft.
»Sagen Sie was, Herr Selb, sagen Sie was. Sie wollen lieber hören? Audiatur et altera pars – Sie halten’s mit dem Recht? Sie sind so was wie das Recht, nicht wahr?« Er lachte wieder, ein behäbiges Lachen.
Die Steinplatten endeten, und unter unseren Füßen knirschte der Kies. Der Wind rauschte in den Bäumen des Parks. Am Rande der Wege standen Bänke, auf dem Rasen Stühle, und viele Patienten waren draußen, einzeln oder in kleinen Gruppen, mit und ohne weißbekitteltes Personal. Eine Idylle – bis auf den zuckenden und hüpfenden Gang einiger Patienten, bis auf die blicklosen Gesichter mit den offenen Mündern anderer. Es war laut; gegen den alten Bau hallte das Gewirr von Rufen und Lachen wie das unverständliche, undurchdringliche Sirren der Stimmen in einem Hallenbad. Manchmal nickte oder grüßte Eberlein nach links und rechts.
Ich versuchte es. »Gibt es hier zwei Seiten, Herr Dr. Eberlein? Eine Unfallseite und eine andere? Und was ist die andere – fahrlässige Tötung? Oder hat jemand Ihre Patientin umgebracht? Sie sich selbst? Wird hier was vertuscht? Dazu würde ich gerne etwas hören, aber meine Fragen scheinen niemanden zu interessieren. Jetzt kommen Sie und reden von Infekten und Infarkten. Was wollen Sie mir sagen?«
[41] »Ich sehe, ich sehe. Mord und Totschlag, mindestens Selbstmord. Sie lieben den dramatischen Effekt? Sie denken sich gerne etwas aus? Wir haben viele hier, die sich gerne etwas ausdenken.« Er beschrieb mit dem Stock einen großen Bogen.