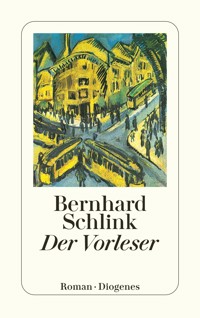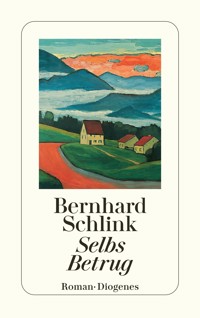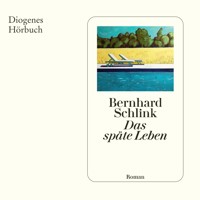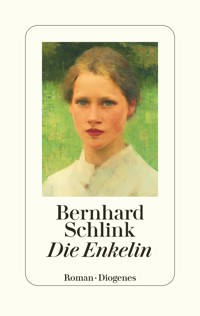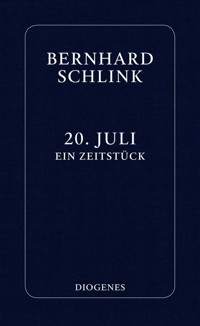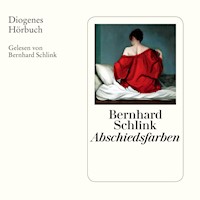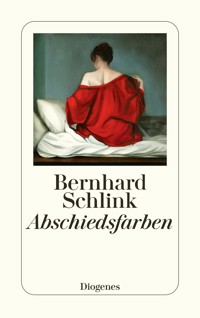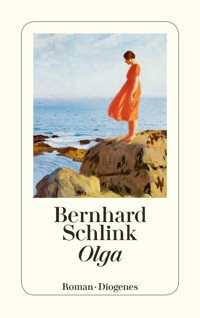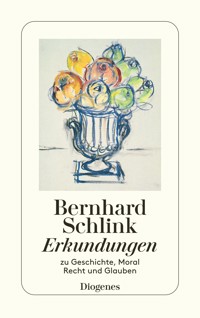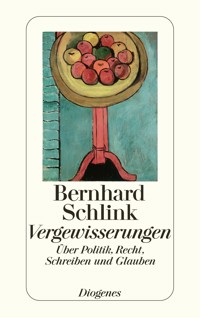12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Martin, sechsundsiebzig, wird von einer ärztlichen Diagnose erschreckt: Ihm bleiben nur noch wenige Monate. Sein Leben und seine Liebe gehören seiner jungen Frau und seinem sechsjährigen Sohn. Was kann er noch für sie tun? Was kann er ihnen geben, was ihnen hinterlassen? Martin möchte alles richtig machen. Doch auch für das späte Leben gilt: Es steckt voller Überraschungen und Herausforderungen, denen er sich stellen muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Bernhard Schlink
Das späte Leben
Roman
Diogenes
Erster Teil
1
Er nahm nicht den Aufzug, sondern die Treppe. Er ging langsam hinunter, Stufe um Stufe, Stockwerk um Stockwerk, registrierte das Weiß der Wände, das Grün der Zahlen, die neben dem Aufzug die Stockwerke anzeigten, das Grün der Türen. Dann stand er vor dem Haus und registrierte die frische Luft, die Fußgänger auf dem Gehweg, die Autos auf der Fahrbahn, das Gerüst am Haus gegenüber.
Sein erster Gedanke war, dass er statt der Treppe den Aufzug hätte nehmen sollen, jetzt, wo ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Als eine Taxe vorbeifuhr, hielt er sie an und stieg ein. Der Fahrer grüßte und machte eine Bemerkung über den schönen Morgen nach dem Regen der letzten Tage. Der Himmel war blau, die Sonne schien, auf dem Grün in der Mitte der Straße blühten Krokusse. Ja, dachte er, was für ein schöner Morgen. Wie habe ich mich immer über den Frühling gefreut nach den langen Monaten, in denen der Himmel tief und grau über der Stadt lag!
Auf der Fahrt durch die Stadt erinnerte er sich an das Gewitter, bei dem er einmal unter diesem Vordach Schutz gesucht hatte, an den Vortrag, den er in dieser Kirche gehalten hatte, an den Abend mit der jungen Frau, die seine Frau wurde, in diesem Restaurant, an das Postamt an dieser Ecke, bei dem er Briefmarken gekauft und Pakete abgegeben und abgeholt hatte, bis es vor ein paar Jahren geschlossen wurde, an den Yogalehrer, der ihn zweimal wöchentlich besucht und in diesem Haus gewohnt hatte, hier an den alten Mann, der einen Sommer lang auf einem Stuhl vor dem Haus gesessen und die Vorbeikommenden gegrüßt hatte, hier an seinen Sturz mit dem Fahrrad auf nassem Laub im letzten Herbst. Es waren nur Erinnerungsfetzen; woher und wohin er unterwegs war, als das Gewitter losbrach, worüber er in der Kirche vorgetragen hatte, wie verliebt er und die junge Frau waren und ob sie’s überhaupt schon waren, was vor und nach dem Sturz gewesen war, stellte sich in der Erinnerung nicht ein.
Stattdessen setzte sich in seinem Kopf fest, ob er sich von jetzt an beeilen müsse. Warum hatte er sich für die Treppe statt für den Aufzug entschieden? Aber er hatte sich gar nicht entschieden, sondern war einfach losgelaufen, wie er sich auch nicht für die Taxe entschieden hatte, sondern einfach eingestiegen war. War damit, einfach loszulaufen oder einfach einzusteigen, Schluss, und musste er sich fortan sorgfältig überlegen, wofür er seine Zeit nutzte? Aber kostete sorgfältiges Überlegen nicht auch Zeit? Er wollte das alles nicht denken, es war unergiebig, aber er konnte sich nicht davon losreißen. Als er es schließlich konnte, kamen ihm die Farben in den Sinn, das Weiß der Wände und das Grün der Zahlen und Türen, ebenso unergiebig.
»Wir sind da.« Er hatte nicht aufgepasst, nicht wie sonst auf das Taxameter geschaut und schon das Portemonnaie hervorgeholt. Er merkte erst auf, als die Taxe hielt und der Fahrer ihn ansprach und sich ihm zuwandte. Er zahlte, stieg aus und ging durch die niedrige Gartentür, die nicht mehr von selbst schloss, sondern mit der Hand ins Schloss geführt werden musste, aufs Haus zu. Er wollte die Gartentür seit Langem reparieren lassen. Eilte es jetzt, oder kam es jetzt nicht mehr darauf an? Im Haus war niemand; seine Frau half ihrer Freundin in der Galerie, und sein Sohn war im Kindergarten. Er konnte sich nicht entschließen, nicht, den Mantel auszuziehen und aufzuhängen, nicht, in die Küche zu gehen und Kaffee zu machen, nicht, in sein Arbeitszimmer zu gehen, in dem das Manuskript eines Aufsatzes lag, an dem er seit einer Woche arbeitete, nicht, sich im Wohnzimmer auf den Sessel zu setzen. Er blieb stehen.
2
Wenn er nur nicht zum Arzt gegangen wäre! Was dort geschehen war, wäre nicht geschehen, was er dort erfahren hatte, hätte er nicht erfahren. Was er nicht erfahren hätte, wäre nicht gewesen.
Er schüttelte den Kopf. Warum hätte er nicht zum Arzt gehen sollen? Er fühlte sich seit Wochen erschöpft, dachte, es ginge um Blutarmut oder Vitaminmangel, und erwartete einen Hinweis zur Lebensführung und ein Rezept. Sie kannten sich seit vielen Jahren, das Verhältnis zwischen ihnen war vertraut, auch wenn es über die Begegnungen in der Arztpraxis nicht hinausging. Er war zwanzig Jahr älter und froh über den Altersunterschied, von dem er sich versprach, dass er den Arzt nicht vor seinem Tod an den Ruhestand verlieren und durch einen neuen ersetzen müsste. Die jährliche Untersuchung und mal Bauchschmerzen, mal Verlust der Stimme, mal Hexenschuss, die gelegentliche Impfung – nie war es um mehr gegangen. Aber nach einer Ultraschalluntersuchung, Urin- und Bluttests und einer Computertomografie eröffnete der Arzt ihm, er habe Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das sei nicht mehr so schlimm wie früher, die Fortschritte der Chemotherapie seien enorm, und überdies gebe es neuartige Behandlungsmethoden, manche schon bewährt, manche noch experimentell. Der Krebs sei zwar fortgeschritten, er könne nichts garantieren und wolle nichts versprechen, aber je rascher die Behandlung beginne, desto besser.
Er sah dem Arzt beim Reden zu, den Augen, die sich immer wieder seinem Blick entzogen und auf den Schreibtisch richteten, den Händen, die auf dem Schreibtisch Papiere hin- und herschoben und schließlich eines zerknüllten.
»Wie lange?«
Der Arzt zögerte. »Das können wir nicht sagen.«
»Etwas werden Sie schon sagen können. Drei Wochen oder drei Jahre?«
»Wohl nicht länger als ein halbes Jahr.«
»Wie geht es mir in dem halben Jahr?«
»Wenn Sie Glück haben, wie jetzt, nur immer müder und matter. »
»Und wenn ich Pech habe?«
»Die Metastasen an Ihren Knochen machen mir Sorgen. Die Schmerzen können unerträglich werden. Dann müssen wir sehen, wo Sie am besten aufgehoben sind, zu Hause oder in einer palliativmedizinischen Abteilung oder einem Hospiz.«
Er zuckte die Schultern. »Ich halte Schmerzen eigentlich gut aus.«
Der Arzt schüttelte den Kopf. »Wenn die Wirbelsäule betroffen ist …« Er strich das zerknüllte Papier glatt. »Herr Brehm, wir haben vor Jahren einmal über den Tod gesprochen, erinnern Sie sich? Sie sagten, Sie wollten sich lieber das Leben nehmen als eines qualvollen Tods sterben. Ich glaube, Sie hatten sich für den Fall der Fälle schon Holzkohle besorgt.« Er holte tief Luft. »Wir kennen uns so lange, dass ich’s einfach sage. Machen Sie das nicht. Meine Frau war zwölf, als ihr Vater sich umbrachte, und sie hat es nicht verwunden. Sie wird es nie verwinden. Ihr Sohn ist jünger, aber darum kommt er nicht besser damit zurecht. Geben Sie ihm die Gelegenheit, sich von Ihnen zu verabschieden. Er kann mit Ihrer Frau an Ihrem Bett sitzen und in Ihren letzten Wochen erleben, wie Sie immer weiter weggehen.«
Eigentlich fand er die Bemerkung übergriffig. Aber dann sah er im Gesicht des Arztes die Sorge, er sei zu persönlich geworden, sah die Festigkeit, weil er, was er gesagt hatte, richtig und wichtig fand, sah das Wohlwollen für ihn und für seinen Sohn. »Ich höre, was Sie sagen.«
Er stand auf. Auch der Arzt stand auf und trat auf ihn zu – wollte er ihn tröstend umarmen? Er wich zurück, verabschiedete sich und ging, ehe der Arzt etwas sagen konnte.
3
Jetzt stand er im Flur und wunderte sich, dass er keinen Entschluss fassen konnte, wo er sich doch vom Arzt so entschlossen verabschiedet hatte. In wenigen Stunden musste er seiner Frau und seinem Sohn begegnen. Wie? Würde er David vom Kindergarten abholen, als sei nichts? Würde er auch Ulla zunächst nichts sagen und erst nach dem Abendessen mit ihr reden, wenn David im Bett lag? Auf dem Sofa, den Arm um ihre Schultern, bei einer Flasche Wein und mit einem Feuer im Kamin?
Beim Abschied vom Arzt hatte er die nötige Entschlossenheit aufgebracht, und er würde es auch bei den Begegnungen mit Frau und Sohn. Dass er nicht wusste, wohin er gehörte, noch zu den Lebenden oder schon zu den Toten, dass er sich verdächtig war, würde ihm nicht dazwischenkommen. Er zog den Mantel aus, machte Kaffee und setzte sich ins Wohnzimmer.
Er wusste, dass, was der Arzt gesagt hatte, ihn noch nicht wirklich erreicht hatte. So war es immer schon gewesen. Als ihn seine erste Freundin, seine erste Liebe, verließ, dauerte es Tage, bis er begriff, dass sie nicht mehr in seinem Leben war, er sie nicht mehr sehen, nicht mehr mit ihr reden, sie nicht mehr berühren, nicht mehr mit ihr schlafen würde. Erst als er es begriffen hatte, begannen der Schmerz und die Trauer. Ähnlich konnte er sich über das Examen, das er als der Beste seines Jahrgangs bestanden hatte, erst nach Tagen freuen; davor bezweifelte er, dass die gute Nachricht stimmte, glaubte, das Prüfungsamt habe sich vertan und werde das Ergebnis alsbald korrigieren. Manchmal half ihm seine Langsamkeit; er reagierte auf Überraschungen, Provokationen, Krisen nicht gefühlsmäßig und wurde für kaltblütig gehalten, obwohl er seine Gefühle nicht kontrollierte, sondern noch keine hatte, weil sie erst später kamen. Oft kränkte seine Langsamkeit andere, seine verzögerte Freude über ein Geschenk, eine liebende Annäherung, einen innigen Moment. Er hatte auch schon den Verdacht gehabt, etwas stimme mit ihm nicht, er habe keine Gefühle, er wisse nur, dass es sich gehört, in bestimmten Situationen bestimmte Gefühle zu haben, und stelle nach der entsprechenden Situation das entsprechende Gefühl her – für sich und für die anderen. Was gehörte sich in seiner Situation? Gab es ein Gefühl, das man im Angesicht des Todes zu haben hatte?
Er war sechsundsiebzig, und natürlich hatte er in den letzten Jahren gelegentlich über den Tod nachgedacht. Sein Beruf war das Recht, und sein besonderes Interesse galt der Geschichte, der Geschichte des Rechts und der Geschichte allgemein. Er mochte den Tod nicht, weil er nicht erfahren würde, wie alles weiterging – würde es zum Krieg zwischen Amerika und China kommen, wer würde ihn gewinnen, was würde aus Europa und aus Deutschland werden, was aus der Welt unter dem neuen, heißen Klima? Er wollte nicht ewig leben, hätte aber gerne auf eine Weise weiterexistiert, die ihn die Geschichte verfolgen und auf die kommenden Jahrhunderte so blicken ließ, wie er auf die vergangenen blickte. Das war das eine. Es gab auch das andere. Der Tod würde ihm ersparen, wie die Wälder starben und die Meere stiegen, wie der Krieg zurückkehrte, wie die Zeit der Demokratie endete und die Menschen wieder autoritär beherrscht werden wollten. Und manchmal geschah es, dass er vor dem Tod erschrak, dem Nichts, der Leere, der Kälte. Dann schämte er sich. Das Nichts ist nichts – was gab es da zu erschrecken?
4
Er sah auf die Uhr. Er war über seinen Gedanken eingeschlafen. Es war die Erschöpfung, die ihn seit Wochen begleitete und bis zum Ende begleiten würde. Ulla hatte das Auto genommen, er musste laufen, es war höchste Zeit, David vom Kindergarten abzuholen.
Er machte das jeden Tag. Er machte es gerne, hatte aber jeden Tag Angst, David würde enttäuscht feststellen, dass er, anders als die anderen Kinder, von einem alten Mann abgeholt wurde, der als Großvater passte, aber nicht als Vater. Er konnte sich nicht vorstellen, dass David es feststellte, sich aber aus Liebe zum Vater die Enttäuschung verbot. Oder doch? Oder hatte er sich einfach daran gewöhnt wie die anderen Kinder und die jungen Eltern, die ihn vor Jahren tatsächlich für den Großvater gehalten hatten? Er wollte nicht, dass David sich seinetwegen als Außenseiter fühlte, und hoffte, die Abholung durch ihn würde bis zum Ende kein Problem werden. Der Kindergarten würde im frühen Sommer enden, im späten Sommer würde die Schule beginnen.
Die Kinder durften das Gelände, auf dem der Kindergarten lag, nur an der Hand der Eltern verlassen. Aber als er auf den Kindergarten zuging, sah David ihn, wartete nicht, rannte vom Gelände auf den Gehweg, achtete nicht auf die Rufe der Kindergärtnerin, rannte ihm entgegen. So kenne ich meinen stillen, scheuen Sohn nicht, dachte er, so kräftig, so schnell, was für ein Lebensmut, was für eine Lebensfreude! Es machte ihn glücklich und traurig, er kniete nieder, breitete die Arme aus, fing das strahlende, lachende Kind auf und hielt es fest.
»Ich habe ihn gehauen, Papa.«
Er wusste sofort, von wem David redete. Ben war der Größte und Stärkste der Gruppe und ließ es die anderen Kinder spüren.
»Er hat mich wieder geschubst, und da habe ich ihn gehauen, und er ist gefallen.«
Er war stolz auf David, der sich lange hatte herumschubsen lassen und nicht länger herumschubsen ließ. »Gut gemacht, David.«
»Angelika hat mich geschimpft. Sie will mit dir reden.«
»Dann gehen wir und reden mit Angelika.« Er stand auf, David nahm seine Hand, und sie gingen zum Kindergarten.
Es war, wie David gesagt hatte. Zwar verstand Angelika, dass David sich gegen Ben gewehrt hatte. Aber dass das sonst so ruhige Kind so heftig geworden war, hatte sie erschreckt. Ben sei gefallen, habe sich verletzt, habe geblutet, die Mutter habe ihn geholt, er sei nicht mehr da. Wenn er wieder da sei, müsse David sich bei Ben entschuldigen, wie Ben bei David.
»Ich will nicht.«
»Sie hören es. Er will nicht. Er soll sich nicht dafür entschuldigen, dass er sich gewehrt hat, aber dass er Ben wehgetan hat. Sie reden mit ihm?«
Er wartete, bis David im Bett lag. Als sie zu Hause waren und ein Flugzeug aus Legosteinen bauten, rief Ulla an, sie habe noch zu tun, komme erst um neun und habe dann schon gegessen. Er aß mit David zu Abend, brachte ihn ins Bett und las ihm vor. Er schlug das Buch zu und nahm Davids Hand.
»Wolltest du Ben wehtun?«
»Ich will, dass er tot ist.« David fing an zu weinen.
»Ist er so schlimm?«
»Er schubst mich und tritt mich und nimmt mir meine Sachen weg. Und Bea nimmt er auch ihre Sachen weg, und wenn sie weint, tritt er sie auch.«
Als er ein bisschen älter als David war, hatte sich eine Nachbarin bei seiner Mutter beschwert, er habe ihr »Pissnelke« nachgerufen. Seine Mutter bestand darauf, dass er sich entschuldigte, und er gab nach, obwohl er das Wort nicht einmal kannte. Er hatte sich nie verziehen, dass er sich derart hatte demütigen lassen, dass er sich derart selbst gedemütigt hatte.
»Wenn Ben sagt, dass es ihm leidtut, kannst du dann sagen, dass es dir auch leidtut?«
David schüttelte den Kopf.
»Wenn Ben sagt, dass er dir nichts mehr tut, kannst du dann sagen, dass du ihm auch nichts mehr tust?«
»Und Bea.«
»Und Bea.«
David dachte nach, und seine Augen wurden schwer.
»Wir reden morgen. Du hast nichts Böses getan. Ich hab dich lieb.«
5
Als Ulla kam, hatte er Feuer im Kamin gemacht und Wein und Gläser bereitgestellt.
»Oh!« Sie hatte den Mantel ausgezogen und aufgehängt und stand in der Tür zum Wohnzimmer, jung, schön, sicher. Er konnte ihre Überraschung nicht deuten, freudig oder enttäuscht, freute Ulla sich auf den Abend mit ihm oder wäre sie lieber für sich. Es war, als wolle sie nicht zeigen, was sie fühlte, und nur ein zur Situation passendes Gesicht machen. Warum, dachte er, fällt mir das immer öfter auf? Sieht sie meine Erschöpfung, sieht sie, dass ich mich mit mir schwertue, und will sie’s mir mit ihren Gefühlen nicht noch schwerer machen? Hat sie denn schwere Gefühle? Oder zieht sie, die jung ist, sich vom erschöpften alten Mann zurück?
Sie war viel zu jung für ihn; er wusste es von Anfang an. Aber sie wollte ihn, und er konnte dem nicht widerstehen. Sie war Studentin, nicht seine Studentin, aber die Freundin einer seiner Studentinnen, die ihn, als er im vollen Café stand und einen leeren Tisch suchte, zu sich und Ulla an den Tisch einlud. Als sie sich vor dem Café verabschiedeten, fragte Ulla ihn: »Bringen Sie mich nach Hause?«, und, altmodischer Höflichkeit verpflichtet, tat er es. Sie kam von einem Bauernhof, dem die Männer abhandengekommen waren und der von Großmutter und Mutter geführt wurde, hatte sich dem Bauernhof verpflichtet gefühlt, Landwirtschaft studiert und als Landwirtin gearbeitet, bis ihr klar wurde, dass sie etwas anderes wollte. Ende zwanzig entschloss sie sich, Kunstgeschichte zu studieren, und machte daneben, was sie immer schon am liebsten gemacht hatte: Sie zeichnete und malte.
Sie erzählte davon unbefangen, fröhlich, selbstbewusst, und als sie ihm unter der Tür sagte, sie wolle ihn wiedersehen, sagte er verwirrt und beglückt zu. Wie komme ich dazu, fragte er sich, sie ist viel zu jung für mich, sie ist viel zu schön für mich, was für eine Laune von ihr. Dann sagte er sich, dass ihre Laune nicht sein Problem sei – warum nicht einen oder zwei Abende mit ihr genießen?
Es war keine Laune. War es das Aufwachsen ohne Vater? Einmal sprach er es an, sie wies es ab, was solle das. Sie liebe ihn, warum müsse er das psychologisch zerreden? Sie liebe seine Gelassenheit, Klugheit, Fürsorglichkeit, seine schlanke Gestalt, seine Falten und sein graues Haar, die Sanftheit, mit der er Liebe mache. Dafür brauche sie keinen Vater, keinen, den sie hatte, und keinen, den sie nicht hatte. Sie saß auf seinem Schoß, die Arme um seinen Hals, und küsste ihn. »Und warum liebst du mich?«
Weil ich mich mit dir wieder jung fühle, wollte er sagen, hatte Angst, sie könnte sich dabei nicht gemeint fühlen, als gehe es ihm nicht um sie, sondern um ihre Jugend, fand aber so schnell nichts anderes. »Weil ich mich mit dir wieder jung fühle.«
»Das hat aber lange gedauert.« Sie lachte. »Siehst du, du bist nicht zu alt für mich. Ich habe dich wieder jung gemacht.«
Er war so unbeholfen verliebt wie damals als Schüler. Damals war ihm die Tochter seines Klavierlehrers verwunschen und unerreichbar vorgekommen, weil sie ein Mädchen war. Jetzt wusste er sich Ulla gegenüber nicht zu verhalten, weil sie so jung war. Wie wollten junge Frauen heute gezeigt bekommen, dass sie geliebt wurden? Womit beeindruckte ein älterer Mann sie, womit machte er sich lächerlich? Wie oft konnte er sich melden, ohne aufdringlich zu sein? Was konnte er schenken, ohne entweder kleinlich oder großspurig zu wirken? Es beunruhigte ihn, aber Ulla setzte sich über seine Unbeholfenheit hinweg, sagte, was sie wollte, und sagte schließlich auch, dass sie geheiratet werden wollte.
Die zwölf Jahre seit der Hochzeit waren gute Jahre. Sie kauften ein kleines Haus mit Garten am Rand der Stadt. Ulla schloss das Studium ab, verlegte sich ganz aufs Malen, fand ein Atelier und eine Galerie, in der sie ausstellte und immer wieder aushalf, und bekam vor sechs Jahren David. Er lehrte bis siebzig an der Universität und schrieb danach weiter, wandte aber immer mehr Zeit an David und an den Garten und ans Kochen. Er nahm das Leben mit Ulla, dem Sohn und den verbliebenen Tätigkeiten als Geschenk, dem man nicht ins Maul schaut. Manchmal sehnte er sich nach einer liebevolleren, weicheren, wärmeren Ulla. Sie war nüchtern, sachlich und meistens, wenn er ihre Nähe suchte, nicht eigentlich abweisend, aber auch nicht wirklich einladend. Sie konnte kurz angebunden sein, schroff werden und aufbrausen, ohne dass er verstand, warum. Er hatte gelernt, damit zurechtzukommen und, statt in den Konflikt zu gehen, sie in die Arme zu nehmen. Wenn sie zu mir so ist, dann ist sie so, sagte er sich, und wenn sie mich so liebt, dann ist das eben, wie sie liebt. Für mich ist’s genug Liebe, genug Glück. Als er den Wein bereitstellte und das Feuer im Kamin machte, fragte er sich, ob sie auf seine Nachricht diesmal emotionaler reagieren und Schmerz und Angst um ihn und sich und ihre Liebe und ihr Leben zeigen würde.
6
Sie setzte sich neben ihn aufs Sofa, und er sagte: »Ich war heute beim Arzt. Du erinnerst dich? Dass ich vor zwei Wochen bei ihm war und er seitdem alles Mögliche untersucht hat? Ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs und noch ein paar Monate zu leben, nicht länger als ein halbes Jahr. Wenn ich Glück habe, bin ich nur erschöpfter als sonst, wenn ich Pech habe, muss ich auf die palliativmedizinische Abteilung oder ins Hospiz.«
Wortlos nahm sie seine Hand in ihre Hände. Sie schüttelte den Kopf, setzte zu reden an, sagte nichts, schüttelte wieder den Kopf. Dann weinte sie leise, die Tränen tropften auf seine Hand. Es tat ihm wohl, wie ein milder, warmer Regen im Sommer wohltut.
Schließlich fragte sie: »Kann man nichts tun?«
»Chemo. Experimentelle Behandlungsmethoden. Es ist eine Quälerei und bringt nicht viel. Ich möchte das nicht.«
Sie rutschte an den Rand des Sofas, sagte: »Komm!«, und er verstand und streckte sich aus und legte den Kopf in ihren Schoß. »Martin, Martin.« Sie beugte sich über ihn, küsste ihn und hielt seinen Kopf an ihren Bauch. Seine nüchterne, sachliche Ulla so weich und sanft – er war den Tränen nahe, weil er bekam, wonach er sich so oft sehnte, was er so oft nicht bekam. Wenn es doch nur nicht enden würde!
»Was willst du jetzt machen?«
»Was ich …« Er verstand nicht.
»Willst du mit uns eine Reise machen? Oder nur mit mir? Willst du noch etwas erleben? Oder regeln? Oder vollenden?«
»Ach, Ulla.« Der Moment der Zärtlichkeit war vorbei. »Ich weiß nicht, was ich noch machen will. Eine Reise, etwas erleben – ich denke darüber nach. Ich habe nichts zu regeln und zu vollenden.«
Sie hob seinen Kopf an. »Ich bin gleich wieder da.« Sie stand auf, legte ein Kissen unter seinen Kopf, ging zum Kamin, schürte das Feuer und legte Holz nach. Er wandte den Kopf; es brannte kräftig. Sie kam zurück, setzte sich, nahm wieder seinen Kopf in ihren Schoß. »Wenn du willst, gehe ich in den nächsten Wochen nicht mehr ins Atelier und in die Galerie. Ich kann mich auch um den Kindergarten kümmern, David hinbringen und abholen, und um alles andere.«
Ulla war wieder nüchtern und sachlich, und er war nicht enttäuscht – vielleicht begriff sie seinen bevorstehenden Tod nicht wirklich, wie er selbst ihn nicht wirklich begriff. »Ich bin nicht bettlägerig, ich mache das schon.« Er sah zu ihr auf, wartete, bis ihre Blicke sich trafen, lächelte und bat: »Hältst du mich noch mal, wie du mich eben gehalten hast?«
7
Im Bett nahm sie ihn zu sich. Danach wollten ihm wieder die Tränen kommen, er hätte gerne geweint, konnte aber nicht. Am nächsten Morgen wachte er, wie stets, vor Ulla und David auf. Er wollte darüber nachdenken, was er in den nächsten Wochen machen könnte. Wie viele durfte er sich geben? Ein halbes Jahr waren sechsundzwanzig Wochen, wenn sich Glück und Pech die Waage hielten, hatte er dreizehn Wochen, in denen es ihm wie jetzt, und dreizehn, in denen es mit ihm abwärtsging, und weil er nicht enttäuscht werden wollte, gab er sich nicht dreizehn, sondern zwölf. In zwölf Wochen ließ sich vieles machen. Er kam auf keine Reise, die ihn gelockt, kein Erlebnis, nach dem es ihn verlangt hätte. Er machte Kaffee und brachte ihn Ulla und sich ans Bett.
»Ich habe eine Idee.« Sie redete, als hätte sie für ein praktisches Problem eine praktische Lösung gefunden.
»Ja?«
»Ich habe vor Jahren einen Film gesehen, in dem ein Mann einen Tumor im Gehirn hat. Er läuft mit seiner Frau von Pontius zu Pilatus, von den Ärzten zum Heiler, aber der Tumor kann nicht operiert und nicht geheilt werden, und er wird an ihm sterben. Besonders schlimm ist, dass die Frau ein Kind erwartet, einen Sohn. Der Mann nimmt ein Video auf und sagt dem Sohn auf dem Video, was ihm wichtig ist, was er dem Sohn hinterlassen und mitgeben will. Willst du das nicht für David machen?«
»Ein Video?«
»Mit dem iPhone geht es ganz einfach. Ich zeig’s dir.«
Ulla war ihm zu schnell mit ihrer Antwort auf eine Frage, die er ihr gar nicht gestellt hatte. Was er in den nächsten Wochen machen würde, wollte er erst einmal selbst überlegen. Er wollte sehen, was in seinem Kalender stand, für die nächsten Wochen, für den Rest seines Lebens. Er wollte herausfinden, wen er noch treffen wollte, mit Ankündigung seines Todes oder ohne. Er wollte über Reisen und Erlebnisse nachdenken – vielleicht fiel ihm doch noch etwas ein. Und vielleicht sähe alles, was er sich jetzt überlegte, ohnehin ganz anders aus, wenn er begreifen würde, wirklich begreifen würde, dass er sterben musste.
»Ich denke darüber nach, Ulla.« War sie